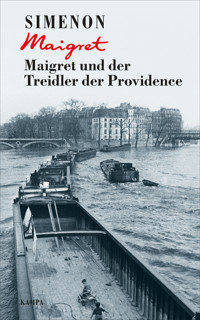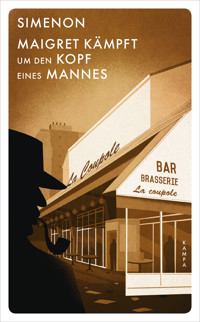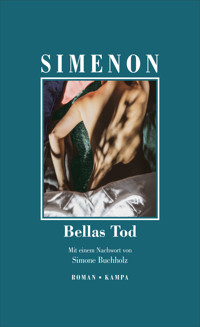Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Georges Simenon
- Sprache: Deutsch
Joris Terlinck, Zigarrenfabrikant, Bürgermeister von Furnes, einer flämischen Kleinstadt, ist ein Tyrann, in privater und politischer Hinsicht. Als er sich weigert, einem seiner Angestellten, dessen Geliebte schwanger ist, einen Vorschuss zu gewähren, bringt sich dieser um. Ist es Terlincks schlechtes Gewissen oder eine Obsession, die ihn immer öfter um die schwangere Lina kreisen lässt? Auf einmal werden Risse in der ehrbaren Fassade sichtbar. Was ist zum Beispiel mit Terlincks Tochter, die er seit Jahren in seinem Haus versteckt hält? Während der Bürgermeister nach und nach seine Autorität in der Stadt verliert, gewinnt der Mensch hinter dem Titel die Sympathien des Lesers.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 287
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Band 36
Georges Simenon
Der Bürgermeister von Furnes
Roman
Aus dem Französischen von Hanns GrösselMit einem Nachwort von Martin Mosebach
Kampa
Ich kenne Furnes nicht.
Ich kenne weder seinen Bürgermeister noch seine Einwohner.
Furnes ist für mich nur wie ein musikalisches Motiv.
Ich hoffe also, dass sich niemand in irgendeiner Figur meiner Geschichte wiedererkennen wird.
Georges Simenon
ERSTER TEIL
1
Zwei Minuten vor fünf. Joris Terlinck, der den Kopf gehoben hatte, um auf seinem Chronometer – das er wie immer vor sich auf den Schreibtisch gelegt hatte – nach der Uhrzeit zu sehen, hatte gerade noch genug Zeit.
Zum einen Zeit, mit dem Rotstift eine letzte Zahl zu unterstreichen und eine Akte zuzuklappen, auf deren Konzeptpapier stand: Kostenplan für den Wasseranschluss und alle sonstigen Klempnerarbeiten im neuen Saint-Éloi-Krankenhaus.
Zum anderen Zeit, seinen Sessel ein Stück zurückzuschieben, aus seiner Tasche eine Zigarre zu holen, sie knistern zu lassen und ihre Spitze mit Hilfe eines hübschen vernickelten Apparats abzuschneiden, den er aus seiner Weste zog.
Es war schon dunkel, denn man schrieb Ende November. Über dem Kopf von Joris Terlinck, im Arbeitszimmer des Bürgermeisters von Furnes, brannte ein ganzer Ring von Kerzen, allerdings von elektrischen, an denen falsche gelbe Tropfspuren klebten.
Die Zigarre zog gut. Terlincks Zigarren zogen alle gut, denn er selber war der Hersteller und behielt sich eine Sonderqualität vor. Als der Tabak brannte, das Zigarrenende angefeuchtet und sorgfältig abgerundet war, musste noch die Zigarrenspitze aus Bernstein ihrem Etui entnommen werden, das beim Zuklappen ein sehr charakteristisches hartes Geräusch machte – manche Leute in Furnes erkannten Terlincks Anwesenheit an diesem Geräusch!
Und das war noch nicht alles. Die zwei Minuten waren noch nicht verbraucht. Wenn er ein wenig den Kopf drehte, entdeckte Terlinck zwischen den dunklen Samtvorhängen hindurch den Hauptplatz von Furnes, die Häuser mit den gezackten Giebeln, die Sint-Walburga-Kirche und die zwölf Gaslaternen entlang der Gehsteige. Er kannte ihre Anzahl, denn er selber hatte sie aufstellen lassen! Hingegen konnte niemand sich rühmen, die Anzahl der Pflastersteine auf dem Platz zu kennen, Tausende von ungleich gerundeten kleinen Pflastersteinen, die von Weitem aussahen wie einzeln von einem Maler der primitiven Kunst hingemalt.
Über allem lag ein feiner, um die Laternen herum weißlicher Dunst, und am Boden, obwohl es nicht geregnet hatte, eine Art Firnis, eine Art Lack aus sehr schwarzem Schlamm, durch den reliefartig die Spuren der Karrenräder verliefen.
Noch eine knappe halbe Minute. Die Rauchwolke um Terlinck verteilte sich. Durch sie hindurch sah er über dem wuchtigen Kamin das berühmte Bildnis Van de Vliets mit seiner ungewöhnlichen Tracht, seinen Puffärmeln, seinen Bandschleifen und Federn am Hut.
Zwinkerte Joris Terlinck seinem Vorgänger etwa zu? Oder blinzelte er nur, weil der Rauch ihn in den Augen brannte?
Von seinem Platz aus hätte er vorhersagen können, dass nun die Bewegung eines Uhrwerks anhob, in Gang kam, zuerst über ihm im Turm des Rathauses, wo eine Uhr mit tiefem Ton ihre fünf Schläge ertönen lassen würde, dann, im Abstand einer Zehntelsekunde, im Uhrenturm, das obligate Glockenspiel.
Nun sah er zu einer Tür am anderen Ende des weitläufigen Arbeitszimmers, die in die geschnitzte Täfelung eingelassen war. Er wartete auf das Scharren, das Hüsteln und sagte:
»Herein, Herr Kempenaar!«
Er hätte sich das »Herr« auch schenken können, denn Kempenaar war der Gemeindesekretär, also sein Untergebener. Mit »Herr« sprach Terlinck niemanden außer Kempenaar an, und er tat es so, als wollte er ihn zermalmen.
»Guten Abend, Baas!«
Er wurde Baas genannt, das heißt »Herr«, nicht nur zu Hause, nicht nur in seiner Zigarrenmanufaktur, sondern auch im Rathaus, im Café und selbst auf der Straße.
Es war Zeit für die Post. Das spielte sich immer auf dieselbe Art und Weise ab. Kempenaar beugte sich von weit hinten über den Bürgermeister und bekam den ganzen Rauch der Zigarre ins Gesicht. Terlinck unterschrieb die Briefe; sie waren auf einer alten Maschine geschrieben, die der Sekretär als Einziger betätigen konnte.
Beim dritten Blatt hatte es noch keine Beanstandungen gegeben. Auf dem vierten endlich hielt Terlinck einen Fingernagel unter ein A, das statt eines O hingetippt worden war, zerriss das Papier in winzige Fetzen und warf diese, wie üblich kommentarlos, in den Papierkorb.
Danach nahm Kempenaar beflissen die übrige Akte an sich, wollte zur Tür eilen, und der Baas ließ ihm freies Spiel, ließ ihn mit der Hoffnung auf Erlösung bis zur Mitte des Teppichs kommen, zog dann plötzlich die Leine an und sagte scharf:
»Übrigens, Herr Kempenaar …«
Und das »Herr« war so betont, dass dem Gemeindesekretär, als er sich umdrehte, der Schweiß auf seiner blatternarbigen Stirn stand.
Von der Mitte des Hauptplatzes aus konnte man die beiden deutlich sehen: Terlinck, in seinen Rauch gehüllt, sitzend, den andern einige Meter entfernt, stehend, mit seiner Akte in der Hand, und jeder in Furnes wusste, dass es der Bürgermeister und der Sekretär waren, jeder wusste auch, dass Letzterem ein unangenehmer Augenblick bevorstand.
»Sie waren doch gestern bei der Abendveranstaltung des Wohltätigkeitsvereins Saint-Joseph, nicht wahr?«
»Ja, Baas!«
Noch wusste Kempenaar nicht, aus welcher Ecke der Schlag ihn treffen würde.
»Anscheinend haben Sie Les Noces de Jeannette gesungen und sind sehr beklatscht worden …«
Denn Kempenaar, der eine Baritonstimme hatte, trat bei allen Amateurkonzerten auf.
»Unter anderem hat Leonard Van Hamme Sie gelobt …«
Jetzt errötete Kempenaar, denn er hatte verstanden. Leonard Van Hamme, der Brauereibesitzer, war der persönliche Feind des Bürgermeisters.
»Sie haben mit ihm in der Trinkstube über mich gesprochen, und Sie haben ihm zu verstehen gegeben, ich stände in geheimer Verbindung mit den Freimaurern …«
»Ich schwöre Ihnen, Baas …«
»Sie riechen nicht nur schlecht, Herr Kempenaar, denn das tun Sie tatsächlich, was mich in Ihrer Gegenwart zum Rauchen zwingt, Sie verleumden mich auch nach Strich und Faden, nur um sich mit jemandem gut zu stellen, der Ihnen eines Tages nützlich sein könnte … Sie widern mich an, Herr Kempenaar … Sie können gehen … Guten Abend, Herr Kempenaar …«
Als der völlig geknickte, ungepflegte und immer leicht schmuddelige Mann durch die halboffene Tür verschwunden war, stützte Joris Terlinck seine beiden Hände flach auf den Schreibtisch, um aufzustehen, und zwinkerte Van de Vliet erneut zu.
Der musste ihn doch verstehen!
Den ganzen Winter hindurch war er gleich gekleidet: schwarzlederne Gamaschen, grauer Anzug aus unverwüstlichem Stoff und darüber eine Art kurzer, pelzgefütterter Paletot. Als Kopfbedeckung eine Otterfellmütze, deren Schwanz das lodernde Rot des Schnurrbarts und das Schieferblau der Augen hervorhob.
In der Marktstraße blieb er vor der Metzgerei Van Melle stehen, bei der es auch Frühgemüse gab und deren Auslage eine Girlande aus Wild umrahmte.
»Was nehmen Sie heute, Baas?«, fragte ihn die rundliche Frau Van Melle.
»Sind die Rebhühner auch frisch?«
»Von heute Morgen … Soll ich Ihnen eines geben?«
Denn er nahm immer nur eines. Vielleicht machte man sich hinter seinem Rücken über ihn lustig, aber das war seine Sache. Dann ging er auf den Hauptplatz zurück. Sein Haus war ein schwarzer Giebelbau, mit einer doppelten fünfstufigen Vortreppe mit schmiedeeisernem Geländer. Er trat den Schmutz von seinen Schuhsohlen ab, ging dann ins Esszimmer, wo unter einer Lampe mit rosa Schirm zwei Gedecke aufgelegt waren.
Frau Terlinck saß mit einer Näharbeit neben dem sauberpolierten Ofen, und jeden Abend zuckte sie überrascht zusammen, als hätte sie sich nach all den Jahren noch immer nicht an den Gedanken gewöhnen können, dass ihr Mann kurz vor sechs Uhr nach Hause kam. Sie sagte nichts, denn im Hause wünschte man einander weder guten Tag noch guten Abend, was nicht nötig ist zwischen Leuten, die sich ständig sehen. Eilig sammelte sie ihre Stoffteile, ihre Garnrollen, ihre Schere zusammen, stopfte alles in ihren Nähkorb und öffnete die Tür zur Küche einen Spaltbreit.
»Tragen Sie auf, Maria!«
Er sah sich in dem Spiegel über dem Kamin im Esszimmer, in dem ein rosa Lampenschirm ein weiches Licht verbreitete. Er verzog keine Miene, während er sich betrachtete, aber er betrachtete sich die ganze Zeit, während er seinen Paletot und seine Otterfellmütze auszog und auch noch, als er sich die Hände über dem Ofen wärmte.
Maria tauchte aus der Küche auf und nahm sofort das kleine Paket mit dem Rebhuhn entgegen; dann brachte sie die Suppenschüssel, und es wurde noch immer nicht gesprochen.
Die Fensterläden waren nicht geschlossen. Auf dem Fensterbrett stand ein Messingtopf mit einer Grünpflanze. Man konnte die beiden von draußen gut sehen, wie sie sich in dem rosa Lichtschein bewegten, bedächtig und stumm wie Fische in einem Aquarium.
Erst wenn Terlinck saß, setzte sich auch seine Frau, faltete die Hände, sprach das Tischgebet, erst leise, indem sie nur die Lippen bewegte, dann wurde das Wispern deutlicher und erhob sich bei den letzten Silben zu einem klar hörbaren Murmeln.
Nach der Suppe gab es Pellkartoffeln mit Quark. Terlinck mochte Kartoffeln mit Quark und einer kleingehackten roten Zwiebel, seit dreißig Jahren aß er das jeden Abend.
Die Tür zur Küche stand offen, und sie hörten das Rebhuhn brutzeln, wussten aber, dass sie nicht davon essen würden.
Frau Terlinck wartete die letzten Bissen des Baas ab und erzählte dann mit schwacher, ängstlicher Stimme:
»Die Kohle ist gekommen …«
Oder:
»Die Gasrechnung ist kassiert worden …«
Irgendetwas! Eine beliebige Neuigkeit aus dem Haushalt. Er sah sie dann an, ohne zu antworten, als dächte er an nichts, schob seinen Stuhl ein Stück zurück und zündete sich eine Zigarre an.
An diesem Abend hatte er sie noch nicht in die Zigarrenspitze aus Bernstein gesteckt, als im Flur die Klingel läutete.
Sie machte einen Höllenlärm in dem breiten, mit Fliesen ausgelegten Flur und dem weiten Treppenhaus, in dem jeder Ton von den Wänden widerhallte, vor allem abends und vor allem, wenn man nicht darauf vorbereitet war.
Man war so wenig darauf vorbereitet, dass Maria, das Dienstmädchen, einen Augenblick in der Küchentür stehen blieb und ihren Herrn fragend anblickte. Man hörte, wie die Haustür geöffnet wurde, und dann Flüstern im Gang. Maria kam wieder herein, teilte überrascht und besorgt mit:
»Der junge Claes …«
Ein unerwarteter Besucher, und schon bekam Frau Terlinck ihr Katastrophengesicht. Nervös schielte sie zu ihrem Mann, dann zu Maria, und in ihren Augen, die zum Weinen geschaffen waren, stand bereits das blanke Entsetzen.
»Wo ist er?«
»Er wartet im Flur …«
Maria hatte nicht einmal die Lampe angemacht! Terlinck fand Jef Claes an der Wand im Dunkeln stehen, seinen Hut in der Hand.
»Was willst du?«
»Ich muss mit Ihnen sprechen, Baas …«
Das alles war völlig außerhalb der Ordnung. Jef Claes, der seit einigen Monaten in der Zigarrenmanufaktur angestellt war, konnte doch nicht einfach bei seinem Arbeitgeber klingeln. Und wenn er ihm etwas Wichtiges mitzuteilen hatte, dann brauchte er es nur tagsüber im Büro zu sagen.
Dennoch öffnete Terlinck die Tür, die genau dem Esszimmer gegenüberlag, machte das Licht an, betrat sein Arbeitszimmer und drehte sich ungeduldig um.
»Na, was ist? … Komm herein …«
Tagsüber wurde in diesem Zimmer nicht geheizt, aber nun zündete Terlinck einen Gasofen an, der hinter seinem Sessel stand und ihm den Rücken wärmte.
Er selber saß, den jungen Mann ließ er stehen, bemerkte dessen fiebrige Augen, die Hände, mit denen er die Hutkrempe zerdrückte.
»Was willst du?«
Dem anderen hatte es vor lauter Aufregung die Sprache verschlagen, und er blickte um sich, als wollte er fliehen.
Statt ihm zu helfen, betrachtete der wuchtige Terlinck ihn durch den Rauch seiner Zigarre hindurch, nicht so, wie man einen Menschen, wie man seinesgleichen betrachtet, sondern wie man irgendeine Sache betrachtet, eine Wand oder den fallenden Regen.
»Also, Baas …«
Er wusste, dass weinen nichts bringen würde. Im Gegenteil! Er nahm sich zusammen. Er öffnete den Mund, machte ihn wieder zu, lockerte ein wenig seinen Kragen.
»Ich bin gekommen …«
Er war mager wie das rachitische Küken aus einer Brut, das Küken, das die Henne aus Gott weiß welchen Gründen mit Schnabelhieben verstößt. Er war schwarz gekleidet, weil alle Angestellten Terlincks glaubten, sich schwarz kleiden zu müssen, mit Stehkragen und Manschetten und Schuhen mit glänzenden Spitzen.
»Ich muss Sie bitten …«
Und schließlich, wie ein platzendes Geschwür:
»Ich brauche unbedingt tausend Franc … Ich habe nicht gewagt, Ihnen im Büro davon zu erzählen … Sie können sie von meinem Lohn einbehalten.«
Der Rauch stieg sachte von der Zigarre auf, einer schwarzen Zigarre mit äußerst weißer Asche, die Terlinck so lange wie möglich stehen ließ und mit Genugtuung ansah.
»Wann hat man dir schon einen Vorschuss gegeben?«
»Vor zwei Monaten … Meine Mutter war damals krank …«
»Und jetzt ist deine Mutter wieder krank?«
»Nein, Baas …«
Er schüttelte den Kopf. Inmitten dieses Arbeitszimmers, in dem die Wärme der Gasheizung sich ausbreitete, war er verlorener als in einer unbekannten Stadt oder einer Wüste.
»Wenn Sie mir die tausend Franc nicht geben, bringe ich mich um …«
»Tatsächlich?«, staunte Terlinck, hob aber nur milde überrascht den Kopf. »So etwas würdest du wirklich tun?«
»Ich muss … Ich schwöre Ihnen, Baas, dass ich dieses Geld unbedingt brauche …«
»Hast du wenigstens einen Revolver?«
Worauf der Junge unwillkürlich an seine Tasche klopfte und mit unfreiwilligem Stolz ausrief:
»Ja, ich habe einen!«
»Ich hatte vergessen, dass dein Vater Adjutant war …«
Wieder Schweigen und, spürbarer, das Fauchen des Gases aus allen kleinen Löchern des Heizofens, die tanzenden blauen Flammen.
»Hören Sie, Baas … Wenn Sie es verlangen, werde ich Ihnen alles sagen, Ihnen allein, und Sie bitten, es für sich zu behalten …«
In den Schreibtisch aus hellem Holz, den die Zeit glattgewetzt hatte, war eine Schreibunterlage aus grünem Maroquin-Leder eingelassen, auf der Tintenfässer und Schreibfedern aneinandergereiht waren sowie ein dicker Briefbeschwerer aus Glas, der die Heilige Jungfrau von Lourdes darstellte. Rechts von Terlinck, in Reichweite seiner Hand, war ein Panzerschrank in die Mauer eingelassen.
»Ich höre …«
»Also! … Ich habe einem jungen Mädchen ein Kind gemacht … Ich werde sie heiraten … Ich schwöre, dass ich sie eines Tages heiraten werde, aber im Augenblick geht es nicht …«
Terlinck verzog keine Miene, und sein Blick ruhte noch immer auf dem jungen Mann wie auf einer Wand.
»Wir müssen etwas tun … Verstehen Sie, was ich meine? … In Nieuport habe ich eine Frau ausfindig gemacht, die es für zweitausend Franc machen würde, davon tausend als Vorschuss …«
Er keuchte, erwartete eine Erwiderung, ein Wort, einen Reflex, doch nichts kam außer einer belanglosen, nicht einmal ironischen Frage:
»Wie alt bist du?«
»Neunzehn, Baas … Ich muss noch meinen Militärdienst ableisten … Danach kann ich mir sicherlich eine Stellung aufbauen und …«
Jemand kam auf dem Gehsteig vorbei, und Jef Claes wandte sich unwillkürlich zum Fenster, verlegen darüber, dass man ihn von draußen in einer solchen Haltung sehen und möglicherweise von Weitem erahnen könnte, was er sagte.
»Wenn ich sie gleich heiraten könnte, würde ich es tun … Aber es ist völlig unmöglich … Ihr Vater würde mich vor die Tür setzen … Er hat uns seit Langem verboten, einander zu sehen …«
»Wer ist es?«
Keine Antwort. Der Junge zögerte. Er schwitzte. Seine Wangen glühten. Und man hätte meinen können, dass Terlincks Schweigen ihn noch mehr einschüchterte als seine Worte.
Schließlich stammelte Jef mit gesenktem Kopf:
»Lina Van Hamme …«
»Leonards Tochter?«
»Ich flehe Sie an, Baas! … Ich weiß, dass Sie gut sind …«
»Ich bin niemals gut gewesen …«
»Ich weiß, dass Sie Verständnis haben, dass …«
»Ich habe überhaupt kein Verständnis …«
War das möglich? Nein! Er musste sich lustig machen! Jef hob den Kopf, suchte in der Miene seines Arbeitgebers nach einer Erklärung.
»Wenn ich ohne Geld von hier weggehe, bringe ich mich um … Sie glauben mir nicht? … Der Revolver in meiner Tasche ist geladen … Ich will nicht, dass Schande über Lina kommt …«
»Das Sicherste wäre gewesen, sie in Ruhe zu lassen!«
Er war genauso gelassen wie im Rathaus, wenn er Herrn Kempenaar seine Meinung sagte.
»Baas! Wenn ich mich Ihnen zu Füßen werfe …«
»Das würde dich nicht weiterbringen, du würdest nur wie ein Schwachkopf aussehen …«
»Sie schlagen mir doch nicht ab, worum ich Sie bitte? Was sind schon tausend Franc für Sie?«
»Tausend Franc!«
»Für mich bedeuten sie mein ganzes Leben, Linas Ehre, ihr Glück … Ich kann nicht glauben, dass ein Mann …«
»Das musst du aber!«
»Baas!«
»Was denn?«
Terlinck sah in den Augen des jungen Mannes ein Aufflackern von Hass, eine schreckliche Drohung.
»Was guckst du den Panzerschrank an? Du sagst dir wohl, dass du mich umbringen und alles herausnehmen könntest, was darin ist, Tausende und Abertausende von Francs, mit denen du so viele Hebammen bezahlen könntest, wie du wolltest?«
Er seufzte, bedauerte, dass der Aschekegel seiner Zigarre hinuntergefallen war, und wischte ihn von seinem Jackenaufschlag ab.
»Du bist jung, Jef! Das gibt sich …«
Gleichzeitig stand er auf.
»Sie lehnen also ab?«
»Ich lehne ab.«
»Warum?«
»Weil jeder die Verantwortung für sein Handeln selbst tragen muss. Schließlich hab nicht ich mich mit Fräulein Van Hamme vergnügt, oder?«
Er trat vor, und Jef wich zurück.
»Ich habe stets verboten, dass man mich zu Hause stört.«
Sein Besucher erreichte den kühlen Flur. Terlinck machte das Licht aus, öffnete die Tür.
»Guten Abend!«
Schon schloss sich die Tür auf den menschenleeren Platz, über den gleich Jef Claes’ Schritte hallen würden.
Joris dachte nicht einmal daran, seiner Frau zu erzählen, weswegen Jef gekommen war, und ihr fiel es noch weniger ein, ihn danach zu fragen. Über ihre Näharbeit gebeugt, warf sie ihm nur kurze Blicke zu, mit ihrem ewig besorgten und vergrämten Gesichtsausdruck. Sie war eine Frau, die ihr Leben mit Weinen verbracht hatte und die bis ans Ende ihrer Tage weinen würde. Maria, um die Hüften eine kleinkarierte Schürze, räumte den Tisch fertig ab.
»Ist es gar?«, fragte Terlinck.
»Es ist gar, Baas.«
Er ging in die Küche und nahm die Emailleschüssel, in der das Rebhuhn lag. Auf der Ecke des Herdes zerlegte er es in kleine Stücke und bröselte Brot in die Soße, wie man es für Hundefutter tut.
Danach ging er in den zweiten Stock und lief einen ziemlich langen Flur zwischen den Mansardenzimmern entlang. Je weiter er kam, desto weniger Geräusch machte er, zwang sich dazu, auf Zehenspitzen zu gehen, und öffnete schließlich eine Klappe in einer Tür.
Sogleich setzte ein Lied oder eher ein seltsames Rezitativ aus, das von einer weiblichen Stimme gesungen wurde. Es war stockdunkel auf der anderen Seite der Klappenöffnung. Kaum, dass man auf einem Bett einen zusammengekauerten Körper erahnte.
»Ich bin’s, Emilia …«, murmelte Terlinck sanft.
Schweigen. Aber er sah auf sich gerichtete Augen, so wie man Augen im Dunkeln der Wälder sieht.
»Du bist brav, nicht wahr? Du bist ganz brav? Heute Abend habe ich dir ein Rebhuhn mitgebracht …«
Er zögerte wie ein Dompteur, der wartet, bis das Raubtier ganz ruhig ist, und erst dann den Käfig betritt.
»Brav, Emilia … Brav …«
Langsam drehte er den Schlüssel im Schloss herum. Als dann die Tür halb geöffnet war, brauchte er nur einen Schritt zu tun, nur eine Bewegung, um die Emailleschüssel auf das Bett zu stellen.
»Brav …«
Und der Blick … Der in sich zusammengekrümmte Körper …
»Brav! …«
Er machte die Tür wieder zu, schaute noch einen Augenblick durch das Guckloch, aber er wusste, dass Emilia sich nicht rühren würde, solange sie spürte, dass er da war.
Unten sagte er nichts. Seine Frau nähte, hob die Augen zu ihm auf, seufzte und senkte sie wieder auf ihre Handarbeit. Durch die offene Tür bemerkte er, dass Maria abwusch.
Wie an allen anderen Abenden zog er seinen gefütterten Paletot über, setzte seine Otterfellmütze auf und betrat sein Arbeitszimmer, um Zigarren aus der Kiste zu nehmen, die auf der Kaminecke stand.
Draußen regnete es zwar nicht, aber der Nebel legte sich klebrig-feucht über Boden und Gegenstände. Am Rathaus waren nur noch das gelbrote Zifferblatt der Uhr über dem Turm und die blutrote Laterne der Polizeiwache, links vom Haupteingang, erleuchtet.
Als Terlinck einige Häuser weiter wie jeden Abend das Café ›Vieux Beffroi‹ betrat, streifte sein Blick wie zufällig die Goldbuchstaben auf dem Schild aus Marmorimitat: Bier Van Hamme.
Er lächelte nicht, trat seine Schuhe ab, stieß die mattierte Glastür auf und drang in die Wärme, den Zigarrenduft und ein Murmeln ein, aus dem ihm wie aus einem Mund entgegentönte:
»Guten Abend, Baas …«
Die Wände waren dunkel. Die Möbel waren dunkel. Das ›Vieux Beffroi‹ hatte den wuchtigen und strengen Stil des Rathauses kopiert; die Wände waren mit Wappen verziert, der Kamin von Schnitzwerk umgeben.
Ohne Eile, ja, betont langsam zog Terlinck seinen kurzen Pelzmantel aus, sah nach links, nach rechts, blickte in die Karten der Whist-Spieler, auf die Stellung der Figuren auf einem Schachbrett und setzte sich schließlich auf seinen Platz zwischen Theke und Kamin.
Sein Etui schnappte. Er war mit seiner Zigarre bis zur Hälfte gekommen, und jetzt nahm er eine zweite Zigarrenspitze aus Bernstein, länger als die erste, damit der Rauch immer dieselbe Strecke zu durchlaufen hatte und eine gleichbleibende Temperatur hielt.
Die zweite Spitze war ebenfalls in einem Etui, das Etui in der anderen Westentasche.
Kees, der Wirt des ›Vieux Beffroi‹, brachte ihm ein dunkles Bier, das sahniger Schaum bedeckte.
»Guten Abend, Baas …«
»… ’n Abend, Kees!«
In Wirklichkeit klangen die Silben schwerer, härter, weil man Flämisch sprach, und zwar mit dem Akzent von Furnes.
Kees sagte tatsächlich:
»Goeden avond, Baas …«
Und der andere erwiderte in etwa:
»… denavond, Kees!«
Zwei Farbdrucke waren zu sehen. Einer stellte eine Zigarre dar, die auf der Ecke eines Tisches mit Fransendecke lag und zu einem Viertel abgebrannt war, und der andere einen Dickwanst, der selig lächelnd rauchte.
Beide Farbdrucke, in den Tönen alter flämischer Gemälde, waren Reklamen für die Zigarren Vlaamsche Vlag, die Terlinck herstellte.
Vlaamsche Vlag! Flämische Flagge!
Manche tranken Genever, die meisten aber Bier. Und doch herrschte der scharfe Geruch des Genever vor und drang, so konnte man meinen, sogar durch den dichten Qualm der Zigarren und Pfeifen.
Der Ofen mit den Messingverzierungen bullerte, manchmal mit plötzlicher Heftigkeit wegen eines Windstoßes. Die Gäste streckten die Beine aus. Die Figuren auf dem Schachbrett rückten vor. Die Kartenspieler ereiferten sich. Von einem fernen Kasernenhof ertönte eine Trompete.
»Du mogelst, Poterman!«, bemerkte Terlinck seelenruhig aus seiner Ecke am Kamin.
Und Poterman errötete, denn das war kein Scherz. Terlinck scherzte nie. Er sprach in aller Ruhe Wahrheiten aus, ohne sich die Mühe zu machen, sie mit einem milden oder tadelnden Lächeln zu entschärfen.
»Ich soll mogeln?«
»Ja, du! Gerade eben hast du mit deinem kleinen Finger deinen Bauern ein Feld vorgeschoben …«
»Wenn ich das getan habe, dann nicht absichtlich, das schwöre ich!«
Alles war dumpf und bedrückend, die Luft, die Bewegungen, das Licht, das mit Mühe die dichte Rauchschicht durchdrang, und draußen diese andere nasse Schicht aus Milliarden von unsichtbaren Tröpfchen, die über der Stadt und den Feldern hingen.
Bedrückend die Figuren auf dem Schachbrett, bedrückend die Karten mit den naiven Bildern und bedrückend die Farbdrucke, bedrückend die Hitze, bedrückend selbst der Titel der Lokalzeitung, die noch in Fraktur gedruckt war und die Joris Terlinck jetzt aufschlug.
Kees, der Wirt des ›Vieux Beffroi‹, wischte seinen Bierhahn ab, sooft er ein Bier gezapft hatte, und im Hintergrund des Saales besserte seine Frau eine Hose aus, die einem zehnjährigen Jungen gehören musste.
Es roch auch noch ein wenig nach dem Hasenbraten, den die Wirtsleute zu Abend gegessen hatten. Im ersten Stock ging das Dienstmädchen zu Bett, denn es musste um fünf Uhr wieder aufstehen.
Dann hörte man plötzlich schnelle Schritte, die eine tönende Diagonale über den Platz zogen. Ein Mann stürmte herbei, rüttelte an der Tür, die er erst beim zweiten Anlauf aufbekam, wahrscheinlich weil er den Griff in die falsche Richtung gedreht hatte.
Alle blickten zu ihm hin. Es war einer der zehn Polizisten von Furnes, der Vater einer kinderreichen Familie, der seit zwei Jahren diesen Posten bekleidete.
»Baas! … Baas! …«
Trotz des Ernstes der Situation war ihm das Ungehörige seines Eindringens voll bewusst, seiner Anwesenheit in diesem Café, das den Honoratioren der Stadt vorbehalten war, und je dünner er sich zu machen versuchte, um sich zwischen den Tischen hindurchzuschlängeln, desto mehr stieß er überall an.
Er wusste nicht einmal, ob er vor allen Versammelten sprechen konnte.
»Baas …«, wiederholte er.
Und der Baas empfing ihn mit seinem allerfinstersten Blick.
»Es sind Revolverschüsse gefallen.«
Sollte er, oder sollte er nicht? Wenn man ihn wenigstens mit einem Wort oder einem Blick aufgefordert hätte.
»Es gibt einen Toten …«
Ein dicker Rauchkringel stieg von der Zigarre auf, und die Beine scharrten ein wenig.
»Es ist Jef Claes … Zuerst hat er durchs Fenster auf Fräulein Van Hamme geschossen …«
Alles wunderte sich, dass Joris Terlinck sich nicht vom Fleck rührte und, vor allem, dass er eine ganze Weile mit geschlossenen Augen dasaß.
»Es ist gerade eben passiert … Mein Kollege Van Staeten ist dageblieben … Ich bin hergelaufen …«
Gerne hätte er, um sich wieder zu fassen, eines der Gläser mit Genever oder Bier getrunken, die auf dem Tisch standen, am liebsten Genever.
»Ist sie tot?«, fragte Terlinck endlich.
»Ich glaube nicht … Sie war noch nicht tot, als …«
Der Bürgermeister nahm seinen Pelzmantel vom Haken und setzte seine Fellmütze auf.
»Komm!«
Es war nicht weit, in der ersten Straße, der Marktstraße, drei Häuser weiter als Van Melle, bei dem Terlinck das Rebhuhn gekauft hatte. Aber die Metzgerei war längst geschlossen. Im Dunkeln standen Leute herum, alle in einer gewissen Entfernung.
Das Haus Van Hamme war ein wuchtiges Haus mit je drei Fenstern zur Straße in jedem Stockwerk. Wie beim Bürgermeister, wie anderswo auch, wurden abends die Fensterläden nicht geschlossen, vielleicht, damit man von draußen die elegante Inneneinrichtung sehen konnte.
Kloop, der Kommissar, war bereits da. Mit ihm drei weitere Polizisten.
Und es war leicht zu begreifen, was geschehen war, vor allem, wenn man die Glassplitter auf dem Gehsteig sah.
Eine Ecke im Vorderzimmer bei Van Hamme nahm das Klavier ein. Lina hatte davor gesessen, und ihr Vater, der dicke Van Hamme, der hundertdreißig Kilo wog, hatte vermutlich danebengestanden und die Notenblätter gewendet.
Jef hatte von draußen auf Lina gezielt und geschossen.
Dann hatte er sich den noch warmen Lauf der Waffe in den Mund gesteckt und …
»Ich habe mit dem Krankenhaus telefoniert, Baas … Sie haben mir einen Krankenwagen versprochen …«
»Sie ist nicht tot?«
»Sie können sie nicht sehen, weil sie von dem roten Sofa verdeckt wird … Sie liegt auf dem Fußboden … Sie blutet stark … Ihr Vater …«
Und plötzlich tönten durch die Nacht die unmenschlich heiteren, schwingenden Töne des Glockenspiels herüber und gleichzeitig die neun Schläge der Rathausuhr.
»Achtung, Baas … Ich habe eine Decke darübergelegt, weil es kein schöner Anblick ist …«
Er meinte den Leichnam, der noch quer über dem Gehsteig mit den kleinen Pflastersteinen lag: Jef Claes. Ein Polizist entlud den Revolver, den er gerade aus dem Rinnstein aufgelesen hatte.
Wasserflocken fielen. Es war kein eigentlicher Regen und doch nasser als Regen. Am Ende der Straße, zwischen den Dächern, sah man einen Mond aufsteigen mit einem breiten, braunen Hof darum.
Als Terlinck das Haus betrat, stieß er fast mit Leonard Van Hamme zusammen, der sich mit beiden Armen gegen die Wand des Flures stützte und schluchzte.
2
Langsam drang es durch, genauso langsam wie die ungreifbaren Tropfen durch das Sieb, das ständig über Stadt und Felder gespannt war.
Und doch hatte es Frau Terlinck, die man sehr viel lieber Theresa nannte, schon am ersten Tag, in der ersten Stunde bemerkt, womöglich noch vor Joris selbst.
Wie hatte sie die Neuigkeit erfahren? Der Platz mit den feuchten kleinen Pflastersteinen hallte stark, vor allem nachts! Leute mussten stehen geblieben sein, Türen sich geöffnet haben. Sicherlich hatte sie ihre Haustür unbemerkt einen Spalt geöffnet und im Dunkeln gelauscht.
Als Terlinck nach Hause gekommen war, lag sie bereits im Bett, aber sofort, kaum dass er den Lichtschalter betätigt hatte, erspähte er ihr offenes Auge auf dem Weiß des Kopfkissens.
Sie schliefen im selben Zimmer, aber nicht im selben Bett, denn Terlinck behauptete, er könne nur auf der harten Sprungfedermatratze eines Eisenbetts gut schlafen. Jetzt saß er auf dem Bettrand, zog seine Gamaschen, seine Schuhe aus und starrte auf das Auge. Er wäre diesem Blick gerne entgangen und hätte gern eine undurchdringliche Miene auf sein Gesicht gezaubert, doch er wusste, dass ihm das nicht gelang und dass das Auge es wahrnahm.
Dabei malte sich auf seinem Gesicht höchstens ein leichtes Zögern, ein Schwanken oder eher noch ein Erstaunen, das nicht frei von Naivität war.
Durch das Fenster, das den Blick ins Wohnzimmer der Van Hammes freigab (mit prunkvollem Mobiliar, das erst kürzlich aus Brüssel angeliefert worden war), hatte Jef Claes geschossen und sich dann umgebracht.
Und jetzt hätte Terlinck schwören mögen, dass seine Frau, wenn sie es gewagt hätte, ihm genau die Frage gestellt hätte, die er sich selbst gestellt hatte, sobald die Neuigkeit zu ihm gedrungen war:
Hatte Jef, nachdem er von Terlinck weggegangen war, Zeit gehabt, Lina zu sehen, mit ihr zu sprechen und ihr von seinem Gespräch mit dem Baas zu erzählen?
Die Antwort lautete: Nein. Der Junge hatte mit überhaupt niemandem gesprochen, das wusste man bereits. Wie der Blitz war er in das kleine Café an der Ecke der Rue Saint-Jean gerannt, in dem das Radio lief und nur wenige Gäste saßen. Er war schnurstracks an die Theke gegangen und hatte hintereinander drei Glas Genever getrunken.
Terlinck seufzte, völlig entnervt durch dieses Auge, das er – so kam es ihm vor – gleichzeitig mit der Nachttischlampe ausschaltete.
Wie an allen anderen Tagen stand er um sechs Uhr auf, und er fand das Auge unten: Theresa, die bereits die Zeitung gelesen hatte und sorgenvoll den Kopf schüttelte, während sie Staub wischte, bedrückter denn je von all dem Elend in der Welt.
Es war Markttag. Es war noch nicht hell, doch hörte man auf dem Platz die Hufe der Pferde, das Krähen der Hähne, manchmal ein langgezogenes Muhen; doch an diesem Tag war der Rhythmus der Stadt nicht derselbe, ebenso wenig wie ihr Geruch.
Lange nach der Morgentoilette hielt Joris Terlinck seine vor Kälte klammen Hände über den Küchenherd gestreckt, dessen Deckel er abgenommen hatte. Dann holte er aus einem Regal, das sich hinter der Kellertür befand, drei Eier, ohne sich um Maria zu kümmern, die für das Frühstück aufdeckte und Speckscheiben in den Herd schob.
Terlinck schlug die Eier in einer geblümten Schüssel – immer derselben –, gab Salz und Pfeffer dazu, mischte kleine weiche Butterstücke darunter und ging schließlich zur Treppe.
Auf halbem Weg schon lauschte er. Je nach den Geräuschen wusste er, ob Emilia ruhig war oder ob ihn gleich eine schlimme Szene erwartete. Vor der Tür blieb er einen Moment stehen, lauschte erneut, machte die Klappe auf und trat schließlich mit der Schüssel in der Hand ein.
»Da sind die Eierchen …«, sagte er. »Die guten Eierchen für Mimilia … Ist Mimilia auch brav? … Wird sie hübsch ihre guten Eierchen essen? …«
Er lächelte nicht. Sein Gesicht mit den harten Zügen war ebenso ungerührt, wie wenn er im Rathaus die Post unterzeichnete, die Kempenaar ihm reichte.
An manchen Morgen stieß Emilia durchdringende Schreie aus, an die Wand gepresst, die sie auf jede erdenkliche Art und Weise beschmutzt hatte, von einem Grauen beherrscht, das nichts lindern konnte.
Andere Male fand er sie ausgestreckt auf dem Bauch liegend, immer nackt, denn die Berührung mit einem Kleidungsstück oder einer Decke ertrug sie nicht, die Zähne in den Überzug der Matratze verbissen, die Fingernägel in das Gewebe gekrallt.
»Brav, Mimilia …«
An diesem Morgen betrachtete sie sich in einer Spiegelscherbe und achtete nicht auf die Anwesenheit ihres Vaters. Er konnte die Schüssel neben sie stellen und sogar mit vorsichtigen Bewegungen, denn sie durfte nicht verschreckt werden, das Stück Wachstuch wegziehen, das man stets unter sie zu schieben versuchte, denn sie stand niemals auf und kannte keine Ekelgefühle.
Das Zimmer erhielt nur durch eine vergitterte Luke Licht. Zum Lüften musste man einen ruhigen Augenblick abwarten; aber Terlinck war schon zufrieden, weil er an diesem Morgen das besudelte Tuch hatte wegziehen können.
»Iss, Mimilia …«
Rückwärts ging er hinaus. Draußen wusch er eigenhändig und ohne Abscheu das Wachstuch unter dem Wasserhahn am Ende des Flurs aus.
Wie üblich aß er seine Eier und seinen Speck. Er dachte an Van Hamme, ließ seine Gedanken schweifen und sah schließlich Theresa an, die ihn ebenfalls anblickte. Es war weiter nichts, und doch geriet er darüber in schlechte Laune.
Er ging über den Marktplatz. Die Menschengruppen erörterten das Ereignis, aber verhalten, unaufgeregt, zumal vor den Kindern.
Von acht bis neun Uhr hielt er sich im Rathaus auf, in dem weiträumigen Arbeitszimmer, das seit Jahrhunderten gleich geblieben war, von Angesicht zu Angesicht mit Van de Vliet, dem sein Blick allmorgendlich einen seltsamen Morgengruß entbot. Er steckte sich seine erste Zigarre an, öffnete sein Etui mit dem vertrauten Schnappen.
Der Tag brach an, mit gedämpftem weichem Licht, von schwarzen Silhouetten mit langsamen Bewegungen durchquert.
Kempenaar kam und meldete, dass Frau Claes, Jefs Mutter, seit einer halben Stunde warte.
»Was soll ich ihr sagen, Baas? Ich glaube, es geht um das Begräbnis …«
Joris empfing sie. Sie war schwarz und nass wie der Rest der Welt an diesem Tag, mit einem von Tränen und Nieselregen schon ganz nassen Gesicht und einer geröteten, schniefenden Nase.
»Muss ich mir Vorwürfe machen, Baas? Ich bin eine anständige Frau, jeder in Furnes weiß das. Mein Leben lang habe ich mich für diesen Jungen abgerackert …«
Terlinck war nicht im Geringsten bewegt. Er betrachtete Frau Claes ohne Neugier, zog an seiner Zigarre.
»Warum müssten Sie sich Vorwürfe machen? Nicht Sie haben auf Lina Van Hamme geschossen, oder?«
»Ich wusste nicht einmal, dass sie es war, hinter der er herlief! Sonst hätte ich ihm klargemacht, dass das kein Mädchen für ihn war …«
Auf dem Platz hatten Landfrauen ihren Regenschirm aufgespannt, obwohl eigentlich kein Regen fiel. Genau unter Terlincks Fenstern begannen jetzt Enten ein ohrenbetäubendes Geschnatter.
»Was wollen Sie eigentlich?«
»Ich habe kein Geld, Baas … Ich glaubte, er hätte ein bisschen etwas bei sich … In seinen Taschen habe ich nichts gefunden … Und für das Begräbnis …«
»Haben Sie einen Bedürftigkeitsnachweis?«
Sie hatte keinen. Seit eh und je ging sie als Putzfrau arbeiten, und bis jetzt hatte ihr Sohn ihr alles gegeben, was er bei Terlinck verdiente.
»Ich bin sicher, dass die Leute mich nicht mehr arbeiten lassen werden …«
Das war ihm gleichgültig. Er klingelte nach Kempenaar.
»Sie werden für die Witwe Claes einen Bedürftigkeitsnachweis ausstellen …«
Dann, als der Gemeindesekretär schon gehen wollte, rief er ihn zurück.
»Haben wir noch Särge?«
Das waren schlechtgezimmerte lange Kisten aus hellem Holz, die in der Garage des Feuerlöschwagens für dringende Fälle in Reserve gehalten wurden.
»Drei sind noch da, Baas.«
»Geben Sie Frau Claes einen.«
So! Das war geregelt! Sie konnte wieder gehen, schniefte noch immer und drückte sich beiseite, um unauffälliger durch die Tür zu kommen.
Kommissar Kloop legte seinen Bericht vor, und Terlinck setzte seine breite Unterschrift darunter, verließ das Rathaus und begab sich zur Zigarrenmanufaktur, die im neuen Stadtviertel stand.
»Wir müssen den jungen Claes ersetzen!«, kündigte er dem Buchhalter an, als er sich an seinen Schreibtisch setzte.
Im Gegensatz zum Rathaus und zu seinem Wohnhaus war hier alles hell und modern, roch nach Lack und Linoleum.
»Ich habe schon jemanden gefunden, Baas.«
Darauf er, aus Widerspruchsgeist oder aus Prinzip:
»Den will ich nicht! Sie werden eine Anzeige in die Zeitung setzen, und ich werde mir die Kandidaten selber ansehen.«