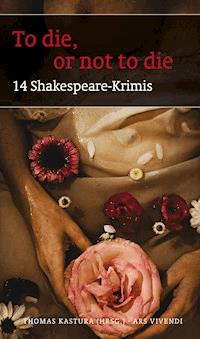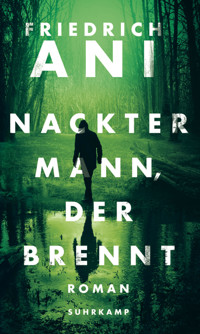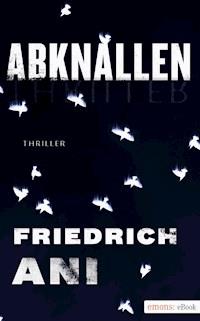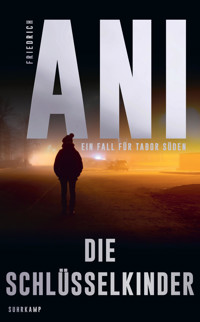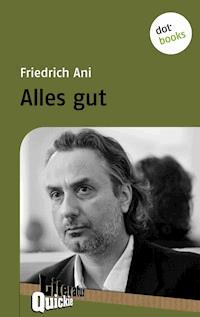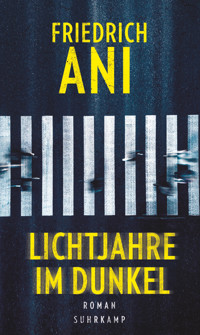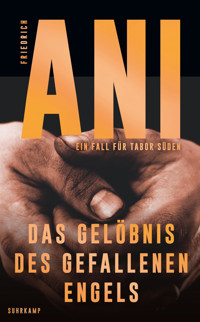6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Tabor Süden
- Sprache: Deutsch
Tabor Süden ermittelt zum 20. Mal Nach dem Brandanschlag auf die Münchner Detektei Liebergesell ist deren Zukunft ungewiss. Gegen den Willen seiner Chefin nimmt Tabor Süden dennoch den Auftrag an, einen Geschäftsmann zu suchen. Bei seinen Ermittlungen stößt er auf Affären und Lügen, auf Menschen, die geübt sind im Wegschauen und Schweigen. Auf Menschen, die nicht mehr an das Glück und an die Gerechtigkeit glauben – so wie es Tabor Süden selbst lange Zeit ergangen ist. Erneut übertrifft Bestseller-Autor Friedrich Ani in diesem Süden-Roman sich selbst. "Der einsame Engel" ist ein scharfsinniger und gefühlvoller Krimi über das Fremdsein in der Liebe und im Leben an sich. »Friedrich Anis Romane sind deutsche Gegenwartsliteratur, deren eminente literarische Qualität sie nicht daran hindert, richtige Geschichten aus diesem Land zu erzählen. Konkret, auf den Punkt, pragmatisch und poetisch.« Thomas Wörtche
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 210
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Friedrich Ani
Der einsame Engel
Ein Tabor Süden Roman
Knaur e-books
Über dieses Buch
»Denn«, sagte ich zu Patrizia, »das Glück, das haben wir doch gelernt, es existiert.«
Nach dem Brandanschlag auf die Detektei Liebergesell ist deren Zukunft ungewiss. Dennoch nimmt Tabor Süden den Auftrag an, einen Gemüsehändler zu suchen. Aus Sorge, so dessen Mitarbeiterin, habe sie sein Verschwinden gemeldet. Bei seinen Ermittlungen stößt Süden schließlich auf eine Wahrheit, die jedes Glück unmöglich macht.
Inhaltsübersicht
»Ich sage, wenn man Sie an die Wand stellte und Sie müssten bekennen, welchen Typ des Gescheiterten Sie am meisten bedauern, welcher Ihnen am meisten zu Herzen geht und Ihnen am meisten Hass auf die Grausamkeit des Schicksals oder der Schicksale eingibt.«
»Alle«, unterbrach ich ihn. »Warum sollte ich einem den Schmerzvorzug geben?«
Juan Carlos Onetti, »Magda«
1
Da ist sonst niemand
»Wie war dein Wochenende?«, fragte sie, und obwohl sie keine Antwort erwartete, schaute sie mich an wie jemand, der am Wortetropf hing.
Ich sagte: »Ich war monumental bebiert.«
Sie lächelte, traurig, denn ihre Freude war verbrannt.
Vor ungefähr einem Monat, an einem Sonnentag im Februar, hatten Unbekannte in der Detektei von Edith Liebergesell Feuer gelegt und damit die Einrichtung vollständig zerstört.
Die Täter waren nicht unbekannt.
Sie stammten aus dem Kreis jener Neonazis, die unseren Kollegen, den achtundsechzigjährigen Leonhard Kreutzer, so schwer verletzt hatten, dass er später im Krankenhaus starb.
In der Statistik der Polizei tauchte der Überfall auf das Büro im fünften Stock am Sendlinger-Tor-Platz als gewöhnliche Brandstiftung auf. Trotz unserer Hinweise und der Tatsache, dass sowohl die Kripo als auch das Landeskriminalamt über unsere Nachforschungen in der rechten Szene Bescheid wussten, begnügten sich meine ehemaligen Kollegen mit der Suche nach gewöhnlichen Unbekannten.
An dem Tag, an dem bei einer Gewalttat auch nur der geringste Verdacht auf einen neonazistischen Hintergrund bestand und die bayerischen Behörden den Anschlag deswegen automatisch als rechtsradikal einstuften, würden dem Münchner Oberbürgermeister Flügel wachsen und im Hofbräuhaus das Bier ausgehen.
»Wo warst du unterwegs?«, fragte Edith Liebergesell.
»Zuerst in meiner Katerschmiede, dann am Hauptbahnhof.«
»Und deine Katerschmiede ist welches Lokal?«
»Das Café Xeng.«
»Eine chinesische Kneipe?«
»Xeng ist bayerisch für gesehen.«
»Wie viel hast du da getrunken?«
Ich sagte: »Das weiß ich doch jetzt nicht mehr.«
»Und was wolltest du am Hauptbahnhof?«
Die Frage hatte ich mir auch gestellt, als ich Gleis sechzehn erreichte und keine Ahnung hatte, warum. Ein Mann, der sich Egon nannte, sprach mich an. Wir tranken ein Bier zusammen. Er fragte mich, was ich von Beruf sei, und ich sagte: Ich bin ein Sucher, und er meinte: Sind wir das nicht alle? Dann tranken wir noch eine Flasche. Irgendwann war er verschwunden. Ich stand an einem Stehtisch in der Halle – wie früher mit Martin, wenn wir von unserer Dienststelle in der Bayerstraße herübergekommen waren und den Menschen zusahen, die wir alle nicht zu suchen brauchten.
»Ich trink noch einen Aperol«, sagte Edith Liebergesell.
Wir saßen vor dem Stadtcafé am St.-Jakobs-Platz, gegenüber dem Jüdischen Museum. Die Frühlingssonne schien zaghaft, und an den Tischen florierten die Gespräche.
Edith und ich hätten ebenso gut vor der Tür eines Hauses am Ende des Weltalls sitzen können.
Das Treffen war ihre Idee gewesen. Andernfalls wäre ich durch die Stadt gelaufen, wie seit Wochen jeden Tag, ziellos, schwerfällig, nutzlos. Die Dinge hatten sich verändert, niemand von uns wusste, wie es weitergehen sollte. Alle zwei Tage erhielt Edith Liebergesell auf ihrem Handy Anrufe von Leuten, die jemanden suchen lassen wollten. Bisher hatte sie nie zurückgerufen.
Wie es aussah, würde der Besitzer der Räumlichkeiten, in denen sich die Detektei befand, den Schaden über die Gebäudeversicherung abwickeln, allerdings erst, wenn die Ermittler fahrlässige Brandstiftung definitiv ausgeschlossen hatten. Seit einer Woche weigerte sich Edith Liebergesell, mit ihrem Vermieter zu sprechen. Sie empfand sein Verhalten als beschämend.
Über die Frage, ob wir weitermachen würden – sie, Patrizia Roos und ich –, hatten wir noch kein Wort verloren. Wir trafen uns, redeten über irgendetwas, begannen mit leichten Getränken und endeten bei den harten Sachen.
Auf dem Waldfriedhof war ich seit dem Feuer nicht mehr gewesen, nur auf dem alten Haidhauser Friedhof, wo Leonhard Kreutzer seine letzte Ruhestätte gefunden hatte. Wenn ich an seinem Grab stand, schwieg ich. Anders als bei Martin Heuer, der neben einer Kolonialwarenhändlerswitwe lag und die Dinge des Lebens mit mir besprach, wie seit urdenklichen Zeiten. Oder am Südrand des Waldfriedhofs auf der Wiese der Anonymen, deren Erdreich die Asche meines Vaters verbarg, irgendwo in drei Metern Tiefe, an einer Stelle, die nur die Grabmacher der Städtischen Friedhofsverwaltung kannten. An einer beliebigen Stelle redete ich mit meinem Vater, wie ich es zu seinen Lebzeiten nie getan hatte – weil er nicht da war, sondern verschollen und Bewohner meiner obdachlosen Erinnerungen.
Ich ging durch die Stadt und wusste nicht, wohin. Ich verbrachte den Tag unter Menschen, aber es hätten auch Tote sein können oder Außerirdische.
Ständig dachte ich über unseren letzten Fall nach, der so unscheinbar begonnen und so hoffnungslos geendet hatte.
Warum hatte ich den alten Mann nicht rechtzeitig gewarnt?
Wieso hatten wir ihn überhaupt allein losgeschickt?
Warum hatten wir nicht begriffen, dass hinter der Suche nach einem angeblichen Taxifahrer eine Welt aus Lügen und Verbrechen steckte und wir Marionetten waren – für den Staat genauso wie für den Anti-Staat.
Jeden Tag Fragen, die keinen Sinn ergaben.
Jeder Tag ein Umherirren im Dunkeln.
An jedem Tag Anflüge von Selbstmitleid und Selbstbetrug und am Ende Alkohol und Verstummen und die Nähe einer Frau, die meinen Zustand wie ein Zerrbild spiegelte.
Wir tranken aus Gewohnheit. Und wenn die Kellner hinter uns die Stühle auf die Tische stellten, bekamen wir es mit der Angst. Draußen wartete die Nacht, und in meiner Wohnung hockte ein Fremder, der meinen Namen angenommen hatte, weil er glaubte, auf diese Weise unbeschadet über die Grenze ins Morgen zu gelangen.
»Der wievielte Aperol ist das?« Edith Liebergesell nippte an ihrem roten Getränk, warf mir einen Blick zu, und ich sah, wie ihre Hände zitterten.
»Der dritte.«
»Dann bin ich erst am Anfang.«
Nach zehn Jahren hatte sie endlich erfahren, wer damals für die Entführung und Ermordung ihres Sohnes verantwortlich gewesen war, doch sie empfand keine Genugtuung darüber. Die Täter kamen aus der rechtsradikalen Szene. Die Haupttäterin war tot, erschossen von ihrem Komplizen, mit dem sie als junge Frau verheiratet gewesen war. Dieser Mann verweigerte die Aussage. Mir war klar, dass er trotz aller stichhaltigen Indizien niemals wegen Menschenraubs und Mordes verurteilt werden würde. Wahrscheinlich würde er nur eine Bewährungsstrafe wegen Mitgliedschaft in einer verbotenen Organisation erhalten. Der Mord am kleinen Ingmar Liebergesell blieb ungesühnt, so wie der gewaltsame Tod von Leonhard Kreutzer.
Ein paar Wochen lang herrschte Empörung, dann stieg die Stadt wieder auf die Stelzen ihrer Selbstgenügsamkeit und stakste in bewährter Manier durch die Reihen ihrer Steuerzahler.
»Hast du finanzielle Reserven?«, fragte Edith Liebergesell.
»Siebentausenddreihundertfünfzehn Euro.«
»Und wenn die aufgebraucht sind?«
»Dann herrscht Brauchtum.«
»Ich könnte meine Wohnung in Schwabing verkaufen und in eine billige Mietwohnung ziehen«, sagte sie.
»In Mecklenburg-Vorpommern?«
»Wieso nicht?«
»Unbedingt.«
Wir schwiegen.
Sie bestellte ihr erstes Glas Grünen Veltliner und ich mein zweites Bier, nachdem ich vorher zwei leichte Weißbiere getrunken hatte, als wäre ich allen Ernstes fähig, mich auszutricksen.
Der Nachmittag verging.
Die Gäste um uns herum wechselten, die Art der Getränke seltener. Manchmal stellte ich mir vor, jemanden zu suchen, Angehörige und Freunde zu befragen, leere Zimmer zu besichtigen und Fotos zu betrachten, auf denen eine Person zu sehen war, die niemand wirklich kannte.
Wie seit jeher.
Stattdessen blieb ich sitzen, trotzte den lauter werdenden Stimmen, dem aufkommenden, kühlen Wind und den Karawanen meiner Gedanken, die durch meinen Kopf vagabundierten, vor den wütenden Stürmen des Bieres noch in Sicherheit.
Was jetzt?, dachte ich.
Ein Mann von fünfundfünfzig Jahren, ehemaliger Staatsbeamter, heute Mitarbeiter einer Detektei, die nicht mehr existierte. Nicht verheiratet, keine Kinder, ohne Beziehung. Beziehung?, dachte ich, ulkiges Wort. Ich hatte nicht einmal eine Affäre, nicht einmal einen Freund, jedenfalls keinen, der am Leben war und real neben mir am Tresen hätte stehen können.
Alles, was ich besaß, war eine Mietwohnung, die meine Chefin mir besorgt hatte, und rund siebentausend Euro auf dem Konto, die ich mir in den vergangenen Jahren auf mysteriöse Weise zusammengespart hatte. Bis zu diesem Tag im März erhielt ich von Edith Liebergesell nach wie vor zweitausend Euro Honorar im Monat. Davon beglich ich meine Krankenversicherung und bezahlte eine niedrige Miete. Was für ein Glück, dachte ich und trank.
Vor mir auf dem Platz ging ein Rabbi in die Synagoge. Ich dachte an den geplanten Anschlag bei der Grundsteinlegung des Jüdischen Gemeindezentrums und an die Bande von Rechtsradikalen, an die wir bei unserer Suche nach dem verschwundenen Taxifahrer geraten waren und die unser Leben für immer verändert hatte.
Was jetzt?, dachte ich wieder.
Ich war noch nicht betrunken genug, um mich treiben zu lassen. Meine Nüchternheit quälte mich und ergab keinen Sinn.
Dann kam Edith mit ihrer grünen Handtasche aus dem Stadtcafé, und ich fragte mich, wann sie aufgestanden und auf die Toilette gegangen war. Ich schaute zu ihr auf und sah, dass ihre Augen gerötet waren und ihre Wangen grau wie alter Schnee.
Sie legte die Hand auf meine Schulter und verharrte einen Moment. Gerade als ich nach ihrer Hand greifen wollte, ließ sie los, ging an mir vorbei und setzte sich auf ihren Stuhl. Sie stellte die Handtasche neben sich auf den Boden, nahm ihr Glas erst mit einer, dann mit beiden Händen und trank es in einem Zug aus. Ich sah ihr zu, wie sie eine ihrer dünnen Zigaretten aus der Schachtel nahm und mit dem billigen gelben Feuerzeug anzündete, tief inhalierte und auf die Uhr schaute, die sie am rechten Handgelenk trug.
Ich sah sie so lange an, bis sie meinen Blick erwiderte.
»Wieso schaust du mich an?«, sagte sie.
»Da ist sonst niemand.«
Eine Träne rann aus ihrem linken Auge. Edith Liebergesell rauchte, und ich wandte meinen Blick ab und trank einen Schluck und lehnte mich zurück, legte den Kopf in den Nacken und schloss die Augen.
Ich konnte nicht einmal mehr weinen.
Nicht einmal mehr weinen.
Kurz vor neun Uhr abends tauchte Patrizia auf. Ihr Dienst in der Grizzleys-Bar begann in zwei Stunden, und sie hatte nicht die geringste Lust dazu. Doch Edith Liebergesell bestand darauf, dass die junge Frau ihren Job nicht vernachlässigte und sich um ein regelmäßiges Einkommen kümmerte.
Patrizia setzte sich mir gegenüber auf die Bank, neben Edith, und bestellte ihren üblichen schwarzen Kaffee.
Inzwischen hatten wir uns nach drinnen verzogen. Wir saßen vor dem Fenster zum Innenhof. Jedes Mal, wenn ich den Kopf hob, schaute ich in einen wandbreiten Spiegel.
»Du siehst nicht gut aus«, sagte Patrizia.
Ich schwieg.
»Schläfst du auch mal?« Ihre Ponyfrisur, die gewöhnlich akkurat über ihren Augenbrauen endete, wirkte ausgefranst und ungepflegt. Statt ihres süß-herben Parfümdufts verströmte sie den Geruch nach ungelüfteten Räumen.
Offensichtlich hinterließ ich keinen besseren Eindruck auf sie.
»Ich will nicht in die Bar.«
»Du musst arbeiten«, sagte Edith Liebergesell.
»Wozu denn?«
»Damit du was zu tun hast.«
»Will ich nicht.«
»Sag was, Süden.«
Ich sagte: »Wir könnten dich begleiten, und du bedienst uns die ganze Nacht.«
»Keine schlechte Idee«, sagte Edith.
»Blöde Idee«, sagte Patrizia.
Auf die Weise kamen wir nicht voran. Also bestellten wir neue Getränke, und Patrizia rührte so lange in ihrer leeren Tasse, bis Edith ihr den Löffel aus der Hand nahm und klirrend auf den Teller fallen ließ. Daraufhin verschränkte Patrizia die Arme und machte das Gesicht einer beleidigten Schülerin.
Wie so oft trug sie einen ihrer blauen Pullover, der diesmal weniger grobmaschig und ausgeschnitten war als andere. Von Kindheit an, das hatte sie einmal erzählt, war sie daran gewöhnt, ihre Meinung zu sagen und ihre Gefühle offen auszudrücken. Das hatten ihre Eltern eingefordert. Als Klassensprecherin motivierte sie ihre Mitschüler, und später, im Studium, diskutierte sie über alles, was ihr durch den Kopf ging. Sie mochte Menschen, die »gradraus« waren, wie sie sich ausdrückte, und als sie die Universität vorzeitig verließ, sorgte sie sich wenig um ihre Zukunft.
Nach einer abgebrochenen Ausbildung zur Hotelkauffrau fing Patrizia als DJane in einem Club an. Eines Nachts stand Edith Liebergesell vor ihr, beseelt bebiert und rücksichtslos rauchend, und bot ihr einen Job in ihrer neu gegründeten Detektei an. Etwas Besseres, sagte Patrizia danach noch oft, hätte ihr nicht passieren können. Sie plante, für immer als Detektivin an der Seite von Edith, Kreutzer und mir zu arbeiten.Und ich?
Ich stellte mir tatsächlich ein Team vor, wie ich es seit meiner Zeit in der Vermisstenstelle der Kripo nicht mehr erlebt hatte.
Diese Vorstellung hatten wir alle. Sogar Leonhard Kreutzer, der graue, traurige Witwer. Sogar Edith Liebergesell, die Mutter eines entführten und ermordeten Kindes.
Wir existierten nicht mehr. Nur noch Edith, Patrizia und ich, wir drei als Einzelne. Und hätte sie nicht so viel Glück gehabt, wäre Patrizia von den Tätern, die Kreutzer auf dem Gewissen hatten, ebenfalls ermordet worden.
Alles, was wir noch teilten, waren rußgeschwärzte Erinnerungen und ein Tisch am Fenster mit der Dunkelheit draußen und unverständlichen Stimmen um uns herum und Blicke, die wir uns zuwarfen, als müssten wir uns versichern, dass wir doch noch da waren.
Patrizia winkte dem Kellner und wandte sich an Edith: »Haben wir keine neuen Aufträge?«
Edith zuckte mit den Achseln.
»Luca, noch einen Kaffee und ein Stück Käskuchen, bitte«, sagte Patrizia zum Kellner, der manchmal ihr Gast im Grizzleys war.
»Käsekuchen ist aus.«
»Dann nur Kaffee.«
»Einen Mohnkuchen könnt ich dir anbieten.«
»Heut mal keine Drogen, Luca.«
»Bist du sicher?« Er nickte mir zu, weil mein Glas leer war, und ich nickte zurück.
»Für mich noch einen Veltliner«, sagte Edith Liebergesell.
»Dein Glas ist noch halb voll.«
»Bist du mein Ernährungsberater?«
Luca ging zum Tresen, und Edith trank ihr Glas leer. Das gefiel mir nicht, aber ich benahm mich nicht anders und wusste, dass sie sich wegen ihres Trinkens vor Patrizia schämte. Wir tranken trotzdem weiter. In diesen Zeiten war eine Katerschmiede so gut wie jede andere.
»Gibt’s doch nicht«, sagte Patrizia. »Irgendjemand muss doch angerufen haben.«
»Ja.« Edith machte eine lange Pause. »Ich hör nicht hin.«
»Gib mir dein Handy.«
»Nein.«
»Gib’s mir, bitte.«
»Nein.«
»Nicht streiten, die Damen.« Luca stellte die Gläser und die Tasse auf den Tisch und lächelte. Das machte er neuerdings ständig, weil er so stolz auf sein runderneuertes Gebiss war.
»Wir streiten nicht«, sagte Patrizia. Und Luca lächelte schon wieder. Ich sah seine Zähne im Spiegel und mein unrasiertes Gesicht, und das Licht war gemein zu mir und gnädig zu Luca. So schnell ich konnte, hob ich mein Glas.
»Möge es nützen!«
Ohne anzustoßen, prosteten wir einander zu, auch Patrizia mit ihrer Kaffeetasse. Allmählich erreichte ich den Zustand der vergangenen Abende und fing an, mich in meinem Schweigen zu suhlen.
Irgendwann sagte Patrizia zu mir: »Das nervt, wie du rumhängst.«
Ich wollte etwas sagen, ließ es aber sein.
»Das nervt«, wiederholte Patrizia.
Nach einer Weile sagte ich: »Musst du nicht zur Arbeit?«
»Ausnahmsweise gebe ich ihr heute frei.« Edith Liebergesell streckte den Arm mit dem leeren Weinglas in die Höhe.
»Und du hör auf, so viel zu saufen«, sagte Patrizia zu ihr.
Die beiden Frauen kamen in Schwung. »Kümmer dich um deinen eigenen Scheiß«, sagte Edith.
»Keine Sorge.«
»Fang mal gleich damit an.«
»Das sieht ekelhaft aus, nimm den Arm runter.«
Edith kümmerte sich nicht darum.
Ich erinnerte mich an die Zeiten, als ich mit Martin regelmäßig ins Stadtcafé ging, oft mit einem Anflug von Panik, weil ich befürchtete, er könnte wegen Biermangels ausfällig werden. Bis eine der Bedienungen uns Nachschub brachte, waren wir jedes Mal ausgenüchtert. Wir fanden nie heraus, welchen unaufschiebbaren Tätigkeiten die jungen Frauen nachgingen, während die Lippen der Gäste austrockneten oder ihre Mägen anfingen, um Hilfe zu knurren. Wenn eine Bedienung mehr als ein Glas auf ihr Tablett stellte, handelte es sich garantiert um eine Anfängerin. Martin und ich waren überzeugt, Wladimir und Estragon hatten weniger verzweifelt auf Godot gewartet als wir auf eine Kellnerin im Stadtcafé. Selige Zeiten.
»Was grinst du so?«, fragte Patrizia.
Ich sah sie an.
»Dich mein ich.«
»Ich grinse nicht.«
»Du grinst wie ein Depp.«
Ich schaute in den Spiegel an der Wand und konnte kein Grinsen entdecken. »Du verwechselst mein Gesicht.«
»Wie lange wollt ihr noch so weitermachen?«
»Zum Wohle.« Luca stellte die frischen Gläser vor uns hin und klopfte mir auf die Schulter. »Schicke Hose hast du an.« Dann ging er zum Nebentisch. Patrizia sah unter den Tisch, um meine Hose zu begutachten, ersparte mir aber einen Kommentar.
Aus einem rätselhaften Grund hatte ich mich morgens in eine meiner abgetragenen Lederhosen mit den Schnüren an der Seite gezwängt, und aus einem noch viel rätselhafteren Grund passte ich noch hinein. Ich betrachtete meinen Bauch und dachte nicht weiter darüber nach.
Edith umklammerte ihr Glas mit beiden Händen. Aus ihren Augen rannen wieder Tränen. Ich beugte mich vor und strich ihr über die Wange, und sie schmiegte den Kopf in meine Hand.
So verharrten wir, bis sie mich ansah und sagte: »Wir sind schuld, wir sind alle schuld.«
Und ich sagte: »Nein.«
»Nein«, sagte Patrizia.
In ihrer Stimme lag so wenig Überzeugungskraft wie in meiner.
2
Mustang XSP
»Rede, Süden«, sagte Patrizia, »erzähl mir was aus deinem Leben.«
»Nein«, sagte ich.
»Warst du ein glückliches Kind?«
Darauf wusste ich nichts zu sagen. Über so eine Frage hatte ich noch nie nachgedacht. Auch wollte ich nicht reden. Jemand würde vorbeikommen und mir ein frisches Bier bringen.
»Sag was.«
Ich sagte: »Wahrscheinlich war ich glücklich.«
»Warum?«, fragte Patrizia.
Ich schaute sie an, dann den leeren Platz neben ihr. Edith war zum Rauchen in den Innenhof gegangen.
»Frag nicht dauernd«, sagte ich.
»Wie alt warst du, als deine Mutter gestorben ist?«
Ich schwieg eine Zeitlang. »Dreizehn.«
»Und du warst sechzehn, als dein Vater abgehauen ist.«
»Das weißt du doch alles.«
»Hat’s dir gefallen im Dorf?«
»Nein.«
»Wieso nicht?«
»Zu viel Dorf.«
»Trotzdem bist du glücklich gewesen.«
»Ja.«
»Siehst du.«
Für einen Moment glaubte ich, ihr heiteres Lächeln galt jemand anderem. »Warst du ein dickes Kind?«, fragte sie mit ernster Miene.
»Nein.«
»Ein dünnes Kind?«
»Normal gewachsen.«
»Glaub ich nicht.«
»Normal und unauffällig.«
»Cowboy oder Indianer?«
»Abwechselnd.«
»Aus dir wird man nicht schlau«, sagte sie und sah zum Fenster. Mehrere rauchende Gestalten standen in einer Gruppe zusammen, Edith war nicht dabei. »Wolltest du als Kind Detektiv werden?«
»Nein.«
»Was dann? Lokomotivführer? Programmierer?«
»Ich hatte keine Vorstellung von meiner Zukunft.«
»Was war dein Vater von Beruf?«
»Ingenieur in einer Maschinenbaufabrik.«
»Und deine Mutter?«
»Hausfrau.«
»Und Martin, dein bester Freund, was wollt der später mal werden?«
»Stadtmensch.«
»Was?«
»Er wollte so schnell wie möglich aus dem Dorf raus.«
»Gemeinsam mit dir.«
»Unbedingt.«
»Und das hat auch geklappt.«
»Unbedingt.«
»Und wieso seid ihr zur Polizei gegangen?«
»Wir wussten nicht, wohin.«
»Martin hat die Entscheidung getroffen, nicht du.«
»Mein Vorschlag war, in den gehobenen Dienst zu wechseln.«
»Zur Vermisstenstelle.«
»Erst zum Mord, dann in die Vermisstenstelle.«
»Wieso da hin? Wieso bist du nie von den Verschwundenen losgekommen?«
»Jemand muss sie suchen.«
»Aber wieso du? All die Jahre?«
»Ich verstehe vielleicht ihre Motive. Ich sammle Biografien und mache mir eine Vorstellung von den Menschen. Ich höre ihnen zu, ich schau sie mir an.«
»Und was siehst du?«
»Versehrte und Getriebene.«
»Martin war auch ein Versehrter und Getriebener.«
Ich schwieg.
»Du vermisst ihn sehr.«
Ich sah zur Tür, aber niemand kam herein.
»Was wirst du tun, wenn Edith die Detektei schließt? In eine andere wechseln?«
»Ich weiß es nicht.«
»Zur Polizei zurückkehren?«
»Das glaube ich nicht.«
»Hast du Angst vor dem Altwerden?«
»Ich bin alt.«
»Denkst du oft daran, wie es gewesen ist, als du jung warst?«
Sie fragte und fragte, und ich wollte aufhören zu antworten. Und etwas zwang mich weiterzusprechen. Und ich kam mir vor wie in einer Vernehmung auf der anderen Seite des Tisches. »Ich erinnere mich kaum daran«, sagte ich und warf dem vorbeihuschenden Luca einen Bierblick zu.
»Hättest du gern Kinder gehabt?«
»Vielleicht.«
»Sei ehrlich, Süden.«
»Vielleicht.«
»Wenn du ganz fest an deine Kindheit denkst, was für ein Bild siehst du dann? Was hast du unbändig gern getan?«
»Wasser aus einem Bach getrunken. Ich habe nicht meine Hände benutzt, sondern den Mund ins eiskalte, fließende Wasser getunkt, das klar war und sauber. Die Sonne spiegelte sich darin, und die Steine am Grund glitzerten. Und ich war immer allein da oben am Gibbonhügel, hinter dem Anwesen vom Bauern Erbmaier. Ich kletterte die Hänge hinauf, hielt mich an Wurzeln fest und roch den würzigen Duft der Erde und der abgefallenen Rinde. Der Wald bestand aus Laub- und Nadelbäumen. Als ich neun oder zehn Jahre alt war, suchte ich nach Hobbits unter den Farnen und Sträuchern. Ich lebte in einer Welt aus Wesen, die nur ich sehen konnte, ich redete mit ihnen und zog mit ihnen durch finstere Schluchten. Ich schlug unsere Gegner in die Flucht und schnitzte aus dünnen Ästen Pfeile, die ich so hoch in die Luft schoss, dass sie fast mit dem Blau des Himmels verschmolzen. Ich las die Spuren von Füchsen und Rehen. Und wenn ich einen Hochsitz entdeckte, kletterte ich hinauf und hielt Ausschau, wie ein Jäger oder Seefahrer.
Allein war ich ein Heer aus Verbündeten. In Gesellschaft war ich nichts als ein geselliger Einzelgänger. Daran hat sich bis heute nichts geändert, das weißt du.
Wenn ich beschreiben soll, wie ich als Kind war, sehe ich mich als einen Bub in kurzen Hosen und einem weißen Hemd. Meine Mutter zog mir am liebsten weiße, kurzärmelige Hemden an, obwohl sie wusste, dass ich übersät von Flecken und Schlieren nach Hause kommen würde und sie das Hemd sofort einweichen und waschen musste. Vermutlich hatte sie einunddreißig weiße Hemden für mich im Schrank. Woher ihre Vorliebe für weiße Kinderhemden kam, weiß ich nicht. Sie starb, und meinen Vater habe ich nie danach gefragt. Nach ihrem Tod zog ich nie wieder eines dieser Hemden an. Später, als Kommissar, kaufte ich mir weiße Hemden aus Baumwolle oder einem anderen Material und trug praktisch keine anderen mehr.
Erst jetzt erinnere ich mich wieder an die Hemden meiner Mutter. Du hast mich dazu gebracht. Ich hatte es vollkommen vergessen. Seltsam, dass Martin nie davon gesprochen hat. Er lief doch damals ständig neben einem Weißhemd her.
Und schau mich an: Auch heute habe ich ein weißes Hemd an, nicht mehr ganz frisch, aber immer noch weiß. Immer noch weiß.«
»Du?«, sagte Patrizia und verstummte.
Ich wartete, sagte: »Was denn?«
Sie beugte sich über den Tisch, küsste mich auf den Mund, strich mir über die Wange, lehnte sich wieder zurück und hörte nicht auf, mich anzuschauen.
Ich wandte den Kopf ab, wieder zur Tür, und stellte mir vor, Martin Heuer käme herein und brächte eine Schale voll schneekaltem Wasser aus den Bächen unserer Vergangenheit. Wir würden sie austrinken und besoffen werden vor Glück.
»Denn«, sagte ich zu Patrizia, »das Glück, das haben wir doch gelernt, es existiert.«
Sie saß auf der Steinbank im dunkelsten Winkel des Innenhofs und rauchte. Ihre grüne Tasche hatte sie geöffnet neben sich gestellt. Während ich näher kam, ließ sie die Kippe fallen, drückte die Glut mit ihrem Schuh aus, griff in die Tasche und holte die nächste Zigarette und ihr Feuerzeug heraus. Sie war seit mindestens einer halben Stunde draußen.
Nachdem Patrizia zuerst auf der Toilette nach ihr gesucht und sie dann auf der Bank entdeckt hatte, bat sie mich, mit Edith zu reden, weil sie trotz ihres Widerwillens loswollte. Ihre Nachtschicht in der Bar hatte vor zehn Minuten begonnen, und sie bräuchte, erklärte sie, das Scheißgeld.
Aber ich redete nicht mit Edith.
Ich stand nur da, die Hände hinter dem Rücken verschränkt, leidlich bebiert, und sog Zigarettenqualm ein. Edith rauchte hastig und mit schmatzenden Geräuschen. Ich wollte ihr sagen, sie solle damit aufhören, und beschloss stattdessen, ins Lokal zurückzukehren.
»Bleib bitte da«, sagte Edith Liebergesell.
Ich drehte mich wieder zu ihr um. Sie hatte die halb gerauchte Zigarette auf den Boden fallen lassen. Die Glut trotzte dem schwarzen Asphalt.
»Ist Patrizia gegangen?«, fragte Edith, ohne mich anzusehen.
»Ja.«
»Was soll ich tun, Süden? Was würdest du an meiner Stelle tun?«
Ich setzte mich auf die Steinbank, die grüne Tasche zwischen Edith und mir, und dachte darüber nach, welche Antwort mein toter Freund Martin Heuer gegeben hätte.
Ich horchte.
Totenstille.
Wahrscheinlich schlief Martin schon, ruhte sich aus vom ewigen Tag.
Auf einmal war das Bild wieder da: Regen fiel, und ich kniete auf dem asphaltierten Hinterhof eines Bordells in Berg am Laim und hielt die kalte Hand eines Mannes, der ein Leben lang mein bester Freund gewesen war, mein Kollege, mein Wegbegleiter, mein Schwellenwächter.
Zwei Stunden zuvor war er bei einer jungen Frau gewesen, einer Prostituierten. Er hatte, erzählte sie mir, in ihrem Korbstuhl gesessen und unverständliches Zeug geredet, »stärk-stärk«, sagte sie und kicherte und trank einen Schluck Gin Tonic und sah mich an, als wollte sie mich überreden, eine Stunde bei ihr zu bleiben. Sie berichtete, er habe Papierfetzen aus der Tasche seiner Bomberjacke gezogen und diese erst glatt gestrichen und dann wieder zusammengeknüllt und eingesteckt. Sie sagte tatsächlich »Papierfetzen«.