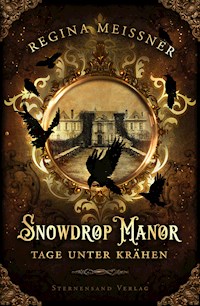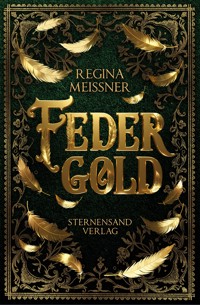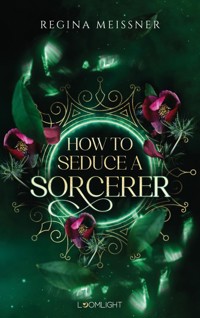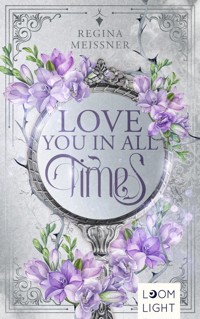Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Sternensand Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Der Fluch der sechs Prinzessinnen
- Sprache: Deutsch
Zwei Seelen, getrennt und verirrt. Der Weg durchs ewige Eis wird von Federn getragen … So beginnen die Flüche der Zwillingsschwestern Penelopé und Genevieve, welche die beiden Prinzessinnen in ewige Kälte verbannt haben. Während Genevieve auf eigene Faust versucht, einen Weg durch die eisige Einöde zu finden und ihren Fluch zu brechen, erhält Penelopé eine Gelegenheit, die ihr helfen könnte, ihr Rätsel zu lösen. Oder ist es Zufall, dass ausgerechnet sie vom Schneekönig in den Eispalast eingeladen wird, der normalerweise keinem Menschen zugänglich ist?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 545
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Titel
Informationen zum Buch
Impressum
Widmung
Kapitel 1 - Genevieve
Kapitel 2 - Penelopé
Kapitel 3 - Genevieve
Kapitel 4 - Penelopé
Kapitel 5 - Genevieve
Kapitel 6 - Penelopé
Kapitel 7 - Genevieve
Kapitel 8 - Penelopé
Kapitel 9 - Genevieve
Kapitel 10 - Penelopé
Kapitel 11 - Genevieve
Kapitel 12 - Penelopé
Kapitel 13 - Genevieve
Kapitel 14 - Penelopé
Kapitel 15 - Genevieve
Kapitel 16 - Penelopé
Kapitel 17 - Genevieve
Kapitel 18 - Penelopé
Kapitel 19 - Genevieve
Kapitel 20 - Penelopé
Kapitel 21 - Genevieve
Kapitel 22 - Penelopé
Kapitel 23 - Genevieve
Kapitel 24 - Penelopé
Kapitel 25 - Genevieve
Kapitel 26 - Penelopé
Kapitel 27 - Genevieve
Kapitel 28 - Penelopé
Kapitel 29 - Genevieve
Kapitel 30 - Penelopé
Kapitel 31 - Genevieve
Kapitel 32 - Penelopé
Kapitel 33 - Genevieve
Kapitel 34 - Penelopé
Kapitel 35 - Genevieve
Kapitel 36 - Penelopé
Kapitel 37 - Genevieve
Kapitel 38 - Penelopé
Dank
Regina Meissner
Der Fluch der sechs Prinzessinnen
Band 4: Eispalast
Märchen
Der Fluch der sechs Prinzessinnen (Band 4): Eispalast
Zwei Seelen, getrennt und verirrt. Der Weg durchs ewige Eis wird von Federn getragen …
So beginnen die Flüche der Zwillingsschwestern Penelopé und Genevieve, welche die beiden Prinzessinnen in ewige Kälte verbannt haben. Während Genevieve auf eigene Faust versucht, einen Weg durch die eisige Einöde zu finden und ihren Fluch zu brechen, erhält Penelopé eine Gelegenheit, die ihr helfen könnte, ihr Rätsel zu lösen. Oder ist es Zufall, dass ausgerechnet sie vom Schneekönig in den Eispalast eingeladen wird, der normalerweise keinem Menschen zugänglich ist?
Die Autorin
Regina Meißner wurde am 30.03.1993 in einer Kleinstadt in Hessen geboren, in der sie noch heute lebt. Als Autorin für Fantasy und Contemporary hat sie bereits viele Romane veröffentlicht. Weitere Projekte befinden sich in Arbeit.
Regina Meißner hat Englisch und Deutsch auf Lehramt in Gießen studiert. In ihrer Freizeit liebt sie neben dem Schreiben das Lesen und ihren Dackel Frodo.
www.sternensand-verlag.ch
info@sternensand-verlag.ch
1. Auflage, März 2019
© Sternensand Verlag GmbH, Zürich 2019
Umschlaggestaltung: Alexander Kopainski | Kopainski Artwork
Illustrationen : Melis Art | redbubble.com/de/people/melisart
Kapitelillustration: Fotolia.de | pipochka
Lektorat: Martina König | Sternensand Verlag GmbH
Korrektorat: Jennifer Papendick | Sternensand Verlag GmbH
Satz: Sternensand Verlag GmbH
ISBN (Taschenbuch): 978-3-03896-038-6
ISBN (epub): 978-3-03896-039-3
Alle Rechte, einschließlich dem des vollständigen oder auszugsweisen Nachdrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten.
Dies ist eine fiktive Geschichte. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Für Annika.
Ich freue mich so sehr, dass du durch meine Bücher
wieder zum Lesen gefunden hast.
Diese Geschichte ist für dich.
Kapitel 1 - Genevieve
Sie war das einsamste Mädchen auf der ganzen Welt. Zumindest fühlte sie sich so, umgeben von Schneemassen, die sie niederdrückten und ihr die Luft zum Atmen nahmen. Früher hatte sie die weiße Pracht geliebt und in Büchern von ihr gelesen – immer in der Hoffnung, sie selbst einmal zu erleben. Doch jetzt, wo ein Dasein aus Kälte und Eis zu ihrer Realität geworden war, sehnte sie sich nach warmen Temperaturen und lauen Sommertagen. Manchmal kam es ihr so vor, als wäre ihr Herz genauso kalt geworden wie der Winter, der sie umgab.
»Bedauerst du dich wieder selbst?«, erklang eine neckende Stimme neben ihr.
Die Prinzessin mit dem feuerroten Haar drehte sich um und blickte auf die weiße Schneeeule, die rechts von ihr auf einer Stange saß, die mit einer Eisenkette an der Decke befestigt war, und sie missbilligend betrachtete.
»Wolltest du heute nicht weiter in den Norden ziehen, um an deinem Rätsel zu arbeiten?«, schickte die Eule hinterher und trieb Genevieve damit nur noch mehr in den Wahnsinn.
Die Prinzessin schnaubte und schaffte es nicht, ihre Wut zu unterdrücken. Zornig sah sie das Tier an und verharrte vor der Stange. »Was soll ich denn noch tun, Libella?«, fauchte die Siebzehnjährige und taxierte das majestätische Tier, das seine schwarzen Augen auf sie richtete.
Gleich, wie wütend Genevieve wurde, Libella blieb ruhig. Vielleicht hatte sie sie aus diesem Grund noch nicht weggeschickt.
»Wir hatten einen Plan. Der bestand auch darin, dass wir kein Trübsal mehr blasen, sondern langsam aktiv werden«, erinnerte Libella Genevieve, doch erntete nicht mehr als ein weiteres Schnauben von der Prinzessin.
»Was soll ich denn noch finden? Ich habe doch schon alles abgesucht«, zeterte Genevieve und ballte die Hand so fest zur Faust, dass die Adern sichtbar wurden. »Da draußen gibt es nichts weiter als Massen aus Schnee und Eis! Niemand weiß etwas mit dem Rätsel anzufangen und …«
»Das kannst du nicht behaupten, bevor du nicht alle gefragt hast«, hielt die Schneeeule dagegen.
Aus dem Augenwinkel erkannte Genevieve, wie das Tier die Flügel ausbreitete, und spürte es schließlich, als es auf ihrer Schulter landete. An das Gefühl, das seine spitzen Krallen verursachten, hatte sie sich längst gewöhnt.
»Du wolltest zu den Naturvölkern gehen. Dass dir niemand im Dorf helfen kann, wissen wir mittlerweile. Aber da draußen gibt es noch eine ganze Welt, von der du keine Ahnung hast. Wenn du sie nicht kennenlernst, kannst du nur scheitern.«
»Du hast leicht reden«, meinte Genevieve. »Du bist ein Vogel und hast keinerlei Pflichten.«
»Falsch. Meine Pflicht besteht darin, dich an deine zu erinnern. Ich mag es nicht, dich den ganzen Tag hier drinnen zu sehen.«
Bevor Genevieve etwas erwidern konnte, schmiegte sich Libella an ihre Wange. Die Wärme ihres Vogelkörpers – das war etwas, das sie zu beruhigen vermochte. Und auch jetzt seufzte Genevieve, ließ für einen kurzen Moment die Berührung zu und straffte dann die Schultern.
»Heute ist es zu spät«, erkannte sie, als sie durch die Fensterscheiben ihrer kleinen Hütte spähte, hinter denen die Nacht Einzug gehalten hatte. Wirklich dunkel wurde es in Prunaea allerdings nie. Der Schnee sorgte dafür, dass ein bisschen der Helligkeit immer erhalten blieb.
Genevieve stupste Libella an, sodass diese wieder auf ihre Stange flog. Die Prinzessin trat an das Fenster. Wohin sie auch schaute, sie sah nichts als Eis und Schnee. Das nächste Dorf, Frigus, in dem sie einst gewohnt hatte, lag einen zweistündigen Fußmarsch entfernt. Ihre Besuche waren immer seltener geworden und schließlich ganz ausgeblieben. In Frigus konnte ihr niemand helfen und deswegen gab es keinen Grund für sie, sich dort aufzuhalten. Stattdessen wohnte sie nun in einem kleinen Häuschen, das aus nicht mehr als zwei winzigen Räumen bestand, die gerade groß genug waren, um sich in ihnen eine Existenz aufzubauen.
Genevieve wischte sich eine Strähne ihres roten Haares aus der Stirn und drehte sich schwungvoll um. Libella saß nicht wie erwartet auf ihrer Stange, sondern hatte es sich auf dem Tisch gemütlich gemacht, wo sie neugierig auf den Pergamentschnipsel starrte, der Genevieves Schicksal erklärte.
»Irgendwelche neuen Erkenntnisse?«, frotzelte die Prinzessin und sank auf einen der beiden Stühle.
Libella antwortete nicht, sondern las sich den Wortlaut des Rätsels durch, dabei musste auch sie – genauso wie Genevieve – es mittlerweile auswendig kennen.
»Der Weg durchs ewige Eis
wird von Federn getragen.
Die Kraft, die in dir wohnt,
durchbohrt auch das kälteste Herz«, rezitierte Genevieve, dann griff sie nach dem Pergament, zerknüllte es und warf es in den Kamin, in welchem sich das Feuer gierig darauf stürzte.
»Ich weiß nicht, ob das klug war«, kommentierte Libella. »Vielleicht vergisst du es.«
»Glaub mir, das wird nicht passieren«, meinte Genevieve und beobachtete, wie die Flammen das Stück Papier vernichteten, bis nur noch Asche übrig blieb. Mit den Fingern kraulte sie Libellas Kopf, der wie immer weich und flauschig war.
Damals, als die Schneeeule zu ihr geflogen war und sich geweigert hatte, wieder zu gehen, war in Genevieve eine große Hoffnung herangewachsen. Ihr Rätsel sprach von Federn – es schien offensichtlich, dass Libella etwas mit der Lösung zu tun hatte. Freudig war sie den Worten erneut auf den Grund gegangen, von Kraft erfüllt, von Entschlossenheit durchdrungen. Aber im Nachhinein hatte Libellas Ankunft nur ein paar Fragen mehr hervorgerufen und nicht eine einzige beantwortet.
Nachdenklich schaute Genevieve auf die Eule mit dem weißen Gefieder, durch das sich graue Schlieren zogen. Jeder andere Mensch hätte ihre Worte nur als ein Krächzen verstanden und ihnen keine Bedeutung beigemessen, aber Genevieve verstand alles, was die Eule ihr sagte. Und genau darin lag das Problem. Das Problem, welches sie ihr Leben lang wie ihren größten Schatz gehütet hatte und das dabei war, an die Oberfläche zu dringen.
Über ihre eigenen Gedanken schüttelte Genevieve den Kopf. Es brachte ja doch nichts.
»In Ordnung«, sagte sie und klatschte in die Hände. »Morgen früh ziehe ich los. Falls es in diesem gottverdammten Land eine Menschenseele gibt, die mir helfen kann, werde ich sie finden.«
Libella sperrte den Schnabel auf. »Das klingt schon viel besser. Natürlich werde ich dich begleiten.«
Genevieve tat ihren Vorschlag als überflüssig ab, doch tief in ihrem Inneren dankte sie der Schneeeule, die einen Teil ihrer Einsamkeit vertrieb und sie immer wieder an das erinnerte, was wirklich wichtig war: das Rätsel lösen, den Fluch brechen, nach Hause kommen.
Nach Hause – das war Brahmenien. Das warme Land, in dem die Sonne hoch am Himmel stand, Regen eine Seltenheit und Schnee eine Unmöglichkeit waren. Zuhause – das war der König, ihr Vater, dem das Herz gleich zweimal hintereinander gebrochen worden war. Zuhause – das waren ihre fünf Schwestern Estelle, Tatjana, Penelopé, Valyra und Arabella, die sie mit jedem Tag in der Einsamkeit mehr vermisste. Sie würde alles tun, um sie wiederzusehen. Aber die Wahrheit war, dass ihr die Hände gebunden waren und jede neue Spur, der sie hinterherjagte, auch nur eine Art und Weise war, die Zeit totzuschlagen. Sie musste etwas tun, sonst würde sie durchdrehen.
»Was weißt du über die Naturvölker?«, fragte Genevieve Libella, die gurrend ihr Gefieder putzte.
Sie hielt in der Bewegung inne und schaute die Prinzessin an, was ihr etwas erschreckend Menschliches verlieh. Auf ihre Frage hin richtete die Eule sich auf und legte den Kopf schief. »Ich habe sie immer nur aus der Ferne gesehen und nie unter ihnen gelebt. Doch es gibt unzählige von ihnen, große und kleine, die sich die Natur zu eigen gemacht haben und sehr viel mehr wissen als die Dorfbewohner. Dein Rätsel sagt sowieso, dass der Weg dich durch Eis und Schnee führt, daher wird es nicht falsch sein, Kontakt zu den Völkern aufzunehmen.«
Genevieve nickte. »Ich werde es versuchen.«
Die Schneeeule sah sie liebevoll an. »Du bist sehr stark«, flüsterte sie und ihre Stimme war so samtig, dass sie sich wie ein warmer Mantel um Genevieves Schultern legte.
Die Prinzessin lächelte, auch wenn sie wusste, dass mehr Traurigkeit als Freude darin schlummerte. War sie stark? War man stark, wenn man jeden Tag aufstand und lebte? Denn viel mehr tat sie nicht.
Genevieves Unterlippe zitterte, als sie an ihre Anfangszeit in Prunaea zurückdachte. Rania, ihre Stiefmutter, hatte sie zusammen mit ihren Schwestern verflucht und jede Prinzessin an einen anderen Ort geschickt. Bis auf sie. Denn Genevieve war zusammen mit ihrer Zwillingsschwester Penelopé in dem Dorf Frigus angekommen. Dadurch war der Fluch beinahe zu einem Segen geworden und sie hatten Erleichterung verspürt. Erleichterung darüber, dass sie zusammen waren. Dass sie gemeinsam die Rätsel, die ihnen mit auf den Weg gegeben worden waren, lösen konnten.
In den ersten Wochen hatten sie alles getan, was nur irgendwie möglich gewesen war. Sie hatten mit den Dorfbewohnern gesprochen, weite Wanderungen unternommen und sich gegenseitig Mut gemacht. Aber jedes Feuer erlosch irgendwann, wenn es kein Holz mehr bekam und alle Gründe, zu brennen, nichtig wurden. Genauso wenig wie Genevieve konnte Penelopé etwas mit ihrem Rätsel anfangen. Es schien nur ein Mehrzeiler zu sein, der keine wahre Bedeutung in sich trug und sie lediglich in den Wahnsinn trieb.
Irgendwann hörten sie auf, über das Rätsel zu reden, und bauten sich stattdessen ein Leben in Frigus auf. Doch während Penelopé menschlichen Kontakt suchte und Freundschaften knüpfte, trieb es Genevieve immer tiefer in die Einsamkeit hinein, sodass sie die Ortschaft schließlich ganz verließ und sich eine Existenz im Nirgendwo aufbaute.
»Ich bin nicht stark«, sagte sie knapp und trat auf die einfache Holzpritsche zu, die ihr als Bett diente. Genevieve schlug das Kissen auf und die Decke zurück. Sie war nicht müde, aber sie wusste, dass die Zeit im Schlaf schneller verging. »Ich vegetiere nur vor mich hin. Ich mache jeden Tag das Gleiche. Penny …«
Libella stoppte Genevieves Worte mit einem aufgeregten Flügelschlagen. Binnen Sekunden war sie bei ihr und nahm neben ihr auf der Pritsche Platz. »Du weißt genau, dass ich das nicht meine«, flüsterte die Eule und stupste ihre menschliche Freundin an.
Vielleicht war es Zufall, dass in diesem Moment Genevieves Blick auf ihre Arme fiel, die durch die langen Ärmel des schwarzen Gewandes verdeckt waren. Doch sie musste nicht darunter blicken, um zu erkennen, welcher Schrecken dort lauerte. Sie hatte ihn sich schließlich selbst zugefügt.
»Es wird heilen«, sprach Libella und strich mit ihrem Schnabel über Genevieves rechten Arm.
Die Prinzessin zog die Schultern hoch. »Wenn es heilt, heißt es, dass ich nachgegeben habe, oder?«
Postwendend schüttelte Libella den Kopf. Seit sie bei Genevieve wohnte, hatte sie sich menschliches Verhalten angeeignet. »Das meine ich nicht«, sagte sie. »Du wirst dich irgendwann nicht mehr verletzen müssen, um dem Drang zu widerstehen.«
Wie gern hätte Genevieve ihr geglaubt. Aber die Wahrheit war, dass das Kribbeln in ihrem Körper jeden Tag größer wurde und sie nicht wusste, wie lange es ihr noch gelingen würde, ihren Schmerz auf ein anderes Ziel zu richten.
»Ich habe heute Nachmittag drei Gläser zerschossen«, wollte Genevieve sagen, aber sie brachte es nicht übers Herz. Aus unerfindlichen Gründen war es ihr wichtig, was Libella von ihr dachte. Dass sie nicht erkannte, wie schwach sie wirklich war.
Freudlos lachte Genevieve in sich hinein. Was war nur aus ihr geworden? Sie hatte einst ein luxuriöses Leben im Palast geführt, Kontakt zu anderen Adligen genossen und die beste Erziehung erhalten. Und jetzt? Lebte sie als Eigenbrötlerin im Nirgendwo, redete mit keiner Menschenseele, aber hatte engen Kontakt zu einer Schneeeule, mit der sie Konversation trieb, und wusste nicht, welchen Sinn es hatte, weiterzumachen.
Aber war das Leben nicht immer so? Man stand jeden Tag auf, tat ein paar Dinge und ging schlafen, ohne wirklich zu wissen, wofür das gut war. Das Ende der Geschichte – das kannte niemand und daher machte man weiter, Stunde um Stunde, Tag um Tag. Und das würde auch sie tun.
»Lass uns schlafen gehen, Libella«, beschloss Genevieve und deutete ein Gähnen an.
Der Vogel verstand, hüpfte vom Bett und flog auf die Stange zu. Dort gurrte Libella einmal und steckte schließlich den Kopf in ihr Gefieder.
Genevieve lächelte mild und wartete auf den Moment, in dem Libella die Augen schloss. Dann stand sie noch einmal auf und holte ihren dicken Pelzmantel, der über dem Sessel hing. Die Nächte in Prunaea waren nicht zu unterschätzen und wenn man nicht vorsorgte, lief man Gefahr, am nächsten Morgen nicht mehr aufzuwachen.
Sie schlüpfte in die Ärmel des Mantels. Dabei blickte sie auf das Armband mit dem Smaragd, das ihre Mutter ihr vor ihrem Tod geschenkt hatte. Genevieve vermisste sie schmerzlich, weswegen ein Seufzen ihren Lippen entwich.
Die Prinzessin zog die Kapuze des Mantels auf, auch wenn sie diese während des Schlafens wahrscheinlich verlieren würde. Mit voller Montur stieg sie abermals auf die Holzpritsche, die mit zwei Eisenseilen an der Wand befestigt war, und deckte sich so zu, dass ihr ganzer Körper geschützt war.
Erst als sie bereit für die Nacht war, fiel ihr auf, dass das Feuer beinahe heruntergebrannt war und seine Wärme nur noch für eine Stunde reichen würde. Innerlich mit sich ringend, verlor Genevieve schließlich den Kampf gegen sich selbst. Weil sie nicht mehr aufstehen wollte, streckte sie eine Hand aus der Decke heraus, schnippte mit den Fingern und sah, wie drei dicke Holzscheite durch die Luft flogen und direkt im Kamin landeten, wo das Feuer sich um sie kümmern konnte.
Die Prinzessin blickte auf ihre Finger hinab. Fakt war: Sie wusste nicht, wie ihre Magie funktionierte, und sie konnte sie auch selten gewinnbringend einsetzen, aber ein paar Bewegungen beherrschte sie mittlerweile.
Als sie in der Scheinwelt erwachte, war sie allein, weswegen der Ort fremd und seltsam auf sie wirkte. Genevieve zog ihr Kleid glatt, eine Mischung aus Duchesse-Linie und Reifrock, und sah sich neugierig um. Die Wände waren durchsichtig, ebenso wie die Decke über ihr – aber um sie herum gab es nichts. Zu mehr war sie nicht imstande gewesen.
Als Genevieve einen Windhauch spürte, drehte sie sich um und sah Penelopé, ihre Zwillingsschwester, die ihr glich wie ein Ei dem anderen und ein ähnliches Kleid trug. Mit gemischten Gefühlen sah Penny sie an und Genevieve hätte sie gern gefragt, welchen Kummer sie mit sich herumtrug, aber in der Scheinwelt durften sie nicht über ihre neuen Leben reden. Ebenso wenig über den Inhalt ihres Rätsels, auch wenn das zweitrangig war, denn das kannte Genevieve sowieso.
»Penny«, sprach sie und trat auf ihre Schwester zu, die das gleiche feuerrote Haar wie sie besaß. Wenn sie ihr in die Augen schaute, sah sie sich selbst – nur in einer anderen, besseren Version.
»Ginny«, antwortete Penny und erwiderte ihren Blick mit einer gewissen Scheu. Mehr sagte sie nicht, aber Genevieve konnte in ihrem Gesicht all die ungestellten Fragen lesen, die nur darauf warteten, beantwortet zu werden.
Wieso hast du dich von mir abgewandt?
Wieso kommst du nicht mehr nach Frigus?
Wieso verbringst du keine Zeit mit mir?
Was ist aus dir geworden?
Genevieves Hand ballte sich zur Faust. Unruhig sah sie sich um. Gleich würde Valyra auftauchen, ihre jüngste Schwester, und die Situation hoffentlich ein wenig auflockern. Angespannt sah Genevieve sich um und zählte im Geiste die Sekunden – aber nichts geschah. Stattdessen trat Penny auf sie zu und griff nach ihrer Hand.
»Wie geht es dir?«, fragte sie ihre Schwester aufrichtig.
Genevieve presste die Lippen aufeinander. »Ich komme zurecht«, log sie und wusste im selben Moment, dass Penny ihr nicht ein Wort glaubte. »Wie geht es dir?«, stellte sie die Gegenfrage.
»Ich komme zurecht«, wiederholte Penny, aber das Lächeln, das sich auf ihre Lippen schlich, war eiskalt.
Genevieve wollte nach ihrer Hand greifen, doch ihre Schwester drehte sich um und wich ihr aus.
»Ich bin gespannt, was Valyra zu erzählen hat«, sagte sie stattdessen.
Genevieve wusste, dass sie nur Konversation treiben wollte, denn in Wahrheit konnte Valyra ihnen gar nichts Relevantes mitteilen. Ihre Zungen wurden schwer wie Blei, sobald sie etwas Wichtiges erzählen wollten.
Vor einigen Monaten hatte es auch Estelle und Tatjana in dieser Scheinwelt gegeben, doch sie waren von einem auf den anderen Tag verschwunden. Arabella hatte sich nur ein einziges Mal gezeigt und dann nie wieder.
Genevieve fuhr sich durch die Haare und seufzte. Penny hatte ihr den Rücken zugedreht und machte deutlich, dass sie nicht mit ihr reden wollte. Wenn eine weitere Schwester anwesend war, riss sie sich für gewöhnlich zusammen und offenbarte nichts von ihrem Gram, aber Valyra hatte die Scheinwelt noch nicht betreten.
Valyra hatte die Scheinwelt noch nicht betreten.
»Penny …«, fing Genevieve an.
Noch bevor sie ihre Frage zu Ende stellen konnte, hatte sich die andere Prinzessin umgedreht und meinte: »Valyra kommt nicht.«
»So lange hat es noch nie gedauert«, stimmte Genevieve ihr zu und zupfte am Ärmel ihres Kleides. »Glaubst du …«
»Vielleicht ist sie dort, wo Estelle und Tatjana sind. Vielleicht auch dort, wo Arabella ist. Oder …« Penny stoppte und auch Genevieve führte ihren Gedanken nicht weiter. Denn an das Oder wollten sie beide nicht denken.
Kapitel 2 - Penelopé
»Ich brauche Muskatnuss, Zucker und ein bisschen Zimt«, zählte Penelopé auf und kratzte sich nachdenklich an der Stirn, weil ihr die letzte Zutat nicht einfallen wollte. »Nelken noch, wenn Ihr welche habt«, fügte sie schließlich hinzu.
Die dicke Frau mit der Pelzmütze murmelte etwas Unverständliches und griff nach Penelopés Korb, um die gewünschten Lebensmittel einzupacken. Ihr Stand war der einzige auf dem ganzen Marktplatz, der noch Essen anbot, und auch hier gab es nicht immer alles, was Penelopé suchte. Noch vor wenigen Wochen hatte die korpulente Marktfrau eine weitaus größere Auswahl besessen, nun war sie nur noch auf das Nötigste beschränkt.
Penny zog sich den Schal dichter um ihren Hals und holte die braune Geldbörse aus ihrer Manteltasche. »Wie viel macht das?«, fragte sie die Verkäuferin, die ihr im Gegenzug den voll bepackten Korb reichte.
Ihre Stirn legte sich in Falten. »Sechzehn Brozin«, murmelte sie.
Penelopé wäre beinahe die Kinnlade heruntergeklappt, doch im letzten Moment fing sie sich. Ihre Herrschaft mochte es nicht, wenn sie eine solch offensichtliche Reaktion zeigte. Immerhin durfte niemand wissen, dass auch ihre besten Zeiten der Vergangenheit angehörten und das Geld knapp wurde.
Noch vor einer Woche hatte Penelopé für die gleichen Zutaten vier Brozin weniger gezahlt und vor vierzehn Tagen hatten sie nur zehn der kostbaren Goldstücke gekostet.
Ungelenk öffnete die Prinzessin die Geldbörse mit der linken Hand und zählte den entsprechenden Betrag ab, den sie der Verkäuferin über die Markttheke hinweg reichte. Dann vergrub sie die freie Hand in der Manteltasche und huschte über den Marktplatz, der heute nur dürftig besucht war. Der andere Stand – eine Ansammlung von Teppichen, die ohnehin niemand brauchte – weckte nicht ihr Interesse. Kalt blies ihr der Wind ins Gesicht, sodass sie schützend die Arme um ihre Mitte schlang.
Penelopé hatte anfangs gedacht, sich an die kalten Temperaturen gewöhnen zu können, aber in Wahrheit traf der Schnee sie jeden Tag mit neuer Wucht. Seit gestern Nacht rieselten die Flocken vom Himmel und es sah nicht so aus, als ob sie je damit aufhören wollten. Penelopé versank tief im Schnee und war froh, dass ihre Stiefel die Kälte abhielten. Rania, ihre böse Stiefmutter, hatte sie in Sommerkleidung an diesen Ort geschickt.
Die Prinzessin wischte sich ein paar Flocken aus dem Gesicht und ging weiter durch die Winterlandschaft. Auf den ersten Blick war Frigus ihr wie ein pulsierendes kleines Dörfchen vorgekommen, doch jetzt, wo das Wetter immer unbarmherziger wurde und die Kälte ihren Tribut forderte, trauten sich nicht mehr viele Menschen nach draußen, saßen stattdessen in ihren Hütten und pressten sich die Nasen an den Scheiben platt. Auch Penelopé war auf dem Weg nach Hause und überglücklich, Väterchen Frost entkommen zu dürfen.
Sie beschleunigte ihre Schritte und ignorierte den kalten Wind, der auf sie einpeitschte. Durch das schnelle Gehen verrutschte ihre gestrickte Mütze immer wieder, doch irgendwann war es ihr egal. Sie wollte endlich ankommen und ihre eiskalten Finger aufwärmen.
Nach ein paar Minuten hatte Penelopé das Haus der wohlhabenden Familie erreicht, in deren Dienst sie stand. Natürlich war ihr Besitz nicht mit dem des Schneekönigs und Herrschers über Prunaea zu vergleichen, doch besaßen die Celtens im Gegensatz zu vielen anderen Familien ein großes Haus und Platz sowie Geld für eigene Angestellte.
Vor dem Dienstboteneingang blieb Penelopé stehen und klopfte sich die Stiefel ab. Ihre Finger glichen mittlerweile Eiszapfen – wieso war sie auch so beschränkt gewesen und hatte die Handschuhe zu Hause auf dem Tisch liegen gelassen? Penelopé kramte in ihren Manteltaschen nach dem Schlüssel, mit dem sie die Tür entsperrte, und stahl sich in die Wärme des Hauses.
Als sie den Kellerraum erreicht hatte, schälte sie sich aus der Jacke, legte Schal und Mütze ab und zog Pantoffeln über. Mit dem Korb in der Hand trat Penelopé in die Küche, die sich ein Stockwerk weiter oben befand und wo sie bereits erwartet wurde.
»Ich dachte schon, der Schnee hat dich verschluckt«, begrüßte ihre Freundin Marnie sie, eine junge Frau mit blondem Haar, deren Wangen mehlbestäubt waren und die gerade dabei war, einen Teig auf der Arbeitsfläche zu kneten.
Penelopé stellte den Korb neben ihr ab und richtete ihren Zopf, der sich draußen in Wohlgefallen aufgelöst hatte. »Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Die Lebensmittel sind wieder teurer geworden.«
Marnie nickte. »Das überrascht mich nicht. Die Ernte ist schlecht und die Handelsstraßen sind mittlerweile kaum noch passierbar.«
Penelopé stöhnte. »Ich frage mich, ob der Winter je enden wird. Hat in Frigus jemals die Sonne geschienen?«
Marnie zwirbelte eine Strähne ihres gelockten blonden Haares. »Ich erinnere mich kaum daran«, gab sie zu und formte kleine Brote aus dem Teig.
»Immerhin habe ich alles bekommen«, meinte Penelopé, während sie die Zutaten aus dem Korb holte und auf die Arbeitsfläche legte.
»Sehr gut. Die Brote sind fast fertig, dann schiebe ich sie in den Ofen. Du kannst schon mal mit dem Kuchen anfangen.« Mit dem Zeigefinger deutete Marnie auf eine große Schüssel, die sie bereits vorbereitet hatte.
Penelopé band sich eine Schürze um und versteckte ihre Haare unter einer weißen Haube. Essen kochen, Kuchen backen – all das ging ihr mittlerweile leicht von der Hand. Es war zur Routine geworden und so tief in ihr verankert, dass sie über die Abläufe gar nicht mehr nachdenken musste. Anders am Anfang, als sie nicht einmal gewusst hatte, aus welchen Zutaten ein Hefeteig bestand oder wie man eine Suppe würzte. Doch wen wunderte es? Als Prinzessin hatte sie sich in ihrem früheren Leben nie mit solchen Dingen beschäftigen müssen und je älter man wurde, desto schlechter lernte man.
Penelopé wog das Mehl ab und vermischte es mit dem Zucker, bevor sie drei Eier aufschlug. Die Herrschaft hatte sich einen weihnachtlichen Kuchen gewünscht.
»Was wird das, wenn es fertig ist?«, fragte Marnie, die an Penelopé herangetreten war. Neugierig blickte sie auf die Mischung, die die Prinzessin gerade mit den Händen vermengte und zu der sie anschließend etwas Zimt dazugab.
»Ich möchte einen Kranz flechten und ihn mit Nüssen garnieren«, sagte Penelopé, in deren Gedanken sich längst ein fertiges Bild des Kuchens geformt hatte.
Marnie steckte den Finger in den Teig und probierte. »Du brauchst definitiv mehr Zucker«, kommentierte sie, griff nach dem Sack und süßte auf Gutdünken.
Unter anderen Umständen wäre Penelopé ihr vielleicht böse gewesen, aber Marnie kannte sich aus und war unschlagbar in der Küche. Gern ließ sie sich von ihr helfen.
Nachdem sich alle Zutaten miteinander vermengt hatten, holte sie den Teig aus der Schüssel, knetete ihn mit den Händen durch und streute Mehl auf die Arbeitsfläche. Mit geschickten Bewegungen rollte sie drei lange Stränge aus, verflocht sie miteinander und formte einen Kranz, in den sie Nüsse steckte.
»Du bist sehr viel besser geworden«, merkte Marnie an und schenkte Penelopé ein Lächeln. »Wenn ich an deine Anfänge denke …«
»Denk einfach nicht dran«, meinte die Prinzessin, schob sich an ihrer Freundin vorbei und kleidete ein Blech mit Backpapier aus. »Das ist lange her.«
»Du hast dich gut eingelebt und deinen Platz in Frigus gefunden«, sagte Marnie.
Sie klang positiv und mutmachend. Ihr Satz war als Kompliment gemeint und doch zog er Penelopé in eine Welt, die sie nicht betreten wollte. In eine Welt, die voller Dunkelheit und grässlicher Erinnerungen war.
Denn wenn Penelopé an ihre Anfänge dachte, musste sie automatisch an Ginny denken. An den Fluch, das Rätsel und den kindlichen Optimismus, den sie an den Tag gelegt hatten. An die Blauäugigkeit, mit der sie das Rätsel lösen wollten, und die Euphorie, an der sie schließlich zugrunde gegangen waren. Letztlich hatte Penelopé das Einzige getan, was ihr übrig geblieben war. Sie hatte den Fluch als ihre neue Existenz angenommen und sich ein Leben in Frigus aufgebaut. Zwar war es nicht im Entferntesten mit dem in Brahmenien zu vergleichen, aber immerhin hatte sie ein Dach über dem Kopf und genügend zu essen und zu trinken.
»Du wirkst in den letzten Tagen sehr verbissen, Pen«, holte Marnie sie in das Hier und Jetzt zurück. Ihre aufmerksamen grünen Augen ruhten auf ihr.
Penelopé jedoch zuckte mit den Schultern, legte den Kranz auf das Backblech und schob es in den Ofen, wo die Brote bereits hochbackten. »Ich bin nur konzentriert, das ist alles«, sagte sie schließlich und rauschte an Marnie vorbei, die sich ihr in den Weg gestellt hatte. Die Prinzessin wusch die Schüssel aus, trocknete sie ab und stellte sie zurück in den Schrank.
»Wenn du mit jemandem reden willst, bin ich für dich da. Das weißt du doch, oder?«, erinnerte Marnie sie.
Penelopé nickte abwesend und hoffte, ihr damit entkommen zu können.
Doch die Köchin gab nicht nach. »Bist du glücklich hier?«
Wie vom Donner gerührt blieb Penelopé stehen und hielt in der Bewegung inne. »Wieso stellst du solche Fragen?«, herrschte sie Marnie an, die ob des rauen Tonfalls zusammenzuckte. Dennoch trat sie einen Schritt auf ihre Freundin zu.
»Seit Wochen schon redest du nicht mehr über deine Vergangenheit. Du sagst, dass du mit ihr abgeschlossen hast, aber so ganz glaube ich dir das nicht …« Nervös nestelte Marnie an ihrer Schürze herum und wagte es nicht, Penelopé anzuschauen.
Diese atmete tief ein und aus, dann meinte sie: »So ist es aber. Ich habe verstanden, dass dies hier nun mein Leben ist. Es hätte mich weitaus schlimmer treffen können.«
»Das stimmt.« Marnie trat auf sie zu und ergriff ihre Hand. »Der Herr und seine Frau sind herzensgute Menschen und wir alle sollten dankbar sein, dass sie uns unter ihre Fittiche genommen haben. Außerdem bin ich glücklich, dass du nun hier bist und mir in der Küche hilfst. Vor dir hat es immer nur Jungen gegeben, mit denen ich nicht klargekommen bin. Und dennoch …«
»Dennoch was?«, rutschte es Penelopé heraus, auch wenn sie keine Nachfragen hatte stellen wollen. Daran, dass Marnie von einem Fuß auf den anderen trat, sah sie ihr die Anspannung an.
»Du bist nicht hier geboren. Nicht hier aufgewachsen. Du bist noch nicht lange in Frigus und hast ein ganzes Leben, das hinter dir liegt. Hast … du es wirklich schon aufgegeben?«
Penelopés Seufzen hätte Steine erweichen können. »Kannst du dich daran erinnern, wie traurig ich geworden bin? Wie die Hoffnung mich immer mehr verlassen hat und ich nicht mehr klarkam?« Sie sah Marnie tief in die Augen und legte alle Überzeugung in ihre Stimme, die sie aufbringen konnte. »Ich will mich nie mehr so fühlen. Nie wieder. Ich komme mit meinem neuen Leben klar. Meine Existenz ist nicht gefährdet, ich habe es warm und in dir eine Freundin gefunden. Wirklich, ich bin zufrieden.« Um ihre Aussage zu unterstreichen, nickte Penny.
Marnie drückte ihre Hand fest, dann ließ sie sie los. »Ich habe bloß gedacht, dass wir … Jetzt, wo so viel Zeit vergangen ist, können wir vielleicht einen neuen Blick auf das Ganze werfen und …«
Penelopé spürte, wie der Zorn in ihr wütete. »Ein neuer Blick?
Zwei Seelen,
getrennt und verirrt,
müssen sich erst finden –
im Schloss, das über die Kälte herrscht.
So entsteht Feuer im Schnee –
durch Liebe und das Band der Ewigkeit.
Was soll sich daran geändert haben? Hast du auf einmal einen Weg gefunden, der mich in das Schloss führt? Denn genau da muss ich doch hin und genau das …«
Penelopé fuchtelte beim Sprechen wild mit den Händen in der Luft herum, sodass Marnie nach ihnen griff und sie festhielt.
»Ich wollte dich nicht wütend machen, Pen, das lag nie in meiner Absicht. Vielleicht hätte ich das Thema nicht ansprechen sollen …«
»Ganz genau«, stimmte die Prinzessin ihr zu und kämpfte sich frei. »Ich will nicht mehr darüber reden. Nicht mit dir und mit keinem sonst. Mein Leben als Prinzessin gehört der Vergangenheit an. Ich bin nun eine Küchengehilfin und sehr zufrieden.«
Es war offensichtlich, dass Marnie ihr nicht glaubte, aber für den Moment reichte es Penelopé, dass sie zumindest keine Widerworte gab.
Wütend wandte sie sich den Zutaten zu, die sie eingekauft hatte, und stellte sie in das Vorratsregal. Marnies Worte hatten eine Wahrheit in ihr wachgerüttelt, die sie schlafen lassen wollte.
Und jetzt, wo sie mit zitternden Fingern auf die Muskatnuss hinabblickte, wurde ihr noch etwas anderes klar: In zwei Tagen war Weihnachten. Das Fest, das man im Kreise seiner Liebsten und mit der Familie verbringen sollte. Marnie würde Frigus morgen früh verlassen, um in das benachbarte Dorf Kalehn zu gehen. Dort wohnte ihr Vater, mit dem sie die Feiertage verleben wollte.
Penelopé hätte ihr diese Entscheidung niemals zum Vorwurf gemacht und doch war es, als würde sich eine eiskalte Hand um ihr Herz schließen, wenn sie an die Tage in Einsamkeit dachte, die vor ihr lagen. Zu Hause war Weihnachten immer etwas Besonderes gewesen, auch wenn kein Schnee Brahmeniens Grund bedeckt hatte. Mit feuchten Augen dachte Penelopé an den geschmückten Baum, die festliche Stimmung und das gute Essen. Aber über allem schwebten die Gesichter ihrer Familie, die ihrer Eltern und die ihrer Schwestern.
Sie konzentrierte sich auf den Ärger in sich, damit die Tränen sich keinen Weg nach draußen bahnen konnten. Mit Wut umzugehen war so viel leichter, als sich Kummer einzugestehen.
Penelopé blinzelte und sah Marnie durch den Tränenschleier. Ihr Mund stand ein Stück offen, so als wollte sie etwas sagen, aber stattdessen breitete sie ihre Arme aus und schloss Penny in ihnen ein. Die Prinzessin vergrub ihren Kopf an der Schulter der Köchin und atmete ihren unverkennbaren Duft nach Zimt und getaner Arbeit ein. Immerhin hatte ihr dieser Fluch eine gute Freundin beschert.
Kapitel 3 - Genevieve
Sie konnte sich nicht daran erinnern, wann sie zuletzt eine Nacht durchgeschlafen hatte. Wann sie am Morgen aufgewacht war, ohne von Albträumen heimgesucht zu werden oder ohne dass die Gänsehaut sich wie eine zweite Schicht auf ihren Körper legte.
So ging es ihr auch heute. Klappernd schlugen ihre Zähne aufeinander, während sie sich frierend weiter unter der Decke vergrub. Sie hatte sie schon zweimal gegen eine dickere ausgetauscht und dennoch kam sie nicht gegen die Kälte an, die sich jede Nacht in ihre Seele schlich.
Genevieve hob den Kopf und warf einen Blick aus dem Fenster, das sie die Tageszeit erkennen ließ, da sie es nicht mit Vorhängen verhangen hatte.
Die Welt war nicht mehr dunkel, aber die Nacht noch nicht vorbei. Ob Genevieve wieder Schlaf finden würde? Ihr Körper war müde, doch ihr Geist zu wach, um die vielen Gedanken, die in ihr tobten, zum Schweigen zu bringen. Albträume hatten sie immer wieder wach gemacht und wenn das Grauen erst Einzug gehalten hatte, war es schwer, es abzuschütteln.
Entschlossen schob Genevieve die Decke von sich, stand auf und schlüpfte in die warmen Fellpantoffeln, die sie sich auf dem Markt in Frigus gekauft hatte. Ihr Rücken schmerzte und ihre Augen waren noch müde, dennoch ging sie auf die Kochzeile zu und schnitt sich eine dünne Scheibe des Brotes ab, das eigentlich schon viel zu hart war, um noch genießbar zu sein.
Bis vor ein paar Tagen hatte sie Marmelade besessen, doch die war mittlerweile zur Neige gegangen, was hauptsächlich an einer verfressenen Schneeeule lag, die Zuckerzeug jeglicher Art nicht widerstehen konnte.
Genevieves Blick wanderte zu der Stange, auf der Libella noch friedlich schlummerte. Im Gegensatz zu ihren Artgenossen hatte sie einen sehr tiefen Schlaf und wurde nur durch laute Geräusche oder direkte Berührungen wach. Wie sie bisher in der Natur überlebt hatte, war Genevieve schleierhaft.
Die Prinzessin tauchte das steinharte Brot in den Rest der Milch, um es weicher zu machen. Sie musste dringend einkaufen gehen. Obwohl das Brot die Flüssigkeit dankend aufnahm, schmeckte es hart und bitter.
Genevieve schlang den Mantel dichter um ihren frierenden Körper. Die Bilder des Albtraums huschten wie Erinnerungen durch ihren Kopf. Einen Teil der Nacht hatte sie in der Scheinwelt verbracht, aber das war es nicht, was ihr Sorgen bereitete.
Als Genevieve ein Pochen spürte, zog sie die Ärmel des Mantels und die ihres Nachtkleides hoch. Sie sog scharf die Luft ein, als sie die offenen Wunden auf ihren Armen entdeckte, die sie sich in der Nacht zugefügt haben musste.
Tränen schossen in ihre Augen, während sie wiederholt den Kopf schüttelte. Genevieve erinnerte sich an das Trümmerfeld, an die letzten Schreie und flehenden Stimmen. Sie sah die Leiche vor sich, den toten Körper ihrer Zwillingsschwester. Und über all dem, über all dem Leid und Schrecken, erkannte sie sich – triumphierend, wie eine Amazone unter den Opfern, die durch ihre Hand gestorben waren.
Genevieve erinnerte sich an das wallende schwarze Kleid, das sie getragen hatte, das sich um ihren Körper schmiegte wie eine zweite Haut und ihr eine Aura des Bösen verlieh. Nie würde sie die dunklen Schwaden vergessen, die aus ihren Händen gewichen waren, die Feuerbälle, die sie aus Angst erschaffen und schließlich direkt auf ihre Schwester geschleudert hatte. Sie konnte gegen die schwarze Magie nichts ausrichten und war elendig zugrunde gegangen.
»Gut, mein Kind«, hatte Rania gesagt, die auf das Schlachtfeld getreten war, als der Kampf schon nicht mehr andauerte. »Ich habe mich bereits gefragt, wann du dich endlich entscheiden wirst, und bin froh, dass du deine Wahl getroffen hast.«
Rania hatte mild gelächelt und Genevieve hatte es mit einer Selbstsicherheit erwidert, die ihr Angst bereitete. Sie sah sich, wie sie die Hand ihrer Stiefmutter ergriff, mit ihr über Pennys toten Körper stieg und auf einer Welle aus Finsternis verschwand.
Das Brot zitterte in ihren Händen. Sie konnte nicht mehr schlucken, so eng fühlte sich ihre Kehle an.
Warum?, dachte sie, und das nicht zum ersten Mal. Warum war sie die Einzige? Warum musste sie sich mit diesem Fluch herumschlagen? Wieso hatte ihre Mutter sie erwählt und nicht Tatjana? Sie hätte besser mit dem Ganzen umgehen können und aus der Schwäche eine Stärke gemacht.
Hasserfüllt schaute Genevieve auf ihre Hände hinab. Ihre Hände, die menschlich und gewöhnlich aussahen, mit schlanken Fingern daherkamen und doch alles andere als ungefährlich waren. Sie hätte nicht ahnen können, welche Macht in ihnen lauerte.
Als sich das altbekannte Prickeln in ihren Fingerspitzen zeigte, biss sie sich so fest auf die Lippe, dass der eine Schmerz vom anderen überdeckt wurde. Aber dadurch wurde das Prickeln nicht weniger – ganz im Gegenteil: Es strömte durch ihren ganzen Körper und lähmte all ihre Gedanken, bis sie einen gequälten Laut ausstieß, ihre rechte Hand zur Faust ballte, sie auf die kleine Schwanenfigur richtete, die ihr auf dem Markt geschenkt worden war, und sie mit einem lauten Knall zerbersten ließ.
Erst als sie die Scherben auf dem Boden sah und die Zerstörung verstand, die sie angerichtet hatte, konnte sie durchatmen und sich wieder auf ihre Gedanken besinnen. Genevieve schlang das Brot herunter und löschte ihren Durst mit der Milch. Von nun an würde sie Wasser trinken müssen.
Libella, die durch den Lärm aufgeschreckt worden war, streckte ihre Flügel aus und flog auf Genevieve zu. Auf der Tischplatte blieb sie sitzen und deutete mit ihrem Schnabel auf die frischen Verletzungen, aus denen vereinzelt Blut tropfte.
»Eine harte Nacht liegt hinter dir«, stellte die Schneeeule fest.
Genevieve musste nicht antworten. Es war offensichtlich, dass sie recht hatte. »Es hilft mir, widerstehen zu können«, sagte sie dennoch, woraufhin Libella ihren schneeweißen Kopf schief legte und sie traurig ansah.
»Ich bewundere dich, dass du immer noch dagegen ankämpfst. Andere hätten schon längst aufgegeben.«
Genevieve setzte sich aufrecht hin. »Penny hat mir mal gesagt, dass Aufgeben nie eine Option ist. Dass es nicht erlaubt ist, nachzugeben. Daran halte ich mich.«
»War der Drang schon immer so schlimm?«, fragte Libella.
Genevieve schenkte ihr einen langen Blick, dann schüttelte sie den Kopf. »In meiner Kindheit hat es ihn überhaupt nicht gegeben. Ich wusste schon früh, dass ich in der Lage bin, Magie zu wirken, aber die Aussicht auf Zaubersprüche hat mich immer positiv gestimmt. Auch als ich älter wurde, wollte ich mehr über meine Kräfte wissen und darüber, wie ich sie einsetze. Natürlich durfte ich niemandem davon erzählen. Aber meine Mutter hat mir schon früh deutlich gemacht, dass es nicht immer so einfach sein würde. Und damit … hatte sie leider Gottes recht.«
Mit den Fingerspitzen strich sich Genevieve über die Striemen, die ihre Haut wie ein Spinnennetz bedeckten.
Libella schenkte ihr einen aufmerksamen Blick, dann plusterte sie sich auf. »Beschreibe mir den Drang genauer, Genevieve«, fordertet sie die Prinzessin auf, die nur traurig an ihr vorbeisah.
»Es ist, als wollte er mich von innen auffressen. Als ließe er mich nie ganz los, auch wenn er manchmal weniger wird. Dennoch spüre ich ihn die ganze Zeit und weiß, dass er mich nie verlassen wird.«
Für einen Moment sah es so aus, als wollte Libella etwas erwidern, aber Genevieve gab ihr nicht die Gelegenheit dazu. Stattdessen stand sie auf, ging zu der Stange, auf der die Schneeeule geschlafen hatte, und holte ihren Rucksack herunter, der daneben hing.
Ablenkung half ihr. Immer wenn sie etwas zu tun hatte, war keine Zeit dafür, ihren dunklen Gedanken nachzuhängen, die wie schwarze Regenwolken über ihr lauerten.
Genevieve löste die Bänder des grünen Rucksacks und stellte sich vor das Fach ihrer Vorratskammer, welches schon bessere Zeiten gesehen hatte. Um ehrlich zu sein, besaß sie nur noch einen Kanten hartes Brot, vier schrumpelige Äpfel und einige getrocknete Fische, die zu jeder Jahreszeit zu bekommen waren und genauso widerlich schmeckten, wie sie aussahen.
Kurzerhand verstaute Genevieve alle Vorräte in ihrem Rucksack. Sie wusste nicht, wie lange ihre Reise dauern würde, und wollte auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Außerdem griff sie nach einer stabilen Flasche mit Korkenverschluss, die sie schon gestern mit Wasser befüllt hatte. Ihr Weg würde sie sicherlich an Flüssen vorbeiführen, sodass eine Ration Flüssigkeit genügen sollte. Zuletzt verstaute sie eine Decke im Rucksack.
Aus den Augenwinkeln nahm Genevieve wahr, dass Libella sich auf die Stange gesetzt hatte und sie musterte.
»Du willst also immer noch losziehen«, kommentierte die Schneeeule, woraufhin sich die Prinzessin ihr zuwandte.
»Ich habe es versprochen und ich werde es versuchen. Vielleicht gibt es ja dort draußen eine Lösung, die ich bisher nicht in Betracht gezogen habe, und vielleicht finde ich unter den Naturmenschen jemanden, der sich mit Flüchen und dunkler Magie auskennt.«
Sie rauschte an Libella vorbei und ging auf den schlichten Schrank zu, in dem sie ihre Garderobe aufbewahrte. Viel war über die Zeit nicht zusammengekommen, und das, was sie hatte, wirkte schäbig und getragen. Doch der Winter war so kalt, dass Äußerlichkeiten nichts mehr zählten und jede Eitelkeit unter einer dicken Schicht Schnee versteckt wurde.
Genevieve griff nach einer weiten braunen Hose, die mit Schafsfell gefüttert war, und schlüpfte in einen Wollpullover, der neben einem Rollkragen extralange Ärmel hatte, sodass auch ein Teil der Finger vor der Kälte verborgen war. Ihre Füße schützte sie mit drei Paar Socken, die sie übereinander zog und schließlich in ihren Winterstiefeln versteckte.
Libella kam zu Genevieve geflogen, im Schnabel den roten Schal, den die Prinzessin in einsamen Abendstunden selbst gestrickt hatte. Dankend schlang sie ihn sich dreifach um den Hals und zog sich die Pelzmütze tief ins Gesicht. Sie war weit geschnitten und bot Platz für all ihre Haare, die sie darunter verschwinden lassen konnte. Auf ihrem Bett lag das Paar Handschuhe, das sie mitnehmen würde. Fehlte nur noch der Mantel, der sie hoffentlich vor der Kälte schützen würde.
Skeptisch warf Genevieve einen Blick aus dem Fenster. Immerhin hatte es aufgehört, zu schneien, auch wenn die weiße Masse gewiss einen Meter hoch war.
»Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich die Wärme Brahmeniens vermisse«, murmelte sie missmutig, schulterte ihren Rucksack und warf Libella einen langen Blick zu. »Du kannst froh sein, dass dir die Kälte nichts ausmacht und du wie gemacht für den Winter bist.«
Libella nahm auf der Schulter der Prinzessin Platz und blinzelte. »Es mag sein, dass ich da draußen nicht friere, aber ich mache mir dennoch Gedanken. Dieser Winter ist härter als alle zuvor und langsam, aber sicher stiehlt er die Lebensfreude der Menschen. Sie fangen an, sich vor dem Schnee zu fürchten und ihn als ihren Feind anzusehen.« Bedauernd schüttelte sie ihren flauschigen Kopf.
Gedankenverloren kraulte Genevieve ihr Gefieder. »Ich habe zwar keine Angst vor dem Schnee, aber es bedeutet leider auch nicht, dass ich ihn mag«, gab sie offen zu und starrte in die Natur, die nur noch aus einer einzigen Farbe zu bestehen schien.
Ihre tierische Freundin gab ein zustimmendes Geräusch von sich. »Ich vermisse die guten Seiten des Winters«, sagte sie leise. »Die, die die Menschen langsam vergessen. Ich vermisse das gesellige Beisammensein, die gemütlichen Märkte, warme Getränke …«
»Du klingst wie ein alter Mann, der seiner Jugend nachtrauert«, witzelte Genevieve, aber in ihrer Stimme hatte sich die Trauer festgesetzt. »Du bist eine Eule.«
»Und dennoch habe ich die Menschen genau dabei gern beobachtet«, hielt Libella dagegen. »In zwei Tagen ist Weihnachten und …«
Genevieve hielt in der Bewegung inne und drehte ihren Kopf langsam der Eule zu. »In zwei Tagen schon?«, hauchte sie und erkannte, wie sehr diese kleine Wahrheit sie traf.
Sie hatte das Weihnachtsfest an den Rand ihrer Gedanken geschoben, um sich nicht weiter mit ihm befassen zu müssen, aber nun, wo Libella es zur Sprache gebracht hatte, spürte sie die kalte Hand, die sich um ihr Herz schloss.
»Das kann mir egal sein«, sagte sie, doch ihre Stimme strafte ihre Worte Lügen. »Ich werde es nicht feiern. Ohnehin gibt es keinen Grund mehr dazu.«
Und bevor Libella sie mit ihrem traurigen Blick durchbohren oder noch mehr sagen konnte, das sie tief traf, lief sie zur Tür und riss sie schwungvoll auf.
Noch vor wenigen Tagen hatte der Sturm sie zu Boden gerissen, doch heute war die Luft still, das Wetter klar. Was nicht bedeutete, dass sie nicht fror. Schon die ersten Schritte auf dem frisch gefallenen Schnee kamen einer immensen Überwindung gleich.
Genevieve hielt das Gesicht gesenkt, dennoch kam es ihr so vor, als würde die Kälte sie mit einem Schlag treffen. Libella spannte die Flügel, verließ ihre Schulter und flog voraus.
Um Genevieve herum gab es nichts als Weiß. Sie hatte sich ein Leben im Nirgendwo aufgebaut. Mit voller Wucht prasselte die Einsamkeit auf sie ein und machte sie für einen Moment bewegungsunfähig. Aber genau das durfte sie nicht sein. Sie musste laufen, durfte nicht stehen bleiben, weil sie sonst an Erfrierungen verenden würde. Mutig setzte sie einen Schritt vor den anderen und trotzte der Kälte, so gut es ihr möglich war.
»Wohin gehst du überhaupt?«, fragte Libella von oben herab.
Genevieve hob kurz den Blick. »Du hast mal gesagt, dass die Naturvölker nördlich von hier leben.«
»Nördlich ja, aber zu welchem Volk willst du? Es gibt unzählige.«
Genevieve schnaubte. Mit jedem Schritt versank sie tiefer im Schnee. »Ich weiß nichts über dieses Land, Libella. Ich habe mein Wissen aus deinen Erzählungen und …«
Die Prinzessin sah, wie die Schneeeule in der Luft anhielt und mehrmals mit den Flügeln schlug, um auf der Stelle verharren zu können. »Es gibt eine kleine Menschengruppe, etwa drei Tagesmärsche von hier entfernt. Ich habe sie auf meinen Reisen oft gesehen und weiß, dass sie sich die wahren Beherrscher nennen. Sie kennen sich nicht nur gut mit der Natur, sondern auch mit Zaubersprüchen und Magie aus.«
Genevieve nickte nachdenklich. »Vielleicht können sie mir helfen. Kennst du den Weg?«
Libella flog einen Kreis in der Luft, was Genevieve als Zustimmung deutete. »Wir dürfen aber nichts überstürzen und du musst regelmäßig Pausen machen. Wenn du dich zu lange in der Kälte aufhältst …«
»Ich weiß, was der Winter mit mir macht«, murmelte Genevieve. »Die Kälte hat sich in meinem Herzen festgesetzt wie ein Geschwür.«
Missmutig blickte sie auf den Schnee hinunter, den sie nicht mehr sehen konnte. Sie hatte eine tiefe Abneigung gegen die Farbe Weiß entwickelt.
»Du solltest am Tag nicht länger als sechs bis maximal acht Stunden unterwegs sein«, sagte Libella von oben. »Dein menschlicher Körper hat sich noch immer nicht an die hiesigen Temperaturen gewöhnt und das müssen wir akzeptieren. Du bist allein unterwegs und mit mir kann niemand außer dir sprechen. Daher käme es einem Selbstmordkommando gleich, wenn du plötzlich zusammenbrechen und auf dem Boden liegen bleiben würdest.«
Genevieve fröstelte angesichts der Vorstellung. Dadurch, dass sie sich zügig weiterbewegte, hatte sie vor allem aufgrund der Anstrengung ein bisschen der Kälte vertreiben können. Sie musste nur auf den Beinen bleiben.
»Ich kenne mich hier in der Gegend gut aus und weiß, wo man schlafen oder zumindest für ein paar Stunden rasten kann«, fuhr die Eule fort. »Du musst deinen Körper in regelmäßigen Abständen aufwärmen und unbedingt genug essen und trinken.«
Abwesend nickte Genevieve. Obwohl sie weiterging und so tat, als würde sie Libellas Worten Gehör zollen, war sie mit den Gedanken ganz woanders. Sie hatte sich die Frage, die in ihrem Kopf festsaß, schon Dutzende Male gestellt und war doch nie zu einer zufriedenstellenden Antwort gekommen.
Hätte sie Rania stoppen können? Wäre es ihr gelungen, sie mit ihren magischen Kräften dingfest zu machen, bevor sie eine Chance gehabt hätte, den Fluch zu sprechen?
Genevieve biss sich auf die Unterlippe, die durch die Kälte spröde geworden war. Sie hatte nicht gewusst, dass Rania des dunklen Zaubers fähig war, aber sie war sich der schwarzen Aura bewusst gewesen, die sie umgab. Eine Aura, die nur Wesen besaßen, die einen Pakt mit der Finsternis geschlossen hatten. Vielleicht wäre es Genevieve gelungen, sie aufzuhalten. Sie zu besiegen, bevor sie das Unheil über ihre Familie bringen konnte. Vielleicht hatte sogar ihre Mutter ihr die Fähigkeiten und Kräfte mit auf den Weg gegeben, um Rania im Falle eines Falles zu stoppen.
Die Prinzessin seufzte. Sie hatte gar nichts geschafft, stattdessen Rania dabei zugesehen, wie sie aus ihrer bösen Macht einen Fluch schuf, der weitaus unheilvoller und endgültiger war als alle ihre kümmerlichen Fähigkeiten zusammen. Sie hatte zugelassen, dass ihre Schwestern alle an unterschiedliche Orte verbannt worden waren – mit einem Rätsel auf Pergamentpapier in der Hand, das doch niemand lösen konnte.
Rania hatte den Fluch gesprochen und auf ihrem Thron aus Dunkelheit triumphiert – und was hatte Genevieve stattdessen vollbracht? Eine Welt geschaffen, in der sich die Schwestern im Traum sehen konnten, um miteinander zu reden. Es sollte ein sicherer Ort werden, an dem sie sich unterhalten konnten, ohne von Rania beobachtet zu werden. Aber Genevieve, die zeit ihres Lebens immer gegen die Magie in ihr angekämpft und keine Ahnung hatte, wie man sie kontrollierte, wusste ihre Kräfte nicht richtig einzusetzen. Aus der Scheinwelt wurde also ein Ort, der das Sprechen über das einzig Wichtige – die Rätsel – verbot. Und das bedeutete, dass sie den Schmerz nur verlängert hatte. Denn nun sahen sich die Schwestern Nacht für Nacht, konnten nur rätseln, was mit der jeweils anderen geschehen war, und verstrickten sich tiefer in Trauer und Missgunst.
Wütend ballte Genevieve die Hände zu Fäusten.
Am Boden unter ihr lag ein Gerippe, welches entfernt an einen Hund erinnerte. Vielleicht sollte sie ihm einfach folgen, am schneebedeckten Grund liegen bleiben und die Augen schließen.
Kapitel 4 - Penelopé
Der Tannenbaum war groß gewachsen und seine Nadeln von einem saftigen Grün. Cebast, der Gärtner, hatte ihn heute Morgen im Wald gefällt und eine Weile gebraucht, um ihn von den Schneemassen zu befreien. Nun stand er im Salon und wartete darauf, geschmückt zu werden. Im Kamin prasselte ein Feuer, das die Kälte nach draußen bannte und dem Raum etwas Gemütliches verlieh.
Penelopé blickte auf die zahlreichen Schachteln und Verpackungen, in denen Kugeln, Lametta und Sterne auf ihren Gebrauch warteten. Sie wollte nicht an ihr Zuhause denken, aber sie kam nicht umhin, denn zusammen mit Valyra hatte sie immer darauf bestanden, den Baum zu schmücken, auch wenn solches Gehabe normalerweise der Dienerschaft vorbehalten war.
Die Prinzessin erinnerte sich daran, wie sie zwei Stühle gestapelt hatten, um den goldenen Stern an der Spitze anbringen zu können. In einem Jahr war Valyra heruntergefallen und hatte sich den Arm so unglücklich verletzt, dass die Wunde genäht werden musste. Und obwohl die Schreie ihrer kleinen Schwester in Penelopés Ohren widerhallten, löste sich ein Lächeln von ihren Lippen.
Vielleicht sollte sie sich nicht grämen und der Vergangenheit nachtrauern. Vielleicht sollte sie dankbar sein, dass sie auf schöne Erinnerungen zurückschauen durfte und in ihrem Leben schon so viel Gutes gesehen, gespürt und geträumt hatte.
Penelopé bückte sich und holte eine dunkelblaue Kugel aus dem Karton, die mit Goldstaub bedeckt war und edel anmutete. Diese sollte ihre erste sein und den Baum vor allen anderen bedecken.
Die Prinzessin lächelte, als die Tannennadeln sie stachen, und wurde erneut sehnsüchtig, als sie den Geruch nach Wald wahrnahm, der den Baum umgab. Wie die Dinge auch standen: Sie wollte ihrer neuen Familie einen schönen Baum ermöglichen und ihn mit so viel Liebe, Kugeln und Hingabe schmücken, wie ihr möglich war.
Als Nächstes nahm sie ein rosafarbenes Geschenk aus dem Karton, welches ein silbernes Bändchen zum Aufhängen besaß. Penelopé platzierte es nicht weit von der dunkelblauen Kugel und spürte, dass die Arbeit ihr Freude bereitete. Zudem war sie eine Entlastung für ihren Rücken, der aufgrund der Aufgaben in der Küche oftmals schmerzte.
Als an der Tür geklopft wurde, drehte Penelopé sich um und murmelte ein leises »Herein«. Sie sah, wie ein älterer Mann den Raum betrat, und lächelte, sobald sie Herrn Celten in ihm erkannte. Die Celtens hatten sie aufgenommen, ganz ohne Eigennutz, und ihr ein Zuhause geboten, das sie sonst vielleicht nicht gefunden hätte.
»Ich wusste, dass ich dich hier finden würde, Penelopé«, sagte er mit seiner warmen Stimme und ging langsam auf sie zu. Herr Celten war ein alter Mann, der die besten Jahre seines Lebens schon hinter sich hatte. Dennoch zeigte er die Gebrechen seines Körpers ungern, war immer zuversichtlich und freundlich seiner Dienerschaft gegenüber. Nicht zum ersten Mal erinnerten seine sanften Augen Penelopé an ihren Vater.
»Setzt Euch doch«, sagte die Prinzessin und schob den Stuhl zurecht, der vor dem Kamin stand.
Herr Celten verzog zunächst den Mund, nahm dann aber dankend den Platz an, ließ sich auf den roten Sessel sinken und warf seinen Krückstock auf den Boden.
»Ich habe gerade mit dem Schmücken des Baumes begonnen«, erklärte Penelopé und deutete auf die Tanne. »Ihr habt wunderschönen Baumschmuck, ich würde am liebsten jeder Kugel einen Platz bieten.«
Herr Celten grinste. »Das hat meine Tochter auch immer gesagt. Sie hatte Angst, dass die Kugeln es ihr übel nehmen würden, wenn sie keinen Platz am Baum bekämen.« Er schmunzelte, doch es lag auch etwas Trauriges um seine Mundwinkel.
Von Marnie hatte Penelopé erfahren, dass sein einziges Kind einer tückischen Krankheit erlegen und seine Frau nicht in der Lage gewesen war, ihm weitere Nachkommen zu schenken.
»Ich bin mir sicher, dass der Baum zauberhaft aussehen wird, wenn er fertig ist«, sagte der Hausherr und fuhr sich über seine grauen, nur noch vereinzelt wachsenden Haare. »Aber sag, mein Kind, schon morgen ist das Weihnachtsfest. Marnie meinte, dass du hierbleiben willst, ist das richtig?« Seine grauen Augen schauten sie ungläubig an.
Ohne Aufforderung nahm sie auf dem Sessel neben ihm Platz und verschränkte die Hände im Schoß. »Ich stehe gern in Euren Diensten und würde mich freuen, wenn ich Euch auch an den Feiertagen helfen kann«, setzte sie zu ihrer Erklärung an, die Herr Celten ihr nicht abkaufte.
»Hast du denn niemanden, zu dem du gehen kannst? Keine Freunde oder Familie?«
So offensichtlich wie er es aussprach, tat es ihr weh. Penelopé schluckte gegen den Kloß in ihrer Kehle an.
Als sie nach Frigus gekommen war, hatte sie Marnie alles erzählt – ihre Gönner wussten jedoch nichts über ihre Vergangenheit. Zu groß war die Angst, als Verrückte gebrandmarkt zu werden, die erzählte, dass sie von einer Magierin verflucht und mit einem kryptischen Rätsel in dieses Land verbannt worden war. Die Menschen in Frigus galten als bodenständig und dachten nicht weiter als bis zu ihrer eigenen Nasenspitze. Magie war für sie ein Fremdwort, ebenso wie Zauber, Hexen oder die dunkle Seite. Deshalb hatte Penelopé beschlossen, ihre Geschichte ruhen zu lassen – zumindest den Menschen gegenüber, bei denen sie sich unsicher war, ob sie sie ernst nehmen würden.
»Du siehst traurig aus, Penelopé. Was ist es, das dich bedrückt?«
Herrn Celtens Stimme brachte sie in die Realität zurück, die ihr ein Seufzen entlockte. Sie blinzelte die aufsteigenden Tränen in ihren Augen weg und log: »Bei uns wird Weihnachten nicht groß gefeiert. Mein Vater ist wahrscheinlich auf der Arbeit. Ich bin mir sicher, dass meine Eltern es gutheißen würden, wenn ich stattdessen ein bisschen Geld verdiene und ehrwürdigen Menschen wie Euch helfe.«
Herr Celten lächelte, was kleine Fältchen um seine Augen legte. »Du verrichtest gute Arbeit, wir sind sehr zufrieden mit dir. Natürlich lassen wir dich auch an Weihnachten helfen, wenn dies dein ausdrücklicher Wunsch ist.«
Penelopé nickte eifrig. »Ich danke Euch, Herr.«
»Ich werde dir für die zusätzliche Arbeit einen Obolus auszahlen«, beschloss er und ignorierte die Beteuerungen der Prinzessin, dass dies nicht nötig war. Er legte seine Hand auf Penelopés Unterarm und drückte ihn sacht. »Würde es dir etwas ausmachen, wenn ich hierbleibe und dir dabei zusehe, wie du den Baum schmückst? Diese Prozedur hat so etwas Heiliges an sich, das …«
»Natürlich«, nickte Penelopé und stand so heftig auf, dass sie fast über ihre eigenen Füße gestolpert wäre. Bald stand sie vor den Kugeln, nahm eine rote aus der Schachtel und hielt sie vor einen der Tannenzweige. »Ist das ein guter Platz?«, fragte sie in Richtung des Hausherrn, doch der schenkte ihr nur eine wegwerfende Handbewegung.
»Ordne sie so an, wie du denkst, mein Kind. Ich bin mir sicher, dass es wundervoll aussehen wird.«
Penelopé nickte dankbar. In regelmäßigen Abständen griff sie in die Kartons, holte Kugeln heraus und hing diese an die Zweige. In einer Schachtel entdeckte sie kleine Schneemänner, die man direkt auf die Nadeln stecken konnte.
Während der Arbeit ruhte Herrn Celtens Blick auf ihr, aber er war nicht wertend, weswegen Penelopé sich entspannen und das Baumschmücken genießen konnte. Bald schon strahlte der Christbaum in einem Meer aus Farben und die noch anzubringenden Kerzen würden es noch schöner machen.
Penelopé bückte sich, um die letzte Schachtel zu öffnen, und entdeckte eine große Schneekugel darin, die nicht als Baumschmuck gedacht war, sich aber als weihnachtliche Dekoration eignen würde. Vorsichtig hob Penelopé das gläserne Gebilde an, überrascht darüber, wie schwer es war. Die Schneekugel hatte einen hellblauen Sockel, der eine Winterlandschaft zeigte, auf der Kinder Schlitten fuhren und sich mit Schneebällen bewarfen. Auch innerhalb der Kugel hatte der Winter Einzug gehalten. Penelopé erkannte die hohen Berge, auf denen der Palast zu Prunaea stand. Der Palast, den niemand erreichen konnte und der doch der Ort war, den sie aufsuchen musste, um ihr Rätsel zu lösen.
»Herr Celten«, sagte sie kurzerhand und drehte sich um, die Schneekugel in der Hand. »Hat es einmal einen Weg nach Prunaea gegeben? Zum Schloss?«
Es wirkte, als würde der Hausherr aus tiefen Gedanken hochschrecken, doch als er die Schneekugel erkannte, lächelte er mild. »Ein wunderschönes Exemplar. Ich habe sie für meine Frau in Auftrag gegeben, als Weihnachtsgeschenk vor über zehn Jahren. Die Anfertigung hat mehrere Wochen gedauert und auch wenn sie nicht perfekt ist, liebe ich jeden Fehler an ihr.« Nostalgie schimmerte in seinen alten Augen. Dann besann er sich Penelopés Frage. »Der Eispalast stand schon immer abgeschieden, es gab für uns nie einen Weg dorthin. Seit meine Familie in Frigus lebt – und das ist seit über einhundertzwanzig Jahren der Fall –, hat es nie ein Mensch geschafft, zum Palast vorzudringen. Genau so wünscht es der Schneekönig.«
Der Schneekönig. Sein Name bereitete Penelopé eine Gänsehaut, wann immer sie ihn vernahm. Auf einmal erschien es ihr, als würde die Kugel in ihren Händen zu Eis gefrieren. Schnell verstaute sie sie wieder im Karton und klappte den Deckel zu. »Was weiß man über ihn?«, kam es ihr über die Lippen.
Herr Celten änderte seine Sitzposition und legte die Stirn in Falten. »Niemand weiß Genaues, aber es ranken sich viele Gerüchte und Sagen um ihn. Die einen meinen, er wäre gar kein richtiger Mensch, sondern ein geflügeltes Wesen, das sich von den Prunaeanern abwenden musste, weil sie seinen Anblick nicht ertrugen. Andere meinen, er ist ein alter Mann, der sich in die Einsamkeit zurückgezogen hat und keinen anderen Menschen um sich herum erträgt.« Herr Celten räusperte sich, was Penelopé als Möglichkeit nutzte, um ihr eigenes Wissen einzustreuen.
»Marnie meinte, dass er ein Tyrann ist. Dass sein Herz aus Eis besteht und er nicht eine gute Minute in seinem Leben erträgt. Daher hat er sich einen Palast ausgesucht, den niemand je erreichen kann.« Fröstelnd schlang sie die Arme um ihren Oberkörper.
»Wie gesagt, es wird viel erzählt, getuschelt und gemurmelt. Doch das ist ganz normal, denn die Menschen neigen dazu, Geschichten zu erfinden, wenn sie sich über etwas nicht ganz sicher sind. Unsere Fantasie ist grenzenlos, vor allem wenn es darum geht, verrückte Intrigen zu spinnen.« Sein Lachen ging in einem Husten unter.
Penelopé dachte angestrengt nach und näherte sich ihm, bis sie vor seinem Sessel stehen blieb. »Das bedeutet, man weiß gar nichts Konkretes über ihn? Nichts, das Hand und Fuß hat?«
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: