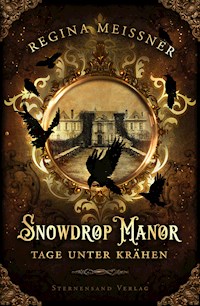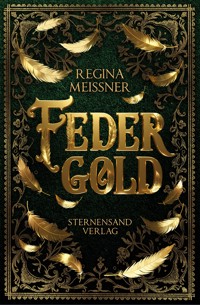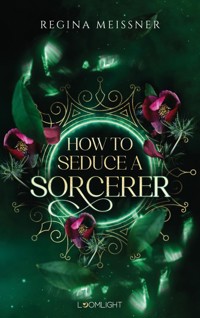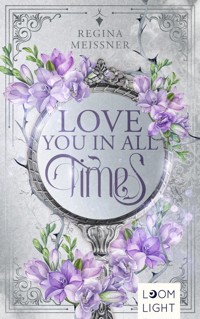Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Sternensand Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Venturia
- Sprache: Deutsch
Die siebzehnjährige Tiana führt ein beschauliches Leben im Schloss von Bel Aniz. In der Prinzessin glüht der Wunsch nach Freiheit und nach Antworten auf Ungereimtheiten, die ihr immer häufiger auffallen. Was ist das geheimnisvolle Land Venturia, über das niemand im Schloss reden darf? Warum ist der König so abweisend, sobald das Gespräch auf Magie gelenkt wird? Doch statt Tianas Fragen zu klären, planen ihre Eltern sechs Bälle, um einen geeigneten Gemahl für ihre Tochter zu finden. Nachdem der erste Ball allerdings vollkommen anders als geplant verläuft, findet sich die Prinzessin auf einmal in einem Strudel aus Ereignissen wieder, der alles, was sie bisher geglaubt hat, als Lüge entlarvt und sowohl ihre Zukunft als auch ihre Vergangenheit infrage stellt. Als sie von einem Fremden verschleppt wird, ist das nur noch der letzte Windhauch, der ihre heile Welt zum Einsturz bringt. Wird es ihr gelingen, aus diesen Trümmern zu entkommen und herauszufinden, wer sie wirklich ist?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 415
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Titel
Informationen zum Buch
Impressum
Widmung
I - Über Blutlinien und Adelshäuser
II - Über Roben und Bälle
III - Über Fantasien und Sehnsüchte
IV - Über Männer und Bettgeschichten
V - Über temporäre Freiheit in einemgoldenen Käfig
VI - Über Ganoven und verbotene Völker
VII - Über Irrglauben und Magie
VIII - Über Namen und Gesichter
IX - Über erste Begegnungen und letzte Worte
X - Über Hierarchien und geheime Gespräche
XI - Über Tanzschritte und Erinnerungen
XII - Über den Moment, der dir den Boden unter den Füssen raubt
XIII - Über verschlossene Türen und kühle Hände
XIV - Über das erste Licht nach einer dunklen Nacht
XV - Über Fluchtversuche und tote Augen
XVI - Über Hexen und das, was es nicht gibt
XVII - Über Regenbögen, für die es nicht regnen muss
XVIII - Über das, was wir vergessen, wenn wir nicht erinnert werden
XIX - Über Torbögen, Holzschwerter und verliebte Füchse
XX - Über Entscheidungen, die man aus Verzweiflung trifft
XXI - Über das Licht der Dunkelheit
XXII - Über Erschütterungen und Verluste
XXIII - Über das Versagen der Liebe
XXIV - Über Hoffnung in Zeiten der schwarzen Sonne
XXV - Über versteckte Vergangenheiten in kaltem Stein
XXVI - Über das, was man sich am Feuer erzählt
XXVII - Über die verborgene Macht der Schmetterlinge
XXVIII - Über Küsse, goldene Schimmer und Rettung in der Nacht
XXIX - Über Blut, Hass und ein Ende, das ein Anfang sein sollte
XXX - Über Albträume, aus denen man nicht erwacht
XXXI - Über Realitäten und Universen
XXXII - Über all das, worüber man nicht sprechen kann
XXXIII - Über klammen Stein und kalte Herzen
XXXIV - Über Angst, Zuversicht und das, was dazwischenliegt
XXXV - Über die Mechanik der Zeit
XXXVI - Über eine Taube unter Raben
Dank
Regina Meißner
Venturia
Band 1: Juwelen und Verfall
Fantasy
Venturia (Band 1): Juwelen und Verfall
Die siebzehnjährige Tiana führt ein beschauliches Leben im Schloss von Bel Aniz. In der Prinzessin glüht der Wunsch nach Freiheit und nach Antworten auf Ungereimtheiten, die ihr immer häufiger auffallen. Was ist das geheimnisvolle Land Venturia, über das niemand im Schloss reden darf? Warum ist der König so abweisend, sobald das Gespräch auf Magie gelenkt wird?
Doch statt Tianas Fragen zu klären, planen ihre Eltern sechs Bälle, um einen geeigneten Gemahl für ihre Tochter zu finden. Nachdem der erste Ball allerdings vollkommen anders als geplant verläuft, findet sich die Prinzessin auf einmal in einem Strudel aus Ereignissen wieder, der alles, was sie bisher geglaubt hat, als Lüge entlarvt und sowohl ihre Zukunft als auch ihre Vergangenheit infrage stellt.
Als sie von einem Fremden verschleppt wird, ist das nur noch der letzte Windhauch, der ihre heile Welt zum Einsturz bringt. Wird es ihr gelingen, aus diesen Trümmern zu entkommen und herauszufinden, wer sie wirklich ist?
Die Autorin
Regina Meißner wurde am 30.03.1993 in einer Kleinstadt in Hessen geboren, in der sie noch heute lebt. Als Autorin für Fantasy und Contemporary hat sie bereits viele Romane veröffentlicht. Weitere Projekte befinden sich in Arbeit.
Regina Meißner hat Englisch und Deutsch auf Lehramt in Gießen studiert. In ihrer Freizeit liebt sie neben dem Schreiben das Lesen und ihren Dackel Frodo.
www.sternensand-verlag.ch
1. Auflage, Dezember 2018
© Sternensand Verlag GmbH, Zürich 2018
Umschlaggestaltung: Jaqueline Kropmanns
Lektorat: Sternensand Verlag GmbH | Martina König
Korrektorat: Sternensand Verlag GmbH | Jennifer Papendick
Satz: Sternensand Verlag GmbH
ISBN (Taschenbuch): 978-3-03896-010-2
ISBN (epub): 978-3-03896-011-9
Alle Rechte, einschließlich dem des vollständigen oder auszugsweisen Nachdrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten.
Dies ist eine fiktive Geschichte. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Für all die, die sich fehl am Platz fühlen
und nicht wissen, wo sie hingehören:
Ihr werdet eure Heimat finden.
Und für Levon III.
I - Über Blutlinien und Adelshäuser
Tiana Anastasia Valerie Serena Minné.
Mein Name war eine bunte Reise durch unsere Blutlinie und setzte sich aus Tanten, Cousinen und Großmüttern zusammen. Obwohl mein Hauslehrer Claudius Kempen darauf bedacht war, dass ich meinen Stammbaum in- und auswendig kannte, drifteten meine Gedanken während der Ahnenkunde immer besonders weit ab. Was brachte es mir, zu wissen, wie mein Urururururgroßvater geheißen hatte, wenn dieser schon seit mehreren hundert Jahren tot war? Welchen Nutzen hatte es, wenn ich die männliche Ahnenlinie im Schlaf rezitieren konnte? Es war schlimm genug, dass meine Familie sich über vier Lande erstreckte und sogar an den Grenzen zu Kesslen, eines kleinen Nachbarreiches, sesshaft geworden war. Einerseits bedeutete dies viele Reisen für mich, andererseits gab es noch mehr langweilige Verwandte, die man regelmäßig besuchen musste.
Seufzend blies ich mir eine Haarsträhne aus der Stirn und musterte meinen Hauslehrer. Er stand, gekleidet in Frack und Leinenhose, neben der großen grünen Tafel, auf die ein Stammbaum gezeichnet war, der meine Vorfahren lebendig werden ließ. Claudius Kempen hielt einen Stock in der Hand, mit dem er nacheinander auf Namen deutete, die mir etwas hätten sagen sollen, aber es nicht taten.
Ich gähnte ausgiebig und starrte aus dem Fenster, das den Schlossgarten zeigte. Früher hatte ich es gemocht, auf den akkurat geschnittenen Rasenflächen spazieren zu gehen und mein blasses Antlitz der Sonne zuzuwenden. Heute fühlte ich mich gelangweilt von den künstlich angelegten Wiesen, die nur wuchsen, weil wir es ihnen gestatteten.
Meine Augen klappten beinahe zu, als ich plötzlich ein Reh auf dem Rasen entdeckte. Seit wann wagten sich die Tiere des Waldes so nah an unser Schloss heran? Neugierig legte ich den Kopf schief und setzte mich aufrechter hin, um das braune Reh besser ausmachen zu können. Es sprang aufgeregt hin und her und verschwand auch nicht, als eine meiner Gesellschafterinnen auf es zutrat und es verscheuchen wollte. Verwundert nahm ich wahr, wie sich das Reh von ihr streicheln ließ.
»Prinzessin Tiana?«, drang Mera Kempens Stimme an mein Ohr und brachte meine Gedanken in das Hier und Jetzt zurück.
Verwirrt blickte ich ihn an und folgte dem Zeigestock, der auf ein freies Feld des Stammbaums zeigte.
»Wer gehört an diese Stelle?« Anprangernd sah er mich an. Wahrscheinlich wusste er nur zu gut, dass ich wieder einmal nicht zugehört hatte.
Schläfrig blinzelte ich und versuchte, seine diffuse Zeichnung zu verstehen. An manche der Namen konnte ich mich erinnern, was aber nicht bedeutete, dass mir das dabei half, das freie Feld zu entschlüsseln. Entschuldigend lächelte ich Mera Kempen an und zuckte mit den Schultern.
Die Enttäuschung stand ihm ins Gesicht geschrieben, gefolgt von Missfallen. Wäre es nicht seine Aufgabe, mich zu belehren, hätte er es schon lange aufgegeben. Allerdings befanden wir uns in einer von meinen Eltern arrangierten Situation, was bedeutete, dass er mir weitere Chancen geben musste. So viele, bis ich den Test in Ahnenkunde bestanden hatte, durch den ich schon viermal gefallen war.
Ich war nicht dumm. Es gab einfach nichts, was mich weniger interessierte als Mera Kempens Geplänkel.
»Fangen wir noch einmal an, Prinzessin«, sagte er beherzt und zwirbelte mit der freien Hand an seinem Schnurrbart. »Eure Großtante zweiten Grades ist Prinzessin Camelia die Dritte. Ihr Sohn …«
Ich schaffte es nicht. Ich konnte ihm nicht zuhören. Seine Stimme war einschläfernder als die Tabletten, die meine Mutter einnahm, wenn sie keine Ruhe fand. Immer wenn mein Blick zur Tafel glitt, fielen meine Augen zu. Es war wie ein Reflex, ich konnte nichts dagegen tun. Hinzu kam, dass die Zeit nicht auf meiner Seite stand und die Uhr ihren Zeiger nur mühsam vorwärts rückte.
Mera Kempens Finger waren weiß vom Kreidestaub. Auch auf der Rückseite seines Fracks hatte sich die Farbe festgesetzt. Jedes Mal, wenn er sich von der Tafel entfernte und in meine Nähe kam, roch ich die stechende Note seines Parfüms.
Mit sechs Jahren hatte er angefangen, sich um meine Bildung zu kümmern. Er war der einzige Lehrer, den ich je in Ahnenkunde gehabt hatte, und mir kam es vor, als hätte er sich in den elf Jahren nicht im Geringsten verändert. Noch immer trug er die ausgebeulten beigefarbenen Hosen, die viel zu groß für seinen drahtigen Körper anmuteten, und auch an seinen braunen Haaren hatte sich nicht viel geändert, wenngleich sie etwas schütterer geworden waren.
»Warum muss ich das Ganze noch mal lernen?«, fragte ich gedehnt und nicht zum ersten Mal.
Dennoch wurde Mera Kempen nicht müde, es mir zu erklären: »Als Prinzessin und künftige Königin über das Land Bel Aniz ist es Eure Pflicht, die Geschichte und damit auch Eure Ahnen zu kennen. Ihr müsst sowohl über die Familien als auch über ihre Konflikte und Gemeinsamkeiten Bescheid wissen.« Wichtigtuerisch sah mein Lehrer mich an.
Ich griff nach der Feder, die neben mir lag, und rollte sie auf dem Tisch hin und her.
»Prinzessin, hört Ihr mir zu?«
Schuldbewusst sah ich meinen Lehrer an. »Ich bin heute nicht ganz auf der Höhe, entschuldigt«, murmelte ich.
Mera Kempen nickte verständnisvoll, aber ich sah die Enttäuschung in seinen Augen. Genauso wie ich wollte auch er, dass die Stunde vorbei war. Aber nach der Stunde … kam eine weitere.
»Möchtet Ihr eine Pause machen, Prinzessin?«
Das Wort Pause brachte mich in das Hier und Jetzt zurück. Dankbar nickte ich und war auf einmal voll aufnahmefähig.
Mera Kempen seufzte und nahm für einen Moment auf seinem Stuhl Platz. Ich beobachtete, wie er ein Brot aus seiner Ledertasche holte und hineinbiss.
Ich selbst nahm einen Schluck von meinem Citrussaft und starrte noch einmal aus dem Fenster. Doch dieses Mal ließ ich den Schlossgarten, der mich nicht im Geringsten interessierte, außer Acht und meinen Blick zu den Tannen schweifen, die hoch in den Himmel wuchsen.
Dort hinten in der Ferne wartete das Abenteuer auf mich. Das echte Leben, das nicht aus Zwängen, Etikette und Ahnenkunde bestand. Während ich mich in einer Vision der Natur verlor, wurde die Sehnsucht in meinem Herzen beinahe unerträglich. Das letzte Mal, dass ich mich unter Tannen gewähnt hatte, war schon viel zu lange her. Ich verteufelte jede Minute, die ich in diesem Palast verbringen musste. In diesem goldenen Käfig, der zwar keine Stäbe hatte, mich aber dennoch wie eine Gefangene hielt.
Missmutig presste ich die Lippen aufeinander. Das Kleid, das ich trug, schnürte mir die Luft ab und erschwerte das Atmen. Es war wunderschön, in einem hellen Gold gefärbt und aufwendig verziert, aber das machte den Umstand nicht wett, dass ich mich kaum bewegen konnte und jeder Handgriff zur Tortur wurde.
»Freut Ihr Euch schon auf den Ball, Prinzessin Tiana?«, fragte mein Lehrer in diesem Moment.
Die Erwähnung der Festivität rief etwas in mir wach, das bis eben geschlafen hatte und sich nun an die Oberfläche kämpfte. Die Bälle meines Vaters. Sechs an der Zahl. Offiziell standen sie unter dem Motto, dem Hof Lebendigkeit und Freude zu schenken. Inoffiziell, und diesen Grund kannte jeder, waren sie dazu da, mich an den Mann zu bringen. Mit meinen siebzehn Jahren war ich in den Augen meiner Eltern alt genug, um mich zu binden und eine eigene Familie zu gründen. Offiziell wollten sie mich nicht drängen, inoffiziell verlangten sie von mir, mich binnen sechs Wochen zu entscheiden. Nicht einmal zwei Monate hatte ich Zeit, um einen Partner zu finden. Aussuchen durfte ich ihn mir selbst, aber ich musste jemanden finden.
»So ein Ball sollte etwas Besonderes sein, nicht wahr? Eine Ablenkung vom langweiligen Alltag?«
Die Art und Weise, wie Mera Kempen krampfhaft versuchte, Konversation zu treiben, machte mich wahnsinnig.
»Habt Ihr schon ein Kleid anfertigen lassen?«
Kleider. Bälle. Ehemänner. Wieso war die Welt, in die ich hineingeboren worden war, nicht meine Welt? In Bel Aniz schien jeder seinen festen Platz zu haben, der seinen Stand und seine Einstellungen markierte. Die Menschen schienen glücklich, gefestigt. Sie wussten, wo sie hingehörten, und gaben sich mit den Gegebenheiten zufrieden. Wieso fiel es mir also so schwer, zu akzeptieren, dass ich eine Prinzessin war?
»Wenn es Euch nichts ausmacht, würde ich mit dem Unterricht fortfahren, Prinzessin Tiana«, schaltete sich mein Lehrer ein.
Entschuldigend sah ich ihn an. Heute war ich zu nichts in der Lage. Hinzu kam, dass meine Gedanken nun auch noch um den ersten Ball kreisten, der schon in drei Tagen stattfinden sollte.
Ich wusste nicht, welche Männer mir vorgestellt werden würden, woher sie kamen und mit welchen Mitteln sie mir den Hof machen wollten. Vielleicht hätte ich mich im Vorfeld mit ihnen beschäftigen sollen, aber noch lagen alle Bälle vor mir. Sechs Wochen, die ich in Frieden verbringen durfte, denn erst danach musste ich meine Entscheidung fällen und mich für einen der Auserwählten entscheiden. Vielleicht würde ich es schaffen, zwischen mehreren Übeln das geringste zu wählen.
»Baroness Sofia III. ging einst eine Allianz mit einem Freiherrn ein. Aus ihrer Ehe entstammen zwei Söhne, Boleslaw und Herrick …«
II - Über Roben und Bälle
»Ich habe das Kleid an der Hüfte etwas enger geschneidert, sodass es Eure schmale Silhouette besser zur Geltung bringt. Außerdem habe ich mir die Freiheit herausgenommen und die Ärmel etwas gekürzt. Auf diese Weise liegt der Fokus auf dem Goldschmuck, dem Ring und dem Armband, das Ihr von Eurer Mutter geschenkt bekommen habt.«
Mura Rocher strich über den Reifrock, in dem es mir schwerfallen würde, eine Tür zu passieren. Kritisch beäugte ich mich in dem schmalen Spiegel, der in der Nähstube aufgebaut worden war.
Das Kleid, das ich trug, war mitternachtsblau, mit schwarzen Nuancen. Dunkle Sterne bedeckten das Oberteil, das sich wie eine zweite Haut an mich schmiegte. Am Abend des Balles würde man mir die Haare am Hinterkopf in Mondform hochstecken und sonnengoldene Schuhe anziehen.
»Niemandem sonst ist es erlaubt, dieses Blau zu tragen«, verkündete Mura Rocher und korrigierte meine Haltung, sodass das Kleid besser zur Geltung kam. »Ihr werdet die Allerschönste im ganzen Palast sein und jeder Mann wird nur Augen für Euch haben.«
Im Spiegel sah ich ihr strahlendes Gesicht und weil ich sie nicht enttäuschen wollte, lächelte ich ebenfalls. Mura Rochers Arbeit war großartig, weswegen sie auch schon seit vielen Jahren in unseren Diensten stand. Mit dem Ballkleid hatte sie sich selbst übertroffen. Ich musste mir eingestehen, dass es mir schon jetzt außergewöhnlich gut stand – und das, obwohl meine Haare noch nicht hergerichtet waren und ich keinen Schmuck trug.
»Seid Ihr schon aufgeregt?«, wollte die Schneiderin wissen.
Ich drehte mich zu ihr um und versank für einen Moment in ihren mütterlichen Augen.
War es Aufregung, die ich verspürte? Nein, denn Aufregung hatte immer etwas Gutes, etwas, dem man entgegenfieberte.
Als Kind hatte ich meine Nöte oft mit Mura Rocher geteilt, weil ich wusste, dass sie eine Lösung für all das kannte, was mich belastete. Aber ich war erwachsen geworden und verstand, dass nur ich selbst gegen meine eigenen Dämonen ankämpfen konnte. Und dennoch – manchmal tat es gut, sich mitteilen zu können. Vor allem in einem Leben, das Reichtum, Gold und Silber, aber keine eigene Meinung gestattete.
Ich blies mir eine Strähne aus der Stirn und holte tief Luft. »Ich glaube nicht, dass ich schon so weit bin«, gab ich aufrichtig zu und sah die Hofschneiderin an, deren freundliches Gesicht auch nicht verschwand, als ich ihr meine Zweifel mitgeteilt hatte.
Aufmunternd klopfte sie mir auf die Schulter und lächelte mich an. »Niemand fühlt sich je wirklich bereit. Dennoch solltet Ihr auf Eure Fähigkeiten vertrauen.«
Fähigkeiten? Traurig lachte ich auf, denn mir wollten keine einfallen.
Sechs Bälle. Sechs Wochen. Was erwartete mich danach? Ein Käfig? Ein Leben in Gefangenschaft?
Meine Eltern ließen mir die Wahl, aber entscheiden musste ich mich. Wenn nicht, würden sie das für mich übernehmen. Und auch wenn ich meinen eigenen Geschmack kaum kannte, kannte ich den meiner Eltern. Mein Vater versuchte schon seit Angedenken, mir meinen Cousin Josen schmackhaft zu machen. Er war zwei Jahre jünger als ich, einen Kopf kleiner und etwa doppelt so schwer. Schon in meiner Kindheit hatte ich ihm nichts abgewinnen können und immer das Weite gesucht, wenn er seinen Besuch ankündigte.
Der Geschmack meiner Mutter war erlesener, aber vollkommen auf optische Merkmale bezogen. Und genau darin lag das Problem. Was nützte mir ein Mann, der groß, breitschultrig war und über ein hübsches Gesicht verfügte, wenn er ein Herz aus Stein hatte oder sich nicht mit Regierungeschäften auskannte?
»In Euren Augen tobt ein Sturm«, bemerkte Mura Rocher in diesem Moment.
Ich wandte mich von meinem Spiegelbild ab und drehte mich zu ihr um.
»Wenn Euch etwas auf der Seele liegt, bin ich für Euch da. Das wisst Ihr.«
Ihre mütterliche Stimme bescherte mir einen Kloß in der Kehle und ließ mich an die vielen Male denken, in denen ich als Kind zu ihr gekommen war. Ich hatte keine Geschwister – und meine Zofe war eine garstige Frau, die es liebte, meine Haare und mich zu schikanieren. In meinen ersten Jahren war Mura Rocher meine Vertraute gewesen.
Traurig blickte ich in ihr Gesicht, das in den letzten Jahren älter geworden war und in dem sich erste Falten zeigten. So gern hätte ich ihr mein Herz ausgeschüttet und ihr wie früher mein Leid geklagt. Aber ich war eine Prinzessin. Und mittlerweile wusste ich, dass meine Pflichterfüllung über allem stand.
»Ich komme zurecht«, flüsterte ich und nickte zweimal, als müsste ich mich selbst überzeugen. Mein Lächeln misslang.
»Ihr seid stark, Tiana, das wisst Ihr, oder?« Sie griff nach meiner Hand und drückte sie fest. »Ihr werdet die richtige Entscheidung treffen.«
»Aber wie?«, brach es aus mir heraus, bevor ich mich zügeln konnte. Mura Rochers Mund verzog sich zu einem Lächeln, doch die Unsicherheit in mir wurde größer. »Ich kann nur mutmaßen, wie viele Junggesellen meine Eltern an den Hof bestellen werden. Es sind sechs Bälle, sie dauern die ganze Nacht und finden in unserem größten Saal statt. Ich werde kaum Zeit haben, alle Männer kennenzulernen oder auch nur mit ihnen zu sprechen. Wie soll ich mich da für einen entscheiden? Wie soll ich mich für den Richtigen entscheiden?« Gedankenverloren zupfte ich an den Ärmeln meines Kleides.
»Ihr müsst ja gar nicht alle kennenlernen«, meinte Mura Rocher verschmitzt. »Es reicht, wenn der Eine dabei ist.«
Der Eine.
Missmutig ließ ich die Schultern hängen. »Ich weiß ja nicht einmal, wer das sein soll.«
»Das ist einfach.« Mura Rocher legte ihre Hände auf meinen Schultern ab und wartete, bis ich sie ansah. Wenn sie lächelte, entstanden kleine Grübchen um ihren Mund. »Wie stellt Ihr Euch Euren Zukünftigen vor? Wie soll er sein? Was muss er haben?« Neugierig sah sie mich an.
Ihr zuliebe ließ ich mich auf das Spiel ein. Und während ich über die Fragen nachdachte, wurde mir bewusst, dass ich mich nie recht damit beschäftigt hatte. Zwar war mir immer klar gewesen, dass ich einmal heiraten würde, aber dieses einmal lag in so weiter Ferne, dass ich es nicht greifen oder näher bestimmen konnte.
Nachdenklich kaute ich auf meiner Unterlippe herum und versuchte, mir mich an der Seite eines Mannes vorzustellen, der mit mir über unser Reich regierte. Mich selbst sah ich gestochen scharf, aber der Mensch neben mir blieb verschwommen und unbestimmt.
»Nun ja«, stammelte ich, um Zeit zu schinden. »Wahrscheinlich wäre es von Vorteil, wenn er sich mit den Regierungsgeschäften auskennt und in Ahnenkunde besser aufgepasst hat als ich selbst. Außerdem sollte er … diplomatisch sein und Talent für Verhandlungen besitzen. Überhaupt würde es mir nichts ausmachen, wenn er …« Überrascht hielt ich inne, weil ich sah, wie die Hofschneiderin den Kopf schüttelte.
»Der Mann Eurer Träume soll also ein Ass in der Regierung sein?«, fragte sie mit hochgezogenen Augenbrauen, woraufhin ich stöhnte. »Natürlich schadet das nicht, aber wonach sucht Ihr wirklich? Wie soll der Mensch sein, der Euer Herz erweicht, Tiana?«
Mura Rochers Blick durchdrang mich wie ein Pfeil. Wenn sie mich so ansah, brachte es nichts, auszuweichen.
»Ich glaube nicht, dass ich den Mann meiner Träume in diesem Palast finden werde. Ich glaube, der Mann meiner Träume ist noch nicht einmal geboren. Was ihn perfekt macht.«
Meine letzten Worte waren mehr genuschelt als klar gesprochen, dennoch hatte Madame Rocher mich verstanden.
Ich warf einen kurzen Blick zur Tür, um mich zu vergewissern, dass wir allein waren, dann meinte ich: »Ich will mich nicht binden. Nicht jetzt. Irgendwann einmal vielleicht, aber ich fühle mich noch nicht bereit. Ich will … noch so vieles entdecken, so viel sehen. Ein Mann an meiner Seite würde mich nur einengen und mich in eine Rolle pressen, die ich nicht erfüllen will.« Japsend holte ich Luft.
Mura Rochers Stirn lag in Falten. »Nicht alle Männer sind schlecht, Tiana«, meinte sie. »Vor allem in den letzten Jahren kommt immer wieder der Fortschrittsgedanke auf. Frauen werden nicht länger als unterlegen angesehen. Ein guter Mann weiß seine Gattin zu schätzen.«
»Das weiß ich doch.« Ich nickte. »Und ich bin mir sicher, dass meine Eltern auch einige geeignete Männer für mich gefunden haben. Und doch … will ich noch nicht heiraten.«
Mura Rocher sah mich mitleidig an. Mit ihrem rechten Daumen strich sie mir über die Wange. »Vielleicht glaubt Ihr mir nicht, aber Ihr seid erwachsen geworden. Ihr seid nicht mehr das ungestüme Kind«, bemerkte sie.
»Das mag sein. Aber in mir … ist der Drang, mehr zu sein. Mehr zu sehen, mehr zu spüren, mehr zu fühlen. Da draußen wartet eine ganze Welt auf mich und ich habe keine Möglichkeit, sie zu entdecken.«
»Ihr werdet noch viel von dieser Welt sehen, Tiana«, meinte Mura Rocher weise. »Gutes wie auch Schlechtes. Es gibt für alles eine Zeit, fürs Reisen wie fürs Heiraten.«
»Aber wieso muss die Zeit fürs Heiraten unbedingt jetzt sein? Sechs Wochen vergehen so schnell! Danach muss ich mich entschieden haben.« Hilfe suchend sah ich sie an. »Kannst du mir einen Tipp geben? Irgendetwas, damit ich nicht vollständig versage?«
Mura Rocher sah mich nachdenklich an. Es lag so viel Schwere in ihrem Blick, die mich manchmal selbst niederdrückte. Wahrscheinlich dachte sie an ihren Ehemann Hekin zurück, der in einer Schlacht vor vielen Jahren gefallen war und an den ich mich kaum erinnern konnte. »Schaut ihnen in die Augen, wenn sie mit Euch sprechen. Viel Verborgenes liegt im Blick eines Menschen.«
»Aber wie finde ich heraus, ob er etwas Gutes oder Schlechtes verbirgt?«
»Ihr werdet es merken, das verspreche ich Euch.« Sie drückte meine Hand noch etwas fester.
Mir kam es vor, als würde mein Leben nur noch aus einzelnen Szenen bestehen, die aneinandergereiht die sechs Wochen ergaben, vor denen ich mich so fürchtete. Doch meine größte Angst galt dem Ende, denn genauso fühlte es sich an. Wie ein Schlussstrich, der unter mein Leben gezogen wurde.
»Wenn der Richtige vor Euch steht, werdet Ihr es wissen«, sagte Mura Rocher. Etwas Sehnsüchtiges trat in ihre Augen und für einen Moment wirkte ihr Blick abwesend. »Ihr werdet es merken, wenn Ihr Euch gut mit ihm unterhalten könnt und er Dinge sagt, über die Ihr vorher noch nicht nachgedacht habt. Wenn Ihr durch ihn weiter denkt als sonst. Der richtige Mann weiß, dass Ihr Flügel habt, und lässt Euch fliegen. Weil er sich sicher ist, dass Ihr zurückkommen werdet.«
Tränen traten in meine Augen, auch wenn ich mir vorgenommen hatte, nicht zu weinen. Zumindest jetzt noch nicht. »Manchmal komme ich mir so schwach vor. Beinahe wie eine Marionette, die von oben gesteuert wird.«
»Wir sind alle Marionetten«, stimmte Mura Rocher mir traurig zu. »Die Kunst besteht darin, den Spieler zu überzeugen, die Schnüre so auszurichten, wie man sie haben möchte.«
III - Über Fantasien und Sehnsüchte
Mein Tagesablauf bei Hof war strikt geregelt. Nach meiner Morgentoilette und einem leichten Frühstück fing mein Unterricht an, der sich bis zum Mittagessen zog. Die Nachmittage variierten. Mal durfte ich reiten, mal bekam ich Lehrstunden im Fechten, mal sollte ich mich in der Bibliothek über die Geschichte unseres Landes informieren. Punkt vierzehn Uhr gab es Kaffee und Kuchen, der je nach Wetterlage mal drinnen und mal draußen serviert wurde. Danach ging meine Gesellschafterin mit mir spazieren, was mit langweiligen Runden im Schlossgarten gleichzusetzen war. In den letzten Wochen hatte ich zudem vermehrt Tanzunterricht, um auf den Bällen eine gute Figur abzugeben.
Beim Abendessen traf ich auf meine Eltern, die mich über meine ewig gleichen Tage ausfragten und ihre Vorfreude bezüglich der anstehenden Festivitäten äußerten. Nach der letzten Mahlzeit stand mir eine Stunde in der Bibliothek zu, die ich entweder mit Lesen, Sticken oder Gesellschaftsspielen verbrachte.
Vor zwanzig Minuten hatte sich die Tür zu meinen Gemächern geschlossen, was bedeutete, dass ich zum ersten Mal an diesem Tag allein war. Meine Haare, die eben gewaschen worden waren, steckten unter einer grässlichen beigefarbenen Haube, die mich zehn Jahre älter machte, und mein Körper verschwand in einem der viel zu weit geschnittenen Nachtkleider, die mich schwitzen ließen, weil sie auch im Sommer lange Ärmel besaßen und den Boden berührten.
Nachdenklich saß ich auf meinem Bett, umgeben von mehr Kissen und Decken, als je ein Mensch brauchen würde, und drückte mir meine Nase an der Fensterscheibe platt. Früher hatte mich die Aussicht gestört, weil ich nichts vom Schlossgarten und den mühsam angelegten Blumenbeeten gesehen hatte, sondern nur die Schemen des Waldes erahnen konnte. Heute war ich dankbar für genau jenen Anblick, da er mir jede Nacht Kraft für den nächsten Tag gab.
Der Palast – mein goldener Käfig – war nicht alles. Da draußen gab es eine Welt. Eine große, gefährliche, aber sicherlich wunderschöne Welt, der ich mich so nah fühlte, obwohl ich sie nie gesehen hatte. Die Sehnsucht in mir wuchs mit jeder Woche, in der ich nur akkurat zurechtgestutzte Grünflächen und in Form gebrachte Büsche sah.
Auf leisen Sohlen lief ich durch mein Zimmer bis zum Kleiderschrank, der einen doppelten Boden hatte und seit vielen Jahren als mein Geheimversteckt fungierte. Eine Weile nestelte ich an der Holzplatte herum, die sich schon verkeilt hatte, und zog schließlich ein Buch hervor. Wie einen Schatz presste ich es an meine Brust und lief zurück zum Bett, wo ich mich unter der größten Decke vergrub.
In meiner Kindheit waren mir Dutzende Bücher vorgelesen worden. Geschichten über gelangweilte Prinzessinnen, mutige Seefahrer oder kühne Helden. Aber es gab nur ein einziges Buch, das es in mein Herz geschafft hatte.
Atemlos holte ich das abgegriffene Exemplar, das mal in Leder eingeschlagen gewesen war, unter der Decke hervor und strich über seinen schwarzen Einband. Die Geschichte Überleben und Kämpfen in Palermo war nicht lang oder kompliziert geschrieben. Sie bestach nicht durch komplexe Sätze oder ausfällige Stilmittel. Dennoch bedeutete sie mir die Welt, denn sie war eine komplette Welt für mich.
Ich schlug das Buch auf, übersprang das Vorwort, das in Latein geschrieben war, und begann direkt beim ersten Kapitel. Und während ich las, musste ich lächeln, denn eigentlich war es nicht nötig, meine Augen auf das Papier zu heften. Daher schloss ich sie, weil die Geschichte auch so lebendig wurde.
Überleben und Kämpfen in Palermo war die Erzählung eines räuberischen Volkes, das in den Wäldern von Palermo von dem lebte, was die Natur anbot. Es ging um Mandeo, einen kühnen Ganoven, der die Reichen überfiel, um sein Volk zu ernähren. Es war eine düstere und raue Geschichte in einer ebenso kalten Welt, aber ich liebte sie mit jeder Faser meines Herzens. Meine Faszination für den Wald begann zu wachsen, als meine Mutter mir zum ersten Mal die Geschichte vorgelesen hatte. Wie das Leben dort draußen wohl war? Ob es tatsächlich Völker gab, die vollständig von der Natur lebten und einen Teil von ihr darstellten?
Es reichte mir nicht mehr, die Freiheit lediglich von meinem Fenster aus zu sehen. Ich wollte sie fühlen, wollte dort draußen sein und die Sonne auf meiner viel zu blassen Haut spüren.
Wie schön es wäre, jemand anders sein zu können – einfach so.
Manchmal, wenn ich mit der Kutsche unterwegs war und wir ein kleines Dorf passierten, eilten die Bewohner aufgeregt zu uns, um mich zu bestaunen. Die Prinzessin und künftige Königin des Palastes sah man schließlich nicht alle Tage. Jedes Mal, wenn ich unter Menschen war, reagierten sie ähnlich. Sie verneigten sich vor mir, zollten mir ihren Respekt und erwiesen mir all die Ehre, die mir laut meinem Stand gebührte. Doch es gab noch eine zweite Seite. Eine, die mir nicht öffentlich gezeigt wurde und die ich nur mitbekam, wenn ich darauf achtete. Wenn die Menschen mich außer Reichweite wussten und meine Präsenz nicht mehr spürten, wurde getuschelt. Natürlich hinter vorgehaltener Hand und bei gedämpfter Lautstärke, aber ich hörte sie trotzdem. Die stillen Vorwürfe, die zahlreichen Vorurteile.
Schau sie dir an! Sie hat doch keine Ahnung, wie es uns geht. Wenn ich doch ein Leben wie sie hätte!
Aber was war das genau – ein Leben wie meines?
Auf den ersten Blick funkelte alles. Man sah den Reichtum, den monumentalen Palast, die teuren Feste und die Privilegien, die mit einem solchen Stand kamen. Man dachte an Teegesellschaften, lange Ausritte und aufwendig zubereitete Mahlzeiten.
Was man nicht sah, war die Einsamkeit.
Manchmal fühlte ich mich wie der einsamste Mensch auf der ganzen Welt. Jedem, der nicht in meiner Haut steckte, erschien diese Vorstellung grotesk. Aber ich wusste, wie eng es sich dort manchmal anfühlte und dass ich ausbrechen wollte, doch gefangen gehalten wurde.
Enttäuscht klappte ich das Buch zu. Mir war nicht mehr nach Lesen zumute. Das Bedürfnis, mich unter der Decke zu verkriechen und die Welt auszusperren, wurde allgegenwärtig, sodass ich nicht mehr dagegen ankämpfen konnte. Ich löschte die Kerze, die neben mir stand, legte das Buch auf dem Nachttisch ab und schloss die Augen.
»Tia«, ruft eine warme Stimme und eine unsichtbare Hand streicht über meinen Kopf. »Tia, du darfst nicht aufgeben. Du darfst dich nicht mit dem zufriedengeben, was du besitzt. Reichtum ist trügerisch, vergiss das nie.«
Verwundert hebe ich den Kopf und sehe mich um, doch ich bin allein auf einer weiten Wiese, die vom Sonnenlicht beschienen wird.
»Hallo? Ist da jemand?«, rufe ich und blicke in alle Richtungen. Nichts geschieht.
»Die Zeit ist beinahe gekommen. Halte noch ein bisschen durch. Und habe keine Angst, wenn es so weit ist. Das Richtige wird geschehen.«
Ein Windhauch streift meine Wange, zart und vorsichtig. Obwohl ich nicht weiß, was um mich herum geschieht und wem diese fremde Stimme gehört, lächele ich.
IV - Über Männer und Bettgeschichten
Die Lehrerin, die an den Hof bestellt worden war, um mich über meine künftigen Pflichten als Ehefrau zu unterrichten, war etwa einen Kopf größer als ich und trug eine stechende Parfümnote mit sich, die Schwindel in mir hervorrief. Sie war jünger als meine Mutter, wirkte aber durch die Krähenfüße um ihre Augen ein Jahrzehnt älter. Wenn ihr etwas missfiel, runzelte sie die Stirn so sehr, dass sie mich an zerknülltes Pergamentpapier erinnerte. Wenn sie wütend wurde, schürzte sie abfällig die Lippen. Wenn sie lachte … nun, das tat sie nicht.
Mera Faucon hatte ihre grauen Haare zu einem strengen Dutt frisiert. In ihrer Hand hielt sie einen Stock, mit dem sie auf ein Bild an der Tafel deutete. »In sechs Wochen werdet Ihr Euch für einen der Junggesellen entschieden haben, Prinzessin Tiana«, fing sie an.
Ihre Stimme erinnerte mich an Schmirgelpapier, kratzend und wenig einladend.
»Die Hochzeit wird zwei Monate später gefeiert werden. Die Ehe ist etwas Aufregendes und etwas Neues. Es ist normal, am Anfang Fehler zu machen, aber ich bin dafür da, um sie möglichst gering zu halten.« Mera Faucon schürzte die Lippen. »Doch vor der Ehe kommt die erste Nacht. Und mit dieser werden wir heute beginnen.«
Ich legte den Kopf schief und stützte mich mit einer Hand auf der Tischplatte ab. Nun hatte ich eine Idee, was die groteske Zeichnung auf der Tafel darstellen sollte. Ich wusste nicht, ob mir eher nach Weinen oder nach Lachen zumute war.
»Wann hattet Ihr Eure erste Blutung, Prinzessin Tiana?«, fragte Mera Faucon geradeheraus, als würde sie mich nach meinen modischen Vorlieben fragen.
»Vor vier Jahren«, sagte ich peinlich berührt, in der Hoffnung, dass sie das Thema fallen lassen würde. Tat sie natürlich nicht. Stattdessen schrieb sie eine gigantische Dreizehn an die Tafel, die mich fortan auslachte.
»Ihr könnt Euch glücklich schätzen, Prinzessin. Eure Eltern haben sich viel Zeit gelassen und Euch nicht unter Druck gesetzt. Es ist nicht unüblich, schon mit fünfzehn Jahren nach einem Ehemann zu suchen.«
Ich schluckte schwer.
»Wie auch immer«, meinte sie und stützte sich auf ihrem Zeigestock ab. »Ihr seid bereits vor vier Jahren zur Frau geworden. Eure Jungfräulichkeit nehmt Ihr als Geschenk an Euren künftigen Gatten mit in die Ehe.«
Je mehr sie sagte, desto unwohler wurde mir. Nervös rutschte ich auf dem Tisch hin und her. Meine Wangen waren sicherlich schon hochrot.
Mera Faucon machte sich jedoch nichts aus meinem Unbehagen und fuhr unbeirrt fort: »Jedes Mädchen, das Klasse und einen Namen hat, geht unberührt in die Ehe. Euer Zukünftiger wird auf diesem Gebiet unter Umständen schon Erfahrung haben, aber das soll uns jetzt nicht weiter beschäftigen. Interessanter ist …« Sie nahm den Zeigestock hoch und deutete auf die ungelenke Zeichnung, die, wie ich mir nun sicher war, ein weibliches Geschlechtsorgan darstellen sollte. »Wir werden heute über den Prozess sprechen. Wie viel wisst Ihr über das, was in der Hochzeitsnacht geschieht?«
Auffordernd sah sie mich an, aber ich konnte ihren Blick unmöglich erwidern. Hilfe suchend wandte ich meinen Kopf zur Tür.
»Wenn ich das richtig verstehe, seid Ihr noch nicht aufgeklärt, Prinzessin«, bemerkte die Lehrerin. »Das ist ungewöhnlich, aber nicht schlimm. Uns bleiben gut und gern vierzehn Wochen, in denen wir einiges aufholen können. Nun gut. Prinzessin Tiana?«
Gedankenverloren wandte ich meinen Blick von der Tür ab und sah Mera Faucon an, die nur ein gelangweiltes Schnauben für mich übrighatte.
»Könntet Ihr mir bitte Eure Aufmerksamkeit schenken?«
Schnell nickte ich.
Ich sah, wie sie nach einem Stück Kreide griff und erneut etwas an die Tafel malte, das auf den ersten Blick an einen Schlauch erinnerte. »Dies hier«, Mera Faucon deutete auf die Malerei, »ist ein männliches Glied.«
Ich zuckte zusammen.
»Es mag Euch komisch vorkommen, aber in der Hochzeitsnacht wird es seinen Zweck erfüllen. Allerdings geschieht dies nicht von selbst, denn auch die Frau muss …«
»Aufhören!«, rief ich, weil ich es nicht ertragen konnte.
Verwundert blickte Mera Faucon mich an, hielt aber in ihren Erläuterungen inne.
»Ich … weiß Bescheid. Man … hat es mir erzählt, damals, als ich zur Frau geworden bin.«
Allzu deutlich erinnerte ich mich an meine Zofe, die mir von den Schrecken des Ehebetts erzählt hatte.
Mera Faucon tat unbeeindruckt. »Wie viel wisst Ihr wirklich?«, erkundigte sie sich. »Mir sind schon oft Mädchen untergekommen, die glaubten, sich auf diesem Gebiet auszukennen, aber denen beim Anblick eines männlichen Glieds die Röte ins Gesicht geschossen ist.«
Ich schluckte und versuchte, nicht weiter auf die Tafel zu schauen. »Ich weiß genug, danke«, redete ich mich heraus.
Mera Faucon klopfte sich den Kreidestaub von den Händen und setzte sich an das Lehrerpult. »Berichtet!«, forderte sie mich auf, woraufhin ich ihr lediglich einen fragenden Blick zuwarf. Sie seufzte und sah mich an, als wäre ich nicht nur schwerhörig, sondern auch nicht besonders klug. »Entweder Ihr oder ich«, fügte sie nach einer Weile hinzu, in der ich geschwiegen hatte.
Mein Herz klopfte, als ich sie ansah. Fieberhaft versuchte ich, mich an die Worte meiner Zofe zu erinnern, sodass ich mir Mera Faucons prekäres Wissen nicht aneignen musste. Unser Palast galt als progressiv, dennoch war ich es nicht gewohnt, über ein solch intimes Thema offen zu sprechen. Nervös spielte ich mit meiner Schreibfeder.
»Die Hochzeitsnacht vollendet den Bund der Ehe«, sagte ich mit leiser Stimme. »Wenn ein Mann und eine Frau sich das Zugeständnis gegeben haben, ewig beieinander zu bleiben, und ein Geistlicher sie gesegnet hat, müssen sie die Ehe vollziehen, damit sie rechtsgültig wird. Dies … findet meistens in der Nacht statt, wenn die Gäste bereits auf dem Heimweg sind.«
Hilfe suchend sah ich Mera Faucon an, die alles andere als begeistert aussah. Unruhig trommelte sie mit ihren viel zu langen Fingernägeln auf das Pult und hatte den Mund verzogen. »Das soll alles sein?«, fragte sie. »Damit habt Ihr mir die Einleitung gegeben. Was aber passiert im Hauptteil?«
Auffordernd schaute sie mich an, aber ich erwiderte ihren Blick nicht. Ich wollte nicht darüber nachdenken, was in meiner Hochzeitsnacht vonstattengehen würde, dadurch wurde das Ganze viel zu real. Ich wartete also ab, bis die Lehrerin ihre Frage selbst beantwortete, und schaute gedankenverloren aus dem Fenster. Indem ich mich auf das konzentrierte, was draußen geschah, konnte ich Mera Faucons nervige Stimme ausblenden.
So früh am Morgen war in den Gärten noch nicht viel los, dennoch entdeckte ich eine dunkelhaarige Frau, die meine Aufmerksamkeit erregte. Sie trug ein sommerliches gelbes Kleid und lief unbeschwert über die Rasenflächen. Nachdenklich legte ich den Kopf schief. Es war ungewöhnlich, dass ich die Frau nicht kannte. Seltsamer war aber, dass ich auf einmal eine tiefe Sehnsucht verspürte. Eine Sehnsucht, die größer wurde, als die Braunhaarige den Kopf hob und mich unverwandt ansah.
Verwirrt blinzelte ich – und sah nur noch den leeren Schlossgarten.
Spielten mir meine Gedanken einen Streich? War ich noch nicht ganz wach und sah Geister?
»Um den Akt zu vollenden, dringt der Mann in regelmäßigen Abständen in die Frau ein, und zwar so lange, bis er so erregt ist, dass er nicht mehr an sich halten kann und sich erleichtert.«
Es war die Stimme meiner Lehrerin, die mich in die Realität zurückbrachte. Eine Realität, die von intimem Vokabular besetzt war. Angeekelt verzog ich das Gesicht.
Als sie zu Ende gesprochen hatte, sah ich sie zum ersten Mal lächeln. Doch es war nicht einladend und warm, sondern jagte mir einen Schauer über den Rücken und ließ mich frösteln.
»Die ersten Male mag es Euch komisch erscheinen, aber irgendwann freut Ihr Euch, wenn Euer Mann das Bett mit Euch teilen möchte.«
Fassungslos schüttelte ich den Kopf und sah Mera Faucons spitzbübisches Grinsen aus den Augenwinkeln.
»Wenn es so weit ist, wird alles gut gehen«, verkündete sie und falls sie mir damit Mut machen wollte, misslang es.
»Habt Ihr noch Fragen, Prinzessin?«, wollte sie wissen und faltete die Hände auf der Tischplatte.
Schnell schüttelte ich den Kopf. Zwar war ich noch lange keine Meisterin, was den Umgang mit dem anderen Geschlecht betraf, aber gerade bestand mein sehnlichster Wunsch darin, diesem Raum zu entkommen, an die frische Luft zu gehen und durchzuatmen.
»Keine weiteren Fragen«, presste ich hervor, was mir einen weiteren amüsierten Blick der Lehrerin einhandelte. Ihre fehlende Ernsthaftigkeit machte mich schier wahnsinnig.
»Nun gut, Prinzessin Tiana. Ich danke Euch für diese erste Stunde. Möchtet Ihr erfahren, womit wir uns in den kommenden Einheiten beschäftigen?«
»Ich lasse mich lieber überraschen«, keuchte ich und konnte den Raum nicht schnell genug verlassen. In diesem Moment war es mir gleichgültig, dass mein Verhalten mit dem einer Lady wenig gemein hatte.
V - Über temporäre Freiheit in einemgoldenen Käfig
Mein Stundenplan sah vor, dass ich mich an drei Tagen in der Woche sportlich betätigte. Dabei wurde gewöhnlich zwischen Reiten, Fechten und Tanzunterricht gewechselt. Für den heutigen Tag stand Letzteres an, aber mein Kopf schwirrte von allem, was mit dem Ball und meinem künftigen Ehemann zusammenhing, sodass ich mich unmöglich noch mehr mit dem Thema befassen wollte. Meine Tage in Freiheit waren ohnehin gezählt, da wollte ich mich nicht schon im Vorhinein in den Wahnsinn treiben.
Ich stand vor der doppelflügeligen Eichentür, die in unseren Ballsaal führte, in dem auch der Tanzunterricht stattfinden sollte. Mein Lehrer, ein schlankes Exemplar mit schulterlangen Haaren, die er sich im Nacken zu einem Zopf zusammengefasst hatte, hielt sich meistens schon eine Stunde vorher im Saal auf, um an einer neuen Schrittfolge zu üben oder die Musik abzustimmen.
Ich atmete tief durch und stieß die Tür entschieden auf. Meine Vorahnung täuschte mich nicht, denn Nuven Cleu zuckte zusammen, als ich in den Raum gestürmt kam.
»Der … Unterricht muss abgesagt werden«, keuchte ich und hoffte gleichzeitig, dass meine brüchige Stimme mich nicht verraten würde.
Nuven Cleu, dessen schlanker Körper heute in einer hautengen Hose steckte, die mehr offenbarte, als ich sehen wollte, runzelte die Stirn. »Ich habe eben noch mit Eurem Vater gesprochen, Prinzessin Tiana«, meinte er perplex. »Er hat mir zugesichert, dass die Stunde wie geplant stattfinden kann.«
»Äh …« Ich massierte mir die Stirn und dachte über eine Ausrede nach. »Die Dinge haben sich kurzfristig geändert. Meine … Mutter hat angeordnet, dass ich heute eine zweite Stunde bei Mera Faucon in Anspruch nehmen soll. Meine Tanzkünste sind besser als mein … Umgang mit dem anderen Geschlecht.«
Das Gute an Nuven Cleu war, dass er mein Wort nicht infrage stellte, sondern nickte und mir seine Enttäuschung versicherte. Wie immer hatte er sich sehr auf die Stunde gefreut.
Ich jedoch war froh, einmal nicht von ihm herumgewirbelt zu werden. Mir gefiel die Art und Weise nicht, wie sich seine Finger um meinen Körper schlangen und wie er meine Hand hielt, wenn wir die neuen Schritte einstudierten.
Eine Weile ruhten seine braunen Augen noch auf mir, dann drehte ich mich um und hechtete den Gang entlang.
Es war noch früh am Morgen und ich hatte ganz offiziell eine Stunde lang nichts zu tun. Nun musste ich es nur geschickt anstellen und durfte mich nicht erwischen lassen.
Meine Eltern würde ich nicht treffen, sie waren sicher in Regierungsgeschäfte verstrickt, die mich als künftige Königin hätten interessieren sollen, es aber nicht taten. Die Schwierigkeit bestand vielmehr darin, meiner Zofe und den vielen Gesellschafterinnen zu entkommen, die zu meiner Unterhaltung eingestellt worden waren. Irgendjemanden von ihnen traf man immer auf den Gängen, was vor allem daran lag, dass sie wenige Pflichten zu erfüllen hatten und sich einen Großteil des Tages langweilten.
In meinem Zimmer ließ ich die Tür hinter mir ins Schloss fallen und drehte den Schlüssel zweimal um. Es hatte Jahre gedauert, bis ich meine Eltern davon überzeugen konnte, mir diese kleine Freiheit einzugestehen.
So schnell es ging, schlüpfte ich aus der dunkelgrünen Robe, die mir meine Zofe heute Morgen angezogen hatte. Bisher hatte ich es noch nicht öffentlich geäußert, aber ich hasste diese Kleider. Vor allem, wenn ich sie an Tagen tragen musste, an denen nichts Besonderes geplant war und die Korsage mir so sehr die Luft abschnürte, dass ich kaum atmen konnte.
Endlich hatte ich es geschafft, die Bänder am Rücken zu lösen. Flink schlüpfte ich aus dem wuchtigen Unterrock und stand alsbald nur in Unterwäsche da. Ich musste meinen Kleiderschrank eine Weile durchforsten, um meine Reitkleidung zu finden, da die Ballkleider einen nicht unerheblichen Teil der Garderobe einnahmen.
Als ich die grüne Hose, das braune Oberteil und die groben Schuhe gefunden hatte, presste ich sie glücklich gegen mein Herz. In Windeseile zog ich mich um und griff anschließend nach meinem hellgrauen Cape, das eine riesige Kapuze hatte, unter der ich für eine Weile verschwinden und meine wahre Identität verschleiern konnte. Natürlich musste ich trotz allem vorsichtig sein, denn die Gänge waren voll neugieriger Augen.
In einem günstigen Moment stahl ich mich aus meinem Zimmer, rannte durch den Korridor, nahm die Wendeltreppe nach unten und schlich durch den Dienstboteneingang, um nicht gesehen zu werden. Im Schlossgarten zog ich die Kapuze besonders tief in mein Gesicht und wurde noch einmal schneller. Bis zu den Stallungen waren es nur wenige Meter, doch erst als ich sie erreicht hatte, wagte ich es, durchzuatmen.
Erleichtert zog ich die Tür hinter mir zu und ging zu der Box, in der mein Hengst Gallus auf mich wartete. Der Friese schaute mich aus seinen dunklen Augen vertrauensvoll an.
»Na, mein Hübscher«, flüsterte ich und legte meine rechte Hand auf seine Nüstern. Gallus’ Gesellschaft hatte mich schon immer beruhigt, dabei war ich keine große Pferdefreundin. Ich mochte eher das, wofür sie standen: lange Ausritte, ungebändigte Natur, Freiheit. Glücklich strich ich ihm über die dicht gewachsene Mähne und atmete seinen Geruch ein.
»Wollt Ihr ausreiten, Prinzessin Tiana?«, erklang eine kehlige Stimme hinter mir.
Ein bisschen enttäuscht war ich schon, dass Kendo, unser Stallbursche, mich von hinten in meinem Cape erkannt hatte, aber seine Augen lächelten, weswegen ich ihm nicht böse sein konnte.
Ich nickte, woraufhin er in dem kleinen Raum verschwand, in dem das Reitzubehör aufbewahrt wurde. Kurze Zeit später kam er mit meinem edlen schwarzen Sattel zurück, auf dessen Blatt meine Initialen standen. Er holte Gallus aus der Box und machte ihn für den Ausritt fertig.
»Wer soll Euch begleiten, Prinzessin?«, erkundigte Kendo sich und sah mich aufmerksam an.
Für meine Reitstunden standen mir für gewöhnlich drei erfahrene Männer zur Verfügung. Ersterer war mein Reitlehrer und von sich und seinem Talent mehr als überzeugt. Er hatte eine überhebliche Art an sich, die ihn mir in mehr als einer Hinsicht unsympathisch machte. Nummer zwei war eine meiner Gesellschafterinnen, Gilia, die ich zwar ab und an gern um mich hatte, aber heute nicht ertragen konnte. Die Letzte im Bunde hörte auf den Namen Pouline und war eine gehässige und geschwätzige Frau, deren Gesellschaft ich nur suchte, wenn die anderen beiden Begleitungen unauffindbar waren.
Für heute erschien mir keiner der drei passend. Ich wollte mit Gallus über die Felder preschen, frische Luft einatmen und für einen Moment meine Sorgen vergessen.
Kurz hielt ich inne, dann drehte ich mich zu Kendo um. »Ich möchte, dass du mitkommst«, verkündete ich und war über seinen verblüfften Gesichtsausdruck nicht wirklich überrascht.
Zwar bewegten sich meine drei Reitbegleitungen auch nicht in meinen Kreisen, aber Kendo stand so weit unter mir, dass ich eigentlich gar nicht mehr als nötig mit ihm sprechen sollte. Doch das hatte ich ohnehin nicht vor. In dieser Stunde wollte ich nur mich und meine Gedanken haben und niemanden, der sie unterbrach. Da kam mir der schweigsame Stallbursche gerade recht. Ich mochte Kendos besonnene Art und sein friedliches Gemüt.
Der grauhaarige Mann musterte mich noch immer, räusperte sich schließlich und meinte: »Ich weiß nicht, ob Euer Vater …«
»Oh, der hat es sogar angeordnet«, meinte ich und schauderte darüber, wie leicht mir die Lüge über die Lippen kam. »Ich möchte auch bloß eine Stunde unterwegs sein und gar nicht weit weg.«
Kendo kratzte sich am Kinn, nickte aber. Ohne weitere Worte half er mir, auf Gallus aufzusitzen, und sattelte schließlich eines unserer Gastpferde, ein groß gewachsenes braunes Exemplar, dessen Mähne kurz geschnitten war.
Als ich auf Gallus saß, ging es mir schon um ein Vielfaches besser. Kendo suchte meinen Blick und ließ sich von mir erneut die Bestätigung geben, dass ein Ausritt mit ihm in Ordnung war. Dann führte er seinen Hengst durch das Tor der Stallungen und wartete darauf, dass ich ihm folgte.
Ich gab Gallus die Sporen, woraufhin er lostrabte. Als ich ihn vor drei Jahren bekommen hatte, war er wild gewesen, doch mittlerweile wusste ich sein Temperament zu zügeln.
In gemächlichem Tempo trabten wir über einen breiten Weg, der auch von Kutschen benutzt wurde, und stahlen uns schließlich in den Wald. Der Anblick der Bäume ließ mein Herz höherschlagen. Mit jedem Schritt fühlte ich mich besser und merkte, dass die Sorge in mir auf ein Minimum zusammenschrumpfte.
Es war ein schöner, sonniger Tag. Am Himmel stand keine einzige Wolke. Kendo vor mir wurde schneller und auch ich trieb Gallus zum Galopp an. Schon viele Male war ich durch den Wald geritten, aber immer erschien er mir neu und aufregend. Gierig atmete ich den Geruch der Tannen ein und genoss den Moment, in dem mir die Kapuze vom Kopf fiel.
Ab und an warf der Stallbursche einen Blick zurück, wahrscheinlich um sich davon zu überzeugen, dass es mich noch gab, aber ansonsten schwieg er. Wenn ich seine breite Silhouette vor mir ausklammerte, war es beinahe so, als wäre ich allein unterwegs. Das hatte ich mir insgeheim immer gewünscht, aber es war mir strikt verboten, mich ohne Begleitung in den Wald zu begeben.
Dabei gab es in diesem Teil nichts, was man fürchten musste. Die Wege waren eben, perfekt zum Reiten, und ins Dickicht wagten wir uns nicht. Und dennoch merkte ich, wie ich meinen Kopf immer wieder in Richtung des dunklen Teils des Waldes drehte. Dorthin, wo das Licht nicht durch die Bäume drang und es keine offiziellen Wege, sondern nur Trampelpfade gab.
Kendo und ich ritten eine Weile gemächlich durch den Wald, in der ich Zeit hatte, meine Gedanken zu ordnen. Die Natur löste keine Probleme, aber sie ließ sie kleiner erschienen. Unbedeutender.
»Prinzessin?«
Kendos Stimme brachte mich in das Hier und Jetzt zurück. Ich blinzelte und sah den Stallburschen an, auf dessen Gesicht etwas Gehetztes lag.
»Wir müssen umkehren«, sagte er mit gepresster Stimme und machte schon Anstalten, seinen Hengst zu wenden.
»Wieso?« Ich wurde aufmerksam und reckte den Kopf, konnte aber aufgrund der Enge des Weges nicht an ihm vorbeischauen.
»Ich erkläre es Euch später. Beeilt Euch!«
Unruhe flackerte in Kendos Augen, die meine Neugierde nur noch mehr schürte. Als der Stallbursche sein Pferd erfolgreich gedreht hatte und mich noch einmal zur Eile antrieb, erhaschte ich einen Blick auf das, was er mir nicht zeigen wollte. Das Blut in meinen Adern begann zu kochen.
VI - Über Ganoven und verbotene Völker
Am Ende des Weges standen zwei Männer nebeneinander, die Messer erhoben, und bedrohten einen dritten, der bereits auf dem Boden lag. Ich sah, dass er fein gekleidet war und einen Mantel aus dunkelblauem Brokat trug – die Farbe, die nur Edelmännern vorbehalten war.
»Prinzessin Tiana!«, zischte Kendo und wurde merklich ungehaltener. »Wir dürfen uns hier nicht aufhalten!«
Doch ich schaffte es nicht, meinen Blick von der Szenerie zu lösen. Ich hörte, wie der Mann auf dem Boden um Gnade winselte, beide Hände in die Luft gestreckt. Seine Angreifer blickten finster drein und erhoben ihre Messer. Offensichtlich waren sie dabei, ihn zu überfallen. Ob er Reichtümer bei sich trug, die …
Platsch.
Ein spitzer Schrei entwich meinen Lippen, als ich sah, wie einer der Angreifer sein Messer in die Kehle des Edelmannes stach. Sein Gurgeln, das verzweifelte Ringen nach Atem, drang mir durch Mark und Bein. Das Nächste, was ich sah, waren Unmengen von Blut – und stechende Augen, die mich wütend anfunkelten.
»LOS JETZT!«, schrie Kendo und endlich erkannte ich die Gefahr, in der ich mich befand.