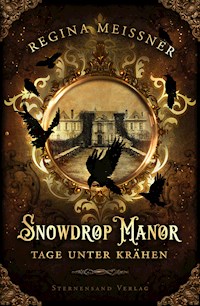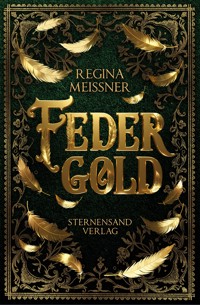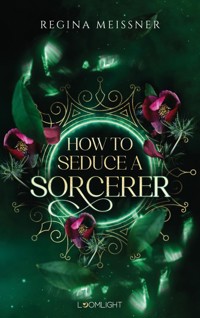
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Planet! in der Thienemann-Esslinger Verlag GmbH
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Magisch, düster und bittersüß Um ihre Familie zu beschützen, willigt die junge Liora ein, die Ehefrau eines Zauberers zu werden. Als sie auf seine Burg gebracht wird, ist dort nichts, wie es scheint. Das Domizil ist von Fabelwesen bevölkert. Ihren Bräutigam sieht sie erst am Tag ihrer Hochzeit, als sie in einem dunklen Ritual vermählt werden. Doch Jaro, der Zauberer, ist ganz anders, als sie dachte. Als Hüter wacht er über die Fabelwesen. Während Jaro sie meidet, plagen Liora Visionen von Geistern. In dem Versuch, sie zu ergründen, kommt Liora Jaro immer näher. Aber er verbirgt etwas und ihre Liebe steht unter keinem guten Stern … High Fantasy mit Gothic-Vibes. Perfekt für Fans von »Belladonna« und »Phantastische Tierwesen«. //»How to Seduce a Sorcerer« ist ein in sich abgeschlossener Einzelband.//
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 508
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Das Buch
»Aber nur die, die wahrhaftig leiden, haben wahrhaftig geliebt.«
Um ihre Familie zu beschützen, willigt die junge Liora ein, die Ehefrau eines Zauberers zu werden. Auf seiner Burg, ihrem neuen Zuhause, ist nichts, wie es scheint. Ihren Bräutigam sieht sie erst am Tag ihrer Hochzeit, wo sie in einem dunklen Ritual vermählt werden. Doch Jaro, der Zauberer, ist ganz anders, als sie dachte. Als Hüter wacht er über die Fabelwesen, die die Burg bevölkern. Während Jaro sie meidet, plagen Liora Visionen von Geistern. In dem Versuch, sie zu ergründen, kommt Liora Jaro immer näher. Aber er verbirgt etwas und ihre Liebe steht unter keinem guten Stern …
Die Autorin
© Sarah M. Bergfeld
Regina Meissner wurde 1993 in einer Kleinstadt in Hessen geboren. Durch lesebegeisterte Eltern entdeckte sie die Liebe zur Literatur früh und versuchte sich am Schreiben eigener Geschichten. Regina hat Lehramt auf Deutsch und Englisch studiert und arbeitet als Produkt- und Social-Media-Managerin in einem Medienunternehmen. Neben dem Schreiben liebt sie das Lesen, das Reisen, Disney und alles, was mit Schweden zu tun hat.
Regina Meissner auf Instagram: regina_meissner_author
Der Verlag
Du liebst Geschichten? Wir bei Loomlight auch!Wir wählen unsere Geschichten sorgfältig aus, überarbeiten sie gründlich mit Autor:innen und Übersetzer:innen, gestalten sie gemeinsam mit Illustrator:innen und produzieren sie als Bücher in bester Qualität für euch.
Deshalb sind alle Inhalte dieses E-Books urheberrechtlich geschützt. Du als Käufer erwirbst eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf deinen Lesegeräten. Unsere E-Books haben eine nicht direkt sichtbare technische Markierung, die die Bestellnummer enthält (digitales Wasserzeichen). Im Falle einer illegalen Verwendung kann diese zurückverfolgt werden.
Mehr über unsere Bücher und Autor:innen auf:www.thienemann.de
Loomlight auf Instagram:https://www.instagram.com/thienemann_booklove
Loomlight auf TikTok:https://www.tiktok.com/@thienemannverlage
Viel Spaß beim Lesen!
Regina Meissner
How to Seduce a Sorcerer
Loomlight
Liebe Leser:innen,
dieser Roman enthält potenziell triggernde Inhalte.
Auf der vorletzten Seite findest du eine Themenübersicht, die Spoiler für die Geschichte beinhaltet.
Entscheide bitte für dich selbst, ob du diese Warnung liest.
Wir wünschen dir das bestmögliche Leseerlebnis!
Regina Meissner und das Loomlight-Team
Playlist
Vance Joy – Fire and the Flood
Ruelle – War of Hearts
Klergy, Valerie Broussard – Start a War
Pim Stones – We have it all
Sam Tinnesz – Far From Home (The Raven)
Maia Hirasawa – Here in Your Arms
Saint Mesa – Sunlit Grave
Eric Kinny, Danica Dora – Last Goodbye
Lord Huron – The Night we Met
Digital Dragons – In Flames
SVRCINA – Meet Me on the Battlefield
UNSECRET, Ruelle – Revolution
Ethan Hodges – Don’t watch me cry
Michael Schulte – Falling Apart
Tommee Profitt, Sam Tinnesz – Heart of the Darkness
Haley Joelle – Memory Lane
Sleep Token – Atlantic
Für Mary.
Für all die Leichen in unserem Keller,für Pennywise, schwarze Nächte im Gruselzimmerund den Typ von Five Guys.
All meine Abgründe lieben dich.
Kapitel 1Regen und Ratten
Der Tod war nichts, vor dem ich mich fürchtete, dafür hatte ich schon zu häufig mit ihm Bekanntschaft gemacht. Viel mehr ängstigte ich mich vor dem Moment, in dem der Tod wieder die Augen aufschlug – denn genau das war mir bei meiner ersten Leiche passiert. Einem menschlichen Mann mit bleichem Gesicht und starrem Körper, in den das Leben zurückkehrte, kurz nachdem ich seine Hosentasche nach etwas Essbarem oder Geld durchsucht hatte. Noch jetzt konnte ich seine knochigen Finger spüren, die sich um meinen Hals legten. Das Gefühl der Enge in meiner Kehle, den Moment, in dem er mir den Atem raubte …
Ich schüttelte die Erinnerung von mir ab und biss energisch die Zähne zusammen. Der Vorfall lag über ein Jahr zurück und durfte mich nicht mehr kümmern. Außerdem war der Mann, vor dem ich jetzt im strömenden Regen kniete, mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit tot.
Seine Augen waren blicklos auf den Himmel gerichtet, sein Körper eiskalt und steif. Über die fahle Haut zogen sich Totenflecken, unschöne Verfärbungen, die sich auch auf seinem Gesicht wiederfanden.
Ich musste schnell sein, sonst kamen mir andere zuvor. Einen bangen Blick über die Schulter werfend, nestelte ich an seinem Hemd, öffnete die Knopfleiste, bis er entblößt vor mir lag. Ein feiner Flaum zog sich über seinen ausgemergelten Bauch, unter dem die Rippen einzeln durchschimmerten. Dieser Mann hatte Hunger gehabt.
So wie wir alle.
Mit flinken Fingern durchsuchte ich seine Kleidung, den dreckigen Stoffbeutel, den seine Hände noch immer umklammerten, in der Hoffnung, irgendetwas zu finden, das ich gebrauchen konnte. Wütend knurrte ich vor mich hin, als mir bewusst wurde, dass der Dreck unter seinen Fingernägeln wahrscheinlich das Wertvollste war, was er besaß. Seufzend stieß ich die Leiche von mir und stand auf.
Der Regen war so dicht geworden, dass ich den Weg vor mir kaum noch erkennen konnte. Ungelenk strich ich mir die langen Strähnen aus der Stirn und band sie im Nacken zu einem Zopf. Meine Zähne klapperten. Eilig hastete ich durch die verwüsteten Gassen, kletterte über eine zerstörte Hauswand und suchte Schutz unter einer Brücke, als sich Hagelkörner unter den Regen mischten.
Um mich zu beruhigen, holte ich dreimal tief Luft. Der Geruch von Verwesung machte mich schwindlig. Besser, ich blieb nicht zu lange hier. Ich musste weiter, wenn ich noch etwas Essbares finden wollte.
Ein Blick in meinen Lederbeutel bestätigte meine Befürchtungen: nur ein paar verschimmelte Beeren – eine magere Ausbeute.
Nicht aufgeben!
Ich löste mich aus dem Schatten der Brücke, hielt mich in Nebengassen, bis ich die Hauptstraße erreichte. Hier war der Gestank nach Tod und Armut übermächtig, doch die letzten beiden Jahre hatten mich gelehrt, mich nicht mehr um solche Banalitäten zu kümmern.
Schreie drangen an mein Ohr. Auf Höhe eines Brunnens stritten zwei Männer miteinander. Ein dritter mischte sich ein, und es kam zu einer Rangelei. Ich beeilte mich, voranzukommen. Ignorierte die bettelnden Frauen am Straßenrand, die ihre Neugeborenen an sich pressten. Ich konnte ihnen nicht helfen. In Kryndon gab es niemanden, der etwas übrig hatte. Niemanden, der etwas entbehren konnte. Und unser König scherte sich einen Dreck um uns. In seinem Palast aus Träumen konnte er die Augen vor der Realität verschließen.
Hagelkörner peitschten mir ins Gesicht, ließen mich den Blick senken. Damit ich kein Aufsehen auf mich zog, lief ich abseits. In letzter Sekunde schaffte ich es, einem nahenden Reiter auszuweichen.
»Hey, pass doch auf!«, brüllte er mir hinterher, da war ich längst verschwunden. Ich stürmte an leeren Häusern vorbei, die mal Geschäfte, Wohnungen oder Restaurants gewesen waren.
Vor einem Laden blieb ich schließlich stehen, weil der Geruch nach frisch gebackenem Brot meine Sinne lahmlegte. Ehe ich mich’s versah, entwich mir ein Seufzen und ich drückte mir die Nase an der Scheibe platt. Vier pralle Brotlaibe warteten in der Auslage, einer perfekter als der andere. Links daneben lagen Brötchen und sogar drei Kuchenstücke.
Ich konnte mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal Kuchen gegessen hatte.
Meine Hände ballten sich zu Fäusten, während ich eine gut betuchte Frau beobachtete, die – bewaffnet mit Federboa und Hut – ihren Korb voll Essen lud. Ihrem Gesicht nach zu urteilen konnte sie unmöglich aus Kryndon kommen. Dafür waren ihre Wangen zu teigig, der Blick aus ihren grünen Augen zu lebendig. Mit einem zufriedenen Lächeln auf den Lippen verließ sie die Bäckerei. Das schrille Läuten der Ladenglocke ließ mich derart zusammenzucken, dass die Dame mir einen pikierten Blick zuwarf.
Ich wusste, was sie in mir sah: Das Gespenst, das ich nie hatte werden wollen. Eine zweiundzwanzigjährige Frau, kaum noch als solche zu erkennen. Sie rauschte an mir vorbei.
Ich sollte sie gehen lassen. Die entgegengesetzte Richtung einschlagen, in der unser Haus lag. Aber da war dieser Geruch nach frischem Brot, der mich in den Wahnsinn trieb.
Während ich der Frau durch Kryndon folgte, rechnete ich mir meine Chancen aus. Sie war deutlich älter als ich, wahrscheinlich jenseits der vierzig. In dem fliederfarbenen Kostüm, das sie trug, kam sie nur langsam voran, weil es auf Höhe der Hüfte eng geschnitten war. Der Hut würde ihr bei der kleinsten unbedachten Bewegung vom Kopf fallen.
Ein Gefühl sagte mir, dass sie noch nie um ihr Essen kämpfen musste. Dass der Krieg ihr nichts genommen, sie vielleicht nicht einmal etwas davon mitbekommen hatte. Außerdem war sie allein unterwegs, was mir einen Vorteil verschaffte.
Mir – und Dutzend anderen hungernden Menschen.
Automatisch wurde ich schneller und schlich der Frau hinterher, die sich in Richtung Marktplatz bewegte. Wenn ich es nur schaffte, sie in eine Nebengasse zu ziehen.
Vielleicht war das aber auch gar nicht nötig.
Eine Kutsche bretterte an ihr vorbei, die sie nach rechts ausweichen und Schutz vor einer Häuserwand suchen ließ. Ich preschte nach vorn, erreichte die Balustrade vor ihr und riss ihr den Korb vom Arm. Verwirrt schaute sie mich an – und ich wusste, dass es ein paar Schrecksekunden dauern würde, bis sie verstand, was passierte. Wertvolle Zeit, in der ich das Brot an mich nahm und die Flucht ergriff.
Ihr Gezeter hörte ich schon bald nicht mehr, und auch ihre dumpfen Schritte verklangen im Tosen des Regens. Ich sprang mehr, als dass ich rannte, die Gasse entlang, weiter nach Osten, aus Kryndon heraus, bis ich einen abgelegenen Platz erreichte. Schon oft hatte ich mich hier im Kornfeld versteckt und meine Beute verstaut. Anspannung pulsierte durch meinen Körper, das Adrenalin trieb mich weiter voran, als endlich das Feld vor mir aufragte.
Nur, dass ich mich dort nicht allein wiederfand, sondern einer Gruppe von drei Männern direkt in die Arme lief. Kaum hatte ich sie gesehen, wirbelte ich herum, doch sie waren schneller. Binnen weniger Sekunden hatten sie mich umzingelt. Hilflos presste ich das Brot an mich.
»Haut ab«, zischte ich den Fremden zu, die mich umkreisten. »Ihr habt hier nichts verloren!« Wohin ich mich auch drehte, schaurige Fratzen blickten mir entgegen. Die Männer schienen nicht älter als ich, strahlten jedoch eine Bedrohlichkeit aus, die etwas Unmenschliches hatte. Gänsehaut kroch meinen Körper hinauf; eine böse Vorahnung machte sich in mir breit.
»Lasst mich gehen!«, bellte ich ihnen durch den Regen entgegen, fest entschlossen, mir die Angst nicht anmerken zu lassen.
»Was hast du denn da?« Der Größte von ihnen, ein Mann mit Schnurrbart und Glatze, schnellte auf mich zu. Im letzten Moment gelang es mir, mich umzudrehen, da schaute ich schon dem Nächsten ins Gesicht. Während ich mir ein stummes Blickduell mit ihm lieferte und versuchte, mich nicht von der blutigen Narbe auf seiner Wange einschüchtern zu lassen, umschlang der Dritte mich von hinten. Er packte meinen Oberkörper so fest, dass mir die Luft aus der Lunge gepresst wurde. Mit routinierten Bewegungen löste er meine Hände, sodass das Brot auf den Boden fiel. Ehe ich mich danach bücken konnte, hatte das Narbengesicht bereits danach gegriffen. Vor meinen Augen riss er sich ein Stück des warmen Teigs ab und stopfte es sich genüsslich in den Rachen.
»Danke fürs Abendessen, Weib«, blaffte er mir entgegen und entblößte eine Reihe schwarzer Zähne. Wütend wand ich mich im Griff des Mannes.
»Wo hast du das her?«, flüsterte er mir gefährlich leise ins Ohr.
»Fass mich nicht an!«, brüllte ich. Mit Schwung stieß ich mein Bein nach hinten – direkt in seine Weichteile. Wie ein kleines Kind jaulte der Mann auf und krümmte sich auf dem Boden zusammen. Ich nutzte den Schreckmoment, rammte dem Bärtigen meinen Ellbogen ins Auge und schlug seinem Kumpan die Faust ins Gesicht. Zeit, mich nach dem Brot umzuschauen, hatte ich keine. Ich kannte Männer wie sie und wusste, dass sie mich niemals freiwillig gehen lassen würden.
Während der Hagel sich verdichtete, rannte ich über das Kornfeld, zurück in die Stadt. Meine Knie stachen vor Anstrengung.
Weil Stehenbleiben keine Option war, humpelte ich weiter, wieder über den Marktplatz, auf dem die wohlhabende Dame sich schon lange nicht mehr aufhielt, in eine schmale Gasse, in der schmutzige Wäsche auf Leinen über mir hing. Ich gestattete mir einen Moment, um durchzuatmen. Mein Blick fiel auf ein vergilbtes Plakat an der Hauswand mir gegenüber, das das Zerrbild eines Zauberers zeigte. Jegliche Art von Magieausübung wird mit dem Tode bestraft, stand in großen, roten Buchstaben darunter und ließ mich frösteln.
Am liebsten wäre ich auf den feuchten Boden gesunken. Schutz suchend schlang ich die Arme um meinen Körper. Es war jetzt schon verteufelt kalt und ich hatte keine Ahnung, wie ich den Winter überstehen sollte.
Meine Hände glitten zu dem leeren Lederbeutel, der um meine Hüfte hing. Über eine Stunde hatte ich mich in der Stadt herumgetrieben – und das war alles? Die Wut setzte eine Hitze in mir frei, von der ich gar nicht wusste, dass ich sie noch besaß.
Mit ihr kam die Trauer – der Gedanke an Kaida und Tian, die erneut ohne richtiges Abendessen ins Bett gehen mussten. Weil ihre Schwester nicht in der Lage war, sich um sie zu kümmern.
Tränen rannen über meine Wangen. Wie sehr ich mich für diese Schwäche hasste! Schniefend legte ich den Kopf in den Nacken.
In dem Moment brach die Sonne durch das Wolkenmeer. Der Hagel ließ nach, und der Regen wurde zu einem feinen Nieseln.
Mit der Sonne kam der Blick nach oben. Richtung Burg, die sich zwischen Häuserfronten auf einem Berg am Horizont abzeichnete. Die Burg, die man von jedem Punkt in Kryndon aus sehen konnte, und in der ein uralter Zauberer in der Verbannung lebte.
Ein Quieken riss mich aus den Gedanken. Hektisch wirbelte ich herum und suchte den Boden ab, wo eine halb tote Ratte in einer Pfütze neben einem Rohr hockte. Ihr fehlte ein Ohr, und ein unappetitlicher brauner Streifen zog sich über ihren Körper.
Alles in mir rebellierte gegen die Idee, die langsam Gestalt annahm. Doch der Hunger war ein perfider Feind. Je länger er einen in seinen Klauen hielt, desto mehr Gewalt besaß er über einen. Irgendwann eroberte er auch die letzten funktionierenden Teile des Gehirns.
Da war diese Ratte.
Meine Familie hatte Hunger.
Ich hob meinen rechten Stiefel und rammte ihn auf den Kopf des Tieres. Trat zweimal fest zu, bis die Knochen knackten. Als ich meinen Fuß anhob, zuckte die Ratte noch, wenige Sekunden später erstarrte sie.
Ich hob sie mit spitzen Fingern am Schwanz an und stopfte den Kadaver in meinen Lederbeutel.
Niemand, weder Mensch noch Magiebegabter, sollte je dazu gezwungen sein, eine Ratte zu essen. Aber ich war längst darüber hinaus, wählerisch sein zu dürfen.
Auf dem Weg nach Hause blendete mich die Sonne. In den letzten zwei Wochen hatte sie sich gar nicht gezeigt. Ich setzte meine Kapuze ab und wrang meine nassen Haare aus. Der Lederbeutel schlug bei jedem Schritt gegen meine Hüfte. Früher hätte mich die Vorstellung, was sich in ihm befand, erschüttert. Inzwischen war ich vollkommen abgestumpft.
Durch den Regen war der Boden rutschig, weswegen ich aufpassen musste, wohin ich meine Füße setzte. Bis nach Hause war es nicht weit, dennoch kam es mir vor, als wäre ich eine Ewigkeit weg gewesen.
Als ich das kleine, baufällige Gebäude erreichte, legte sich ein Teil meiner Anspannung. Mit klammen Fingern nestelte ich den Schlüssel aus der Manteltasche. Knarrend sprang die Tür auf – und der Geruch nach daheim schlug mir entgegen. Wärme, Familie, Zuflucht – und darunter Alkohol und Krankheit.
Leise schloss ich die Tür hinter mir, hängte den Mantel an den Nagel in der Wand und schlüpfte aus meinen nassen Schuhen.
»Liora?«
Kaidas Kopf zeigte sich im Türrahmen. Aufgeregt lief sie auf mich zu und schlang ihre Arme um mich. Um mit ihr auf einer Höhe zu sein, machte ich mich kleiner, und vergrub meine Nase in ihrem roten Haar.
»Hast du mir was mitgebracht?«
Die Tatsache, dass immer noch Hoffnung in ihrem Blick lag, machte es mir nicht leicht. »Keine gute Ausbeute, Kleines. Wie geht es Tian?«
Das Lächeln auf ihren Lippen rutschte eine Etage tiefer. »Er hat schlecht geträumt und war gar nicht mehr ansprechbar. Sein Kopf ist so heiß.« Ich drückte sie fester, dann stand ich auf und verschwand in dem spärlich eingerichteten Schlafzimmer, das die beiden sich teilten.
Mein Körper verkrampfte sich, als mein Blick auf das Klappbett fiel, in dem, vergraben unter Decken und Kissen, mein Bruder lag. Obwohl dies der wärmste Raum des Hauses war und noch dazu der einzige, in den es nicht reinregnete, fror Tian ununterbrochen.
Auf leisen Sohlen schlich ich zu ihm. Es war gut, wenn er schlief, dann hatte er keine Schmerzen. Und ich konnte mich der Illusion hingeben, dass er wieder gesund werden würde.
Vor dem Bett sank ich auf die Knie und schob die Decke ein Stück zur Seite, sodass ich seine Stirn berühren konnte. Sein Fieber war gestiegen; es schwächte ihn bereits seit drei Wochen. Da wir kein Geld für Medizin hatten, magische Heilung unter Todesstrafe stand und der Doktor nur selten nach Kryndon kam, wussten wir nicht weiter.
Mein Herz verkrampfte sich, als ich durch Tians dünnes Haar strich. Da öffneten sich seine Augen. Sein Blick, erst fahrig und orientierungslos, fand schließlich mein Gesicht.
»Tian«, flüsterte ich und hauchte ihm einen Kuss auf die Stirn. »Wie geht es dir?«
Kaida erschien neben mir und griff nach meiner Hand.
Etwa zwei Sekunden sah Tian mich noch an, dann schlossen sich seine Augen. Ich zog die Decke hoch.
»Er schafft es doch, oder?«, fragte Kaida wie jeden Abend.
Es tat weh, sie anzulügen. Schlimmer war jedoch, sie mit einer Wahrheit zu belasten, die sie mit ihren zwölf Jahren nicht verkraften konnte.
»Natürlich wird er wieder gesund. Er muss nur zu Kräften kommen.« Ich drückte ihre Hand, ehe ich in die Küche verschwand. »Ich mache uns Abendessen.«
Ihre tapsigen Schritte folgten mir.
»Danke, dass du auf deinen Bruder aufgepasst hast. Du machst das gut.«
Beim Strahlen ihrer Augen brach etwas in mir. Ich hatte mir geschworen, ihr ein gutes Leben zu bieten. Ein Leben, in dem es ihr an nichts mangelte und sie nach ihren Träumen greifen konnte.
Kein Leben, in dem es gebratene Ratte zum Abendessen gab.
»Hast du deine Hausaufgaben gemacht?«, fragte ich Kaida, die sich auf den klapprigen Schemel gesetzt hatte. Gelangweilt verschränkte sie die Arme vor der Brust.
»Schon vor Stunden. Wir lesen immer noch Majesticus.«
Ich drehte ihr den Rücken zu, damit sie nicht sehen konnte, was ich aus dem Lederbeutel zog. Die tote Ratte lag nass und schwer in meiner Hand. Notdürftig wusch ich sie in einem Kübel, in dem wir Regenwasser sammelten und hackte ihr dann mit einem sauberen Schnitt den Kopf ab. Es war nicht das erste Mal, dass ich ein Tier zubereitete, das man eher nicht essen sollte, daher wusste ich ungefähr, worauf es ankam. Doch gleich, wie viele Gewürze ich verwendete und wie klein ich das Fleisch schnitt, der faulige, beinahe fischige Geschmack verschwand nicht.
Mit einem Ratschen zog ich der Ratte das Fell über die Ohren. In einer Pfanne ließ ich unser letztes Öl schmelzen und warf das Fleisch hinein. Verheißungsvoll zischte es in der Stille.
»Ich brauche einen neuen Stift.« Kaida tauchte so plötzlich neben mir auf, dass ich ertappt zusammenzuckte. Schnell schob ich die Überreste der Ratte zurück in den Lederbeutel.
»Du hast doch erst einen von Hanja bekommen.«
»Ja – und er hat genau eine Woche gehalten. In der Schule geben sie uns keine mehr – Sparmaßnahmen.«
Ich seufzte. »Hast du bei Vater nachgesehen? In der Schublade im Wohnzimmer?«
»Da gibt es schon lange keine Stifte mehr.« Kaida spielte an einer ihrer roten Locken, die mich je nach Lichteinfall an Feuer erinnerten. »Was ist das überhaupt?« Ihr kritischer Blick galt dem Fleisch in der Pfanne.
»Fisch«, murmelte ich, griff nach einer Gabel und wendete die Stücke. »Ein Mann auf dem Markt hat ihn uns zum halben Preis verkauft.«
»So riecht er auch.« Kaida rümpfte die Nase. »Da verschwindet mein Hunger ganz von allein.«
Ehe sie zurück an ihren Platz gehen konnte, fasste ich sie am Oberarm. Sie verlor immer mehr Gewicht.
»Was hast du heute gegessen, Kaida?«
Sie wich meinem Blick aus. »In der Schule gab es Pfirsiche. Die waren nicht mehr besonders frisch, aber besser als nichts.«
»Und davon abgesehen?«
Kaida biss sich auf die Lippe. »Was hast du heute gegessen?«, konterte sie – und da ich die Frage ebenso wenig beantworten wollte wie sie, schwiegen wir beide.
Mit Mühe gelang es mir, Tian ein paar Löffel Suppe einzuflößen. Selbst wenn er wach war, schien er nie richtig anwesend zu sein: Sein Blick war verhangen, die Augen trüb und farblos.
Es brachte mich um den Verstand, dass wir nichts für ihn tun konnten. Dass die Medizin, die ihm helfen würde, unerschwinglich für uns war und wir keinen Magiebegabten herbestellen konnten, der sich seiner annahm.
»Hast du ihm Wadenwickel gemacht?«, fragte ich meine Schwester, die sich ein Stück Ratte in den Mund schob und andächtig auf dem Fleisch herumkaute.
»So, wie du es gesagt hast. Aber ich bezweifle, dass es etwas bringt. Kann nicht Rieka noch mal nach ihm schauen?«
»Ich werde ihr Bescheid sagen.« Ich schöpfte Kaida den letzten Löffel Suppe in die Holzschale. Das Wasser war nur lauwarm. In einem der Küchenschränke hatte ich einen Rest Lauch gefunden. Salz gab es schon seit Tagen nicht mehr – dafür hartes Brot, aus dem ich großzügig die Schimmelflächen herausgeschnitten hatte. Kaida musste es in die Suppe tunken, um abbeißen zu können.
»Willst du nichts essen?«, fragte sie mit Blick auf meinen leeren Teller.
Abwehrend hob ich die Hände. »Ich habe mir unterwegs auf dem Markt etwas geholt. Ich bin satt.«
Den letzten Satz hätte ich mir sparen können, denn sie las mir die Lüge von der Nasenspitze ab, ließ sie aber unkommentiert. Meine Schwester rutschte mit dem Stuhl näher an den Tisch heran. Ihre Füße reichten mit Leichtigkeit bis auf den Boden. Wann war sie groß geworden? Und seit wann war dieser Tisch so leer?
Ein Bild längst vergangener Zeiten blitzte in meiner Erinnerung auf, das ich energisch beiseiteschob. Manche Fenster blieben lieber geschlossen.
»Der Stift«, fiel mir da ein. »Ich schaue gleich mal in Mutters Zimmer, ob wir noch einen haben.«
»Notfalls benutze ich den von Loni.«
»Brauchst du sonst noch etwas?«
Kaida schüttelte den Kopf – und weil ich Angst hatte, weiter nachzufragen, nickte ich bloß. Als sie vom Schemel aufstand und ihren Suppenteller auf die Anrichte stellte, schlackerte das graue Gewand um ihren Körper.
»Liest du uns noch eine Gutenachtgeschichte vor?«
Ich nickte abwesend. Vorher jedoch hatte ich etwas anderes zu erledigen.
Kapitel 2Alkohol und Schimmel
Ich klopfte nicht an, weil er sowieso nicht darauf reagieren würde. Weil es ihm gleichgültig war, wenn man ihn seinem selbst gewählten Elend überließ.
Energisch stieß ich die Tür auf und die bekannte Alkoholfahne wehte mir entgegen. Dieser Gestank hatte sich auf ewig in die Wände unseres Hauses eingebrannt.
Auf dem Weg zum Sofa sammelte ich drei Bierflaschen und zwei dreckige Tücher ein. Dann baute ich mich vor der Gestalt auf, die halb am Boden, halb auf den grünen Kissen lag und die Lider gesenkt hatte.
»Ist ein Brief gekommen?«, fragte ich ihn, nicht sicher, ob er mich überhaupt wahrnahm.
Doch die Augen meines Vaters öffneten sich. Ein Rülpsen verließ seinen Mund, über den er sich großflächig wischte. »Liora.«
»Ist ein Brief gekommen?«, wiederholte ich ungeduldig. »Von Alev?«
»Wie spät ist es?« Er gähnte.
»Spät genug. Du hast wieder den ganzen Tag verschlafen.« Ich gab mir Mühe, der Wut in mir keinen Raum zu geben. Die Arme um die leeren Bierflaschen geschlungen, trat ich einen Schritt auf ihn zu. Sein Hemd war falsch zugeknöpft und am Kragen schmutzig; die Hose verrutscht, sodass ich einen Blick auf seinen bleichen Bauch werfen konnte.
»Ist ein Brief gekommen?«, stellte ich die Frage zum dritten Mal und legte Nachdruck in meine Stimme.
Mit einem Ächzen richtete mein Vater sich auf. Seine schwarzen Haare, einst gepflegt und kurz geschnitten, standen in alle Richtungen ab. »Hab nicht nach der Post geschaut«, lallte er.
»Und das Geld von dir?«
Verwirrt kniff er die Augen zusammen. »Was für Geld?«
»Du hast gesagt, dass du mir Geld gibst – für Kaida und Tian. Tian ist sehr krank, und wenn wir nichts unternehmen, stirbt er.«
Statt einer Antwort sah er mich nur verwundert an. An Tagen wie diesem war ich mir sicher: Der Alkohol hatte auch seine letzten funktionierenden Gehirnzellen abgetötet.
»Ich hab kein Geld«, nuschelte er.
Das wusste ich. Weil alles, was er als Kriegsversehrter bekam, sofort in seine Sucht investiert wurde. Und doch wurde ich nicht müde, ihn danach zu fragen.
»Kaida und Tian haben heute Abend eine Ratte gegessen«, informierte ich ihn. »Wir haben nicht mal mehr Geld, um uns ein Brot zu kaufen.« Ich sank vor ihm auf die Knie, sodass er gezwungen war, mir in die Augen zu schauen. »Wenn Alev uns nichts schickt, bleibt nichts mehr übrig. Du hast zwei Kinder, die du ernähren musst. Wie gedenkst du das zu tun?«
Meinen Vater an seine Pflichten zu erinnern war in etwa so Erfolg versprechend, wie einer Ratte das Tanzen beizubringen.
Mit offenem Mund schaute er mich an, während ein Speichelfaden sein Kinn hinablief. »Ist in der Flasche noch was drin?« Seine Wurstfinger deuteten auf meine Hände. Am liebsten hätte ich ihm mit der Flasche den Kopf eingeschlagen.
Mordfantasien über meinen Vater waren etwas, das ich mir vor Jahren nicht hätte vorstellen können. Jetzt waren sie ein fester Bestandteil meines Tages. Vieles wäre einfacher, wenn es ihn nicht mehr gäbe. Wenn er im Krieg nicht nur seinen rechten Fuß, sondern auch sein Leben verloren hätte.
Ich könnte ihm sagen, dass ich ihn hasste. Dass ich mich für ihn schämte. Dass ich lieber keinen Vater als einen wie ihn hätte. Aber all diese Beleidigungen würden an ihm abprallen, während sie mich nur weiter belasteten.
»Du solltest dringend aufräumen«, rief ich ihm entgegen, ehe ich sein Zimmer mit den Bierflaschen in der Hand verließ. Mit einem lauten Knallen fiel die Tür ins Schloss. Ich zog meine nassen Stiefel über und entsorgte die Flaschen im Eimer vor dem Haus. Die Müllsammler waren seit Wochen nicht mehr gekommen, und langsam fragte ich mich, ob sie Kryndon als das ansahen, was es war: ein Schandfleck.
Im Briefkasten schlug mir gähnende Leere entgegen. Heute war der elfte November – seit Tagen wartete ich auf eine Nachricht von Alev. Mehr noch auf ein paar Münzen, die wir dringend gebrauchen konnten. Es war riskant, Geld zu verschicken, weil es nicht immer bei uns ankam, doch da Alev mehrere Tage entfernt in Alder arbeitete, konnte er es uns nicht vorbeibringen.
Im Regenfass neben der Dachrinne schwamm ein toter Vogel. Er hatte die Augen gespenstisch aufgerissen und gen Himmel gerichtet. Einen Moment blieb ich stehen und musterte ihn verwirrt.
Dann ging ich mit hängenden Schultern zurück ins Haus und schloss die Tür. Obwohl ich nur kurz draußen gewesen war, waren meine Haare schon wieder nass vom Regen. Wie gern hätte ich ein Bad genommen – doch warmes Wasser war etwas, das mir mittlerweile wie ein Fiebertraum erschien. Genauso wie frische Kleidung. Angewidert schnupperte ich am Ärmel meines Kleides. Ich konnte mich nicht daran erinnern, wann ich es das letzte Mal gewaschen hatte.
»Er sucht sich junge Frauen, die er bestialisch ermordet und für seine eigene Unsterblichkeit nutzt«, drang Kaidas Stimme aus dem Schlafzimmer. »Er ist viele Hundert Jahre alt, aber er will für immer leben.« Ein gruseliges Lachen entstieg ihrer Kehle. »Der Zauberer auf dem Berg ist der Stoff, aus dem Albträume gemacht sind. Nur dass er eine reale Gestalt ist. Nach dem Krieg wurde er in seine Burg verbannt, doch von dort aus verbreitet er noch immer Angst und Schrecken. Manche sagen, er sei für das Leid in Arvendom verantwortlich. Andere wiederum glauben …«
Mit schnellen Schritten durchquerte ich den Flur und stieß die Tür zum Schlafzimmer auf. Kaida zuckte auf ihrem Schemel zusammen, das Buch fiel ihr aus der Hand. Tian hatte sich im Bett aufgerichtet; sein umnebelter Blick verriet nicht, ob er wirklich anwesend war.
»Musst du mich so erschrecken?« Aufgebracht funkelte Kaida mich an und griff nach dem Buch.
»Kaida! Du weißt, dass du nicht über Magie reden darfst! Niemals.« Sogar die Wände konnten Ohren haben.
Meine Schwester verdrehte die Augen. »Hier hört uns doch niemand. Außerdem finde ich die Legenden um den Zauberer spannend. Und wenn du uns keine Gutenachtgeschichte vorliest …« In ihren grünen Augen tobte Streitlust.
»Was ist das überhaupt für ein Buch?« Ich kniete mich neben Kaida auf den Boden, auf einen zerrupften Teppich, den wir günstig auf einer Auktion erstanden hatten – und der roch, als ob man schon mal eine Leiche in ihm transportiert hatte.
»Hanja hat es mir geschenkt.«
»Hanja?« Ich nahm ihr das schwarze Buch aus der Hand, das mit einem Ledereinband eingeschlagen war. »Sie müsste am allerbesten wissen, wie gefährlich so etwas ist. Sie dürfte das nicht einmal mehr besitzen.« Mit einem Schaudern erinnerte ich mich an einen Tag nach Kriegsende, an dem in einem großen Feuer alle Bücher über Magie, Magiebegabte und Zauberer verbrannt worden waren. Um ein Zeichen zu setzen, dass die Schreckenszeit des Zauberers vorbei war. »Hanja war hier?«
»Gestern schon.«
»Wieso hast du mir nichts erzählt?«
Kaida verdrehte abermals die Augen. »Weil es nichts zu erzählen gibt. Sie blieb eine Stunde, hat Papa angeschrien und mir dieses Buch und zwei Walnüsse gegeben. Entschuldigung, dass ich dir von diesem bahnbrechenden Ereignis nicht berichtet habe.«
»Hey, werd nicht frech!« Mit der freien Hand boxte ich sie gegen den Oberarm. Dann schlug ich das Buch auf, das weder Titel noch Inhaltsverzeichnis besaß. In meinen Fingern begann es zu kribbeln, wie immer, wenn ich etwas Verbotenes anfasste. Dass Magie eine gewisse Faszination auf mich ausübte, konnte ich nicht leugnen. Auch wenn ich wusste, wie gefährlich und zerstörerisch sie war. »Warum schenkt Hanja dir so etwas? Sie bringt uns damit in Teufels Küche. Wir müssen es sofort loswerden!« Schon blickte ich in Richtung Kamin, als Kaida mich am Arm fasste.
»Beruhige dich. Das Buch ist harmlos. Es ist nur eine Legendensammlung.« Sie wollte mir das Buch aus der Hand reißen, aber ich kam ihr zuvor.
»Der Zauberer auf dem Berg«, las ich eine der in fetter schwarzer Schrift gedruckten Überschriften vor. »Wir haben einen Eid geschworen, dass wir uns mit solchen Sachen nicht mehr beschäftigen!«
Trotzig schob Kaida die Lippe vor.
»Weißt du, wofür solche Geschichten geschrieben wurden? Um den Menschen Angst zu machen. Um ihnen etwas zu geben, vor dem sie sich fürchten sollen. Doch die Zeit, in der Magie so viel Ärger angerichtet hat, ist vorbei. Wir müssen keine Angst mehr vor ihr haben.« Ich war im Begriff, das Buch zuzuklappen, da hatte Kaida auf die nächste Seite geblättert. Die Schwarz-Weiß-Zeichnung eines Zauberers bedeckte drei Viertel des Papiers. Mit grimmigem Blick schaute er mich an. Auf seinem Kopf thronte ein spitzer Hut, der mit Spinnweben verziert war. Sein Haar war lang und dunkel, die Haut so dehnbar wie ein Kaugummi, das man zu lang gezogen hatte. Auf seiner Schulter saß ein schwarzer Rabe. Bei seinem Anblick verknotete sich mein Magen.
»Hier steht, dass er schon mehrere Jahrhunderte alt ist. Nach dem Krieg wurde er auf seine Burg verbannt, die er nicht mehr verlassen kann. Er ist einer der wenigen Zauberer, die den Krieg überlebt haben. Was denkst du, was er den ganzen Tag da oben treibt?«
»Ach, Kaida.« Ich legte meinen Arm um ihre Schulter und zog sie an mich heran. »Wir dürfen nicht so tief graben. Das Zeitalter des vierten Zauberers ist vorbei und wir haben endlich wieder einen menschlichen König.« Der sich einen Dreck für uns interessiert. »Magie ist etwas Böses, mit dem wir uns nicht befassen dürfen.«
»Ich weiß.« Kaida kaute auf ihrer Lippe herum. »Und trotzdem … nur theoretisch.« Sie richtete sich auf. »Der Zauberer auf dem Berg: Was denkst du, ist er für ein Mann? Was tut er den ganzen Tag auf seiner Burg in der Einöde?«
Ich seufzte, ließ den Gedanken meiner Schwester zuliebe aber zu. Dennoch drosselte ich meine Stimme. »Na schön. Zauberer beherrschen die dunklen Künste. Sie sind um ein Vielfaches stärker als gewöhnliche Magiebegabte. Nun haben sie aber keine Macht mehr über uns. Wir haben den Krieg gewonnen und darüber sollten wir dankbar sein. Ich weiß nicht, was der Zauberer auf der Burg den ganzen Tag tut. Ich tue gut daran, mich mit diesen Dingen nicht zu befassen. Und du solltest das auch nicht tun.« Mahnend sah ich sie an.
»Und doch bringt er immer noch Elend über Arvendom.«
Ich zog meine Augenbrauen zusammen. »Steht das auch in diesem Buch?«
Meine Schwester schüttelte den Kopf. »Das hat Hanja erzählt. Sie hat gesagt, dass der Zauberer den Frieden verabscheut. Dass er seine Hände über seine Kristallkugel gelegt, Arvendom gesehen hat – und schwarze Schlieren auf uns hat niederregnen lassen.« In einem Anflug von Theatralik sah sie mich an. Ich sollte dringend mit Hanja reden.
Energisch schlug ich das Buch zu. Ich würde es bei der nächstbesten Gelegenheit verbrennen. »Diese Geschichten tun weder dir noch unserem Bruder gut.« Auch wenn der mittlerweile wieder schlief und seinen Kopf der Wand zugedreht hatte. Besorgt legte ich ihm meine Hand auf seine Stirn. Je weiter der Tag fortschritt, desto höher stieg sein Fieber.
»Erzähl Tian lieber was Schönes«, bat ich Kaida. »Oder lies ihm aus dem Buch vor, das ihr in der Schule besprecht.«
»Aber Majesticus ist todlangweilig. Außerdem glaube ich nicht, dass ein Siebenjähriger das versteht.«
Wenn er denn überhaupt noch etwas verstand …
»Wie auch immer.« Ich klopfte mir auf die Oberschenkel und stand mit dem Buch in der Hand auf. »Es ist spät und du solltest schlafen gehen. Sonst bekomm ich dich morgen wieder nicht aus dem Bett.«
Ich zerraufte ihr Haar, auch wenn sie das nicht mochte. Mit jedem Tag wurde Kaida erwachsener, mit jedem Tag entglitt sie mir ein bisschen mehr, ohne dass ich etwas dagegen tun konnte.
»Na gut.« Müde reckte sie ihre Arme. Ihr Atem roch nach Ratte.
»Schlaf gut. Und wenn was mit Tian ist, weck mich«, erinnerte ich sie und nahm sie in den Arm. Kaida legte sich auf die Matte am Boden und deckte sich mit dem löchrigen Plaid zu. Tian war der Einzige, der noch in einem richtigen Bett schlief. Alle anderen hatten wir verkaufen müssen. In lichten Momenten regte ich mich darüber auf, dass wir ein Bett gegen vier Äpfel getauscht hatten, aber ich wusste, dass wir damals keine Wahl gehabt hatten.
Ich blies eine der beiden Kerzen aus und ging mit der anderen in den Flur. Draußen war es mittlerweile stockdunkel.
Aus Vaters Zimmer drang gleichmäßiges Schnarchen. Wenigstens etwas. Wenn er schlief, trank er nicht. Und gab auch kein Geld aus.
Mit der Kerze und dem Buch in der Hand stieg ich die Treppe zum oberen Stockwerk hoch. Die dritte und die achte Stufe waren morsch. Dadurch, dass unser Haus an unzähligen Stellen undicht war, begann es langsam zu schimmeln. Mir wurde bang bei dem Gedanken, dass wir hier wohl nicht mehr lange würden leben können. Dieses Haus war unser wertvollster Besitz und wenn wir es verloren, würden wir auf der Straße landen.
An guten Tagen versuchte ich die Schimmelherde zu ignorieren. An schlechten fiel mir auf, wie groß sie geworden waren und dass es mittlerweile kein einziges Zimmer mehr gab, das nicht von ihnen befallen war.
Im oberen Stockwerk gab es nur noch einen bewohnbaren Raum. Die anderen waren so feucht, dass sich niemand mehr dort aufhalten konnte. Der pessimistische Teil in mir wartete jeden Tag darauf, dass das Haus einstürzte. Der sadistische wünschte sich, dass es meinen Vater unter sich begrub.
Der Raum, der einst meiner Mutter gehört hatte, war eng geschnitten und büßte durch die niedrigen Wände zusätzlich an Größe ein. Außer einem Schrank, meinem Nachtlager und einem Spiegel, bei dem das Glas an mehreren Stellen gesprungen war, gab es hier drinnen nichts.
Bis auf das Schmuckkästchen, das ich noch nicht hatte verkaufen können. Weil es das Letzte war, was mich an sie erinnerte.
Ich öffnete die Schranktüren, schob die grüne Decke beiseite und holte das Kästchen hervor, das aus edlem Holz geschnitzt war und eine filigrane Blume auf dem Deckel zeigte. Wenn man es aufklappte, erschien eine Ballerina, die sich, gekleidet in Tutu und Spitzenschuhen, einst um die eigene Achse gedreht hatte.
Mit dem Kästchen setzte ich mich auf mein Nachtlager, das aus einer löchrigen Decke und zwei mit Heu gefüllten Kissenbezügen bestand.
Vieles wäre besser, wenn Mutter noch hier wäre. Mit ihrem Tod hatte der Verfall erst begonnen. Eine Welle der Traurigkeit erfasste mich, während ich die Ballerina anstarrte – und doch nur sie sah – meine wunderschöne Mutter. Bis zu ihrem Tod war sie ein Geheimnis für mich geblieben.
Versprich mir, dass du für deine Geschwister sorgst, wenn ich nicht mehr da bin.
Versprich mir, dass du nie vergisst, wer du bist und was du kannst.
Ich zog die Beine an den Körper, stellte das Schmuckkästchen auf meinen Knien ab.
Ich verspreche es. Es wird meinen Geschwistern an nichts fehlen.
Es war nicht das einzige Versprechen, das ich gegeben und gebrochen hatte. Doch das, was am meisten wehtat. Wo auch immer Mutter war, ich wollte, dass sie mit Stolz auf mich blickte. Dass sie es nicht bereute, mir die Verantwortung für die Familie übertragen zu haben.
»Es tut mir leid«, flüsterte ich. »Es tut mir so unendlich leid.«
Ich verstaute die Schatulle unter der Decke im Schrank. Vater ging nur selten nach oben, doch ich wusste, dass er sie verkaufen würde, wenn er sie fand. Auf dem Schwarzmarkt bekam er gewiss einige Flaschen Bier dafür.
Ich wollte mich gerade hinlegen, als das zerbrochene Spiegelglas meine Gestalt auffing. Und sosehr ich meinen eigenen Anblick normalerweise mied, heute wollte ich mich ihm stellen.
Wann war ich so dünn geworden? Wann hatte ich auch meine letzten weiblichen Rundungen eingebüßt? Meine Brüste waren als solche schon gar nicht mehr zu erkennen.
Aber es war nicht mein Körper, der mir einen Schauer über den Rücken jagte. Sondern mein Gesicht. Die eingefallenen Wangenknochen, das spitze Kinn, die leeren Augen. Ich sah aus wie eine hässliche Version meiner selbst. Als hätte ein Maler nur die Konturen auf die Leinwand gebracht und die Farbpalette vergessen.
Mit zweiundzwanzig Jahren hatte ich mehr graue Haare als meine Großmutter mit siebzig. Und sobald ich meinen Kopf zu fest berührte, hielt ich ein Büschel Haare in der Hand. Doch während sie mir auf dem Kopf ausfielen, wuchsen sie an allen anderen Stellen unkontrolliert.
Ich hatte nie viel auf mein Aussehen gegeben, aber mein Spiegelbild jagte mir eine Heidenangst ein.
Nicht so sehr jedoch wie die Gestalt, die sich auf einmal hinter mir zeigte. Sie war – sofern das überhaupt möglich war – noch blasser als ich und trug ein zerrissenes, graues Kleid. Ihre Augenhöhlen waren leer, sie hatte spröde Lippen und eine Narbe, die sich quer über ihr Gesicht zog.
Es war nicht das erste Mal, dass ich sie sah. Je stärker der Hunger wurde, je länger ich nichts aß, desto lebhafter wurden meine Halluzinationen. An guten Tagen verschwand die Geistergestalt, wenn ich mich zu ihr umdrehte. An schlechten begann sie sich mit mir zu unterhalten.
Heute war ein schlechter Tag.
Eiskaltes Grauen machte sich in mir breit, als die Geisterfrau ihre Hand auf meine Schulter legte. »Bald wird sich dein Leben ändern«, flüsterte sie. Ihre Stimme war dünn wie Papier. »Er wird dich wie uns alle in den Abgrund ziehen.«
Kapitel 3Brot und Blumen
Der nächtliche Regen hatte Kryndon in ein Schlammfeld verwandelt. Kaida und ich wateten durch den Matsch. Meine Stiefel waren schon jetzt durchnässt. Je weiter wir in den Stadtkern eindrangen, desto leichter wurde es, voranzukommen. Kaidas Schule lag in der Nähe des Marktplatzes, ein hässlicher, grauer Kasten, der zu Kriegszeiten als Spital genutzt worden war und auch jetzt kaum die richtige Ausstattung für eine Schule bot. Ein Großteil der Klassenzimmer hatte noch immer keine Tische, von Stühlen ganz zu schweigen.
Da das Gebäude nach Kriegsende nur provisorisch renoviert worden war, zog es in allen Ecken. Die Fenstergläser hatte man nur teilweise ausgetauscht, viele Scheiben waren zersprungen.
Dennoch war ich dankbar, dass Kaida ihre Vormittage hier verbringen durfte. Dass sie lernen durfte. Das allein war viel wert.
»Viel Spaß«, wünschte ich ihr. Der Rucksack, in dem sie ihre Schulsachen aufbewahrte, war viel zu groß für ihren Rücken.
»Warte«, fügte ich hinzu, als sie Anstalten machte, auf das Gebäude zuzurennen. »Ich habe noch was für dich.«
Umständlich nestelte ich die Beeren, die ich gestern gesammelt hatte, aus meiner Manteltasche und reichte sie ihr. Kaidas Augen wurden groß.
»Iss sie lieber gleich, sonst nimmt sie dir noch jemand weg.«
Ein tröstendes Gefühl flutete meinen Körper, als meine Schwester sich die Früchte in den Mund stopfte. Sie fiel mir um den Hals, dann gesellte sie sich zu zwei gleichaltrigen Mädchen.
Im Gegensatz zu mir war es Kaida nie schwergefallen, Anschluss zu finden. Wo sie ein einnehmendes Wesen hatte, war ich verschlossen und eigenbrötlerisch. Wo sie sprach, zog ich mich schweigend in mich selbst zurück.
Ich wartete, bis sie im Gebäude verschwunden war, und betete, dass der Mittagsdienst irgendetwas Essbares für sie hatte. Wenn sie eine Mahlzeit in der Schule bekam, stand ich nicht so sehr unter Druck, ein Abendessen zu liefern.
»Mach dir nicht so viele Sorgen. Kaida ist ein zähes Biest. Sie …«
Noch bevor Rieka zu Ende gesprochen hatte, wirbelte ich zu ihr herum und zog sie an mich heran.
»Ich bin so froh, dich zu sehen«, murmelte ich in ihr braunes Haar, das frisch gewaschen roch. Rieka hatte es sich hochgesteckt.
»Ich hab dir doch gesagt, dass ich komme.«
»Und doch hat es sich angefühlt wie eine Ewigkeit.«
Ich deutete auf die Bank unweit des Schulhofes, auf der wir nebeneinander Platz nahmen. Rieka stellte den Weidenkorb, den sie in der Hand gehalten hatte, auf den Boden. Er war mit einem Geschirrtuch bedeckt.
»Du siehst gar nicht gut aus«, sagte sie ohne Umschweife.
»Na, wenn das mal keine schöne Art ist, seine beste Freundin zu begrüßen«, witzelte ich. »Ich hab schlecht geschlafen.« Und einen Geist im Spiegel gesehen.
»Ja – und so ziemlich seit einer Woche nichts mehr gegessen?« Ihr aufmerksamer Blick nahm nicht nur meinen Körper, sondern auch all das in sich auf, das ich vor den Menschen zu verbergen suchte.
»Ich komm klar«, murmelte ich – und musste kurz die Augen schließen, weil mir schwindlig wurde. Tief durchatmend streckte ich die Schultern durch. »Das Wetter bekommt mir nicht.«
Wortlos kramte Rieka in ihrem Korb. Sekunden später lag eine Scheibe Brot auf meinem Schoß, die mir das Wasser im Mund zusammenlaufen ließ. Ich nahm sie in beide Hände, wohlwissend, dass mir es dann noch schwerer fallen würde, zu widerstehen, befühlte die harte Rinde und das weiche, teigige Innere. Führte das Brot zu meiner Nase, um den leichten Duft nach Mehl in mich aufzunehmen.
Ich. Hatte. Solchen. Hunger.
Schwer schluckend versteckte ich das Brot unter meinem Kleid.
»Was tust du da?« Rieka fasste mich an der Schulter.
»Kaida und Tian brauchen es dringender als ich. Die Schule kann noch immer keine Mahlzeit sicherstellen, und oft kommt Kaida hungrig nach Hause. Wenn sie heute Abend …«
»Lio, ich habe dir das Brot gegeben – und nicht deiner Schwester.«
»Ich brauch es aber nicht. Ich habe schon …«
Rieka schlug mir mit der flachen Hand gegen den Hinterkopf und zog das Brot unter meinem Unterrock hervor. Mit strengem Blick sah sie mich an. »Ich habe es dir schon hundert Mal gesagt und ich werde es dir wieder sagen: Es bringt niemandem etwas, wenn du verhungerst. Das macht Tian nicht gesund und Kaida nicht satt. Also iss, verdammt noch mal.« Anklagend hielt sie mir das Brot vor das Gesicht – und dieses Mal reichte eine Nuance seines würzigen Geruchs, um mich schwach werden zu lassen. Noch im Kauen ermahnte ich mich, langsam zu essen, es zu genießen, es mir einzuteilen – ein paar Sekunden später waren meine Hände leer. Hungrig blieb ich, auch wenn sich mein Magen nicht mehr ganz so dumpf anfühlte.
»Danke«, flüsterte ich, beschämt über meinen Ausbruch. »Ich weiß, dass ihr selbst nicht viel habt. Wenn ich es euch irgendwann zurückgeben kann …«
Rieka legte mir den Arm um die Schulter. »Freso und ich teilen gern. Und wo wir schon bei der Sache sind: Ich möchte, dass du heute bei uns zu Abend isst.«
Mein Kopfschütteln kam, bevor ich darüber nachdenken konnte.
»Hör zu.« Rieka rutschte näher an mich heran und griff nach meinen Händen. Ihre waren warm und einladend, so wie ihr ganzes Wesen. »Freso hat gestern Geld von der Staatskasse bekommen – eine weitere Kriegsabfindung. Uns geht es besser als den meisten in der Stadt – und du bist meine älteste und beste Freundin. Lass mich dir helfen.«
Ich wollte stark sein. Ich wollte es wirklich. Aber der Ausdruck in Riekas sanften Augen, in denen so viele Erinnerungen, so viel Heimat, Zuversicht und Sicherheit lagen, ließ mich in Tränen ausbrechen.
Auch das war eine Folge des Hungers: An manchen Tagen ließ er mich emotional abstumpfen, beinahe erkalten – an anderen machte er mich weinerlich und schwach.
»Hast du im Krankenhaus nachgefragt?« Ich wischte mir über die Augen.
Rieka wich meinem Blick aus – und das genügte mir als Antwort. Trotzdem sagte sie: »Es gibt momentan keine freien Stellen. Zumindest keine, die sie bezahlen können. Dabei haben sie erst gestern jemanden entlassen.«
Ich schluckte meine Enttäuschung hinunter. »Wieso das?«
Riekas Blick verdunkelte sich. »Er wurde beim Praktizieren von Magie erwischt. Ein herkömmliches Medikament hat nicht geholfen, weswegen er auf seine Kräfte zurückgegriffen hat.«
»Was ist mit ihm passiert?«
Meine beste Freundin zuckte mit den Schultern. »Ich habe nur gesehen, wie sie ihn mitgenommen haben. Danach …«
Sie beendete den Satz nicht, weil wir beide genau wussten, was mit ihm passiert war. Die Wahrscheinlichkeit, dass er noch lebte, war gering. Unser menschlicher König kannte kein Erbarmen. Manchmal ließ er sogar Magiebegabte auf dem Marktplatz hinrichten, um ein Exempel zu statuieren. Einmal mehr war ich dankbar für meine Menschlichkeit.
»Ich bin mir sicher, dass wir Arbeit für dich finden«, fuhr Rieka fort.
»Es gibt keinen Ort, an dem ich nicht nachgefragt hätte. Niemand hat Geld – die meisten Geschäfte stehen leer. Schon vor dem Krieg war es für eine Frau schwer, eine Anstellung zu finden. Jetzt kommt es mir unmöglich vor.«
Mit einem lachenden und einem weinenden Auge dachte ich an die Nachmittage zurück, die ich bei Mr Hughes im Blumenladen gearbeitet hatte. An die Sträuße, die ich gebunden und er mit Magie verfeinert hatte.
Jetzt lag der Blumenladen, wie so vieles andere in Kryndon, in Trümmern. Eine Bombe hatte Mr Hughes getötet, niemand besaß mehr Geld für Blumen und Mrs Hughes war dem Hunger zum Opfer gefallen.
Das war über drei Jahre her, und doch wurde mein Herz jedes Mal aufs Neue schwer, wenn ich an dem zerfallenen Gebäude vorbeiging und vor Erinnerungen floh.
»Hast du mal an Kaidas Schule gefragt? Vielleicht kannst du im Unterricht aushelfen.«
»Ich kann nicht mal einen Brief schreiben, ohne dass Kaida über meine Fehler lacht. Außerdem stellen sie gerade niemanden ein. Sie haben die Klassen vergrößert, damit sie weniger Lehrer brauchen. Kaida lernt jetzt mit sechzig anderen Schülern.«
»Ich fass es nicht, dass das unser Leben ist«, flüsterte Rieka.
»Manchmal wache ich morgens auf und stelle mir eine Welt vor, in der wir in Frieden leben können. Menschen, Magiebegabte und Zauberer. In der der Krieg nicht so viel Elend gebracht hat.« Ich sammelte die Krümel auf dem Unterrock zusammen und steckte sie mir in den Mund.
»Und doch sind wir hier.«
Ich richtete den Blick auf das graue Gebäude, das eher an eine Nervenheilanstalt als an eine Schule erinnerte. Ein Teil von mir war dankbar, dass Kaida überhaupt die Möglichkeit zum Lernen hatte. Der andere wünschte sich so viel mehr für sie.
»Wie geht’s deinem Vater?« Rieka faltete das Tuch und legte es zurück in ihren Korb. Obwohl sie nicht wohlhabend war, wirkte sie stets adrett und zurechtgemacht. Die Mühe, die sie sich mit ihrer Frisur gab, konnte ich nicht mal für mein gesamtes Erscheinungsbild aufbringen.
»Wie soll’s ihm schon gehen? Er ist kaum ansprechbar, säuft den ganzen Tag und schert sich einen feuchten Dreck um uns.«
»Es muss schwierig sein, die nötige Geduld aufzubringen.«
»Ich bin nicht mehr geduldig.« Mein Blick versteinerte. Um uns herum war nicht mehr als verbrannte Erde. Boden, auf dem schon lange nichts mehr wuchs. »Er hat kein Interesse an uns. Würde er sich auch nur ein bisschen um Kaida und Tian scheren, hätte er nicht unser ganzes Geld versoffen.«
»Glaubst du nicht, dass es wieder besser werden kann?«
Ich schnaubte. Rieka war eine unverbesserliche Optimistin. Sooft mich ihre positive Art schon gerettet hatte; heute wollte ich nichts von ihr hören. »Was soll denn besser werden? Mutter ist gestorben – und das wird er nie verkraften. Die Erinnerungen an den Krieg halten ihn wach – oder wecken ihn, wenn er gerade eingeschlafen ist. Manchmal schreit er stundenlang.« Die Erinnerung an Vaters letzten Rückfall jagte mir einen eiskalten Schauder den Rücken hinab. »Ich habe eingesehen, dass ich ihm nicht helfen kann. Vielleicht ist Gott gnädig und erlöst uns von ihm.«
Riekas kreisrunde Augen nahm ich nur am Rande wahr, weil meine Aufmerksamkeit auf etwas anderes gelenkt wurde. Ruckartig stand ich auf, kletterte rückwärts über die Bank und hob mein Kleid an, damit es nicht über den Boden schleifte.
»Warten Sie!« Ich hastete auf den kleinen Mann mit roter Mütze zu, auf der ein Oktagon prangte, das ihn als Briefträger kennzeichnete. Um seine Hüfte hatte er eine Ledertasche gebunden.
Er war im Begriff, zwei Umschläge in einen Briefschlitz zu schieben, als er sich zu mir umdrehte.
»Ist ein Brief für mich gekommen?«, fragte ich atemlos. »Liora Waygold.«
Der Mann schob sich die Brille zurück auf die Nase, dann öffnete er die Tasche. Unruhig verlagerte ich mein Gewicht von der einen auf die andere Seite. Rieka stellte sich neben mich.
»Tut mir leid, da ist nichts«, murmelte er. »Ah, Moment, hier …«
Mein Herz schlug doppelt so schnell, als er mir einen zerknitterten Umschlag entgegenstreckte, um den mehrere Bänder geschlungen waren.
»Alev. Endlich.« Hektisch löste ich die Knoten der Bänder, ließ sie achtlos zu Boden fallen und öffnete das Kuvert. Es wog schwerer als seine früheren Nachrichten, und die Hoffnung in mir wuchs.
Dennoch zwang ich mich, zuerst das Papier aus dem Umschlag zu ziehen.
»Liebste Liora«, las ich mit halblauter Stimme. »Liebe Kaida, lieber Tian, lieber Vater. Ich vermisse euch schrecklich. Jeder Monat, den ich in Alder verbringe, ist einer, der die Sehnsucht in mir unerträglicher macht.«
Ich schluckte.
»Die Arbeit in Alder gefällt mir gut. Johin hat mich in alle Bereiche eingelernt. Jeden Tag stelle ich Nägel, Werkzeuge und Ketten her. Gestern hat mich eine wohlhabende Frau besucht, der ich ein besonderes Hufeisen anfertigen durfte. Sie hat mir ein großes Stück Kuchen gegeben und ein Armband geschenkt, das an euch geht. Ich weiß, dass Schmuck nicht mehr viel Geld einbringt, aber vielleicht gelingt es dir ja trotzdem, das Armband gegen Essen einzutauschen.
Ich hätte euch gern mehr Geld geschickt, aber es reicht nur für ein paar Rupane. Aufgrund der angespannten wirtschaftlichen Lage war Johin gezwungen, meinen Lohn anzupassen. Für die dreißig Prozent, die er mir weniger zahlen kann, darf ich bei ihm im Gästezimmer schlafen. Das ist in Ordnung für mich, bedeutet aber auch, dass ich noch weniger Geld für euch zur Seite legen kann.
Es tut mir unendlich leid. Ich weiß, in welch großer Not ihr euch befindet. Jeden Abend liege ich wach und denke an euch. Ich hoffe so sehr, dass wir uns bald wiedersehen werden.
Dein Alev.«
Mit einer Mischung aus Enttäuschung und Rührung klappte ich den Brief zusammen. Dann warf ich einen Blick in den Umschlag und fand das Armband, von dem mein Bruder gesprochen hatte. Es bestand aus mehreren, silbernen Gliedern, in die filigrane Blumen eingraviert waren. Unter anderen Umständen, in einer anderen Zeit hätte ich es gern getragen. Doch zu meinem Flickenkleid würde es lächerlich aussehen.
Und so schön es auch war – es war nahezu nutzlos. Trug ich es, lief ich Gefahr, dass es mir gestohlen wurde, doch wenn ich versuchte, es zu Geld zu machen, würde es mir niemand abkaufen. Die Zeiten, in denen Menschen sich für die schönen Dinge interessierten, waren vorbei.
»Ich könnte es mit ins Krankenhaus nehmen«, bot Rieka an. Auf ihre Stirn hatte sich eine Falte geschlichen. »Gestern Nacht wurde eine wohlhabende Frau eingeliefert, die sich das Bein gebrochen hat. Vielleicht kauft sie es mir ab.«
Dankbar reichte ich ihr das Schmuckstück. Selbst wenn wir nur ein paar Rupane dafür bekamen, war es besser als nichts.
Ich steckte meine Hand in den Umschlag, in der Hoffnung, das Geld zu finden, von dem Alev gesprochen hatte. Mit den Fingerspitzen ertastete ich drei einzelne Münzen – drei Rupane – die ausreichten, um zwei Köpfe Kohl zu kaufen. Wenn der Verkäufer mit sich verhandeln ließ.
Verdammt. Ich biss mir auf die Lippe, ehe ich die Münzen in meiner Kleidtasche verstaute, wo sie sich zu dem kümmerlichen Rest Geld gesellten, das mein Vater nicht ausgegeben hatte.
»Ich kann es bestimmt verkaufen«, sagte Rieka, um mich aufzumuntern.
Schweigend setzte ich mich in Bewegung. Ich hatte die Hoffnung gehabt, mit Alevs Geld einkaufen gehen zu können. Jetzt musste ich sehen, was sich von den Münzen überhaupt bekommen ließ.
Riekas Mund öffnete sich, aber ich schüttelte den Kopf.
»Es ändert ja doch nichts. Lass uns das Beste draus machen.«
Das Beste draus machen.
Das tat ich, seit der Krieg ausgebrochen war. Seit Vater in die Schlacht geschickt worden war und seinen Fuß verloren hatte. Seit ich meinen ersten Toten gesehen hatte. Seit ich wusste, wie sich Hunger anfühlte und wie viel schlimmer es sich anfühlte, seine Geschwister hungrig zu sehen. Seit ich immer erfinderischer wurde, aus dem wenigen Essen, das wir hatten, Gerichte zu kochen. Seit Alev in einer anderen Stadt arbeitete, um zumindest etwas Geld zu verdienen und ich ihn unendlich vermisste. Seit meine Mutter im Kindbett gestorben war, ohne dass Vater sich von ihr verabschieden konnte. Seit die Zauberei aus unserem Leben verbannt worden war und Magiebegabte ihre Kräfte nicht mehr einsetzen durften.
Rieka und ich bogen in die Haupteinkaufsstraße ein, in der die meisten Läden überlebt hatten oder restauriert worden waren. Die Ressourcenlage war angespannt, doch mit dem nötigen Geld konnte man sich alles kaufen, was man brauchte.
Seufzend nahm ich die Schlangen aus Menschen und Magiebegabten zur Kenntnis, die sich vor den Häusern tummelten. Aus Erfahrung wusste ich, dass die meisten kein Geld bei sich trugen und nur zum Betteln hier waren. Was es zu einer Gefahr machte, das Geschäft mit Lebensmitteln zu verlassen.
Rieka straffe die Schultern, dann schoben wir uns an gaffenden, hungernden Personen vorbei und betraten den ersten Laden, ein Backsteingebäude mit schiefem Schornstein, das einst ein Café gewesen war und jetzt Grundnahrungsmittel verkaufte.