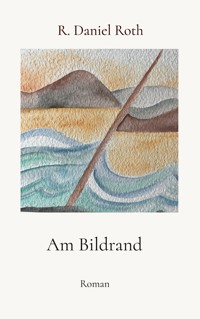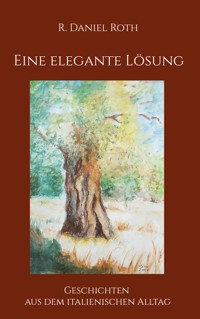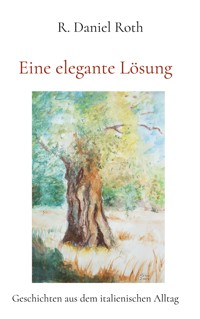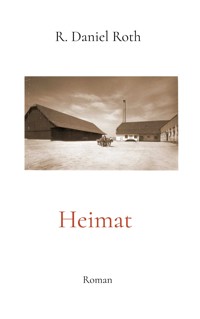Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es war an einem ungewöhnlich heißen Augustsonntag eines ungewöhnlich heißen Sommers, als die Einwohner von Chiacchierata beschlossen, nicht mehr zu sprechen. Nicht heute. Nicht morgen. Und auch nicht in fünfzig Jahren. Niemals mehr. Es schien, als wären sie all der aus ihnen herausströmenden und über sie hinweg flutenden Worte plötzlich überdrüssig geworden. Sie schalteten ihre Fernseher aus. Und ihre Radios. Und sie sollten sie nie wieder einschalten. Sie ahnten nicht, dass sich ein schreckliches Geheimnis hinter ihrem Entschluss verbarg.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 279
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
„Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist.“
Victor Hugo
Inhaltsverzeichnis
Teil 1
Kapitel 1.
Kapitel 2.
Kapitel 3.
Kapitel 5.
Kapitel 6.
Kapitel 7.
Kapitel 8.
Kapitel 9.
Kapitel 10.
Teil 2
Kapitel 1.
Kapitel 2.
Kapitel 3.
Kapitel 4.
Kapitel 5.
Kapitel 6.
Kapitel 7.
Kapitel 8.
Kapitel 9.
Kapitel 10.
Kapitel 11.
Kapitel 12.
Kapitel 13.
Kapitel 14.
Kapitel 15.
Kapitel 16.
Kapitel 17.
Kapitel 18.
Teil 3
Kapitel 1.
Kapitel 2.
Kapitel 3.
Kapitel 4.
Kapitel 5.
Kapitel 6.
Teil 4
Kapitel 1.
Kapitel 2.
Kapitel 3.
Kapitel 4.
Kapitel 5.
Kapitel 6.
Epilog
Nachbemerkung
Danksagung
Weitere Informationen
Teil 1
1.
Es war an einem ungewöhnlich heißen Augustsonntag eines ungewöhnlich heißen Sommers, als die Einwohner von Chiacchierata beschlossen, nicht mehr zu sprechen. Nicht heute. Nicht morgen. Und auch nicht in fünfzig Jahren. Niemals mehr.
Sie schalteten ihre Fernseher aus. Ihre Radios. Und sie sollten sie nie wieder einschalten. Es schien, als wären sie all der aus ihnen herausströmenden und über sie hinweg flutenden Worte plötzlich überdrüssig geworden.
Wie jeden Sonntag hatte Don Graziano auch an diesem heißen Augusttag das übliche Höllenszenario auf die in ihre Bänke gekrümmten Einwohner herabbeschworen. Und ihnen mit den Qualen des Fegefeuers gedroht. In dem sie für immer und ewig zu schmoren hätten. Falls sie sich, wie gewohnt, durch sachtes Wegdämmern dem Schrecken seiner Schilderungen zu entziehen versuchten. Worauf die Kirchgänger noch tiefer in ihre Bänke versanken. Vergeblich bemüht, die Last der niederdrückenden Worte von sich abzuschütteln. Noch vergewisserte sie das ins Kirchenschiff einströmende Sirren der Zikaden, sich im Diesseits, fern von Fegefeuer und Höllenpforte zu befinden. Doch sie wussten, dass jenseits der kühlenden Mauern bereits Satan auf sie lauerte. Um sie unter dem Joch ihrer Feldarbeit in der brütenden Hitze schon zu Lebzeiten gefügig zu braten.
Die Predigt war noch nicht zu Ende, da spürten die Kirchgänger, wie sich eine befremdliche Unruhe unter ihnen ausbreitete. Die Kerzen der Seitenaltäre flackerten auf. Und als hätte jemand an ihren Kitteln gezupft, drehten sich die, die in den ersten Reihen saßen, überrascht um. Stellten irritiert fest, dass sich auch alle andern umgedreht hatten. Und wandten sich mit einem gemeinsamen Seufzer wieder dem Altar zu.
Auch Don Graziano fühlte sich an seinem Talar gezupft. Warf einen tadelnden Blick auf die hinter ihm kauernden Ministranten. Schielte zum über ihm hängenden Altarkreuz hoch. Und drehte sich dann kopfschüttelnd wieder seiner Gemeinde zu. Als er sah, dass die Kirchgänger verwirrt um sich schauten und sich bekreuzigten, bekreuzigte auch er sich. Setzte ein verfrühtes Amen hinter seine noch nicht beendete Predigt. Verzichtete auf den in der Liturgie vorgegebenen Singsang und den abschließenden Friedensgruß. Und verstummte.
Die ohnehin schon verunsicherten Kirchgänger wunderten sich über den plötzlichen Abbruch der Predigt. Warfen sich fragende Blick zu. Fädelten sich zögernd aus den speckigen Holzbänken. Duckten sich unter den Portalbogen, der wie eine Guillotine über ihre Nacken dräute. Hoben ängstlich ihre Gesichter. Blinzelten misstrauisch nach oben. Wankten dann auf den Kirchplatz hinaus. Wo das grelle Mittagslicht von den Steinplatten abprallte. Und jäh in ihre Augen schoss. Geblendet taumelten sie an der Kirchmauer entlang. Verteilten sich wie jeden Sonntag in kleinen Grüppchen. Doch als sie ihre Münder öffneten, um sich über das eben Vorgefallene auszutauschen, kamen keine Worte über ihre Lippen. Sie sahen sich verwundert an. Ließen ihre Unterkiefer wieder hochklappen. Und nickten sich zu.
In diesem Augenblick gemeinsamen Verstehens war ihnen plötzlich klargeworden, dass es nichts mehr gab, worüber sie sich auszutauschen wünschten. Mehr noch. Sie spürten mit großer Klarheit, genügend Worte verschlissen und deren Unzulänglichkeit entlarvt zu haben. Sie beschlossen, sich ihrer künftig nicht mehr zu bedienen. Wendeten sich noch einmal einander zu. Nickten wieder. Und verließen, ohne ein weiteres Wort hinzufügen, den Kirchplatz.
Don Graziano fühlte, wie eine Last von ihm abfiel, die er all die Jahre mit sich herumgeschleppt hatte. Die mahnenden Worte, die er Sonntag für Sonntag auf seine Gemeinde niederprasseln ließ, und an die er selbst nicht mehr glaubte, würde es nun nicht mehr geben. In diesem Schweigen, das sich nun über sie alle gestülpt zu haben schien, erhoffte er sich die Erfüllung einer Sehnsucht, die unter dem Ballast überflüssiger Worte tief in ihm verschüttet lag. Die Sehnsucht nach dem verlorenen Gott. Der diesen Ort so schmählich im Stich gelassen hat. Und er hoffte, dass dieses Schweigen auch den nicht enden wollenden Aufschrei in seinem Innern zum Verstummen bringen möge.
Beppe, der die Kirche seit damals nie wieder betreten hat, beobachtete verwundert, wie sich die Kirchgänger verfrüht durch den Portalbogen schleppten. Und sich statt drauflos zu schnattern, wortlos auf der Piazza verteilten. Und sich zunickten. Bis die Woge des unausgesprochenen Entschlusses nun auch an ihn heranschwappte. Und nun auch er plötzlich spürte, dass es nichts gab, was noch gesagt werden musste. Und er verabschiedete sich von all den Stimmen, die dieses Bergdorf damals wieder neu gefüllt hatten. Die sich überschlagenden Stimmen der Kinder. Das heisere Krächzen der Frauen. Das mürrische Poltern der Männer. Und die bauchige Bassstimme von Giovanni, der all die Jahre die fehlende Begleitung der zerstörten Orgel zu ersetzen versucht hatte. Auch sie würde er nun nicht mehr hören. Beppe nahm sich vor, alle diese Stimmen in seinem Gedächtnis aufzubewahren. Vielleicht, so hoffte er, würde die nun eingekehrte Stille eine andere sein als die, der er im Lärm der Worte vergeblich zu entkommen versucht hatte. Und als Beppe sah, wie alle sich bückten, um, wie er meinte, die noch in ihnen aufgestauten Worte auf dem Kirchplatz abzulegen, legte auch er seine Worte dort ab. Setzte sich auf das Mäuerchen, das die uralte Steineiche umrahmte. Beobachtete im Schatten ihrer ausladenden Krone, wie sich die Kirchgänger in verschiedene Richtungen zerstreuten. Und wartete darauf, dass die flirrende Mittagshitze all die dort aufgehäuften Worte hinwegschmelzen würde.
Für Fortunato, der schon seit seiner Geburt in einer allumfassenden Stille lebte, schien sich durch das unerwartete Schweigen zunächst nichts zu ändern. Er hatte noch nie ein Wort gesprochen. Und noch nie eins vernommen. Vergeblich hatte er sich all die Jahre bemüht, durch Gesten und Blicke mit den anderen Einwohnern in Kontakt zu treten. Nur, wenn er seine selbst geschnitzte Olivenholzflöte an den Mund führte und ihr Töne entlockte, die Sehnsüchte in ihnen erweckte, zu denen sie sonst keinen Zugang fanden, spürte er, dass diese Töne eine Brücke zwischen ihm und ihnen spannten. Die wieder zusammenbrach, wenn er seine Flöte absetzte.
Als er feststellte, dass die Lippen der anderen sich nicht mehr bewegten, als sie auf dem Kirchplatz beisammenstanden, und sie mit Händen, Armen und Beinen vor sich her gestikulierten, begriff Fortunato, dass sie, eine Sprache einzuüben begannen, die die seine war. Und er hüpfte vor Freude über den Piazza. Von nun an würde er im gemeinsamen Schweigen mit ihnen verbunden sein.
Die Einwohner von Chiacchierata hatten sich nie als eine zusammengehörige Gemeinschaft empfunden. Sie waren nicht, wie in anderen abgelegenen Bergdörfern, seit Generationen zu Familien und Großfamilien zusammengewachsen. Und mit ihren Dörfern verwurzelt.
Auf der Flucht vor dem großen Krieg hatten sie sich in diesen offenbar verlassenen Ort verirrt. Und als sie in der Sakristei der ungewöhnlich großen Kirche zwei Männer kauern sahen, die ihnen mit leeren Augen entgegenstarrten, ahnten sie, dass etwas Ungewöhnliches mit diesem Ort geschehen sein musste. Da die beiden Männer aber keine Antwort auf ihre Fragen geben wollten oder konnten, fragten sie nicht weiter nach. Sammelten die vom Krieg verschont gebliebenen und in alle Windrichtungen verstreuten Reste ihrer Familien zusammen. Und nachdem sich einer der beiden verstörten Männer als der ehemalige Pfarrer des Dorfes zu erkennen gab, baten sie ihn, die sonntägliche Messe nun auch für sie abhalten zu wollen.
Immer mehr Vertriebene oder Flüchtende kamen und richteten sich in den leeren Häusern ein. Ohne sich jedoch zu einer Dorfgemeinschaft zusammenzufinden. Sie schotteten sich voneinander ab. Wichen einander aus. Und wenn sie sich doch begegneten, was in den engen Gassen unvermeidbar war, redeten sie aufeinander ein, um zu vertuschen, dass sie sich nichts zu sagen hatten.
In dem nun in sie eingedrungenen Schweigen fühlten sie sich die neuen Einwohner dieses kleinen Bergdorfs in den Apenninen zum ersten Mal als eine Gemeinschaft miteinander verbunden.
2.
Zur gleichen Zeit hörte der in Deutschland gefeierte Klarinettist Moses Himmelreich während eines seiner Konzerte Töne, die er noch nie zuvor vernommen hatte.
Schon seit einigen Jahren füllte er Konzertsäle mit seinen Soloauftritten. Sein Name war in aller Munde. Löste Bewunderung aus. Und begann als heller Stern am Musikerhimmel zu leuchten. Moses spürte, dass er an der Schwelle einer vielversprechenden Laufbahn stand. Er genoss den Beifall, den man ihm spendete. Und den Ruhm, der ihm daraus erwuchs.
An diesem Hochsommertag hörte Moses plötzlich Töne, die sich über die von ihm geblasenen zu erheben schienen. Zuerst meinte er, es sei das Echo seiner eigenen, die von den Wänden des Konzertsaals widerhallten. Doch diese Töne hatten mit den von ihm geblasenen nichts gemein. Es waren Töne von einer Vollkommenheit, wie er sie nie erreichen würde. Das wusste er.
Während der nächsten Konzerte kamen die Töne wieder. Sie lugten gleichsam hinter seinen eigenen hervor. Und als wollten sie ihn necken, verstummten sie, sobald er seine Klarinette absetzte. Sobald er sie jedoch wieder an die Lippen führte und seine Töne in den Konzertsaal blies, waren auch diese anderen Töne wieder da. Und er musste sich überwinden, seine eigenen dazuzugesellen. Die, wie ihm schien, diesen anderen kläglich hinterher hüpften.
Es geschah während eines Benefizkonzertes zu Beginn der Adventszeit, dass Moses diese Töne in einer Intensität vernahm, die ihm ein Weiterspielen unmöglich machte. Er brach mitten in seinem Solo ab. Doch als er versuchte, den fremden Klängen nachzulauschen, verstummten auch sie. Noch einmal setzt er sein Instrument an die Lippen. Und kaum hallten die für ihn typischen, in Bögen auf- und abschwellenden Arpeggien in den Saal hinaus, waren auch die anderen Töne wieder da. Die zunächst wie der Nachhall seiner eigenen wirkten. Sich dann von ihnen lösten und selbständige, wunderbare Melodien improvisierten, die seine Variationen in den Schatten stellten.
Mehr noch als die eigenmächtigen Tonfolgen waren es die Töne selbst, die ihn aufmerken ließen. Sie waren von so überwältigender Klarheit, wie Moses sie nie zuvor gehört hatte.
Noch einmal hielt er inne und bemühte sich, die Töne zu erhorchen, die sich zwischen seine drängten. Doch wieder verstummten sie, als er sein Instrument absetzte.
Die Menschen im vollbesetzten Konzertsaal begannen auf ihren Sitzen hin und her zu rutschen. Drehten sich verunsichert einander zu. Flüstern und Hüsteln gingen durch die Reihen. Als es zu einem allgemeinen Murmeln anschwoll, nahm Moses sein unterbrochenes Spiel noch einmal auf. Doch kaum erklangen die ersten Töne, drängten sich diese anderen wieder dazwischen. Als lachten sie über seine stümperhaften Versuche, ihnen gleichzukommen. Verspotteten sein kümmerliches Spiel.
Und auf einmal war ihm das Bühnenlicht, das ihn umgab, zu grell. Der Konzertsaal zu voll. Der ihm zuteilwerdende Applaus unangemessen. Selbst der Klang seines geliebten Instrumentes erschreckte ihn.
Moses unterbrach sein Solo, legte seine Klarinette vor sich auf den Parkettboden. Verbeugte sich vor den raunenden Zuhörern. Und verließ ohne weitere Erklärungen den Konzertsaal.
In diesem Moment wusste Moses, dass er die Sprossen der bereits angelehnten Karriereleiter hinabsteigen, sich aus dem Rampenlicht herausstehlen und nie wieder einen Konzertsaal betreten würde.
Hatte man noch vor kurzem emphatisch seine Hände geschüttelt, waren es jetzt Köpfe, die geschüttelt wurden. Weder seine Kollegen noch seine Bewunderer begriffen, was den umjubelten Musiker zu diesem Entschluss bewegt hatte. Moses wusste, er würde sich lächerlich machen, wenn er ihnen von obskuren Tönen erzählte, die offenbar nur er wahrnahm. Um irgendetwas zu sagen und gleichzeitig zu verschweigen, was er nicht sagen konnte, erklärte er, die Welt um ihn herum sei ihm zu laut geworden. Das Licht auf der Bühne blende ihn. Mache ihn für zu viele Menschen sichtbar. Während er für sich selbst unauffindbar geworden sei.
Solcherlei Reden hinterließen noch mehr Kopfschütteln. Er hörte, wie hinter seinem Rücken von Burnout und Tinnitus getuschelt wurde. Einige rieten ihm, einen Halsnasenohrenarzt aufzusuchen.
Moses bedauerte, all jene zu verwirren, die ihn geschätzt und ihm Beifall gespendet hatten. Er hob seine Schultern.
Auch wenn er ihren Ursprung nicht erklären konnte, wusste er, dass es kein Tinnitus war, der ihn diese wunderbaren Töne hören ließ.
„Es sind Klänge von nie gehörter Schönheit und Tiefe“, sagte er und sah, wie sich die Kollegen zuzwinkerten und sich befremdet von ihm abwandten.
Sein Entschluss blieb unumstößlich.
Daran konnte auch Judith nichts ändern. Die ihn ihrerseits ebenfalls drängte, sich ärztlichen Rat einzuholen. Den sie freilich aus einer anderen Fachrichtung erwartete.
„Was ist denn plötzlich in dich gefahren, Moses? Alle Welt feiert und verehrt dich wegen genau der Töne, die du, wie kein anderer, deiner Klarinette zu entlocken vermagst. Und du suchst nach Tönen, die außer dir niemand zu hören scheint?“
Sie maß ihn mit teils besorgten, teils vorwurfsvollen Blicken.
Er habe im Glitzern seines Ruhmes wohl vergessen, dass er eine Familie habe, die ihn liebte. Und die ihn brauchte.
„Das ist es ja gerade, Judith. Ich habe nicht nur vergessen, dass ich eine Familie habe. Ich komme in mir selbst nicht mehr vor.“
„Ja,“ spöttelte Judith, „vermutlich hat der Beifall so sehr deinen Kopf gefüllt, dass du nichts anderes mehr in ihm antriffst.“
Moses wiegte seinen Kopf hin und her.
Es sei eher so, dass der, den er dort antreffe, nicht der sei, in dem er sich wiedererkenne.
„Und was hat das, bitteschön, mit deinen geheimnisvollen Tönen zu tun?“
„Es sind eben nicht meine Töne“, sagte Moses gequält.
Er wisse selbst nicht, wo sie ihren Ursprung haben. Doch seien sie von einer Reinheit und Tiefe, dass es ihm nicht mehr gelinge, seine ihm jetzt dürftig erscheinenden Klarinettentöne neben sie zu stellen.
„Das ist doch absurd, Moses!“ schrie Judith.
„Warum quälst du mich, Judith? Du weißt, dass ich dich und die Kinder über alles liebe.“
„Über alles?“ höhnte Judith, „wenn überhaupt, dann doch wohl erst an zweiter Stelle. Nach Anerkennung und Ruhm.“
„Und warum glaubst du, kehre ich alldem nun den Rücken?“
„Fest steht, du machst uns zum Gespött der ganzen Stadt! Und darüber hinaus.“
Wenn es das sei, was sie quäle, der Spott der Leute könne ihr nichts anhaben, da er auf ihn und nicht auf sie und die Kinder ziele. Und was es nun genau sei, das sie ihm vorwerfe? Mangelnde Liebe zu seiner Familie? Oder seinen allseits Unverständnis hervorrufenden Rückzug aus Erfolg und Ehrungen?
„Es ist derselbe Ruhm, der mich euch und mir selbst entfremdet hat, in dem auch du dich eingerichtet hast, Judith. Du willst diesen Platz an der Sonne nicht verlieren und verstehst nicht, warum ich ihn freiwillig verlasse.“
„Niemand versteht es!“ rief Judith, „nicht einmal deine besten Freunde. Und ich bezweifle, dass du es selbst verstehst.“
„Es hat nichts mit verstehen zu tun“, murmelte Moses.
Liebevoll strich er über den alten Bösendorfer Flügel, der hinter Judith stand. Auch auf ihm würde er nun nicht mehr spielen.
Tief in seinem Inneren ahne er Musik, die mit nichts vergleichbar sei, was seine Ohren je zuvor gehört haben.
„Ich muss herausfinden, wo sie ihren Ursprung hat.“
Plötzlich hellte sich Judiths Gesicht auf. Und sie warf ihm einen schelmischen Blick zu.
„Es sind die Obertöne, die du plötzlich deutlich heraushörst, mein lieber Moses. Natürlich! Ist es nicht das, was du dir immer gewünscht hast? Und jetzt hörst Du sie getrennt von den Grundtönen deines Klarinettenspiels. Das ist doch wunderbar! Und ausgerechnet jetzt willst du deine Karriere aufgeben?“
„Nein,“ sagte Moses. Die Obertöne höre er schon lange in seinen geblasenen Tönen mitschwingen.
Er schaute über Judith hinweg.
„Die Töne, von denen ich spreche, haben nichts mit den Obertönen zu tun. Und schon gar nicht mit dem beharrlich pfeifenden kleinen Mann im Ohr, den man Tinnitus nennt, wie es mir meine Kollegen suggerieren wollen. Die Töne, die ich höre, klingen wie Töne aus einer anderen Welt… ich weiß, das hört sich verrückt an. Aber bisher ist es mir nicht geglückt, eine andere Erklärung dafür zu finden.“
Judith musterte ihn besorgt.
Ob er sich nicht doch lieber Hilfe von außen holen wolle? Noch sei es nicht zu spät. Er solle wissen, dass seine Familie hinter ihm stehe. Gerade jetzt, da er sich offenbar in einer schwerwiegenden inneren Krise befinde.
„Ich flehe dich an, Moses, warte nicht, bis alles zerstört ist! Dein Leben. Und das deiner Familie.“
„Ich muss den Ursprung dieser Töne ergründen. Sie haben sich mir zu erkennen gegeben, um mich wissen zu lassen, dass alles, was ich bisher gehört und selbst gespielt habe, nur klägliche Versuche sind. Ich weiß nicht, ob es einen Ort gibt, an dem ich sie wieder hören werde. Aber ich weiß, dass es im Trubel der Konzertwelt nicht möglich sein wird. Ich habe keine Wahl, ich muss ihrem Lockruf folgen. Wo und wann immer sie sich mir offenbaren mögen.“
Sein Blick, der sich in unbestimmte Weiten verloren hatte, kehrte zurück. Und einen Augenblick lang schien es Judith, als wankte Moses in seinem Entschluss. Doch noch ehe sie seinen Zweifel, den sie zu bemerken meinte, nutzen konnte, um ihn vielleicht doch noch zur Umkehr zu bewegen, fuhr Moses mit fester Stimme fort.
„Für dich und die Kinder ist gesorgt.“
Wie sie wisse, habe er ein nicht unbeträchtliches Vermögen für sie alle eingespielt. Darüber könne sie frei verfügen. Er habe nur einen Bruchteil davon für sich selbst abgezweigt.
„Für meine Reise ins Ungewisse brauche ich nicht viel“, fügte er hinzu.
Und obwohl er sich selbst nicht verstand, bat er Judith noch einmal, ihn zu verstehen. Als er jedoch sah, wie sich ihr Gesicht verzerrte und sie vergeblich versuchte, Wut und Tränen zurückzuhalten, begriff er, sie würde ihn niemals verstehen. Auch sonst niemand. Er wusste ja selbst nicht, was mit ihm geschah. Nur, dass er der drängenden Sehnsucht folgen musste, die diese Töne in ihm erzeugt hatten.
Als Judith am späten Nachmittag wieder in ihre gemeinsame Wohnung in Berlin-Charlottenburg zurückkehrte, fand sie eine Nachricht auf der geöffneten Tastatur des Flügels.
„Ich kann nicht anders.“
Darunter stand noch „verzeih mir!“, doch das war durchgestrichen.
Obgleich im protestantischen Glauben erzogen, konnte Judith mit diesem Luther- Satz nichts anfangen. Nachdem sie den säuberlich geschriebenen Zettel gelesen hatte, las sie ihn noch einmal. Und noch mal. Und ein weiteres Mal. Als sie zu ahnen begann, dass sich ihr der Sinn dieser vier und der zwei durchgestrichenen Worte auch nach noch so häufigem Lesen nicht erschließen würde, hämmerte sie mit beiden Fäusten auf die Klaviatur ein. Bis ihre Handkanten schmerzten. Stieß gellende Schreie aus, die sich mit den dissonanten Klängen des Klaviers zu einer schrillen Kakophonie vermengten. Warf den dunkelbraun lackierten Deckel über die Tasten. Zerriss Moses’ Zettel. Und erzählte den Kindern, dass ihr Vater für unbegrenzte Zeit verreist sei.
Doch Niklas, der jüngere von beiden, wollte sich mit dieser vagen Auskunft nicht zufriedengeben.
„Was heißt unbegrenzt, Mami?“
„Das heißt, dass Mami nicht weiß, wann Vater wieder zurückkommt“, erklärte Samuel von oben herab.
„Aber Weihnachten wird Vati doch wieder zurück sein?“
„Ich fürchte nein, Niklas. Dein Vater ist auf Tournee. Weit weg von hier“, sagte Judith und versuchte ihre Tränen zu verbergen.
„Was ist Tournee? Ist das eine Insel?“ fragte Niklas.
Samuel lachte.
„Ja, eine Insel im Notenmeer! Du bist ein Trottel, Niklas! Vater spielt irgendwo Klarinette. In Japan, oder so.“
„Ist Japan auch eine Insel im Notenmeer?“
„Ach, vergiss es!“
Wie kommt er auf eine Insel? dachte Judith.
„Dein Vater wird Weihnachten nicht zurückkommen“, wiederholte sie.
Niklas zupfte an ihrem Ellbogen. Er hatte sich daran gewöhnt, dass sein Vater die Festtage nur selten zu Hause verbrachte.
„Aber nach Weihnachten, da wird er zurückkommen, Mami?“
Er schmiegte sich an ihren Rock.
Der Kleine spürt es, dachte Judith. Ja, Moses hat sich auf eine Insel verkrochen.
„Nein, Niklas, Vater wird auch nach Weihnachten nicht zurückkommen.“
Sie umwickelte Niklas‘ Händchen in ihrer Rockfalte.
„Aber er wird doch Geschenke schicken. Von der Insel im Notenmeer?“
Als keine Antwort kam, sah er zu seiner Mutter hoch.
Keine Geschenke? Sein Vater hatte immer Geschenke geschickt, wie weit er auch von zu Hause weg war.
„Er hat uns verlassen, stimmt‘s?“ sagte Samuel und knallte seinen Teller auf den Küchentisch, „er kommt überhaupt nicht mehr zurück. Ist doch so?“
„Ist er tot?“ fragte Niklas.
„Egal. Ob tot. In Japan. Oder sonst irgendwo. Das kommt doch auf dasselbe raus. Er ist ja sowieso nie zu Hause.“
„Dein Vater ist Musiker, Samuel. Es ist sein Beruf, unterwegs zu sein.“
„Dann soll er doch seine Klarinette heiraten! Und mit ihr Kinder haben!“
„Samuel!“
„Ach, Scheiße! Ist doch so.“
Samuel sprang vom Stuhl auf.
„Wenn Klarinetten Kinder kriegen, sind das dann kleine Klarinetten?“ fragte Niklas.
Und als Judith ihre Tränen nicht mehr zurückhalten konnte, schlüpfte Niklas aus ihrer Rockfalte und schaute verwirrt zu Samuel hoch.
„Ja, so wie du!“ krächzte Samuel, und legte seine Arme um seinen Bruder, „du bist wirklich ein Trottel, Niklas!“
3.
Moses ahnte, dass die geheimnisvollen Töne nicht an einem bestimmten Platz zu suchen waren. Und obwohl sie sich auf der Bühne eines Konzertsaals offenbart hatten, vermutete er ihren eigentlichen Ursprung in der Stille. Dort, wo sie in ihrer Makellosigkeit durch keine anderen Töne gestört würden. Auch nicht durch die von ihm selbst erzeugten. Mit denen er sie zwar aus ihren Tiefen gelockt, sie aber dann offenbar enttäuscht und verschreckt hatte.
Und so begab er sich ohne seine geliebte Klarinette auf eine Reise in die toskanischen Apenninen, von deren Stille und Einsamkeit er in einer Reportage gehört hatte.
Er verband seine Sehnsucht nach den erlauschten Tönen mit einer anderen alten Sehnsucht, die seit seiner Jugendzeit in ihm schwelte. Italien. Das Land des Lichts. Das für ihn immer schon auch das Land der Musik war.
„Was um alles in der Welt erhoffst du dir in Italien zu finden, was du nicht auch hier finden könntest?“ fragte einer seiner Kollegen, als er von seinem Entschluss hörte.
Als Moses von der Suche nach Tönen erzählte, die sich ihm offenbart hatten und die er in der Stille wiederzufinden hoffte, sah ihn der Kollege belustigt an.
„Und die willst du in Italien finden? Ausgerechnet in Italien? In einem Land kakophonischen Gelärms?“
Er habe nicht vor, diese Töne auf der Piazza San Marco oder im Gewühle knatternder Mofas zu suchen, sagte Moses unbeirrt. Er habe keine Ahnung, wo er sie finden werde. Wüsste er es, müsste er sie nicht suchen. Und in Italien wolle er mit seiner Suche beginnen.
Er fuhr mit dem Alpenexpress bis Bologna, wo er in den ‚direttissimo‘ nach Piccenio umstieg. Von dort aus wollte er seine Wanderung durch die Apenninen beginnen.
Musikerfreunde hatten ihm von einer Wanderroute erzählt, die von Modena über die Garfagnana ans tyrrhenische Meer führe. Doch Moses wollte einen eigenen Weg durch diese Bergewelt gehen. Abseits ausgetretener, von Wanderern bevölkerter Pfade.
„Du musst immer und überall deinen eigenen Weg gehen.“
Wie oft hatte er dies von seinem Ziehvater mit vorwurfsvollem Ton zu hören bekommen. Als sei dies etwas Anrüchiges, ein Makel, den es zu beheben galt. Ja, er war immer seinen eigenen Weg gegangen. Wessen Weg hätte er denn sonst gehen sollen? Es gab nur diesen einen Weg. Den, den man selbst ging. Und diesen Weg ging er. Wohin er ihn auch führte.
Moses stand noch auf dem Trittbrett, da fuhr der Zug schon wieder los. Stolpernd setzte er seinen Fuß auf den lang ersehnten italienischen Boden. Hielt eine paar Minuten inne. Außer ihm war niemand hier ausgestiegen. Das heruntergekommene Gebäude sah nicht aus wie ein Bahnhof. Doch dann entdeckte er die teils schon abgebröckelten Buchstaben auf der rußverschmierten Ziegelwand. „Stazione di Piccenio“.
„Italia“, murmelte er vor sich hin.
Wie hatte er auf diesen Augenblick gewartet!
Er wusste nicht, wie lange er schon vor dem Bahnhof stand, als er ein „Buongiorno, Signore!“ hörte.
Ein hagerer Mann schob ein Fahrrad auf ihn zu, an dem eine mit Briefen gefüllte Ledertasche hing.
„Buongiorno,“ antwortete Moses. Und beim Aussprechen des melodiösen Grußwortes spürte er wieder, dass sich seine lange unterdrückte Sehnsucht zu erfüllen begann.
„È freddo, vero?“ sagte der Mann und hievte die Tasche mit den Briefen von seinem Fahrrad.
Jetzt spürte auch Moses die feuchte Kälte, die sich von seinen Füßen aufwärts überall in seinem Körper auszubreiten begann.
„Un freddo boia!“ fügte der Mann hinzu. Und warf Moses einen vorwurfsvollen Blick zu. Als habe er die „Henkerkälte“ hier eingeschleppt.
Um dem Mann, der offensichtlich der örtliche Briefträger war, zu zeigen, dass auch ihn diese unerwartete Kälte überraschte und zu schaffen machte, schlang Moses seine Arme mehrmals um Brust und Schultern.
Ja, es war kalt. Sehr kalt. Und feucht. Und der Himmel war grau. Sehr grau. Verblüfft musste er feststellen, dass er sich Italien immer nur warm und sonnig vorgestellt hatte.
Trotzdem hielt das Glücksgefühl in ihm an. Eine Sehnsucht hatte sich erfüllt. Hier würde sich auch die andere Sehnsucht erfüllen. Wenn es einen Ort gab, an dem diese Töne sich wieder offenbarten, dann würde es hier in Italien sein. Das spürte er.
Moses nickte dem postino zu. Warf sich seinen Rucksack über die Schulter. Und marschierte auf der sich aufwärts schlängelnden Straße den wolkenverhangenen Berghängen entgegen. Kaum hatte er die Häuserreihen hinter sich gelassen, merkte er, dass ihm die „Henkerskälte“ von Piccenio tief in den Körper gekrochen war und er sie mit sich schleppte. Nun bliesen auch noch eisige Windböen von den Bergen herunter auf ihn zu. Und Moses hatte Mühe, nicht von der Straße geweht zu werden. Er stemmte sich mit aller Kraft dagegen. Konnte aber nicht verhindern, dass noch mehr Kälte in seine Ärmel und Hosenbeine eindrang.
Schließlich sah er ein, dass er so nicht weiterkommen würde. Er kehrte wieder um. Flüchtete ins Innere des kleinen Bahnhofs. In dem es kaum wärmer war als auf der Straße. Aber immerhin windgeschützt. Als ein dampfender Espresso vor ihm stand und er seine Hände an der heißen Tasse aufgewärmt hatte, fühlte er sich besser. Er verließ das Bahnhofscafé. Und machte sich noch einmal auf den Weg, um vor der Dunkelheit den nächsten Ort zu erreichen.
Der Wind wurde immer heftiger. Und immer kälter. Moses stampfte unverdrossen gegen beides an. Und wunderte sich, dass ihm die Welt, die er zurückgelassen hatte, nicht fehlte. Er hatte sich ihr nie ganz zugehörig gefühlt. Weder der Welt der Musiker. Noch der Welt derer, die er mit seiner Musik in Bann gezogen hatte. Auch Judith und die Kinder fehlten ihm nicht. Er sah sie deutlich vor seinem inneren Auge. Judith, Samuel und Niklas. Er trug sie in seinen Gedanken mit sich. Aber sie fehlten ihm nicht. Und Moses schämte sich dafür.
„Bin ich ein Monster?“ rief er gegen die Böen an, die ihm die Worte aus dem Mund zerrten und von ihm wegbliesen.
Wie war es möglich, dass er sich so reuelos von seiner Familie trennen konnte? Er dachte an seine Musikerkollegen, die Familie und Kinder hatten. Keiner von ihnen würde freiwillig seine Familie verlassen. Schon gar nicht wegen Tönen, die sich weder beschreiben noch abrufen ließen. Und die sich ihm seit dem Tag, als er sich auf die Suche nach ihnen machte, kein einziges Mal mehr offenbart hatten.
„Ich werde sie finden“, rief er in die verwaiste Landstraße hinein, die sich durch verlassen wirkende graue Häuser schlängelte.
Er wusste nicht, ob er die Töne damit meinte. Oder die Antworten auf Fragen, die in sein Bewusstsein drängten. Die aber, sobald er sie zu formulieren versuchte, in Schichten seines Inneren hinabsanken, zu denen er keinen Zugang hatte. Er spürte, dass sich tief in ihm etwas bewegte, das sich seinem Willen entzog. Und seinen Körper ohne eigenes Zutun gegen die Kälte anschob.
In Tisana unterbrach Moses seine Wanderung. Er musste sich eingestehen, dass er nicht angemessen gekleidet war.
Doch es gab nur einen kleinen Bekleidungsladen in dem Ort. Der bereits auf die Sommerkollektion umgestellt hatte. Moses erwarb zwei Baumwollpullover, einen winddichten Parka, einen dünnen langen Schal und mehrere sommerliche Mützen. Und fror weiter. Auch der Versuch, sich mit ausladenden Schritten aufzuwärmen, half ihm nicht, die Kälte von sich abzuschütteln. Je mehr er ausschritt, desto mehr fror er. Er zog die zwei Pullover übereinander. Stopfte seine Schuhe mit Papiertaschentüchern aus. Schlang den neu erworbenen Schal mehrmals um Kopf und Hals. Und fror immer noch. Der beißende Wind zerrte an allen Fasern seines Körpers. So kalt hatte er sich Italien nicht vorgestellt.
Kurz vor Tisana Alta fiel Schnee. Die entlaubten Zerreichen verschwanden hinter einer weißen Flockenwand. Der Schnee fiel so dicht. dass Moses erst merkte, dass er sich bereits mitten im Ort befand, als er ein beleuchtetes Barschild auftauchen sah.
Der Mann hinter der Theke zeigte wenig Bereitschaft, Moses‘ Italienischkenntnisse zu würdigen. Er schlabberte ihm ein fast unverständliches „m’dispiace, Signore“ entgegen. Und als Moses seine Frage wiederholte, sah der Mann ihn nur ausdruckslos an.
Irgendwo müsse es doch eine Möglichkeit zum Übernachten geben, beharrte Moses. Es werde bald dunkel. Es schneie immer heftiger. Und er habe Hunger.
Der Barmann musterte den schlotternden Fremden. Bewegte seinen Oberkörper schaukelnd vor und zurück. Eine Geste, die Moses nicht zu interpretieren wusste. Und weil er immer noch glaubte, der Mann habe ihn nicht verstanden, schüttelte er sich, gab ein wieherndes „Brrrr“ von sich. Und führte seine beiden Hände in Pfötchenstellung ruckelnd zu seinem Mund.
Der Barmann unterbrach die Schaukelbewegungen seines Körpers. Ließ noch einmal seinen Blick über den in mehrere Schals und Mützen Vermummten gleiten. Knurrte „aspetti! Warten Sie!“ Und verschwand hinter einer niedrigen Tür neben der Theke.
Die Temperatur in der Bar war kaum höher als auf der Straße. Aber es fiel kein Schnee, blies kein Wind, und das im Hintergrund knisternde Feuer ließ Moses auf Zuflucht vor der hereinbrechenden Nacht hoffen.
Eine Frauenstimme murmelte monoton. Der Mann bellte dagegen an. Doch es gelang Moses nicht, einzelne Worte aus ihrem ungleichen Dialog herauszuhören. Seine Italienischkenntnisse schienen ihm hier zu nichts nütze zu sein.
Dann war es plötzlich still.
Der Barmann erschien in der Tür.
„Venga! Kommen Sie!“
Moses folgte ihm.
Sie kamen in einen winzigen Raum, der nur aus einer offenen Feuerstelle und einem klapprigen Plastiktisch bestand. Über der Tischplatte hing eine ringförmige Neonlampe, die bläuliches Licht auf die verrußten Wände warf. Beißender Qualm füllte das Zimmer.
Als Moses zu einem Grußwort ansetzen wollte, musste er husten. Zögerlich zog er seine Mützen vom Kopf. Lockerte seine Schals. Brachte schließlich ein prustendes „buonasera“ aus sich heraus. Und hielt nach der Frau Ausschau, deren Stimme im Verborgenen weitermurmelte. Bis er schließlich ein in schwarze Kittel gehülltes Bündel entdeckte, das mit einer Kaminzange im zischelnden Feuer fuhrwerkte.
Auch sein an sie gerichtetes „buonasera“ blieb unbeantwortet. Der Mann wies mit dem Kinn auf einen der Stühle, die den Tisch säumten. Das in schwarze Kittel gehüllte Bündel erwies sich als die Frau, zu der das Murmeln gehörte. Alles an ihr war schwarz. Die Kittel, das Tuch, das ihren Kopf bedeckte. Und die kohlenschwarzen Augen, die aus ihrem zerfurchten Gesicht misstrauisch herausblitzten.
So ärmlich der düstere Raum wirkte, so überraschend schmeckte Moses das Essen, das die beiden Alten mit ihm teilten. Die Frau murmelte unaufhörlich vor sich hin. Vielleicht murmelte sie auch gegen den Mann an. Der sowohl sie als auch Moses vollkommen ignorierte, als säßen sie nicht am selben Tisch.
Mit großer Geschwindigkeit schlang er Bandnudeln mit Fleischsoße in sich hinein. Und hatte seinen Teller bereits geleert, bevor Moses zu essen angefangen hatte. Die Frau füllte den Teller ihres Mannes noch zweimal nach. Als er ihn abwinkend beiseiteschob, stand sie auf und nahm auch Moses‘ den noch kaum angetasteten Nudelteller mit. Wohl in der Annahme, der fremde Gast sei nicht in der Lage, mit einem Nudelgericht zurechtzukommen.
Gleich darauf brachte sie zwei Eisenpfannen, knallte sie auf den Tisch und rief:
„Spezzatino di cinghiale con ceci e bietola. Wildschweingulasch mit Kichererbsen und Mangold.”
Sie schrie es wie einen Befehl aus sich heraus.
Moses zuckte erschrocken zusammen. Mit einem zweiten Gang hatte er nicht gerechnet. Er lächelte verlegen. Bediente sich aus beiden Pfannen. Und fing, um nicht auch noch diesen Gang zu verpassen, gierig zu essen an.
Aber wieder gelang es ihm nicht, mit der Geschwindigkeit seiner Wirtsleute mitzuhalten. Der Mann löffelte das Wildschweingulasch wie ein Schaufelbagger in seinen Mund. Schluckte die Brocken fast unzerkaut hinunter. Wischte sich dann mit dem Handrücken über die Lippen. Und schob den Teller wortlos von sich. Worauf ihn seine Frau, ohne ihren Sprechgesang zu unterbrechen, neuerlich bis zum Rand füllte.
Der Mann aß und knurrte. Die Frau sah ihm dabei zu und murmelte. Das war ihre Art, miteinander zu kommunizieren.
Als Moses sich bedankte, wollte die Frau ein weiteres Mal Kichererbsen und Wildschweingulasch auf seinen Teller häufen. Moses breitete beide Hände über seinen Teller. Bedankte sich noch einmal. Und erkundigte sich nach einer Unterkunft. Der Mann zuckte mit dem Kinn. Worauf die Frau Moses mit einer knappen Kopfbewegung aufforderte, ihr zu folgen. Und im Gang neben der Küche ein Nachtlager für den ungebetenen Gast herrichtete.
Als Moses am nächsten Tag aufbrach, lag eine geschlossene Schneedecke vor ihm. Und es schneite immer noch weiter. Hinter Gramigna wurde es kälter. Und das Schneetreiben nahm zu. Er beschloss, seine Reise zu unterbrechen, um sich erst einmal an die heimtückische Kälte zu gewöhnen, die mittlerweile tief in seine Knochen eingesickert war.
In Logaiolo suchte er nach einer Unterkunft.