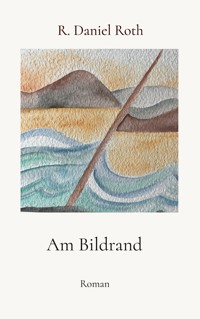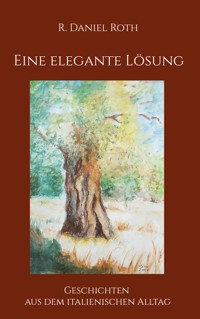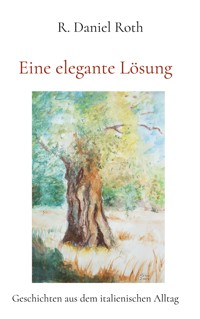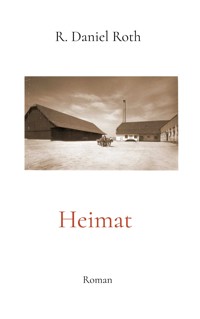
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es gibt Orte, in denen sich die Wut der ganzen Menschheit verdichtet. Und niemand, der an einem solchen Ort lebt, kann sich dieser Wut entziehen. Sie ist wie eine ansteckende Krankheit, eine Seuche. Die jeden erfasst, der mit ihr in Berührung kommt. Sie kriecht tief in einen hinein. Und lässt einen nie wieder los. Lapping war so ein Ort. Hier hatte mein Vater von Anfang an keine Chance. Und ich auch nicht. Die in Lapping schwelende Wut erfasste auch die Dorfbewohner von Wimling. Ging dann auf Niederkattlhofen über. Bis schließlich alle unsere drei Dörfer voller Wut waren. Sie entlud sich vom Stärkeren, zum weniger Starken, zu den Schwächeren hin. Nur die Allerschwächsten, die niemanden mehr fanden, an denen sie ihre Wut auslassen konnten, fraßen sie in sich hinein. Wo sie weiterkochte. Die Wut kochte in Mater Graziana. Und im Hauptlehrer Kager. Sie kochte in unserem Stier. Und in unserem Eber. Und ganz besonders in unserem Hofhund Wampo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 399
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
an meinen Vater, für meine Mutter
„Sprechen und Denken sind eins.“
Karl Kraus
Inhaltsverzeichnis
Erster Teil Spucke im Kopf
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Zweiter Teil Schande
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Dritter Teil Ich bin es nicht
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Epilog
Erster Teil
Spucke im Kopf
1.
Ich bin der Heinrich Hofer.
Der Hanswurst. Der Trottel. Der Dorfdepp. Und ich war schon tot, als ich geboren wurde.
Dabei hatte es gar nicht so übel angefangen. Ich bin nämlich an einem Sonntag geboren. Einem Sonntag im August, der mich und die letzte Sommerhitze ausbrütete.
Das war aber auch schon alles.
Vermutlich habe ich das bereits geahnt, als mich meine Mutter in die Welt zu pressen versuchte. Denn ich wehrte mich so gut ich konnte. Und meine Mutter hatte viel Mühe damit. Als ich schließlich doch herausschlüpfte, war ich tot. Jedenfalls glaubte das meine Mutter. Und sie war recht traurig, wo doch nun die ganze Plackerei umsonst gewesen sein sollte. Selbst mein Vater muss betroffen dreingeschaut haben, will man den Aussagen meiner Omi Glauben schenken.
„Nein!” soll meine Omi gerufen und meiner Mutter den Schweiß von der Stirn gewischt haben, „der Junge ist doch ein Sonntagskind!”
Dann hat sie mich an meinen verschrumpelten Winzlingsfüßen gepackt. Mich abwechselnd in kaltes und heißes Wasser getaucht. Und mir unaufhörlich Klapse auf den Po verabreicht. Worauf nun auch sie sich Schweiß von ihrer Stirn wischen musste.
„Der Teufel scheißt immer auf denselben Haufen“, soll mein Vater geknurrt und kopfschüttelnd das Schlafzimmer verlassen haben. Erzählte mir meine Omi später. Und tief in mir drinnen habe ich gespürt, dass von irgendwoher viel Unerfreuliches auf den Lebensweg meines Vaters gefallen sein musste. Und ich mit zu diesem Unerfreulichen gehörte.
Dass mein Vater sich gerne in Sprichwörtern ausdrückte und sich nicht darum scherte, ob sie so, wie er sie verwendete stimmten, habe ich freilich erst viel später herausgefunden. Er benutzte sie, wie sie ihm gerade in den Kram passten.
„Der Junge ist ein Sonntagskind! Und damit basta!“ rief meine Omi noch einmal und klatschte mit beiden Händen auf den Nachttisch. Immerhin sei sie zu diesem Anlass eigens aus Holzing angereist.
Die Hebamme, nach der mein Vater bereits beim Einsetzen der Wehen geschickt hatte, war immer noch nicht da. War jetzt auch nicht mehr vonnöten. Flirrende Hitze erfüllte das Schlafzimmer. Kein Lüftchen erfrischte meine Mutter. Die zurückgefallen mit nassen strähnigen Haaren in den dampfenden Kissen lag. Und in unregelmäßigen Atemzügen vor sich hin stöhnte.
Sollte das Ergebnis dieser Qualen so kläglich gewesen sein?
Meine Omi jedoch war fest entschlossen, mich in diese Welt hinein zu prügeln.
Als ich es nicht mehr aushielt, mich weiter tot zu stellen, und zu strampeln und zu brüllen anfing, atmete meine Omi auf. So laut, dass es auch mein Vater, der vor der Tür stand, hörte. Und wieder hereinkam. Noch einmal seinen Kopf schüttelte. Und einen misstrauischen Blick auf seinen Sprössling warf. Der schon bei seiner Geburt aus der Reihe tanzen musste. Und den er nun für diese Welt gefügig zu machen gedachte. Die er für die seine hielt. Und in der ich mich nach seinen Vorgaben zu verhalten habe. Wie ich später erfahren durfte.
Ich spürte schon damals, dass ich am falschen Tag zur falschen Zeit in einem Zug abgesetzt worden war, der in die falsche Richtung fuhr. Oder wie ein Baum, der an einen Ort gepflanzt wurde, an dem er nicht gedeihen konnte. Mit dem Unterschied, dass ich mich von dem mir zugedachten Ort würde wegbewegen können. Aber das wusste ich damals noch nicht.
Sie sei freilich wenig einladend gewesen, diese Welt, in der ich nun angekommen war, gab meine Omi zu. Es sei nicht der richtige Zeitpunkt gewesen, die Welt zu betreten. Die damals in Trümmern lag. Und nach Krieg roch. Und der richtige Ort war es schon gar nicht.
Aber mich hat natürlich keiner gefragt.
Doch nun hatte mich meine Omi lebendig geschlagen. Und so laut ich auch brüllte und mit meinen Beinchen und Ärmchen ruderte: es war zu spät. Ich konnte nicht mehr dorthin zurück, von wo ich gekommen war.
Dann kam der Dünzl, unser Rossknecht, mit seinem Pferdefuhrwerk auf unseren Hof gefahren. Er war der Erste, der meinem Vater zu seinem Stammhalter gratulierte. Sogar seine Pfeife habe er aus dem Mund genommen. Sagte meine Omi. So ergriffen war er von diesem Häufchen Leben, das sich in dieses trostlose Kaff verirrt hatte.
Die Augusthitze lastete schwer auf dem niederbayrischen Dorf. Mein ganzes Leben sollte mich die Sommerhitze an diese unguten Momente erinnern. Es herrschte jene pralle Stille, die alles, was lebt, zu Boden drückt. Die Katzen verkrochen sich unter Bänken und Maschinen. Wampo, unser Hofhund, vergaß sein Bellen und igelte sich in seiner Hütte ein. Selbst die Bäume duckten sich unter die kochende Stille. Das Vieh auf den baumlosen Weiden litt am meisten. Die Schweine pressten sich nah an die Stallwand. Die Kühe versuchten vergeblich, sich so zu stellen, dass sie einander Schatten gäben. Und aus der Ferne drang das Geräusch eines vereinzelten Traktors durchs offene Schlafzimmerfenster. Der Raglkofer war immer noch auf den Feldern. Weiß der Teufel, was er gegen Ende August dort draußen zu tun hatte.
Als der Dünzl hereinkam, hörte ich auf zu schreien. Und nun trauten sich auch die Arbeiter herein, die vor der Schlafzimmertür gewartet hatten. Meine Omi schaukelte mich summend hin und her. Und ich wurde an viele Münder gedrückt.
In der Hoffnung, es würden keine weiteren Münder auf mir herumschmatzen, fing ich gleich nochmal zu schreien an. Und meine Omi legte mich neben meine Mutter zurück. Die kaum Kraft hatte, mich an ihre Brust zu betten. Doch schon wurde ich neuerlich von ihr weggezerrt. Von Mund zu Mund weitergereicht. Bis ich von all den Küssen vollkommen besabbert war.
Sie fuhren mit ihren Zeigefingern über meine Nase, die noch ein Näschen war. Sie sagten ‚duuutz, dutz, dutz‘. Und ich spürte, dass sie nicht mich mit dem meinten, an dem sie sich zu schaffen machten. Das konnten sie auch gar nicht. Denn der, an dem sie herumfummelten, und den meine Omi mit beherzten Klapsen ins Leben gelockt hatte, war nicht ich. Jedenfalls nicht alles von mir. Und ich bin sicher, dass ich schon damals tief innerlich spürte, dass das Wesentliche von mir nicht mit herausgekommen war.
Nach und nach war das ganze Dorf angetreten, um den Sprössling des neuen Gutsverwalters in Augenschein zu nehmen. Und ihn scheinheilig zu betätscheln. Denn tatsächlich befürchteten sie, dass sich mit diesem neuen Leben einer dazugesellte, der nicht dazugehörte. Das wollten sie auf gar keinen Fall. Denn wenn sie sich auch im Gewohnten langweilten, so war es ihnen doch immerhin vertraut. Alles Fremde und Neue würde einen bedrohlichen Einbruch in das bedeuten, worin sie sich seit Generationen anödeten.
Jetzt kam auch der Raglkofer durch unser Hoftor gedonnert. Berichtete meine Omi. Er ließ den Lanz noch ein paar Mal aufbellen. Drosselte die Dieselzufuhr solange, bis der Eintakter würgende Geräusche von sich gab. Und endlich stillhielt. Zwischen Garage und Pferdestall traf er auf den Dünzl. Der in ausladenden Bewegungen schaumigen Schweiß von den glänzenden Leibern der massigen Belgier wischte. Der Raglkofer hätte gern einen Bogen um den Dünzl gemacht. Er wusste, dass dessen Tage als Rossknecht auf unserem Hof gezählt waren. Denn schon bald würde es einen weiteren Traktor geben. Noch einen. Und noch einen. Dann brauchte mein Vater keinen Rossknecht mehr.
Doch der Dünzl hatte den Raglkofer schon gesehen.
„Der neie Verwoita hot wos Kloans kriagt!“ rief er ihm zu. Ohne die Pfeife aus dem Mund zu nehmen.
Der Raglkofer habe nur blöd gegrinst. Und ohne Umschweife den Hof verlassen. Sagte meine Omi. Von der neuen Existenz auf unserem Hof habe er nichts wissen wollen.
Mein Vater war Verwalter auf dem gräflichen Gut von Lapping. Das etwas abgesondert am östlichen Dorfrand lag. Ein typischer bayrischer Vierkanthof, der von Scheune, Ställen, Geräteschuppen und Wohnhaus umschlossen war. Und mein Vater war sehr stolz auf seinen Hof. Der nicht seiner war. Er war auch stolz darauf, bei einem richtigen Grafen zu arbeiten. Obwohl ihm das kein Glück brachte. Aber das wusste er damals noch nicht.
Lapping ist die größte von drei gottverlassenen niederbayrischen Ortschaften, die sich in eine ausladende Donauschleife schmiegen. Eine schmale Straße durchschneidet riesige Weizenfelder, führt westlich nach Wimling und östlich nach Niederkattlhofen, dem Gemeindesitz der drei Dörfer.
In unsere drei Dörfer hineinzufinden ist einfach. Wieder herauszukommen beinahe unmöglich.
In unregelmäßigen Abständen fallen die Jugendlichen der Dörfer übereinander her. Verprügeln sich so lange, bis ein Dorf die Oberhand gewinnt. Der so entstandene Burgfriede ist jedoch trügerisch. Schon nach kurzer Zeit fängt es in den unterdrückten Dörfern wieder zu gären an. Und sie fallen neuerlich übereinander her.
Das war immer so. Und wird immer so bleiben.
Da jedes unserer drei Dörfer einen anderen Dialekt sprach, gab es keine wirkliche Verständigung zwischen den Wimlingern, Niederkattlhofenern und Lappingern. Und auch später, als die Dörfer längst zu einem großen Dorf zusammengewachsen waren, und ihre Dialekte ineinander verschmolzen, taten sie weiter so, als verstünden sie sich nicht.
Die Leute unserer drei Dörfer hatten sich ohnehin nichts zu sagen. Gingen sich aus dem Weg, wo sie nur konnten. Nur sonntags, in der Kirche von Niederkattlhofen, standen sie heuchlerisch dem Altar zugewandt. Starrten auf den Mund vom Pfarrer Wandlinger. Aus dem Worte kamen, die sie nicht verstanden. Und auch gar nicht verstehen wollten.
Die Leute in unserem Dorf mochten meinen Vater nicht. Weil er ein Ausländer war. Für sie war jeder ein Ausländer, der nicht in Lapping geboren wurde. Ein Zugereister. Einer, der nicht dazugehörte. Ein Fremdkörper. Sie verstanden nicht, was er sagte. Begriffen nicht, was er tat. Und nun stellten sie voller Groll fest, dass noch ein weiterer Fremdkörper hinzugekommen war.
Vielleicht hofften sie ja insgeheim, mich mit ihren scheinheiligen Liebkosungen zu ersticken.
Ich schrie so lange, bis sie endlich gingen. Dann drapierte mich meine Omi wieder an die Brust meiner Mutter. Wo mich weiche Geborgenheit empfing. Doch von all dem Gedrängel und Gesabber hatte ich Durst bekommen. Als ich mich jedoch noch näher an meine Mutter herankuschelte, um mir ihre Milch zu erlutschen, wartete bereits die nächste unangenehme Überraschung auf mich. So sehr ich auch saugte. Da kam nichts. Ihre Brustwarzen blieben trocken. Meine Mutter war von den vorangegangenen Jahren ihrer Flucht so ausgemergelt, dass sie keinen Tropfen Milch für mich hatte.
Leider hatten auch unsere Kühe ihre Milchproduktion eingestellt. Als wollten sie sich für die vernachlässigte Fütterung während der letzten Kriegsjahre an uns rächen. Da war nichts zu machen. Mein Durst blieb ungestillt. Und ich fing wieder zu schreien an.
Glücklicherweise donnerten fast täglich amerikanische Armeeautos durch unsere drei Dörfer. Die Amerikaner warfen Kaugummis, Trockenmilch und Zigaretten aus den offenen Autofenstern. Lachten und gaben breiige Laute von sich. Über die Zigaretten freute sich meine Mutter besonders. Doch da mein Vater nicht duldete, dass sie rauchte, versteckte sie sie schnell in ihrem Kittel. Legte nur die Trockenmilchpäckchen vor ihn hin. Worauf mein Vater wieder mal nicht wusste, was er dazu sagen sollte. Und vermutlich gar nicht begriff, warum meine Mutter die Trockenmilch so feierlich vor ihm aufbaute.
Ich erinnere mich nicht, ob mir die Trockenmilch der Amerikaner geschmeckt hat. Aber ein starkes Gefühl der Dankbarkeit hat sich in mir festgesetzt. Für die Amerikaner. Es hielt auch an, als mich mein Onkel Hans Jahre später darüber belehrte, dass die Amerikaner sich stets ungefragt ins Weltgeschehen einmischten. Und Dank für etwas einforderten, das man nicht wirklich von ihnen gewollt hatte.
Dass mich ihre Trockenmilch vorm Verhungern gerettet hat, ließ der Onkel nicht gelten. Wahrscheinlich hat seine Mutter seinerzeit ausreichend Milch für ihn gehabt. Oder die Kühe seines Vaters.
2.
Es waren vor allem Schläge, die meine Kinderjahre begleiteten. Schläge. Schmerz. Wut. Und Scham.
Es begann schon im Kindergarten, wo Mater Graziana ihre Schläge mit Kommentaren begleitete. Kommentare, die ich nicht verstand. Erst später fand ich heraus, dass sie den Rosenkranz herunterleierte, während sie uns verprügelte.
Wenn sie mit uns ‚fertig war‘, wie sie es nannte, sperrte sie sie uns in einen Saal. Der so schwarz war, dass man nichts erkennen konnte. Auch nicht, wenn sich die Augen daran gewöhnt hatten. Und sie ließ uns viel Zeit, um uns daran zu gewöhnen. Die Dielen knarrten und ächzten in die schwarze Stille. Von Mäusen, die sie wohl von unten her zerfraßen. Der Schmerz tobte auf meinem Hintern. Die Finsternis brauste in meinem Kopf.
Und als ich zu beten versuchte, wusste ich nicht, an wen ich mein Gebet richten sollte. Denn Mater Graziana behauptete, es gäbe nur einen Gott. Und auch meine Mutter sagte, dass es nur einen Gott gäbe. Ein Gott, der für alle da ist. Wenn er aber für alle da ist, ist er auch für Mater Graziana da. Wie konnte ich mich diesem Gott anvertrauen?
Die Finsternis nahm kein Ende.
Manchmal dachte ich, sie würde überhaupt nie mehr aufhören. Und doch hätte ich nicht sagen können, was ich mehr fürchtete: die Finsternis oder Mater Grazianas herannahende Schritte. Die ich schon von weitem am klappernden Tritt ihrer Holzpantoffeln erkannte. Bis sich die Tür öffnete. Und sie in einem Rechteck grellen Lichts erschien. Wie von einem Heiligenschein umgeben.
Ihre Augen blitzten über ihren gefältelten Lippen. Und sie sah aus wie eine Elster. Mit ihrem wächsernen Gesicht und der schwarzweißen Flügelhaube drum herum.
Während ihrer ‚Erziehungsmaßnahmen‘, wie sie es nannte, brabbelte sie im immer gleichen Singsang die immer gleichen Sätze. Die sich zu keinem Ganzen fügten. Sich wie ein Refrain anhörten, zu dem das zugehörige Lied fehlte. Ein zusammenhangloser Mix aus ‚bösen Buben‘, ‚schlimmen Mädchen‘ und ‚Avemaria‘.
Je mehr wir sie anflehten, desto lauter sang sie. Ließ ihren Stock niedersausen, bis sie den angemessenen Rhythmus für ihre Litaneien gefunden hatte.
„Avemariavolldergnade, ich bring euch noch Manieren bei, derHerristmitdir, du bistgebenedeitunterdenWeibern, ihr missrat‘ne Brut, unddieFruchtdeinesLeibesJesuAmen.“
Wie seinerzeit bei den Sklaven. Dachte ich später, als ich mich an Mater Grazianas Erziehungsrituale zurückerinnern sollte. Nur dass es die Sklaven selbst waren, die ihre eintönigen Melodien über ihre geschundenen Körper und gedemütigten Seelen sangen. Während es im Kindergarten die Peinigerin war, die sang. Und wir unseren Schmerz herausschrien, ohne eine tröstende Melodie in uns vorzufinden.
Irgendwann bekreuzigte sich Mater Graziana. Hob ihre Augen erschöpft zum Kruzifix. Das in der Zimmerecke hing. Und von wo aus Gott ihr Tun zu billigen schien. Dann rieb sie ihre Hände an den Seiten ihrer schwarzen Kutte ab. Als hätte sie sich an uns beschmutzt. Ließ ihre blitzenden Augen über uns wandern. Und zog den Nächsten am Ohrläppchen in den pechschwarzen Saal.
Wenn ich zu Hause aus der Badewanne stieg, versuchte meine Mutter von den Striemen auf meinem Hintern wegzusehen, weil sie sie für die hielt, die mein Vater mir zufügte. Niemals würde sie mir geglaubt haben, dass es die süßlich auf sie einredende Ordensschwester war, die uns erbarmungslos mit ihrem Stock traktierte.
Und Stock und Kochlöffel waren auch für meinen Vater wie das Zepter eines Königs. Freilich erkannte er nicht, dass er damit allenfalls über meinen Hintern regierte. Und nicht merkte, dass der, über den er zu herrschen glaubte, sich seinem Zugriff entzog.
Er meine es gut mit mir. Und wolle nur das Beste für mich. Versicherte mir meine Mutter immer wieder. Und ich fragte mich, warum er mich beschämen und mir Schmerz zufügen musste, um zu beweisen, dass er es gut mit mir meinte und nur mein Bestes wollte.
Ich fragte mich auch, ob er nicht merkte, dass seine Schläge nicht die von ihm gewünschte Veränderung herbeiführten. Erst als ich eines Tages unser Brotmesser mit solcher Wucht vor ihm in den Linoleumboden rammte, dass es bis zum Schaft dort steckenblieb, schien ihm zu dämmern, dass er seine Macht, über mich verloren hatte. Die er niemals hatte.
Aber bis dahin war es noch ein weiter Weg.
3.
Es gab nur wenige Aussagen meines Vaters, die nicht mit ‚man muss‘ oder ‚man darf nicht‘ begannen.
Diese Satzanfänge waren wie große rollende Steine, die sich vor meine Ohren schoben. Und alles was dann folgte, nicht mehr in sie eindringen ließen.
Ich musste alles. Und durfte nichts. Das war seine Philosophie.
Ich durfte nicht spielen, wenn die anderen spielten. Und am Sonntag musste ich mit ihm und meiner Mutter nach Drebelsberg fahren. Stundenlang in Schaufenster auf langweilige Anzüge glotzen. Die alle gleich aussahen. Und die er sich sowieso nicht leisten konnte.
Wenn ich mit dem Dünzl zusammen auf dem Pferdewagen sitzen wollte, was sich als sehnlichster Wunsch durch die ersten Jahre meiner Kindheit zog, schüttelte mein Vater seinen Kopf. Weder begründete er seine Verbote. Noch erklärte er seine Befehle. Was er sagte, hatte befolgt zu werden. Auch das, was er nicht sagte. Und nur andeutete oder durch sein Schweigen befahl.
Daran änderte sich auch nichts, als sich zwei weitere Leben zu unserer Familie gesellten. Zwar weitete mein Vater nun seine Moralpredigten auf meine Schwester und auf meinen Bruder aus. Hielt auch für sie sein Zepter bereit. Denn auch sie konnten ihm nichts recht machen. Vor allem aber war ich es, der ihn immer und immer wieder enttäuschte. Weil ich nun mal so war, wie ich war. Und nicht so, wie er war. Oder wie er sich vorgestellt oder gewünscht hatte.
Dabei war das ja gar nicht möglich. Weil ich ja ich war. Und nicht einmal das. Sondern nur die Hülle dessen, der sich darin verbarg und gar nicht zum Vorschein kam. Den nicht einmal ich zu fassen bekam. Es hatte keinen Sinn, ihm das zu erklären. So was verstand mein Vater nicht.
Ich, zum Beispiel, habe mir nie vorgestellt, dass er anders sein könnte. So wie er war, war er nun mal. Ob mir das passte oder nicht. Und freilich passte es mir meistens nicht.
Alles komme nur davon, dass mein Vater nicht rauche und nicht trinke. Behauptete meine Omi. Und goss sich ein Gläschen Likör ein. Deshalb sei er so griesgrämig. Und so rechthaberisch. Leute, die keine Laster haben, sagte sie, seien pingelig, stur und streng. Wie mein Vater eben.
Und natürlich hatte er mit allem Recht, was er an uns auszusetzen hatte. Sagte meine Omi und zwinkerte mir zu.
„Vater hat recht.“ Das sei ein Naturgesetz in unserer Familie. Und an Naturgesetzen rüttele man nicht.
Da mein Vater sie zu Weihnachten nicht bei uns in Lapping duldete, wusste sie nicht, dass mein Vater sich immerhin am Heiligen Abend 'mal einen genehmigte‘, wie er es nannte. Sie wusste auch nicht, dass er an diesem Abend eine dicke Zigarre qualmte. Obwohl er meiner Mutter das Rauchen missgönnte.
Tatsächlich hatte die Heiligabendzigarre einen guten Einfluss auf meinen Vater. Kaum blies er bläuliche Wölkchen vor sich hin, war er plötzlich ein anderer. Er redete dann sogar mit meiner Mutter. Mit jedem Gläschen Likör wurde er fröhlicher. Denn bei dem ‚einen‘ blieb es nicht. Er lachte sogar. Pfiff seine Landfunkmelodien laut vor sich hin. Und tanzte dazu. Mit sich selbst. Übersah, wie meine Mutter erwartungsvoll auf dem Stuhl hin und her rutschte.
Wenn er die Flasche mit dem ‚Danziger Goldwasser‘ wieder zuschraubte, schüttelte er sie noch einmal. Hielt sie gegen die Glühbirne und ich sah, wie winzige Goldblättchen in der Flüssigkeit herumwirbelten. Dann verschwand die viereckige Flasche in seinem Schreibtisch und ich wusste, sie würde erst in einem Jahr wieder herausgeholt werden. Und noch während der süßliche Zigarrenqualm über dem Christbaum waberte, entluden sich schon wieder die ersten ‚Man muss‘- und ‚man darf nicht‘-Sätze über unsere ausgepackten Geschenke. Da ließen wir sie achtlos liegen, um der zu erwartenden üblichen Standpauke zu entgehen. Die wir inmitten des weihnachtlichen Familienfriedens noch unerträglicher als sonst empfunden hätten. Bereits am ersten Weihnachtsfeiertag begann er ohnehin wieder, an uns herumzunörgeln. Was wir auch taten, es passte meinem Vater nicht.
4.
Ich bin sicher, mein Vater wäre ein anderer geworden, hätte es ihn nicht nach Lapping verschlagen.
Es gibt wohl Orte, in denen sich die Wut der ganzen Menschheit verdichtet. Und niemand, der an einem solchen Ort lebt, kann sich dieser Wut entziehen. Sie ist wie eine ansteckende Krankheit, eine Seuche. Die jeden erfasst, der mit ihr in Berührung kommt. Sie kriecht tief in einen hinein. Und lässt einen nie wieder los.
Lapping war jedenfalls so ein Ort.
Hier hatte mein Vater von Anfang an keine Chance. Und ich auch nicht.
Die in Lapping schwelende Wut erfasste auch die Dorfbewohner von Wimling. Ging dann auf Niederkattlhofen über. Bis schließlich alle unsere drei Dörfer voller Wut waren. Sie entlud sich vom Stärkeren, zum weniger Starken, zu den Schwächeren hin. Nur die Allerschwächsten, die niemanden mehr fanden, an denen sie ihre Wut auslassen konnten, fraßen sie in sich hinein. Wo sie weiterkochte.
Die Wut kochte in Mater Graziana. Und im Hauptlehrer Kager, der zu geeigneter Zeit die Erziehungsmaßnahmen meines Vaters vertiefen sollte. Sie kochte in unserem Stier. Und in unserem Eber. Und ganz besonders in unserem Hofhund Wampo.
Unser Wampo, und es fällt mir heute noch schwer, ihn ‚unser‘ zu nennen, war eine Mischung aus einem deutschen Schäferhund und einem Wolfshund. Behauptete mein Vater. Schon wenn Wampo mich roch, fing er wild zu kläffen an. Raste wie besessen an den Holzlatten seines Käfigs entlang. Fletschte seine bräunlich fleckigen Zähne. Am ganzen Körper zitternd, schlich ich an seinem Zaun vorbei in den Garten. Um Kohlrabi, Blumenkohl, Petersilie oder Karotten zu holen. Starrte, wie gelähmt vor Angst, in seine rötlich funkelnden Knopfaugen. Dann knurrte er. Und es lief mir eiskalt den Rücken hinunter. Das klang anders als bei anderen Hunden.
Kam ich dann vollbeladen mit Gemüse wieder an ihm vorbei, verschluckte er sich an seinem eigenen Bellen. Wirbelte in einem wilden Veitstanz um seine eigene Achse. Verbiss sich in die Zaunlatten. Und ich wusste, dass er mich damit meinte.
Trotzdem schickte mich mein Vater immer wieder in den Garten zum Gemüseholen.
„Der Wampo kann nichts dafür, Heini!“ versuchte mich meine Mutter zu beschwichtigen, „dieser dämliche Rammelhuber ist schuld! Ich weiß, mein Junge, du hast dem Wampo nichts getan. Doch der Wampo ist ein Hund. Er begreift das nicht.“
Der Rammelhuber war unser Stallknecht. Er hatte sich um unsere Kühe zu kümmern. Die natürlich dem Herrn Grafen gehörten. Der Rammelhuber schlug den Wampo. Mit einer Eisenstange. Und fütterte ihn mit blutigem Fleisch. Deutete dann mit dem Finger auf mich. Worauf der Wampo voller Wut auf mich losstürzte, bis der Rammelhuber an seiner Leine zerrte, den Wampo in letzter Sekunde von mir zurückriss. Und scheppernd lachte.
Einmal wurde der Wampo so wild, dass er die Zaunlatten durchbiss. Und aus seinem Laufstall freikam. Die Lappinger flüchteten in ihre Häuser. Verriegelten sich. Und trauten sich nicht mehr auf die Straße. Denn der Rammelhuber war an dem Tag gerade in Drebelsberg. Und nur auf ihn hörte der Wampo. Weil er ihn schlug. Und mit blutigem Fleisch fütterte. Keiner der Lappinger verließ sein Haus. Auch die nicht, die zur Arbeit in die Fabrik nach Puckling mussten. Sie verbarrikadierten sich in ihren Stuben. Und die Straßen von Lapping gehörten unserem Wampo ganz allein.
Einen ganzen Tag und eine halbe Nacht lang ist er mit seinem unheimlichen Bellen durch die Dorfstraßen gerannt. Gegen die Haustüren angesprungen. Und selbst die, die immer so ein großes Mundwerk hatten, sind mucksmäuschenstill hinter ihren Türen gehockt. Und haben den Wampo wüten lassen. Bis er von seinem Gebell ganz heiser war.
Ein Pfiff vom Rammelhuber genügte. Und der Wampo hörte auf zu kläffen. Lief mit wedelndem Schwanz auf ihn zu. Als hätte er sich im Handumdrehen von einer Bestie in ein Schoßhündchen verwandelt. Auch als ich am nächsten Tag in den Garten musste, bellte der Wampo nicht. Lag mit heraushängender Zunge vor seiner Hütte. So fertig war er von seinem erbosten Herumrasen im Dorf. Knurrte nicht einmal, als ihn der Rammelhuber an die Kette legte. Damit mein Vater die zerbissenen Zaunlatten an seinem Laufstall ersetzen konnte.
Eines Tages aber ist der Wampo so wütend geworden, dass er selbst unseren Schweizer angeknurrt und ihn ins Bein gebissen hat. Als der Wampo das viele Blut gesehen hat, das aus dem Bein von unserem Schweizer herausgelaufen ist, hat er gleich noch mal reingebissen. Und wie unser Schweizer dann vor Schmerz und Wut gebrüllt und der Wampo gejault und gebellt hat, ist das schon ein recht schauriges Duett gewesen.
Von da an musste ich keine Angst mehr vor unserm Wampo haben. Denn der Tierarzt, der ein Freund von unserem Schweizer war, ist noch am selben Tag mit seinem Jagdgewehr zu uns auf den Hof gekommen. Und hat den Wampo erschossen.
Das war dann schon seltsam. Als er weg war, der Wampo, hat er mir plötzlich gefehlt. Obwohl ich immer so viel Angst vor ihm gehabt hatte.
5.
Die Wut, die über unseren drei Dörfern schwebte, steckte sogar in den Gewittern. Die mit unheimlichem Donnergrollen heranrollten. Sich zu entfernen schienen. Krachend wieder zurückkehrten. Und dann stundenlang über unseren Dörfern kreisten.
Am schlimmsten war es nachts. Wenn die Blitze direkt auf meine Bettdecke zielten. Und es so hell in unserem Schlafzimmer wurde, als würde der Spengler Hösl mit seinem Schweißbrenner drin arbeiten. Ich wusste natürlich, dass der Spengler Hösl nicht mitten in der Nacht in unserem Schlafzimmer schweißte. Und verkroch mich unter der zentnerschweren Bettdecke. Bis ich zu ersticken drohte.
„Hab’ keine Angst, Heini!“ Sagte meine Mutter. „Das Gewitter ist erst dann direkt über uns, wenn Blitz und Donner zusammenfallen. Du musst zählen, nach dem Blitz. Wenn du bis zehn zählen kannst, bis es donnert, ist das Gewitter noch zehn Kilometer weit weg.“
Aber das beruhigte mich nicht. Auch nicht, wenn ich nach einem Blitz bis fünfundzwanzig zählen konnte, bevor der Donner loskrachte. Das Gewitter also erst im fernen Drebelsberg tobte. Ich verkroch mich trotzdem unter der Bettdecke. Damit mich nicht womöglich doch ein verirrter Blitz erreichte. Schon wenn riesige Wolkenballen über dem Vierfichtenbuckel zusammenkrachten, begann ich zu zittern. Obwohl ich wusste, dass der Donner nicht gefährlich war. Und die Blitze noch weit weg waren.
In einem der Sommer umkreisten ständig blauorangene Wolkenwände unsere drei Dörfer. Die Luft war so stickig und spannungsgeladen, dass die Lappinger kaum noch ihre Häuser verließen, wenn sie nicht mussten. Meine Mutter stöhnte. Und sehnte sich erlösenden Regen herbei. Während mein Vater, wie jedes Jahr, um seine Ernte bangte. Die gar nicht die seine war. Während vom Bayrischen Wald unaufhörlich dumpfer Donner von den Bergen zu uns herüberhallte.
„Es wird Hagel geben. Und die ganze Ernte verwüsten,“ unkte mein Vater.
Doch die Gewitter blieben an den Berggipfeln hängen. Die Sonne brannte sich weiterhin durch den schlierigen Himmel. Und ich war froh, dass die Gewitter ihre Wut an den Drebelsberger Bergen ausließen. Nur meine Mutter klagte weiterhin über die unerträgliche Schwüle. Verschloss sich im Badezimmer. Nutzte die Gelegenheit, dort heimlich zu rauchen.
Doch plötzlich hatte eines der Gewitter einen unerwarteten Schlenker zu unseren Dörfern hin gemacht. Am helllichten Tag wurde es schwarz. Die Luft blieb stehen. Die Bäume vor unserem Küchenfenster erstarrten. Tonnenschwer drückte der Wolkenhimmel auf Lapping herunter. Die Luft knisterte. Angespannte Stille füllte unsere Küche. Sogar mein Vater vergaß, seine mittägliche Moralpredigt anzustimmen. Wir rührten lustlos in unseren Suppen herum. Selbst die Schmeißfliegen hatten ihr Gesumme eingestellt. Klebten träge an den Tellerrändern.
Dann geschah alles gleichzeitig.
Eine Flammensäule schoss aus dem dunklen Himmel auf uns zu. Ein Knall zerriss die Stille. Es krachte. Polterte. Als löste sich der Himmel über uns auf. Und fiele in seinen einzelnen Bestandteilen auf Lapping und unseren Hof herab. Aber der Himmel fiel nicht herunter. Stattdessen kehrte die bewegungslose Stille wieder zurück. Noch immer war kein Tropfen Regen gefallen.
Dann krachte es wieder. Diesmal war es die Küchentür. Mein Vater, der aufgesprungen, dann aber wie angewurzelt neben dem Esstisch stehen geblieben war, hatte die Küche verlassen. Meine Mutter, die jetzt rot im Gesicht wurde, schrie meinem Vater hinterher „Wie sollen die Kinder begreifen, dass sie die Tür vorsichtig zuzumachen haben, wenn...“ und brach mitten im Satz ab.
Eine gewaltige Lichtkugel platzte vor unserem Küchenfenster. Gleichzeitig ging ein Beben durch unser Haus. Die Teller vor uns machten ein Hüpfer. Und in ihnen die Suppenlöffel. Die Suppenspritzer auf den Küchentisch katapultierten. Meine Schwester und ich rannten auf meine Mutter zu. Versteckten uns unter ihrer Schürze. Von dort aus vernahm ich gedämpft das schauerliche Quieken der Schweine.
„Jetzt hat‘s eingeschlagen,“ flüsterte meine Mutter.
„Ein Nachzügler,“ kommentierte meine Omi, die sich geweigert hatte, sich bei dem herannahenden Unwetter nach Holzing zurückfahren zu lassen, „in ihnen ballt sich nochmal die gesamte Kraft, die seine Vorgänger nicht loswerden konnten.“
Und während ich noch über diese Nachzügler sinnierte, schoss ein weiterer Nachzügler auf unseren Hof herunter. Gleichzeitig gab es einen noch lauteren Knall. Der das Geschirr in unserem Küchenschrank zum Scheppern brachte.
Die Schweine fingen wieder an zu quieken. Ich kroch unter der Schürze hervor. Und sah, dass meine Mutter nun weiß im Gesicht war.
„Der Schweinestall brennt!“ schrie sie.
Dann kam Wind auf. Jähe Böen rissen kleine Flämmchen von den Flammen. Und schleuderten sie auf das Hühnerhaus zu. Das auch sofort Feuer fing. Und nun ebenfalls lichterloh brannte. Aufgeregtes Gackern gesellte sich zum Quieken der Schweine.
Immer heftiger zerrte und schob der Wind an den Flammen. Die riesengroß anwuchsen. Und auf unser Wohnhaus herüber züngelten. Meine Schwester schrie und krallte sich an meiner Mutter fest. Weitere Blitze schossen auf uns herunter. Zerbarsten in schepperndem Krachen.
Das Gewitter konnte gar nicht genug kriegen. Den ganzen Tag und die ganze Nacht kreiste es um unsere drei Dörfer. Zum Schluss hat der Blitz auch noch beim Nädler eingeschlagen. Auch bei ihm brannten Stadel und Ställe ab. Die meisten Tiere konnten sich retten. Liefen noch tagelang verwirrt im Dorf herum.
6.
Kurz nachdem die Ställe wiederaufgebaut worden waren, brannte unser Hof schon wieder. Diesmal war es der Weidinger, aus dem die Wut herausbrach. Das behaupteten jedenfalls die Kriminaler. Die die Brandursache herauszufinden hatten.
Mitten in der Nacht weckte mich meine Mutter.
„Heini, steh auf! Es brennt.“
Mehr sagte sie nicht. Und sie sagte es, als fände draußen ein Feuerwerk statt. Das wir nicht versäumen sollten.
Das Bett meines Bruders war bereits leer. Auch das meiner Schwester. Und obwohl ich vermutlich längst zu schwer für sie war, hob meine Mutter mich aus den Kissen. Trug mich im Schlafanzug die Treppen hinunter.
Im Flur war das Fenster zum Hof zersprungen. Die Haustür stand offen. Gelbrötliche Flammen leckten in unseren Hausgang.
„Feuer!“ stammelte ich, „viel Feuer!“
„Ja, Feuer,“ bestätigte meine Mutter, „viel Feuer.“
Als sie die Tür öffnete, schlug mir brodelnde Hitze entgegen. Meine Mutter presste mich fest an sich. Stieß mit dem Fuß die Eingangstür zu. Rannte in den Hausgang zurück. Durch die Waschküche. Dem Hinterausgang zu. Und ich spürte, wie ihr Herz an meine Schläfen donnerte.
Auch zur Waschküche wehten bereits die Flammen herein.
Meine Mutter drückte mich so fest an sich, dass es wehtat. Und ich hörte, wie sie vor sich hin flüsterte. Verstand aber nicht, was sie sagte. Ihre Stimme wurde immer flehender.
„Mmmit wwem redest dudu, Mammi?“
„Mit Gott.“ Sagte sie. „Mit Gott, mein Junge.“
Ich presste Spucke durch meine Lippen. Besabberte ihren Arm, mit dem sie mich hielt. Bis sie eine Hand auf meine Lippen legte.
Ich verstand nicht, was sie zu Gott sagte. Und was er mit diesem Feuer um uns herum zu tun hatte. Hoffte nur, dass es nicht derselbe Gott war, zu dem Mater Graziana betete. Und ich fragte mich, ob es denn auch einen Gott gab, der für mich zuständig war.
Meine Mutter riss das Badezimmerfenster auf. Setzte mich auf dem Fensterbrett ab. Und sprang ins Freie. Ich schrie laut auf. Ich wollte natürlich nicht allein auf dem Badefensterbrett liegen bleiben. Doch sie zog mich bereits wieder an sich. Rannte mit mir an der Rückseite unseres Wohnhauses entlang. Und ich spürte wie ihr Herz gegen meine Schläfen schlug.
Auch hinter dem Haus war es sehr heiß. Obwohl hier noch keine Flammen zu sehen waren. Die Kühe brüllten, wie ich so nie brüllen gehört hatte. Und ich zupfte am Arm meiner Mutter und deutete nach oben.
„Mammi, ssso vviele Sterne aam Himmel!“
„Daas sind keiine Sterne,“ sagte sie, „daas sind keiine Sterne, Heini.“
Sie sagte es, als sänge sie den Messegesängen vom Pfarrer Wandlinger hinterher.
Als eine riesige Feuergarbe aus dem Kuhstalldach schoss, begriff ich, dass nicht nur unser Hof, sondern der ganze Himmel brannte. Und in diesem Moment musste ich an eine Predigt vom Pfarrer Wandlinger denken. Und ich rief:
„Ist das der Weltuntergang, Mammi?“
Meine Mutter antwortete nicht. Sie drückte mich nur noch fester an sich. Und lief weiter. Musste immer wieder ausweichen. Weil glühende Strohfetzen herunter rieselten.
Beinahe wäre sie mit dem Weidinger zusammengestoßen. Der nichts und niemanden wahrzunehmen schien. Nur einfach in den Misthaufen glotzte. Und sich nicht von der Stelle rührte.
Brennende Kühe hüpften in wilden Bocksprüngen um ihn herum. Warfen sich in den Mist. Wälzten sich in den Flammen. Und brüllten schauerlich.
Der Weidinger stand nur da. Mit hochgezogenen Schultern. Eingezogenem Kopf. Und schaute finster in den dampfenden Mist hinein.
Die Hühner flatterten aufgeregt auf die Rücken der Schweine. Gackerten wie aufgezogen. Die Schweine, wiederum, versuchten die Hühner abzuschütteln, hoppelten in alle Richtungen. Rollten sich auf der aufgewühlten Erde. Quiekten und kreischten.
Es herrschte ein ziemliches Durcheinander.
Ich sah den brennenden Strohfetzen nach, die über uns hinweg geweht wurden, als meine Mutter abrupt stehen blieb. Jetzt hatte auch sie den Weidinger entdeckt. Wie er mit rußverschmiertem Gesicht im Misthaufen stand. Seine Augen blitzten wie glühende Kohlestückchen.
Das war nicht der Weidinger, wurde mir plötzlich klar. Das war er. Von dem mein Vater sprach als ich geboren wurde. Er, der angeblich immer auf den größten Haufen scheißt. Und ich barg meinen Kopf unter das Kinn meiner Mutter.
„Schau mal, Mami! Der Teufel!“
Meine Mutter packte erschrocken mein Gesicht und hob es zu sich hoch.
„Das ist der Weidinger, Heini! Erkennst du ihn denn nicht?“
Natürlich erkannte ich ihn. Den Weidinger. Wie er dort in der stinkenden Glut stand. Gleichzeitig aber sah ich auch ihn zum ersten Mal. Den Teufel. Wie er aus dem Weidinger herausgrinste. Und als plötzlich auch der Misthaufen zu brennen anfing, wusste ich, dass der Teufel direkt aus der Hölle hochgekommen war. Und sich im Weidinger versteckt hatte.
Ich sah die roten und gelben Flammen, die überall aus den Türen und Fenstern herausschossen. Durch meine vom vielen Rauch verschleierten Augen sahen sie noch größer und noch unheimlicher aus. Und ich war froh, als die weiche Hand meiner Mutter sich auf meine Stirn legte. Und meine Augen verdeckte.
Endlich lief meine Mutter weiter.
Die Katzen miauten und jaulten. Und weil sie ständig zwischen ihren Füßen hin und her wuselten, stolperte meine Mutter. Und ihr Kinn schlug gegen mein Nasenbein.
Auf einmal rasten einige Kühe auf uns zu. Ich versuchte mich an der Brust meiner Mutter unsichtbar zu machen. Drückte meine Lider fest zu. Denn ich wusste, wo die Kühe waren, musste auch der Stier sein. Er musste jeden Augenblick auftauchen. Und uns über den Haufen rennen.
Der Stier kam nicht. Aber die Kühe hätten uns mit Sicherheit niedergetrampelt, wenn wir nicht von zwei starken Händen an die Hauswand gezerrt worden wären. Die Kühe rannten laut muhend in Bocksprüngen an uns vorüber. Und ich erschrak, als ich den Weidinger nun direkt vor mir sah. Wie er meine Mutter an die Stallwand drückte. Hinter uns brodelte und zischte der Misthaufen. Wie der Schlund der Hölle, der uns zu verschlingen drohte. Auch meine Mutter schien jetzt zu erkennen, wer sich im Weidinger versteckt hatte. Sie riss sich von ihm los. Floh mit mir ins Dorf hinein. Und der Teufel im Weidinger lachte scheppernd hinter uns her. Erst viel später begriff ich, dass uns der Weidinger davor gerettet hatte, von den wild herumrasenden Kühen zertrampelt zu werden.
Meine Mutter trug mich zur Dorfwirtschaft. Wo auch schon meine Schwester und mein Bruder auf Handtüchern auf dem Fußboden lagen. Und ich verstand nicht, warum sie uns ausgerechnet in die Dorfwirtschaft trug. Gegen die mein Vater stets wetterte. Sie eine Lasterhöhle nannte. Und sich weigerte, auch nur einen Fuß hineinzusetzen.
Mein Bruder weinte leise in sich hinein. Meine Schwester versuchte, ihn zu beruhigen. Und wie immer im unpassendsten Augenblick, fing meine Nase zu bluten an. Das Blut schoss aus dem rechten Nasenloch. Verzweifelt suchte ich nach einem Taschentuch. Unaufhörlich lief es hellrot aus mir heraus. Bis mein ganzes Gesicht besudelt war. Und mein Schlafanzug. Weil ich nichts anderes fand, stopfte ich mir den Zipfel einer Tischdecke, die säuberlich gefaltet über einem der Stühle hing, ins blutende Nasenloch. Aber das nützte nichts. Das Blut quoll an den Stoffrändern vorbei. Tropfte auf meine Füße. Und auf den Dielenboden des Gastraums.
Noch immer saß meine Schwester über meinen Bruder gebeugt. Der immer weiter weinte. Auch meine Nase blutete immer weiter. Und ich befürchtete, dass solange Blut aus mir herauslaufen würde, bis nichts mehr davon in mir drin war.
Entlang der Wände türmten sich übereinander und ineinander gestellte Stühle und Tische. Als habe man eine leere Fläche für die Tanzenden schaffen wollen. Die nur noch darauf warteten, dass die Musik begänne. Nach und nach polterten alle Arbeiter von unserem Hof in die Gaststube. Aber sie sahen nicht aus, als wollten sie tanzen. Wie sie in rußbedeckten und schwitzenden Gesichtern durcheinanderredeten. Und die Musik fing auch nicht zu spielen an. Stattdessen redeten alle hektisch aufeinander ein.
Irgendwann eilte meine Mutter auf mich zu. Umschlang mit beiden Händen meinen Kopf. Und mein Nasenbluten hörte auf. Während sie in meinem Gesicht herumwischte, murmelte sie die ganze Zeit vor sich hin. Ich vermutete, dass sie wieder mit Gott sprach. Dann legte sie mich auf eine kratzige Wolldecke. Neben meinen immer noch schluchzenden Bruder. Meine Schwester war vor Erschöpfung inzwischen eingeschlafen.
Mein Kopf fühlte sich dumpf und hohl an. Vielleicht war er schon ausgeblutet. Dachte ich.
„Schlaft jetzt, Kinder!“ befahl meine Mutter.
Jetzt kam auch noch der Raglkofer in den Gastraum gestolpert. Und alle die anderen Arbeiter. Und sie trampelten solange auf dem alten Holzboden herum, bis mein Bruder, der endlich eingeschlafen war, wieder aufwachte und wieder zu weinen anfing. In meinem Kopf vermischten sich das Weinen meines Bruders, das Stampfen der Arbeiter und ihre aufgeregten Stimmen zu einem Geräuschbrei, der sich wie ein Karussell um mich herumdrehte. Bis ich kotzen musste.
„Schlaft endlich, Kinder! Schlaft!“ schrie jetzt auch noch meine Mutter, nachdem sie meine Kotze mit einer der zusammengefalteten Tischdecken aufgewischt hatte.
Wie sollte man in dieser Unruhe schlafen? fragte ich mich, musste aber dann doch irgendwann eingeschlafen sein.
Am nächsten Tag durften wir wieder in unsere Betten zurück. Aber schon ein paar Tage später weckte uns meine Mutter wieder mitten in der Nacht. Diesmal brannten die Geräteschuppen. Auch das Hühnerhaus und der Schweinestall standen ein weiteres Mal in Flammen. Meine Mutter schleppte uns bis ans andere Ende des Dorfes. Ins Haus von unserem Schweinemeister. Weil die Lappinger Angst hatten, die Schnapsbrennerei, die zu unserem Hof gehörte und gegenüber der Wirtschaft lag, könnte auch noch Feuer fangen. Und explodieren. Dann würde ganz Lapping mit allen Lappingern in die Luft fliegen. Worum es nicht schade wäre, soll mein Vater gebrummt haben. Sagte meine Mutter.
Ich fragte mich, wo der Schweinemeister und seine Frau jetzt schliefen. Wo wir doch nun ihre Betten besetzten. Behielt meine Frage aber für mich. Denn ich war natürlich froh, dass es hier keine lodernden und zischenden Flammen gab. Es war auch nicht so heiß und stickig wie in der Dorfwirtschaft.
Drei Tage schliefen wir Kinder im Haus vom Schweinemeister. So lange, bis die Explosionsgefahr vorüber war. Erst später erfuhr ich, dass weder der Schweinemeister und seine Frau, noch meine Mutter und mein Vater und auch keiner der anderen Erwachsenen im Dorf in diesen drei Tagen geschlafen haben. Sie alle waren mit dem Löschen der um sich greifenden Brände beschäftigt. Damit das Feuer nicht auf unser Wohnhaus übergriffe. Und womöglich doch noch die Brennerei zum Explodieren brachte.
Und obwohl der Weidinger dann noch ein drittes Mal zündelte, blieben Brennerei und Wohnhaus vom Feuer verschont.
7.
Danach rätselten die Leute unserer drei Dörfer, wie der Gutshof gleich dreimal hintereinander Feuer fangen konnte. Blitze konnten ihn nicht entzündet haben. Denn es waren weit und breit keine Gewitter in Sicht gewesen.
Die Feuerwehren kamen bis von Puckling, Drebelsberg und Strutzing. Sogar von München kamen sie. So groß war das Feuer. Zwar durften wir nach ein paar Tagen wieder in unser Wohnhaus zurück. Und der Schweinemeister und seine Frau konnten wieder in ihren Betten schlafen. Aber überall auf dem Hof knisterte und zischte es noch. Und wenn Windböen darüber hinwegfegten, fingen die Flammen von neuem an, aufzulodern. Die Feuerwehren spritzten und spritzten.
Wochenlang stank ganz Lapping nach fauliger Asche, verbranntem Stroh und verkohlten Tierkadavern. Denn die meisten der gräflichen Tiere waren bei der Feuersbrunst umgekommen. Auch unsere Hühner, die mein Vater nach dem Blitzschlag neu erworben hatte, waren dem Feuer zum Opfer gefallen. Die wenigen Tiere, die sich retten konnten, hatten bei den Nachbarbauern Unterschlupf gefunden. Die haben das natürlich abgestritten. Und mein Vater musste neue Schweine, Kühe und Hühner für das gräfliche Gut erwerben. Und weil er gerade dabei war, Tiere einzukaufen, brachte er auch einen neuen Hofhund mit. Ließ sich auch von meinem Flehen nicht davon abhalten. Und nannte ihn wieder Wampo.
Glücklicherweise war Wampo Nummer Zwei ein friedlicher Hund, der niemanden etwas tat. Nur tagaus tagein gelangweilt vor sich hin bellte. Um dem Gequieke der Schweine, dem Brüllen der Kühe und dem Gackern der Hühner seinen Beitrag hinzuzufügen.
Für meinen Vater aber war es das Schlimmste, dass der sonst so ordentlich gejätete gräfliche Hof nun ein rauchender Schutthaufen war. Auch als die verbrannten Schweinekadaver und die durch die Hitze geplatzten Kuhkörper beseitigt worden waren, blieb der Gestank von verschmortem und verwesendem Fleisch. Durch das viele Spritzwasser hatten die Tierleichen zu faulen angefangen. Ganz Lapping roch danach. An windstillen Tagen war der Gestank kaum auszuhalten.
Auch dem Raglkofer ‚sein‘ neuer Lanz fiel dem ‚Großen Brand von Lapping‘ wie man ihn nannte, zum Opfer. Der Dünzl konnte zwar ‚seine“ Rösser noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Aber das hat mich genützt. Der Herr Graf beauftragte meinen Vater, drei neue Traktoren zu erwerben. Und ein Rossknecht war nun nicht mehr nötig. Die Zeit der Rösser war vorbei.
Wir husteten die Nächte durch. Und tagsüber auch. Und weil alle im Dorf husteten, merkten weder mein Vater noch meine Mutter, dass wir Kinder mehr husteten als alle anderen. Erst als wir zu kotzen anfingen, ließ mein Vater den Dr. Vilber kommen. Der feststellte, dass wir alle drei Keuchhusten hatten. Wir husteten natürlich trotzdem weiter. Bis wir rot, blau und grün in den Gesichtern waren. Und wieder kotzen mussten. Als der Dr. Vilber, der Angst hatte, sich bei uns anzustecken, endlich auftauchte, hatten wir das Schlimmste überstanden. Und mein Vater schickte ihn mit seinen Medikamenten wieder nach Strutzing zurück. Als drei Tage später ein Brief vom Dr. Vilber bei uns ankam, in dem er die Hin- und Rückfahrt in Rechnung stellte, ließ mein Vater seinen Ärger natürlich wieder an mir aus.
Inzwischen rätselten die Kriminaler weiter, wer die drei Feuer im Gut von Lapping gelegt haben könnte. Und ob es sich denn überhaupt um Brandstiftung handele. Da der Weidinger ein dorfbekannter Zündler war, haben sie schließlich ihm die Brände in die Schuhe geschoben.
Doch so sehr sie ihn auch triezten, sie konnten den Weidinger zu keinem Geständnis überreden. Und weil er nur so dagesessen, vor sich hingestarrt, und kein Wort gesagt habe, hätten die Kriminaler einen Psychologen dazu geholt. Wurde im Dorf gemunkelt. Und als er auch im Beisein des Psychologen nichts zugeben wollte, hätten sich die Kriminaler selber zusammengereimt, was sie vom Weidinger hören wollten.
Mein Vater sagte nur: „Es ist ja klar, dass der Weidinger verdächtigt wird. Weil ihn keiner im Dorf leiden kann. Aber warum sollte ein Trottel wie er dreimal hintereinander den gleichen Hof anzünden?“
Irgendwann haben sich die Kriminaler und der Psychologe auf eine Aussage geeinigt. Die der Weidinger gar nicht gemacht habe. In der scharfen Kurve, die hinter unserem Stadel vorbeiführt, sei er vom Fahrrad gestürzt. Vermutlich sei er besoffen gewesen, zu schnell gefahren und ins Schleudern geraten. Tatsächlich fand man sein Fahrrad später, verbeult in den verkohlten Resten der Ernte.
Als er dann so vor dem gräflichen Stadel im Dreck lag, so spekulierten die Kriminaler weiter, habe den Weidinger eine wahnsinnige Wut gepackt. Und weil sonst nichts da gewesen sei, woran er seine Wut auslassen hätte können, und er zudem Streichhölzer in der Hosentasche gehabt habe, sei ihm unser Hof gerade recht gekommen. Er habe dann alle Streichhölzer auf einmal aus der Packung gezogen. Sie gleichzeitig angerissen. Und in unseren Stadel geworfen. Der kurz nach der Ernte mit Strohballen angefüllt war. Und sofort Feuer gefangen habe. Mit den mächtigen Flammenstößen sei seine Wut dann erst richtig aufgelodert. Und er habe es die beiden darauffolgenden Tage gleich nochmal probiert. Und nochmal. Bis er halt alles abgefackelt hatte.
Und weil der Psychologe und die Kriminaler schon gerade beim Zusammenreimen waren, behaupteten sie auch noch, dass der Weidinger schon lange einen Rochus auf meinen Vater gehabt und schon als Kind gern mit dem Feuer gespielt habe. Und sich nun der geeignete Anlass ergeben hatte, seiner Wut Ausdruck zu verleihen und sie in ein Vergnügen für ihn zu verwandeln.
Der Weidinger habe sich die ihm vorgelesene Aussage, die er gar nicht gemacht habe, ohne erkennbare Regung angehört. Und nichts dazu gesagt. Auch als sie einen richtigen Zündler aus ihm zu machen versuchten, dem es einen Mordsspaß bereite, alles anzuzünden, was ihm in den Weg komme, habe er hartnäckig geschwiegen. Worauf die Kriminaler nun richtig wütend geworden seien. Und ihm mit dem Zuchthaus gedroht hätten. Doch auch dann habe der Weidinger kein einziges Wort gesagt.
Nachdem alles abgebrannt war, kam der Herr Graf in seinem Geländewagen vorgefahren. Und hat sich seinen Hof angeschaut. Den es nun nicht mehr gab.
Wie er dann auf meinen Vater einredete. Und in seinem schicken Jagdanzug mit lässigen Gesten die abgebrannten Gebäude wieder auferstehen ließ, da hat mir mein Vater leidgetan. Denn der Herr Graf ist gleich darauf wieder in seinen Geländewagen gestiegen. Und davongebraust. Während mein Vater nun die Gebäude wiederaufbauen musste. Die der Herr Graf mit seinen Händen zusammengefuchtelt hatte.
Freilich hat auch mein Vater nichts selbst aufbauen müssen. Es waren die Maurer und Zimmerer, die für ihn und den Herrn Grafen schufteten. Als dann Monate später die brandneuen Gebäude um die Brennerei und das alte Wohnhaus fertiggestellt waren, fuhr der Herr Graf wieder vor. War sehr stolz auf seinen Hof. Der nun viel schöner und größer war als der alte. Er gestikulierte schnell noch ein paar Nebengebäude dazu. Deren Fertigstellung er natürlich wieder meinem Vater überließ. Der wiederum die Maurer und Zimmerer beauftragte.
Bevor der Herr Graf jedoch wieder in seinen Jeep stieg, kam er auf mich zu. Beugte sich zu mir herunter. Fragte mich, ob mir sein neuer Hof gefalle. Ich merkte natürlich, dass ihm meine Meinung wurscht war. Machte trotzdem meinen Mund auf. Doch es kam nur Spucke heraus. Der Herr Graf lächelte. Und noch ehe ich ihm sagen konnte, dass ich den alten Hof lieber mochte, mit seinen unergründlichen Gängen, knarrenden Geheimnissen und Nischen, in denen ich mich verstecken konnte, strich er mit seinen langen dünnen Fingern durch meine zerzausten Haare. Stieg dann gut gelaunt in seinen Wagen. Und sauste winkend durch das nagelneue Hoftor davon.
Und wieder mal munkelten die Leute. Die gute Laune vom Herrn Grafen machte sie stutzig. Da gehe etwas nicht mit rechten Dingen zu. Sagte mein Vater. Der Wiederaufbau des gräflichen Gutes musste ein Heidengeld gekostet haben.