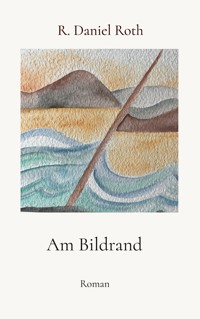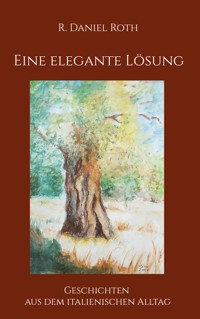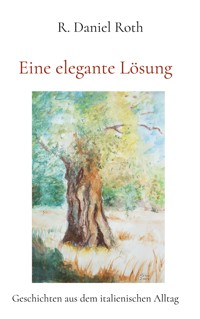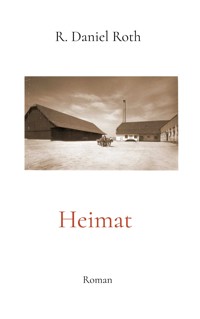Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Gedichte und Geschichten öffnen sich jedem anders. Sie befreien sich aus dem Gitter der sie eingrenzenden Worte. Klingen in verborgene Abgründe hinab. Berühren unbewusst durchlebte Räume, tief eingelagerte Ängste und Sehnsüchte. In jener unwirtlichen Novembernacht habe ich zum ersten Mal gespürt, dass man nicht alles verstehen muss. Und dass das, was uns am meisten bewegt, Augenblicke tiefen Leids und großer Freude, sich nicht im Verstehen offenbart. Vielleicht aber im Erzählen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 176
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Kim
Inhalt
Teil 1
Ein kleiner Junge im U-Bahnhof
Litfaßsäule
Lese-Oase
Spiesmutti
Teil 2
Ave-Maria
Unerwünscht eingereist
Ein Kind auf der Leopoldstraße
Aloisi
Einmal nach Italien
Ich hier drinnen. Ihr da draußen
Roller-Rudi
Teil 3
Immer diese Baustellen
Der Aufzug
Beim Therapeuten
Tatsachen
Der davonlaufende Abend
Teil 4
Die alte Kagereit
Die Wut unserer drei Dörfer
Wir große rollende Steine
Onkel Hans weiß zu viel
Einladung auf dem Meeresgrund
Epilog
Autor
Hinweis
Für Kim
Teil 1
Ein kleiner Junge im U-Bahnhof
München. U-Bahnhof Universität.
Ich gehe mit Anna Passfotos machen. Während wir vor dem Automaten auf die Bilder warten, zupft mich ein kleiner Junge. Er will unbedingt meine Trillerpfeife haben, die ich auf einem italienischen Markt erworben habe.
„Die Pfeife brauche ich,“ sage ich, „wie soll ich sonst meinen Freunden pfeifen?
Der Kleine zieht weiter an der Pfeife am Schlüsselbund, der an einem Karabinerhaken an meinem Gürtel baumelt.
„Ich muss auch meinen Freunden pfeifen!“ sagt er.
Das leuchtet mir ein, und ich gebe ihm die Pfeife.
Anna betrachtet ihre Fotos, die aus dem Automaten züngeln.
Der kleine Junge versteckt meine Pfeife in seiner rechten Hosentasche. Hält sie dort fest. Und schaut auf seine Füße. Die in schmuddeligen Sandalen klemmen.
„Ich habe Hunger!“ sagt er.
Anna sieht mich fragend an.
„Wo wohnst du denn?“ frage ich ihn.
Der Junge hebt seinen Kopf.
Was hat das mit meinem Hunger zu tun, fragen seine hellen Augen durch die Haarsträhnen auf seiner Stirn.
Die rechte Hand ruht weiter in seiner Hosentasche. Die linke zupft wieder an meinem Schlüsselbund. An dem jetzt keine Pfeife mehr hängt.
„Du musst pfeifen!“ sage ich, „dann kommen deine Freunde und bringen dir was zu essen.“
„Ich hab‘ Hunger!“ sagt der kleine Junge.
„Willst du uns nicht sagen, wo du wohnst!“ wiederholt jetzt Anna.
„Weit,“ sagt der Junge, schielt durch seine Haare. Und deutet auf das schwarze Loch aus dem gerade ein U-Bahnzug knirschend hereinfährt.
Seine Hände schweigen jetzt solidarisch in den Hosentaschen.
„Die Pfeife braucht er wohl nicht für seine Freunde,“ sagt Anna.
Wie sie das meine, frage ich.
„Nur so,“ sagt sie.
Der Kleine zupft und zupft und lächelt. Es ist ein ungeübtes Lächeln. Und doch wirkt es verschmitzt.
Das macht der fehlende linke Schneidezahn, denke ich.
Anna sieht mich fragend an.
Ich sehe ihre Fotos, die sie noch immer in einem Viererstreifen zwischen den Fingern hält. Viermal ihr Kopf in klein, sehr farbig.
Ich gehe zum Kiosk.
Der Kleine folgt mir.
Anna auch.
„Willst du eine Bockwurst?“
„Lass ihn doch!“ sagt Anna, „merkst du nicht, dass er sich schämt?“
„Und?“ frage ich ihn nochmal und beuge mich zu ihm runter, „willst du nun eine?“
„Ja-mit-Brot,“ sagt er schnell und schaut an mir vorbei auf die Aus- und Einsteigenden.
„Eine Bockwurst, bitte!“ sage ich zur Kioskfrau, die breit in ihrem Warenkasten thront.
„Und eine Limonade - du willst doch Limonade?“ frage ich zu dem Jungen hinunter.
Er starrt mich an.
Die Limonade scheint ihm egal zu sein, denke ich. Das verstehe ich nicht. Ich würde keinen Bissen herunterkriegen, ohne zu trinken. Und schon gar nicht eine Bockwurst.
„Senf oder Ketchup?“ schnarrt die Kioskfrau.
„Willst du Senf oder Ketchup, mein Freund?“ frage ich in seine Augen, die mich misstrauisch ansehen.
„Du bist nicht sein Freund,“ sagt Anna, „auch nicht, wenn du ihm eine Bockwurst kaufst.“
Darauf weiß ich nichts zu sagen. Der Kleine auch nicht.
Ich sehe seine geballte Faust, die sich auf seiner rechten Hosentasche abzeichnet.
Er braucht meine Trillerpfeife nicht. Denke ich. Sie ist nicht laut genug. Wenn er von weit kommt, werden seine Freunde sie nicht hören.
„Senf oder Ketchup?“ wiederholt die Frau und knallt eine Flasche gelbe Limonade vor mich hin.
Der Junge schaut wieder auf seine Füße.
„Geben Sie mir beides, Senf und Ketchup,“ sage ich.
Sie schüttelt unwillig den Kopf. Spritzt dickliche braune und rote Soße aus zwei Plastikflaschen auf und um die Wurst herum. Ich stelle die Bockwurst mit Senf und Ketchup und die an den Papptellerrand geklemmte Semmel neben die Limonade auf die Kioskablage.
Anna mustert mich. Deutet dann mit dem Kinn auf den Kleinen.
Ich begreife, dass der Junge, dessen Freund ich offenbar nicht bin, die Sachen nicht erreicht.
Als ich ihm einen nahestehenden leeren Bierträger als Podest hinrücke, schiebt er ihn mit dem Fuß beiseite.
„Das sieht doch doof aus!“ sagt er, streckt sich und fingert zur Ablage hoch.
Der Pappteller kippt zu ihm hin. Ein paar Brösel lösen sich aus der ältlichen Semmel. Und fallen in seine struppigen Haare. Schließlich kriegt er die Wurst zu fassen. Er stopft sie mit beiden Händen in seinen Mund. Und kaut sie gierig in sich hinein.
Anna macht den Mund auf, als wolle sie etwas sagen. Sagt aber nichts. Und macht ihren Mund wieder zu.
„Schmeckt’s?“ frage ich.
Der Junge hebt seinen Kopf. Sein Gesicht ist rot und gelblichbraun verschmiert. Jetzt greift er auch nach der Semmel. Und steckt sie zur Wurst in seinen Mund. Irgendwie gelingt es ihm, Wurst und Semmel gleichzeitig im Mund zu behalten. Die Limonade hat er noch nicht angerührt.
Geht weg, sagen seine Schultern.
Plötzlich zieht er meine Trillerpfeife aus seiner Tasche.
Vielleicht will er jetzt doch seinen Freunden pfeifen, denke ich. Aber er hält sie nur fest umklammert in seiner Hand.
„Lass uns gehen!“ sagt Anna, „deine gönnerhafte Pose ist ihm peinlich.“
Dir oder ihm? Denke ich.
Jetzt zupft sie mich am Schlüsselbund.
Der Junge mampft weiter in sich hinein. Mit einer Hand hält er die Pfeife. Mit der anderen die Wurst.
„Ciao,“ sage ich.
„Tschüss,“ sagt Anna.
Der Kleine würgt den letzten Rest der Wurst hinunter. Schaut dann zur Limonade hoch.
Die Kioskfrau wirft einen Blick auf den Jungen. Dann auf mich und Anna. Schüttelt den Kopf.
„Warte! Ich mach sie dir auf,“ sagt sie, öffnet die Flasche. Und schiebt sie an den Rand der Ablage. Der Junge streckt sich. Anna sieht mich erwartungsvoll an. Nimmt dann die Flasche von der Ablage. Und hält sie dem Jungen hin. Der Junge schaut ein paarmal um sich, hebt die Flasche an seine Lippen. Und trinkt die Limonade ohne abzusetzen aus.
„Wir hätten ihn mitnehmen sollen!“ sagt Anna, während wir die Treppen aus dem U-Bahnhof hochsteigen.
„Wen?“
„Den kleinen Jungen eben. Hast du nicht gesehen. Der hatte richtig Hunger.“
„Nun, deswegen habe ich ihm eine Bockwurst gekauft.“
Wir überqueren die Georgenstraße.
„Er hat bestimmt niemanden, der sich um ihn kümmert.“
Warum wollte er dann meine Pfeife? Denke ich.
„Ich verstehe nicht, wie du dir das vorstellst? Da mischt man sich nur in etwas hinein!“
Ein Radfahrer klingelt uns beiseite, als wir zum Mensa- Gelände abbiegen.
„Wir hätten ihn mitnehmen sollen!“ beharrt Anna.
„Entschuldige mal, meine Liebe! Man kann doch nicht einfach anderer Leute Kinder mitnehmen!“
„Woher willst du das wissen?“
„Was wissen?“
„Ob er anderer Leute Kind ist?“
„Unser Kind ist es doch wohl nicht!“ sage ich. Und bereue es sofort. Doch ich kann die Worte nun nicht mehr zurücknehmen.
Anna bleibt ruckartig stehen.
„Tut mir leid!“ sage ich und suche nach ihrer Hand.
„Er war so allein mit de in e r Wurst!“ sagt sie. Und zieht ihre Hand zurück.
Litfaßsäule
Schwabing, 20. März. Ich schiebe mich auf der eisbedeckten Destouchesstraße in Richtung Pündterplatz dem Frühlingsanfang entgegen.
Es ist kalt. Zu kalt, um an den Frühling zu glauben.
Ich gehe langsam, um den schneidenden Zugwind auf meinem Gesicht gering zu halten. Vor mir schlurft ein Mann mit Mantel und Pelzmütze gebückt über den harschigen Gehweg. Seine Hände drängen sich tief in die Manteltaschen. Rote Moonboots umranden klobig seine Füße und Unterschenkel.
Ich kauere mich in seinen Windschatten.
Der Mann verzögert seine Schritte und kommt so unvermittelt zum Stillstand, dass ich Mühe habe, nicht auf ihn zu rutschen. Ich komme gerade noch rechtzeitig zum Stehen. Ärgere mich jedoch über sein unangekündigtes Bremsen.
Andächtig betrachtet er die Litfaßsäule, die vor uns aus dem Schnee ragt.
Er nimmt seine Hände aus den Manteltaschen. Die Arme hängen schwer an seinen schmalen Schultern. Wie bei jemandem der viel mit sich herumträgt. Und es nirgendwo abladen kann.
Ich beuge mich vor, schiele an seinem Mantelkragen vorbei. Mit feuchten Augen fixiert er eines der aufgeklebten Plakate.
Links vom Gehweg türmen sich vereiste Schneehaufen. Rechts an der Hauswand wölbt sich spiegelglatt das gefrorene Tauwasser der tagsüber tropfenden Eiszapfen.
Die Lage ist klar: Überholen ist unmöglich.
Und umkehren will ich nicht.
So stehe ich weiterhin dicht hinter diesem Mann. Schmiege meine Wangen an die vereisten Ränder meines Schals. Und glotze, unfähig meinen Ärger zu artikulieren, mit ihm gemeinsam auf die Litfaßsäule. Während ich von einem Bein auf das andere trete.
Ich sage „Entschuldigung!“ gegen seinen Rücken. Aber er scheint mich nicht zu hören. Und da er weiterhin unbeweglich auf die Litfaßsäule starrt, ich aber gern weitergehen würde und nicht an ihm vorbeikomme, tippe ich nun mit meinem Handschuh auf seine Schulter.
Der Mann nimmt keine Notiz von mir.
Ich könnte ihn einfach beiseiteschieben. Denke ich. Doch dazu ist mein Ärger noch nicht groß genug. Zudem riskiere ich, dass er stürzt. Mich mit sich reißt. Und einen Versicherungsfall heraufbeschwört.
Gemeinsam betrachten wir weiter die Litfaßsäule.
Ich sehe eine Gruppe überlebensgroßer junger Leute mit braunorangenen Gesichtern. Drei flotte Burschen in offenen Hemden, aus denen viel Brusthaar hervorquillt. Alle drei auf blitzblanken Motorrädern um ein Mädchen gelagert, blond und mit aggressiven Sägezähnen in einem verkrampften Lachen erstarrt.
Vielleicht ist er einem Infarkt nahe. Denke ich. Oder es hat ihn ein Gehirnschlag ereilt.
„Kann ich Ihnen helfen?“ grummele ich unter meinem Schal hervor.
Der Mann starrt weiter entrückt auf das Plakat. Als sähe er in eine andere ferne Welt, die das Bild auf der Litfaßsäule in ihm erweckt.
Plötzlich dreht er sich zu mir um und sieht mich mit glasigen Augen an, als habe sich seine Welt nach dorthin verdreht.
Ich höre seinen Atem. Und atme nun meinerseits auf. Ganz offensichtlich nimmt er mich nicht wahr. Aber immerhin lebt er. Er stößt weiße Atemwölkchen aus seinem Mund.
Das Plakat fordert mich in großen Lettern dazu auf, den Augenblick in vollen Zügen zu genießen. Stattdessen stehe ich weiterhin blockiert hinter diesem merkwürdigen Betrachter. Und genieße ganz und gar nicht.
Es dämmert bereits.
Die Farben auf der Litfaßsäule werden blasser.
Der gegenüberliegende Gehweg ist leer. Weißaugige Autos gleiten lautlos über die glitzernde Fahrbahn und verlieren sich in roten Pünktchen in Richtung Belgradstraße. Ein abbiegender Scheinwerfer wischt grell in die Motorradgruppe auf der Säule.
Der Mann packt mich am Arm.
„Das Mädchen da! Sehen Sie!“
Meint er die auf Frau getrimmte Figur im sommerlich gerasterten Teint?
Seine Stimme ist hoch und glucksig. Sie passt nicht zu ihm.
„Ich sehe ein Plakat. Was ist damit?“ sage ich ärgerlich.
Der Zeitpunkt eines möglichen Weitergehens verlagert sich ins Unbestimmte. Ich friere und fühle mich eingeklemmt. Dabei müsste ich nur umkehren.
Das will ich aber nicht.
„Die Kleine dort!“ sagt der Mann und deutet auf die überlebensgroße Einheitsfrau.
„Ja. Irgend so ein Model für eine bescheuerte Zigarettenreklame! Was ist mit ihr? Und was, vor allem, habe ich damit zu tun?“
Der Mann schweigt wieder gegen die Litfaßsäule.
„Was immer mit ihr oder mit Ihnen los ist - wenn ich Ihnen nicht helfen kann, dann lassen Sie mich doch bitte vorbei!“
Meine Worte scheinen ihn nicht zu erreichen.
Ich recke meinen Kopf aus der Deckung.
Sofort spüre ich den schneidenden Wind und verkrieche mich wieder in meinem Mantelkragen.
Wieder deutet der Mann auf die Litfaßgruppe.
„Die Kleine dort zwischen den Motorrädern, das ist meine Tochter!“
Seine Stimme höre ich jetzt nur gedämpft. Durch seinen Mantelkragen klingt sie weniger piepsig.
Na klar, denke ich, auch solche Tussis haben natürlich Väter.
„Ja,“ sage ich, „trotzdem wäre ich froh, wenn Sie mich jetzt vorbeiließen.“
Wie aus weiter Ferne senkt sich sein Blick auf mich. Und bleibt überrascht auf mir haften.
„Aber bitte, junger Mann! Ich wollte sie nicht belästigen. Sie können es ja nicht verstehen, wie es ist, seine Tochter nur auf Plakaten zu haben.“
Und noch ehe ich ihn warnen kann, betritt er die leicht gewölbte Eisfläche nahe der Hauswand, um mir Platz zu machen. Natürlich stolpert er. Fällt mir in die Arme. Und bringt auch mich aus dem Gleichgewicht.
Wir kreiseln um uns herum, fangen uns gegenseitig auf, drehen uns, tief umschlungen, noch einige Male um uns herum Achse. Als wollten wir einen neuen Tanz zusammen einstudieren.
Irgendwie schaffen wir es, tänzelnd und uns immer wieder umarmend, in wackeliger Balance zu bleiben. Kommen schließlich beide auf sicheren Beinen wieder zum Stehen.
Erfreulicherweise habe ich mich bei diesem Eistanz an ihm vorbeigeruckelt. Frostiger Zugwind bläst nun ungeschützt auf mein Gesicht. Doch als ich weitergehen will, packt mich der Mann am Arm. Und hält mich fest.
„Sie kommt nie. Und ich habe nichts von ihr. Nicht einmal ein Foto. Ein Vater will seine Tochter ab und zu sehen. Verstehen Sie das?“
Da ist sie doch, denke ich. Überlebensgroß von allen Seiten einsehbar.
„Ich bin kein Vater,“ sage ich und versuche seine Hand abzuschütteln, ehe wir noch einmal ins Rutschen geraten.
Doch der Mann will mich nicht loslassen.
„Da ist sie doch, werden Sie sagen. Wir betrachten sie ja gerade. Ja, riesengroß und immer lachend. Aber wissen Sie was? Sie lacht gar nicht. Schauen Sie doch mal genau hin! Sie lacht nicht.“
Seine Stimme ist brüchig geworden. Und piepst nun noch mehr als zuvor.
„Entschuldigen Sie, junger Mann! Ja, ich weiß, Sie möchten weitergehen. Es ist kalt, nicht der richtige Ort für ein Familientreffen. Zudem Sie auch nicht zu dieser traurigen Familie gehören. Sie möchten nach Hause. In ein warmes Wohnzimmer. Zu Ihrer Familie. Zu Ihrer Tochter. Oder zu ihrem Sohn.“
Ein Scheinwerferpaar mischt Regenbogenfarben in seine plierigen Augen. Und bringen auf seinen Wangen festgefrorene Tränen zum Glänzen.
„Nein, das ist kein Platz für ein Rendezvous mit seiner Tochter,“ brummelt er noch einmal vor sich hin.
Eine Woge Mitleid zieht unter meinen Mantel. Doch sie reicht nicht aus, mich für ein Verweilen an dieser unwirtlichen Stelle zu erwärmen. Trotzdem will ich ihn nicht ohne ein abschließendes Wort hier einfach so stehen lassen.
Aber es will mir keins einfallen.
„Ich habe weder Sohn noch Tochter,“ sage ich schließlich.
Der Mann hat sich wieder seiner Litfaßsäulentochter zugewandt. Und ich beeile mich, von ihm loszukommen.
Als ich in die Ansprengerstraße einbiege, bleibt eine ältere Dame unmittelbar vor mir stehen und setzt ihre Einkaufstasche ab, die ihr offenbar zu schwer geworden ist.
Um sie nicht umzurennen, weiche ich auf die gewölbte Eisfläche aus. Verliere den Halt unter meinen Füßen. Versuche mich, diesmal ohne Partner, in einem Pirouettentanz, um mich selbst zappelnd, auf den Beinen zu halten. Stürze dennoch. Und plumpse derb auf den Rücken.
Alle Befehle, meinen Körper wieder zum Aufstehen zu bewegen, bleiben unbefolgt. Ich spüre das harte kalte Eis unter meinem Hinterkopf. Unter meinem Körper spüre ich nichts. Der Mann scheint meinen Sturz beobachtet und seinen Litfaßaltar verlassen zu haben. Denn plötzlich sehe ich sein Gesicht über mir.
„Oh du mein Gott, sind Sie gestürzt?“
Irgendwie überflüssig, darauf zu antworten.
Verdammter Familienkram. Denke ich.
„Lassen Sie nur! Es hat keinen Sinn! Ich kann mich nicht bewegen,“ füge ich hinzu, als der Mann mir aufzuhelfen versucht.
„O du mein Gott, o du mein Gott,“ stammelt er unentwegt und wackelt mit fuchtelnden Armen auf eine naheliegende Telefonzelle zu.
Inzwischen ist es ganz dunkel geworden. Aus den Fenstern der Destouchesstraße zuckt violettblaues Licht auf die Eisflächen.
Wenigstens friere ich nicht mehr, denke ich, während das Gefühl aus meinem gesamten Körper entweicht.
Ich döse vor mich hin. Bildfetzen lösen sich aus meinem Gehirn und zerfallen. Gedanken formen sich. Nur wenige davon bleiben übrig:
Die Gehwege sollten winters besser geräumt werden! Fußgänger benötigten Bremslichter! Und Väter sollten ihre Töchter nicht nur auf Litfaßsäulen haben!
Dann kommt der Notarzt.
Lese-Oase
Ein Maisamstag in München. Es ist 13 Uhr 05.
Wie auf zwei gegenläufigen Fließbändern rollen Ströme von Spaziergängern zwischen ‘Siegestor’ und ‘Münchner Freiheit’ hin und her. Ganz Schwabing scheint auf den Beinen zu sein. Herausgelockt durch die ersten warmen Sonnenstrahlen. Auch ich bewege mich mit Anna im Fluss der Schlendernden.
Ecke Kaiserstraße lassen wir uns vor der Buchhandlung ‘Lese-Oase’, (seit Jahrzehnten unter der geschäftstüchtigen Führung der Familie Haberländer), von den in den Gehweg geschobenen Bücherkisten ablenken.
„Ich geh rasch einen ‘Sprotte’-Kalender für Omi kaufen!“ sagt Anna. Omis Geburtstag stehe vor der Tür. Und sie liebe doch Sprotte.
Sie zieht ihre Hand aus meiner und schlüpft an der weißhaarigen Dame vorbei durch die Ladentür.
Trotz langem Samstag informiert uns ein Schild auf der gläsernen Eingangstür über eine vorzeitige Schließung des Ladens um 13 Uhr.
Die alte Dame weist alle weiteren um Einlass Begehrenden, mit einem Krückstock wortlos auf das Hinweisschild zeigend, freundlich ab.
„Die Mutter des Inhabers,“ flüstert Anna. Geht auf sie zu. Und wird durchgelassen.
Ich muss draußen bleiben.
Die Frühlingssonne liegt auf den Bücherkisten. Ich krame uninteressiert darin herum. Beobachte aus dem Augenwinkel, wie willige Buchkäufer abgewiesen werden. Nur hin und wieder wird der eine oder andere durchgelassen. Sie haben wohl Beziehungen. Kennen Frau Haberländer. Herrn Haberländer. Oder jemanden der Frau oder Herrn Haberländer kennt. Oder sie kennen, wie Anna, die weißhaarige Dame selbst. Oder werden von ihr erkannt.
München, die nördlichste Stadt Italiens.
Ein älteres Paar nähert sich mit drei Büchern der Glastür. Sie gehören nicht zu den Privilegierten und werden abgewiesen.
Der Mann scheint sich jedoch nicht damit abfinden zu wollen. Er deutet auf den vor der Eingangstür postierten Bücherkasten.
„Die Bücher hier,“ er wedelt mit den drei Büchern vor dem Gesicht der Alten, „sind aus diesem Kasten. Wozu steht er noch hier, wenn ich mich nicht daraus bedienen darf? Er fordert mich geradezu zum Kauf heraus!“
Die alte Dame schaut lächelnd auf die ihr vorgehaltenen Bücher und schüttelt den Kopf. Worauf der Mann wahllos zwei andere Bücher aus einer der Bücherkisten nimmt und neuerlich auf die alte Dame zusteuert.
Immer noch lächelnd verwehrt sie ihm durch Querhalten ihres Stocks den Zutritt zur Buchhandlung.
„Aber Sie können doch nicht Bücher zum Verkauf anbieten und einen dann nicht damit zur Kasse lassen! Sie verleiten mich ja geradezu zum Diebstahl,“ bellt der Mann, „wollen Sie das? Wollen Sie, dass ich zum Dieb werde?“
„Lass Sie, Arthur! Du siehst doch, sie wollen uns nicht mehr hineinlassen! Du brauchst die Bücher nicht,“ versucht ihn seine Begleiterin zu beschwichtigen.
Nimmt ihm die Bücher aus seiner Hand. Legt sie zurück in die Bücherkiste. Und versucht ihn wegzuzerren.
Der Mann schüttelt sie wie eine lästige Fliege von sich ab, nimmt nochmal andere Bücher aus der Kiste und hält sie der weißhaarigen Dame triumphierend entgegen.
„Da nehmen Sie sie doch! Los, nehmen Sie Ihre Bücher doch wenigstens wieder zurück! Soweit kommt’s noch, dass ich hier zum Kriminellen werde!“
Er könne die Bücher doch ebenso gut selbst wieder in die Kiste legen, redet ihm seine Begleiterin besänftigend zu.
Der Man wedelt unbeirrt mit seinen zwei Büchern weiter vor dem Gesicht der Alten.
„Arthur, lass die Frau in Ruhe!“ faucht seine Begleiterin, „wozu brauchst du denn diese Bücher? Du hast sie dir noch nicht einmal angesehen!“
Der Mann fuchtelt weiter mit den Büchern vor der weißhaarigen Dame herum.
„Soll ich sie einfach so mitnehmen? Ist es das, was Sie wollen? Wollen Sie diese Schuld auf sich laden, mich schuldig werden zu lassen?“ keift Arthur hysterisch.
„Bist du verrückt?“ fährt ihn seine Begleiterin jetzt an, „was redest du denn da? Leg diese verdammten Bücher wieder in den verdammten Kasten zurück!“
Sie beugt sich vor und versucht die Titel zu erkennen.
„Die liest du mit Sicherheit nicht!“
Die Alte steht unbeweglich vor ihnen. Ihr Gesicht ist eine lächelnde Wand. Sie hält immer noch ihren Krückstock horizontal vor sich.
Als Arthur fortfährt, sie mit den Büchern zu bedrohen, macht sie einen Schritt zurück und sieht ihn vorwurfsvoll an.
„Sie sind sehr unhöflich, mein Herr!“
Arthur presst die Bücher fest an sich. Seine Begleiterin zerrt an ihnen. Und an Arthur.
„Jetzt komm endlich! Vergiss diese dummen Bücher! Leg sie zurück!“
Und mit einem verächtlichen Kinnzucken fügt sie hinzu:
„Die sind selber schuld, wenn sie kein Geschäft machen wollen!“
„Unhöflich?“ fragt Arthur nach, „ach, unhöflich nennen sie das? Das hat nichts mit Höflichkeit zu tun. Hier geht es ums Prinzip!“
„Welches Prinzip denn?“ stöhnt seine Begleiterin.
„Ums Prinzip eben.“
Er zögert.
Plötzlich scheint er es sich anders überlegt zu haben.
„Sollen sie doch auf ihren Büchern hocken bleiben!“ raunzt er, schleudert die Bücher der weißhaarigen Alten vor die Füße, dreht sich brüsk um und greift entschieden nach der Hand seiner Begleiterin.
„Es gibt auch noch woanders Bücher! Nicht nur in diesem elitären Tempel hier!“
Inzwischen hat sich ein Grüppchen um den aufgebrachten Mann gebildet.
„Manno, du bist ja völlig durchgeknallt!“ ruft ein junger Bursche mit roten und grünen Haaren und bahnt sich einen Weg zu den Bücherkisten, „hör auf deine Alte! Vergiss die Bücher und klemm dich vor deinen Fernseher. Wo du hingehörst!“
„Bravo!“ meldet sich nun noch eine weitere Stimme aus dem Grüppchen.
Jetzt sind noch weitere Stimmen zu hören.
„Endlich einer, der hier den Mut hat, diesen Hysteriker in die Schranken zu weisen!“
„Wer gibt ihm eigentlich das Recht, die alte Dame zu beleidigen?“
„Sie tut schließlich nur ihre Pflicht!“