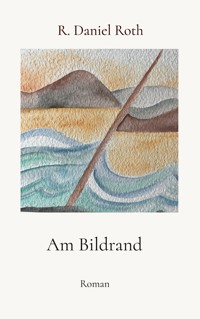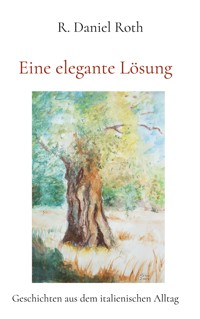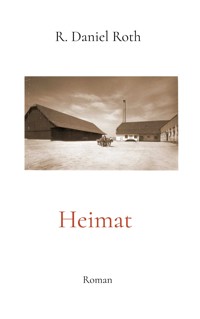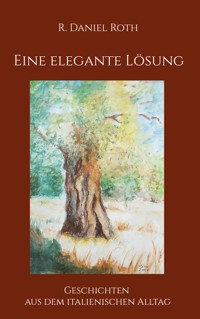
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Freunde von Freunden werden hierzulande nicht nach Papieren befragt. Wenn man jemanden kennt, der einen kennt, oder erkannt wird von jemandem, der einen kennt, den man selbst nicht kennt, kriegt man in Italien einen geraubten Goldschatz, eine Geisel, und vielleicht sogar eine Leiche im Kofferraum durch alle Straßensperren. Und es gibt Ausweichmöglichkeiten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 172
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
für Kim, an meiner Seite
Inhalt
Lebenstraum
Autobahnparty bei Siena
Degustazione di vino
Ein alter Brauch
Der Feuerwehrmann von Monti
Fliegende Mütter
Don Tarcisio
Man überholt nicht in der Kurve
Lino und die Zahnputzbecherablage
Lino und der Schreibtisch
Mein Freund Gianni
Die Straßensperren von Rosía
Traktorfahrer gesucht
Banküberfall in Paganico
Nie wieder mit Freunden zu Luigi
Eine elegante Lösung
Auf einer Parkbank in Grosseto
Der Barista von Costa Fabbri
Cenone
Frösche quaken nicht
Nachbemerkung
Dank
Autor
Hinweis
Lebenstraum
Wir alle träumen. Mehr oder weniger.
Viele träumen nur schlafend. Manchen Träumern genügt das nicht. Sie weben ihre Träume mit hinein in ihre Tage. Und weil sie als Tagträumer belächelt werden, verbannen sie diese ihre ins Licht keimenden Träume wieder zurück in das amorphe Dunkel ihrer Nächte.
Ich weiß nicht, ob man Mut braucht, um durchlässig zu werden für das, was sich aus dem Inneren chiffriert ins Bewusstsein drängt. Um dort gelesen oder gar erschaffen zu werden.
Ich weiß auch nicht, ob es immer eine Sehnsucht ist, die, einmal aus den Labyrinthen der Traumwelt entziffert, in unser Leben eindringt und sich in ihm fordernd und übermächtig ausbreitet.
Doch ich weiß, um seine Träume in den Tag hinein zu träumen, genügt es, ein Tagträumer zu sein. Das ist nicht wenig. Doch den meisten fehlt der Mut dazu. Sie nehmen ihn nicht ernst, ihren Traum. Versperren ihm den Zugang zu ihren Tagen
Diese Menschen träumen nicht eigentlich.
Ihre Träume träumen sich selbst. Blubbern hoch aus den Tiefen ihres eigenen Traumfundus. Und dem der gesamten Menschheit. Führen ihr Eigenleben in ihren Nächten. Formen sich zu Bildern und Symbolen, düsteren Wolken und heiteren Düften. Verketten sich zu bizarren Anekdoten. Verquirlen sich ineinander. Und verblassen wieder, wenn sie erwachen.
Oft bleibt nicht einmal ein Funken Erinnerung an diese Träume oder Traumfetzen zurück.
Vielleicht ahnen sie ja, dass das Geträumte, Einlass in ihre Tagwelt begehrt. Doch ihr innerer Zensor hält sie zurück. Aber das Geträumte schwelt jenseits ihres Bewusstseins in ihnen weiter. Lagert sich in ihnen ein. Und sie tragen es in Formlosigkeit abgeschobener Schwere in sich herum.
Manchmal jedoch lebt ein Traum so unvermittelt in unseren Tag hinein, dass er bereits Gestalt annimmt, noch ehe wir ihn abwehren und in die Traumwelt zurückzuschicken vermögen. So ein Traum entsteht aus einer tief in uns eingesunkenen Sehnsucht. Die ihn ans Licht zu zerren versucht.
Um ihn aus der Traumwelt in die Tagwelt umzupflanzen, genügt es nicht, weiter zu träumen. Ein solcher Traum will erwachen. Verwirklicht werden. Fordert seinen Platz in unserem Leben.
Er wird zum Lebenstraum.
Ich weiß nicht, ob es für manche Menschen möglich ist, dem alles vereinnahmenden Fordern eines ins Bewusstsein drängenden Lebenstraums zu widerstehen.
Ich weiß nur, ich habe es nicht geschafft.
*
Als Anna und ich, an einem goldenen Januarnachmittag den wohl seit Jahrzehnten nicht mehr begangenen Holperweg zur Ruine Monte Cu hochschlendern, ahne ich noch nicht, dass dieser Ort alle meine auseinanderdriftenden Sehnsüchte bündeln würde. Die hier ihre Erfüllung finden sollten.
Auf dem Gipfel der Anhöhe angekommen, stockt mir der Atem. Ich wende mich zur Seite. Sehe, dass auch Anna zu mir herüberschaut.
Entweder befinden wir uns gerade beide im selben Traum. Denke ich. Oder das, was sich vor uns auftut, ist tatsächlich Wirklichkeit.
Einen Ort wie diesen habe ich nie zuvor gesehen.
Reste eines zusammengebrochenen, von Brombeerhecken umschlungenen Gemäuers thronen auf einem von Steineichenwäldern umgürteten Plateau, das den Blick über die endlosen Hügelkämme der südlichen Toskana nach allen Seiten hin freigibt. Nicht nur das, was ich mit meinen Augen aufzunehmen vermag, verschlägt mir den Atem. Es ist die erzählende Stille, die über allem schwebt. Und als hätten wir bereits Wurzeln in der toskanischen Erde geschlagen, stehen wir gebannt inmitten dieser lichtdurchfluteten Weite. Die mich vom ersten Moment an in sich aufnimmt. Und mich nie wieder loslassen sollte.
Es ist, als sei die Toskana in mir explodiert.
Hier will ich, nein, hier muss ich leben. Koste es, was es wolle.
„Oh je,“ sagt Anna und atmet einmal tief ein und wieder aus, „du Armer! Du bist einem Kollektivtraum zum Opfer gefallen.“
Ich weiß natürlich um die Affinität meiner Landsleute zur Toskana.
„Der Kollektivtraum, von dem du sprichst, ist nur so eine vorübergehende Modeerscheinung,“ sage ich abwinkend, „jemand macht etwas vor. Und alle machen es nach. Was ich hier spüre, ist etwas anderes.“
Anns mustert mich belustigt.
„Es ist als…“ setze ich nochmal an. Aber mir fehlen die Worte, zu beschreiben, was in mir auflodert. Und weder Anna noch meine Freunde sollten es schaffen, mich aus der Gewissheit zu vertreiben, dass dies hier der Platz ist, der auf eine Frage antwortet, die ich nie gestellt habe. Stets aber schon in mir trage.
Sollen sie mich doch alle belächeln, denke ich. Für sie mag es andere Wege geben. Für mich gibt es nur diesen einen. Unter diesem Himmel. Auf dieser Erde. An diesem Platz.
„Und wie stellst du dir das vor?“ fragt Anna. Und nur schwingt schon ein Hauch Neugierde in ihrer Frage mit.
„Ganz einfach,“ sage ich, „wir machen ein Gästehaus auf, einen agriturismo. Für alle diese Toskanaverliebten. Und du wirst sehen, sie rennen uns die Tür ein!“
„Na, du musst was sagen! Wer ist denn toskanaverliebter als du.“
„Eben, ich weiß was die mögen.“
Das Grundstück stellt sich als käuflich heraus. Also kaufen wir diesen von Gestrüpp überwucherten Steinhaufen. Zu einem erstaunlich niedrigen Preis.
Doch gleich darauf fangen die Schwierigkeiten an.
„Natürlich,“ sagt Anna.
„Das war doch vorauszusehen,“ sagen meine Freunde.
Das zusammengebrochene Gemäuer entpuppt sich als der Rest einer über tausend Jahre alten ehemaligen Abtei. Und natürlich steht es unter Denkmalschutz. Und das Grundstück, auf dem es steht, unter Naturschutz.
„Bingo!“ sagt Anna, „wir haben einen Steinhaufen gekauft mit einem Stück Land drum herum, auf dem wir keinerlei Veränderungen tätigen dürfen, na Mahlzeit.“
Um aus dieser verfahrenen Situation vielleicht doch noch herauszukommen, beauftragen wir einen Anwalt. Dann einen weiteren. Und noch einen. Und noch einen. Der erste Anwalt lässt uns wissen, dass die Sache aussichtlos sei. Und lässt uns seine Honorarforderung dafür zukommen. Der zweite belächelt die Aussage seines Kollegen, erreicht aber auch nichts. Und stellt nun seinerseits seine Honorarforderung.
„Gib auf!“ sagt Anna.
„Gib auf!“ sagen meine Freunde.
Meinen Lebenstraum aufgeben, denke ich. Wie soll ich das?
Ich erkundige mich nach einem kompetenteren Anwalt.
„Non si preoccupi, Signore! Ci vorra un po di tempo. Ma abbia pazienza, ce la facciamo, machen Sie sich keine Sorgen! Es wird eine Weile dauern. Aber das schaffen wir schon, vedrá, Sie werden sehen!“ sagt der Anwalt.
Mit diesen hoffnungsmachenden Worten hält er uns eine Weile hin. Die Honorarforderungen schrauben sich höher und höher. Das anfangs günstig erworbene vielversprechende Projekt eines Gästehauses wird zu einem Geldfresser. Ohne Aussicht, das Projekt jemals verwirklichen zu können.
„Du bist verrückt, wenn du weitermachst“ sagt Anna, „lass los! Bevor diese deine Schnapsidee unser Leben zerstört.“
„Schnapsidee? Das ist mein Lebenstraum!“
„Du hast dich da in was verbissen, was dich in den Abgrund führt,“ sagen meine Freunde.
„Lass los!“ sagen jetzt auch meine Verwandten.
Und da die Sehnsucht unentwegt weiter in mir tobt, und ich mich offenbar als Einziger für nicht verrückt halte, begebe ich mich in die Hände eines Psychoanalytikers. Um vielleicht von ihm zu erfahren, wie ich ohne die Erfüllung meines Lebenstraums, der mich vollkommen mit sich ausgefüllt hat, weiterleben soll. Und während ich mich bemühe, herauszufinden, warum mir alle um mich herum vorwerfen, von einem ‚diffusen Toskanatraum‘ besessen zu sein, den ich selbst als die Erfüllung meines Lebens wahrnehme, kommen immer weitere Honorarforderungen von Anwalt Nummer Vier bei uns an.
Nach dreijähriger intensiver Psychoanalyse legt mir der Analytiker nahe, die Behandlung abzubrechen. Er finde keine zu entknüpfenden Seelenknoten in mir. Was mir ganz offensichtlich zu fehlen scheine, sei ein Leben in der Toskana. Sagt der Analytiker. Und er bedauere zutiefst, mir bei der Verwirklichung dieses Lebens nicht behilflich sein zu können. Schenkt mir ein hilfloses Lächeln. Und entlässt mich nun seinerseits mit einer Honorarforderung, die hinter denen der Anwälte nicht zurücksteht.
„Vier Anwälte und ein Analytiker haben nun unser Geld in der Tasche. Auch der Verkäufer von deinem verdammten Monte Cu reibt sich die Hände, dass wir ihm dabei geholfen haben, einen wertlosen Steinhaufen zu Geld zu machen. Und du gibst immer noch nicht auf?“ stöhnt Anna.
Dann, als habe die Verwirklichung meines Lebenstraums der ausgesprochenen Worte eines Analytikers bedurft, entwirrt sich von einem Tag auf den anderen die festgefahrene Situation.
Der Ausbau von Monte Cu wird durch die Belle Arti di Siena (Amt für Denkmalschutz in Siena) plötzlich genehmigt. Und auch das Umweltamt gibt unerwartet seine Erlaubnis, das Grundstück ums Haus herum zu bepflanzen und zu bewirtschaften.
Ebenso unerwartet fängt nun auch Anna wieder Feuer an unserem fast schon begrabenen Projekt. Nach über zehn Jahren des Wartens und Kämpfens wird mein Lebenstraum doch noch Wirklichkeit.
Wir brechen unsere Zelte in Deutschland ab. Und erwecken die Ruine der alten Abtei zu neuem Leben. Zwischen Rosmarin- und Salbeisträuchern, Oliven, Zypressen und Pinien lassen wir ein Paradies entstehen, das wir über viele Jahre mit unseren Gästen teilen sollten.
*
„So viele Sterne,“ sagt Anna in das monotone Pfeifen der Zwergohreneule.
„Ja,“ sage ich. Drehe mich auf dem Liegestuhl zur Seite. Und schaue auf die vibrierenden Lichter der über die Hügel verteilten zahllosen kleinen Orte am Horizont, „und so viele Wildschweine, die um uns herum grunzen.“
„Auch mit ihnen werden wir wohl diesen Ort teilen müssen,“ flüstert Anna, als wolle sie es vorerst noch vor den Wildschweinen geheim halten.
„Du hast gewonnen,“ sagt sie mir leise ins Ohr, als die ersten Gäste am nächsten Morgen auf unserer Terrasse erscheinen, „ich sehe in ihren Augen, was ich in deinen gesehen habe, als wir vor über zehn Jahren hier hochschlenderten.“
Autobahnparty bei Siena
Ich bin mit Anna unterwegs nach Bientina, um dort neue Liegestühle und Schirme einzukaufen. Damit es unsere Gäste auch während der nächsten Saison gut bei uns haben.
Wir fahren früh los, um noch vor der landesüblichen langen Mittagspause dort anzukommen. Hinter Siena beginnt es wolkenbruchartig zu regnen.
Plötzlich kommen zwei riesige Lastzüge ins Schlingern. Schwanken bedrohlich hin und her. Versuchen vergeblich, sich gegenseitig auszuweichen. Verkeilen sich ineinander. Und verteilen sich krachend und knirschend über zwei Autobahnspuren.
Alles geschieht wie in Zeitlupe. So habe ich ausreichend Gelegenheit, zu bremsen, hoffe nur, dass wir nicht von hinten aufgespießt werden. Aber glücklicherweise kommen alle um uns herum kreiselnden Fahrzeuge rechtzeitig zum Stillstand.
Wir schreiben den geplanten Einkauf der Liegestühle und Sonnenschirme augenblicklich ab. Und stellen uns auf langes Warten ein.
Die meisten blockierten Autofahrer steigen aus, begutachten die ineinandergeschobenen Blechriesen. Zuerst sind alle, auch Anna und ich, erleichtert, dass die Lastwagenfahrer offensichtlich unverletzt geblieben sind. Doch dann kippt die Stimmung. Wir alle sind von irgendwo abgefahren, um möglichst bald an unseren Zielorten anzukommen. Und nun sitzen wir hier auf unbestimmte Zeit fest.
Nach etwa einer Stunde bahnt sich ein Kran einen Weg durch die inzwischen über mehrere Kilometer gestauten Fahrzeuge. Der Kranführer steigt aus. Schüttelt entschieden den Kopf. Er erkennt wohl auf Anhieb, dass sein Kran den Proportionen der havarierten Lastzüge nicht gewachsen ist. In der Tat sieht es aus, als versuche ein Fischer einen Pottwal mit einer Angel hochzuziehen.
Bei den ersten Versuchen, die beiden Lastzüge voneinander zu trennen, hebt sich lediglich der Kran vom Boden Die Lastzüge selbst bewegen sich keinen Zentimeter. Doch der Kranführer scheint fest entschlossen. Er zerrt mit seiner Seilwinde weiter, erst am einen dann am anderen Lastzug. Setzt den Haken an unterschiedlichen Stellen an. Ohne Erfolg.
Ich beobachte mich dabei, wie ich innerlich mitziehe. So wie manche Beifahrer in bedrohlichen Situationen mitbremsen, obwohl sie kein Bremspedal zur Verfügung haben.
Rums! Plötzlich löst sich das Führerhaus von einem der Lastzüge mit einem Ruck. Und wird mit Gewalt nach hinten über die aufgestauten Autos hinweg den Abhang hinuntergeschleudert. Vielleicht meinen ja einige von denen, die hier festsitzen, es finde hier ein Unfallhappening statt. Denn jetzt begleitet lautes Beifallklatschen den krachenden Aufprall. Wie durch ein Wunder ist wieder niemand zu Schaden gekommen.
„Hier stehen wir wohl noch eine Weile,“ kommentiert Anna.
Irgendwann heulen Sirenen heran. Polizeiautos, Feuerwehr- und Krankenwägen schlängeln sich durch die kreuz und quer stehenden Autos auf die Unfallstelle zu. Die Polizisten, Feuerwehrleute und Sanitäter springen aus ihren Fahrzeugen. Kommen im Laufschritt heran. Und starren auf die bizarre Szenerie. Nachdem sie festgestellt haben, dass es weder Tote noch Verletzte zu geben scheint, schieben sie die Mützen ihrer unterschiedlichen Uniformen nach oben. Und kratzen sich an ihren Köpfen. Einige der deutlich als Zugehörige der Feuerwehr erkennbaren Männer fangen an, mit großen Reisigbesen die Unfallstelle zu kehren. Was, wie jedes Fegen, zu Ergebnissen führt. Die jedoch keine Befreiung der hier festsitzenden Verkehrsteilnehmer erwirken. Was diese wiederum kopfschüttelnd zur Kenntnis nehmen.
Inzwischen fährt der entschlossene Kranführer fort, mit Seilwinde und Haken an den ineinander verkeilten Lastwägen zu ziehen. Um sie, wie auch immer, voneinander zu trennen. Es kracht, es knirscht. Doch was sich bewegt, ist nur der Kran selbst. Der mehrmals umzukippen droht.
Weitere Hilfsfahrzeuge rücken an. Die Helfer gesellen sich zu ihren Kollegen. Stellen sich im Halbkreis um die umgekippten Lastzüge. Beobachten nun gemeinsam die unergiebigen Bemühungen des Kranführers.
„Auf die Idee, einen größeren Kran zur Unfallstelle zu zitieren, scheint niemand zu kommen,“ sagt Anna.
„Vielleicht ist ja schon einer oder mehrere unterwegs und sie kommen nicht durch den Stau,“ rufe ich auf Italienisch in das Knirschen und Krachen hinein.
„Ma meglio!“ ruft eine italienische Frauenstimme, was in etwa heißt, „schön wär’s“ oder „von wegen“ oder „das glaubt ihr doch selber nicht!“.
„Alla italiana,” kommentiert eine andere Stimme, “italienisch eben.“
„Ich wusste gar nicht, dass die Italiener so ein ironisches Verhältnis zu sich selber haben,“ sagt Anna.
Es scharen sich mehr und mehr Verkehrsteilnehmer um den Kran. Und bereichern die festgefahrene Situation mit mehr oder weniger passenden Kommentaren.
Einige schlagen fluchend ihre Autotüren auf und zu. Andere stehen in kleinen Grüppchen zusammen und unterhalten sich an- oder aufgeregt.
Der Kranführer lässt seinen Blick über die Wartenden schweifen. Als überdächte er die Verbissenheit, mit der er an seinem Tun festhält. Und erhoffte sich einen Rat aus der Reihe der Wartenden. Oder wenigstens einen klitzekleinen Hinweis, wie er sie und sich selbst aus dieser misslichen Lage befreien könnte. Dann nickt er entschlossen. Wendet sich wieder den Armaturen seines Krans zu. Und fährt fort, an den Lastwägen herumzuzerren. Auftrag ist Auftrag.
„Wenn er so weitermacht,“ sagt Anna, „werden wir bis zum Abend oder gar bis zum Morgengrauen hier eingekesselt bleiben.“
„Ich weiß nicht. Wenn ich sehe, was da vorgeht, habe ich eher den Eindruck, wir werden unser restliches Leben hier verbringen müssen. Zumindest so lange, bis die beiden Blechriesen so verrostet sind, dass sie in abräumbare Einzelteile zerfallen. Bis dahin werden uns hoffentlich Nothubschrauber aus der Luft mit überlebenswichtigen Nahrungsmitteln versorgen.“
Inzwischen haben einige angefangen, die Motoren ihrer Autos aufheulen zu lassen. Was immer sie sich davon versprechen, es reiht sich ein in das unergiebige Tun innerhalb dieser chaotischen Szenerie. Andere bewegen ihre Autos auf die verkeilten Laster zu. Fuchteln aufgeregt aus ihren Fenstern oder geöffneten Schiebedächern. Einige fahren ruckartig vor und wieder zurück. Wohl eine über die Beinmotorik ausgeleitete Entladung ihrer Ohnmacht und Hilflosigkeit. Wieder andere recken ihre hochroten Köpfe aus den Seitenfenstern, um bildstarke Flüche gegen Unbekannt hinauszubrüllen.
Der Kranführer hält einen Augenblick inne. Streckt sich mit erhobenen Armen über das gesamte Blech hinweg, als habe er die Stimme eines Propheten vernommen, der sie aus dieser eingeklemmten Situation zu führen weiß.
Die meisten jedoch verhalten sich eher stoisch. Als hätten sie sich, wenn auch unfreiwillig, zu einer Megaparty eingefunden. Die nicht so recht in Gang kommen will.
Ich werde immer unruhiger. Anna vermutlich auch. Aber sie lässt sich’s nicht anmerken.
Frauen haben die besseren Nerven. Denke ich.
Ich steige aus. Ich steige ein. Ich steige aus.
Schließlich frage ich einen der Polizisten, wie viele Stunden es wohl noch dauern würde, worauf dieser, durchaus nicht unfreundlich, in der den südlichen Straßenpolizisten vorbehaltenen Eleganz eine vage Handbewegung ins Unermessliche andeutet. Ich bedanke mich, wenn ich auch nicht weiß, wofür. Und trotte zu unserem Auto zurück.
Jetzt fangen einige an, mit emporgereckten Köpfen von einem Bein aufs andere zu hüpfen. Als hielten sie nach einer Möglichkeit Ausschau, sich zu erleichtern. Andere arrangieren sich in kleinen Grüppchen zu Schwätzchen aller Art.
Jene, die mit ihren Familien unterwegs sind, breiten Tischtücher auf den Kühlerhauben aus. Die Mütter und Großmütter bringen Kühltaschen, Pappbecher und Plastikgeschirr heran. Es ist Mittagszeit. Auf das Mittagessen will man nicht verzichten. Auch nicht im Stau. Die Väter entkorken Weinflaschen. Und schrauben Mineralwasserflaschen auf.
Irgendwann ruft eine Frauenstimme:
„Se volete caffè? Wenn jemand Kaffee will?“
Zwei monströse Thermosflaschen werden hochgehalten. Natürlich. Denke ich. Ohne Kaffee geht hierzulande gar nichts. In ihrer Liebe zum Kaffee vereinen sich die Gemüter.
Ein Raunen geht durch die Schicksalsgemeinschaft.
Einige rufen „bravo“. Die meisten klatschen wieder. Alles drängt in Richtung Thermosflaschen. Junge und ältere Frauen schlendern, ihre schreienden oder lachenden Kinder und Enkel vor sich her schaukelnd, durch die Reihen der Autos. Aus einem Radio, direkt neben uns, höre ich Stimme von Lucio Dalla. Weiter hinten tönt Zucchero zu uns herüber. Gleich darauf setzt Gianna Nannini ein.
Die Party kommt in Gang.
Über allem wabert der Geruch von Kaffee, herbem Rotwein, Schinken und Käse und dem in die Autobahn eingesunkenen Gestank von Benzin, Gas und Diesel.
Ein paar Halbwüchsige laufen hinter einem erschlafften Ball her.
„Doch nicht hier auf der Autobahn, ragazzi!“ ruft eine Frauenstimme.
„Autobahn!“ tönt es lachend zurück.
Junge und ältere Männer gesellen sich dazu. Der fast zerknüllte Ball fliegt über die Autodächer. Die Jungen johlen, die Alten lachen. Ein paar Hunde, die einer Katze hinterherjagten, mischen sich in das Spiel. Einer der Hunde bekommt den Ball zu fassen. Beißt hinein. Und rennt mit ihm davon.
„Giulia! Vieni qua!“ brüllt eine der Männerstimmen.
„Wie kann man seine Hündin nur ‚Giulia‘ nennen?“ rufe ich belustigt.
„Wieso?“ echauffiert sich Anna, „fändest du Enrico oder gar Mario vielleicht besser?“
„Ja, auf alle Fälle, aber nur wenn’s ein Rüde wäre.“
Irgendwann rollt ein Polizeikommando heran. Und leitet uns und die eingeklemmten Fahrzeuge durch eine Öffnung des bepflanzten Mittelstreifens auf eine der Gegenspuren.
Wir steigen in unser Auto. Während auch alle die anderen wieder in ihre Fahrzeuge einsteigen, meine ich Bedauern in den Gesichtern zu beobachten.
Es dauert, bis alle Fahrzeuge hinübergelotst sind. Die Party ist vorüber. Wo sie doch gerade erst losgegangen war.
Anna und ich tauschen uns während der gesamten Heimfahrt darüber aus, was wir lustig, originell oder nervig empfanden.
„Erinnerst du dich an den schlaksigen Typen mit der kleinen Brünetten und den drei süßen Kleinen,“ sagt Anna.
„Du meinst die mit dem Maremmahund? Na klar. So einen sollten wir uns auch mal anschaffen.“
„Ehrlich gesagt, hätte ich lieber eine Katze,“ sagt Anna.
Im Nachhinein fanden wir vieles witzig, worüber wir auf der Party selbst nicht wirklich lachen konnten. Erst als wir wieder zu Hause ankommen, fällt uns wieder ein, weswegen wir überhaupt unterwegs waren.
„Ach weißt du,“ meint Anna, „bis zum Saisonbeginn vergehen noch Monate. Bis dahin haben wir noch jede Menge Zeit, um wieder nach Bientina zu fahren.“
„Vielleicht gibt es ja unterwegs wieder so eine nette Party,“ füge ich hinzu.
Degustazione di Vino (Weinverkostung)
Eigentlich wollten wir nur noch schnell nach Slowenien reinfahren, um vor unserer Heimreise vollzutanken.
Wenn unser Auto einen großen Tank habe, lohne es sich, einen kleinen Umweg nach Gorizia zu machen, und vor dort aus kurz nach Slowenien reinzufahren. Meinte Mario, der Chef des Hotels in Grado, in dem wir für ein paar Tage untergekommen waren. Der Sprit koste dort deutlich weniger. Und da unser Auto über einen großen Tank verfügt, beschließen wir, uns auf diesen Umweg einzulassen.
Als wir gerade wieder nach Italien einfahren, meldet sich Annas Mobiltelefon.
„Se avete ancora voglia di visitare una bellissima azienda vinicola lí vicino?” Ob wir noch Lust hätten, ein sehr schönes nahegelegenes Weingut zu besichtigen…? fragt Mario. Man habe von dort aus eine wunderbare Aussicht über die friulanischen Hügel und Weinberge.
Anna sieht mich fragend an. Wir haben uns nichts weiter für diesen letzten Tag unseres Urlaubs vorgenommen. Bleierne Junihitze wabert über den Dächern von Gorizia. Und bringt die Luft zum Flirren. Was kann man an einem solchen Tag Besseres machen, als sich auf eine erhobene Position zu begeben und eine angekündigte schöne Aussicht zu genießen?
Ich nicke. Ja, warum nicht.
Mario gibt uns die Adresse und Telefonnummer eines gewissen Giancarlo. Vermutlich der Besitzer des Weinguts. Und meint: „Ruft dort an, bevor ihr ankommt und sagt, dass ich euch geschickt habe!“
Es ist kurz nach Zwölf.