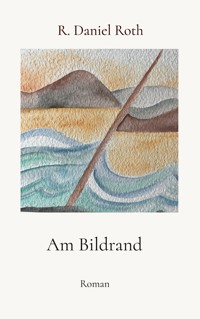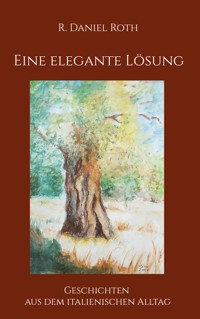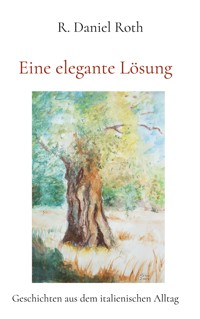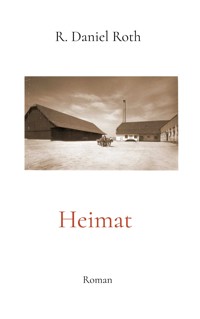Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Ich weiß nicht, warum ich angehalten habe. Sie hat nicht einmal gewunken. Auch jetzt steht sie nur da. Als sei sie mit dem überschwemmten Seitenstreifen verwachsen.... Nimmt sie überhaupt wahr, dass ich für sie anhalte? Vielleicht habe ich mich ja getäuscht. Und sie will gar nicht mitgenommen werden. Und will ich sie überhaupt mitnehmen? Frage ich mich, als ich den Rückwärtsgang einlege..." Als der kauzige Philipp auf seinen Nachtfluchten die Anhalterin Anna mitnimmt und mit ihr in die große Ebene ninausfährt, ahnt er nicht, dass er in einen Sog gerät, der ihn aus sich selbst herauszuzerren droht... Eine Roadstory zwischen Traum und Wirklichkeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 228
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
„Für dich und nur nicht kenntlich fast, doch eine Spur von allem möchte ich dir geben, Leben, doch nicht die Linie, sondern rechts und links davon die beiden Seiten.“
Kim an meiner Seite (1978, Casanuova/Siena)
Die einzige Möglichkeit irgendwo anzukommen ist, dass man sich erst überlegt, wo man hinwill, bevor man losgeht
John Updike
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Teil 1: Abenddämmerung
Wie eine Insel im Regen
Die Stille der Nachtfahrten
Der Große Wagen
Teil 2: Die Ebene
Jenseits der Grenze
Die Fliege
Eine bessere Welt
Die Falle
Ein Niemand
Im Innern der Erde
Teil 3: Morgendämmerung
Anna
Unterm Schleier
Der große Anschlag
Epilog
Prolog
Ich sei ein unausstehlicher Mensch. Sagt Teresa.
Ich setze alles durch, was ich wolle. Kümmere mich nur um meine eigenen Bedürfnisse. Ignoriere die ihren. Und die der anderen.
Dabei ist es genau andersherum. Sie ist es, die alles durchsetzt. Und ich muss mich davor schützen, nicht zum Ball in ihrem Spiel zu werden.
„Welches Spiel?“ fragt Teresa.
„Dein Spiel eben,“ sage ich.
„Und wie ist es mit den anderen?“ fragt Teresa.
„Welche anderen?“
Dann fängt sie wieder mit der Ursuppe an.
„Kaum erwachen wir aus der Ursuppe,“ sagt sie, „fangen unsere Probleme an.“ Und sie sagt es in einem Tonfall, als wolle sie mir auf die Sprünge helfen, etwas zu verstehen, was sie längst durchschaut hat. Ich aber wohl noch nicht.
Ich beobachte, wie die Worte durch ihre Lippen rutschen.
„Wir schauen über den Tellerrand,“ sagt sie, „und was stellen wir fest?“
Ich schaue sie an.
„Du sollst nicht mich anschauen! Dort! Draußen! Was siehst du?“
Ich wende mich kurz von ihr ab.
„Na was schon?“ sagt sie, „dass alles schon da ist.“
Alles? Denke ich. Was meint sie mit ‚alles‘? Und schaue sie wieder an.
„Alles eben,“ sagt sie, „Straßen. Gehwege. Häuser. Brücken. Fahrräder. Motorräder. Autos. Schiffe. Flugzeuge und Kinderwägen. Verstehst du?“
Ich frage mich, worauf sie hinauswill.
„Skateboards und Roller. Häfen. Bahnhöfe. Kirchen. Tempel und Moscheen.“
Sie fixiert mich mit einem herausfordernden Blick.
„Und inzwischen auch wir,“ sagt sie, „in unserer Nichtigkeit.“
Ich habe keinen blassen Schimmer, was sie mir mit ihrer Aufzählung sagen will. Wo sind die erwähnten Probleme?
Einstweilen erfreue ich mich ihrer Mundbewegungen.
Vor allem beim A, wenn sich ihre Lippen öffnen. Oder beim U und Ü. Wenn sie ihre Ober- und Unterlippe nach außen stülpt. Ihren Mund kreisrund formt. Und mir den dunklen Vokal gleichsam entgegen küsst.
Und prompt sagt sie: „Uuuuursuuuppe. Schuulen. Uuuniversitäten und Fluuugplätze. Rollschuuhe. Suuupermärkte. Tuunnels. Büüüühnen und Lüüüüfte.“
Dabei wendet sie ihren Blick nach innen.
Was sie dort sieht, weiß ich nicht. Vielleicht das, was mir, ihrer Ansicht nach, entgangen ist? Und was sie mir nun mit ihrer Aufzählung zu verklickern versucht?
Ich lege mein Kinn auf dem Tellerrand ab. Schaue mich um.
Ja, stimmt schon. Es ist alles da, was sie aufzählt.
„Verstehst du? Wir sind hier überflüssig,“ sagt sie.
Ja. Vielleicht sogar unerwünscht, denke ich. Und, da hat sie schon recht, es gibt kaum noch Platz, sich dazwischen zu zwängen. Und, denke ich, vielleicht steht der Teller, über dessen Rand wir schauen, in einem weiteren noch größeren Teller. Jenseits dessen sich noch viel mehr befindet. Was wir von unserem Tellerrand aus gar nicht sehen. Uns nicht einmal vorzustellen vermögen. Und wäre es nicht möglich, sinniere ich weiter, dass auch dieser Teller in einem anderen, noch größeren ruht? Wir uns lediglich von Teller zu Teller vorarbeiten? Nie wirklich zu sehen bekommen, was außerhalb all dieser Teller ist? Vorausgesetzt wir schafften es, diesen Teller überhaupt zu verlassen, über dessen Rand wir gerade schauen. Und falls es denn überhaupt ein ‚außerhalb‘ gibt.
„Friedhööfe und Rechnungshööfe,“ sagt Teresa jetzt, „die Bööörse, allerlei Lööcher und Höööhlen. Die Ööölkrise und die Mindestlööhne.“
Auch ihr Ö liebe ich. Wenn sie ihren Mund wie ein Eichhörnchen spitzt. Und sich ihre Lippen, fast blutleer, über die obere Zahnreihe wölben.
Aber jetzt sagt sie: „Droogerien Strooom. Telefoon. Ooopernhäuser. Kinoos. Und das Rooote Kreuz.“
Und diese O's haben etwas Verschlingendes. Wie Schwarze Löcher im Universum. Die alles um sich herum in sich hineinsaugen. Und komprimieren. Besonders, wenn sie Worte ausspricht, in denen zwei O's vorkommen. Wohnblock, Vorhof, Hoftor. Zum Beispiel. Oder gar zwei O’s hintereinander. Wie Moor. Moos. Zoo…
Unerträglich, der Sog, der von den aufeinander folgenden O‘s ausgeht. Ich muss mich am Tellerrand festklammern. Um nicht von ihnen eingeschlürft zu werden.
Stopp! Stopp! Stopp! Es reicht. Denke ich. Sage es aber nicht. Und Teresa zählt weiter auf.
„Staadtspaarkaasse“, Kraaankenhäuser, Gaasleitungen, Waaaschstraaaßen, Kaasernen, Faaabriken, Raaadios. Und das Staaandesaaamt.“
Und jetzt finde ich auch ihre A's bedrohlich. Sie husten wieder heraus, was ihre O’s eingesogen haben. Verdichtet. Angriffslustig. Frontal auf mich zu.
Um ihre O’s und A‘s nicht mehr sehen zu müssen, schaue ich zur Seite.
Wie lächerlich, denke ich. Als sei etwas nicht da, wenn ich die Augen davor verschließe! Zumal ich es weiter deutlich höre.
Teresa atmet tief ein. Überrascht mich mit einem weiteren Vokal. Stößt mit erhobener Stimme „Geburtshilfe, Sterbeurkunden und Fußballstadien“ hervor. Ohne die Vokale in die Länge zu ziehen.
Sie sagt „Glücksspiele, Arbeiter und Arbeitgeber, Sterbehilfe, Anwälte, Gerichtsvollzieher und Richter, Terroristen, anerkannte und nicht anerkannte Staatsgrenzen“.
Und schöpft nochmal Atem.
Mit erhobener Stimme scheint sie mehr Luft zu benötigen. Anders als bei Blasinstrumenten, denke ich, die in den tieferen Tonlagen mehr Luft erfordern.
„Steuerfahnder, -berater und -hinterzieher,“ sagt sie triumphierend, während ich mit der rechten Schuhspitze der Aufzählung ihrer Begriffe hinterherklopfe.
„Das Internet und der Klimawandel. Ein- und Auswanderer. Fundamentalisten, Gläubige. Atheisten. Fanatiker. Häretiker. Sektierer. Und die Globalisierung,“ skandiert sie mit schriller Stimme in mein Klopfen hinein. Versucht meinen Blick einzufangen. Fügt dann hinzu:
„All das, was sich in Jahrtausenden ohne unser Zutun entwickelt hat, was Millionen Menschen vor uns erfunden, erdacht, gebaut und auf diesen Planeten gesetzt haben. In all das werden wir, ohne gefragt zu werden, und ohne Vorwarnung hineingeworfen.“ Sie seufzt. „Wieviel wäre uns immerhin erspart geblieben, wenn wir früher aus der Ursuppe gestiegen wären! Sagen wir mal, so vor zehn- oder zwanzigtausend Jahren.“
Sie sagt es in einem Tonfall, als sei ich es, der vor langer Zeit die Entscheidung gefällt hat, die dazu führte, dass wir jetzt mit all dem konfrontiert sind, was sie gerade aufzählt.
Und das Schlimmste,“ fügt sie hinzu, „ist unser unentrinnbares Eingebundensein in die Koordinaten von ‚Ich‘, ‚Du‘, ‚Wir‘, und ‚die Anderen‘.
Durch das Küchenfenster sehe ich die Spitze des Fernsehturms in den sich verdunkelnden Himmel ragen. Ihn hat sie bei ihrer Aufzählung unerwähnt gelassen.
„Das ist nichts“, sage ich, „verglichen mit dem sich endlos wiederholenden Ineinanderfließen von Tag und Nacht.“
„Dieses Ineinanderfließen vom Tag in die Nacht, wie du es so poetisch nennst, vollzieht sich seit undenklichen Zeiten, mein Lieber. Übrigens auch von der Nacht in den Tag. Und das schon lange bevor es ein menschliches oder irgendein anderes Wesen auf diesem Planeten gab,“ lässt mich Teresa wissen, „und es wird sich wohl noch eine Weile wiederholen.“
Und als hätte sie es gerade in den Nachrichten erfahren, sagt sie:
„So lange jedenfalls, wie sich die Erde um sich selbst und um die Sonne dreht.“
„Das zu wissen, macht es für mich nicht leichter,“ sage ich, „egal, wer sich um was, oder ob sich überhaupt wer oder was dreht. Es geht um diese dahinschleichenden Minuten. Wenn die Nacht den Tag verdrängt. Das Licht am westlichen Horizont verblasst. Von Osten her Sekunde um Sekunde Helle aus den Häuserwänden sickert. Während der Tag westwärts abrückt, die Nacht von Osten heranwächst. Und sich die Straßenschluchten immer mehr verdunkeln.
„Du steigerst dich da in was hinein, Philipp. Hier in der Stadt ist dieser Übergang fast nicht wahrnehmbar. Kaum verschwindet das Tageslicht, schon flammen die Straßenlaternen auf,“ sagt Teresa.
„Auch sie können nicht verhindern, dass die Nacht den Tag umstellt.“
„Du lieber Himmel, Philipp, dann mach deine Augen zu und halte sie so lange geschlossen bis es Nacht geworden ist!“
„Das nützt gar nichts. Ich spüre ihn dennoch. Diesen schleichenden Übergang. Wenn das Dunkel von allen Seiten an mich herandrängt. Und sich über mich wirft. Es ist, als ob eine riesige Steinplatte sich auf mich heruntersenkte. Ich fühle, wie sie näher und näherkommt. Ich weiß, gleich wird sie auftreffen, mich zerquetschen. Und ich kann nichts dagegen tun. Ich spüre den Schmerz, den sie verursachen wird. Tief in mir drin. Wie ein Phantomschmerz, nur, dass er statt nachher, vorher eintritt.“
„Welche Steinplatte denn?“ fragt Teresa.
„Es ist eine Metapher.“
„Die aber nichts taugt für das, was du mir weiszumachen versuchst.“
„Weismachen? Ich will dir nichts weismachen. Dieser für mich qualvolle Übergang vom Tag in die Nacht findet de facto statt. Jeden Abend aufs Neue.“
„Was hat das mit der Steinplatte zu tun, die dich zerquetscht?“
„Zu zerquetschen droht.“
„Aber du weißt doch, dass sie dich nicht zerquetscht,“ sagt Teresa.
„Ja. Aber erst hinterher.“
„Und wenn du die Vorhänge zuziehst? Decken über dich wirfst? Dich im Keller verkriechst? Oder dich im Garten eingräbst? Bis es Nacht geworden ist. Dann kriegst du die Dämmerungsphase gar nicht mit.“
„Das ist es ja eben. Selbst wenn ich mich in einem Kino, einer hellerleuchteten Galerie, oder inmitten eines ausgestrahlten Cafés vor der einbrechenden Nacht verstecke. Oder mich im blendenden Neonschein eines Kaufhauses davor zu schützen versuche. Ich spüre, wie die Farbe aus den Häuserfassaden und Alleebäumen rinnt. Die Dunkelheit das Licht absaugt. Und es wie Abfall hinter den Horizont kippt. Das spüre ich, auch ohne hinzusehen. Es ist die Steinplatte, die sich auf mich heruntersenkt und mich zu zermalmen droht.“
„Ich weiß nicht,“ sagt Teresa. Wiegt ihren Kopf hin und her, „gut, meinetwegen. Auch wenn es denn so wäre.“
„Es ist definitiv so. Den Konjunktiv kannst du getrost beiseitelassen.“
„Okay, okay, Philipp! Aber es geht doch vorüber,“ sagt sie versöhnlich, „und du weißt das. Du hast es tausendmal erlebt. Und stell dir mal vor, die Erde würde in der Phase der Dämmerung für immer innehalten? Dann würde das, was für dich offenbar unerträglich ist, für immer und ewig anhalten.“
„Dann gäbe es ja diesen Übergang nicht mehr. Es wäre ja wieder ein Dauerzustand.“
„Ohne das Dunkel der Nächte wüssten wir nichts von den auf uns herunterblinkenden Welten, die unsere Erde umkreisen,“ sagt Teresa, ohne auf meinen Einwand einzugehen, „würde dir das nicht fehlen?“
Ja. Das kenne ich schon. Wenn sie mit ihren Argumenten nicht weiterkommt, weicht sie aus und erweitert das Thema in eine andere Richtung.
„Ich habe ja nichts gegen die Nächte. Der Übergang ist es, der…“
„… unerträglich für dich ist. Das hab ich begriffen.“
„Vielleicht wäre es anders, wenn sich Tag und Nacht schneller ineinanderschöben,“ räume ich ein, „einfach, bumm, aufeinander krachten.
„Dann geh in die Tropen!“ sagt Teresa, „dort krachen Tag und Nacht übergangslos aufeinander.“
„Woher willst du das wissen? Bist du je in den Tropen gewesen?“
„Nein, Philipp, bin ich nicht. Aber ich weiß auch, dass sich unter uns Australien befindet. Ohne je dort gewesen zu sein.“
„Was Australien betrifft, ist das eine Frage der Sichtweise. Nur wenn wir uns oben dünkten, träfe deine Aussage zu. Im Übrigen wird wohl auch in den Tropen das Licht allabendlich von der Dunkelheit aufgesogen.“
„Ja. Aber eben, bumm, übergangslos.“
„Wir befinden uns aber nicht in den Tropen, wie dir sicher nicht entgangen ist. Und ich habe auch nicht den Wunsch, dort hinzuziehen.“
„Das solltest du dir vielleicht nochmal überlegen,“ stichelt Teresa, „schon allein wegen des Sprits, den du auf deinen abendlichen Panikfahrten verfährst, mit denen du der Dämmerung zu entkommen meinst.“
„Und du glaubst, Einsparungen würden mich vor der Panik schützen, die mich allabendlich befällt?“
„Dann denke wenigstens mal darüber nach, wieviel Dreck du während deiner sinnlosen Dämmerungsfluchten in die Atmosphäre verpuffst!“
„Ich fürchte, auch ökologische Argumente werden meine Qualen während des schleppenden Übergangs vom Licht ins Dunkel nicht mildern.“
„Mein Gott, Philipp! Dann versuche, dich auf Alltägliches zu konzentrieren! Das hilft immer.“
„Was gibt es denn Alltäglicheres als die unermüdliche Rotation unseres Planeten?“
„Den Supermarkt. Zum Beispiel,“ sagt Teresa.
Ich gebe zu, jetzt bin ich überrascht: Auf diese Gesprächswende war ich nicht gefasst.
„Der Supermarkt? Okay. Was ist mit ihm?“
„Er schließt in Kürze.“
„Ja, das ist mir bekannt. Er schließt jeden Tag um die gleiche Zeit. Außer sonntags.“
„Und?“
„Was und? Sonntags bleibt er durchgängig geschlossen.“
„Eben. Und heute ist Samstag. Was folgerst du daraus?“
„Dass gestern Freitag war. Zum Beispiel.“
„Ja-und-was-noch-Philipp?“
Ich habe nicht die geringste Ahnung, was sie mit ihrem Ratespiel bezweckt.
„Du weißt es ja offenbar. Sag es mir einfach!“
„Dass-morgen-Soooonntag-ist, Philipp.“
„Ja. Natürlich. Aber auf was genau willst du nun hinaus?“
„Auf den Küüühlschrank!“, ruft sie
„Den Kühlschrank? Was ist denn mit ihm?“
„Hast du ihm heute schon einen Blick gegönnt?“
„Sollte ich das??“
„Keinerlei Assoziationen, Philipp, nicht wahr?“
„Er ist leer? Ist es das, was du mir auf diesen Umwegen zu verklickern versuchst?“
„Bingo!“ jauchzt Teresa, „und da böte der naheliegende Supermarkt die Möglichkeit, sich neu zu bevorraten. Zumal morgen Sonntag ist.“
„Ach so. du meinst, ich sollte einkaufen gehen?“
„Zum Beispiel.“
Warum sagst du das nicht gleich? Ohne diesen Umweg über das Alltägliche und den Kühlschrank.“
„Jetzt geh erst mal ans Telefon! Hörst du nicht, dass es läutet?“
„Diese Vergewaltigung von Beethovens Elise, die der moderne Mensch offenbar angenehmer empfindet als das vertraute Klingeln, nennst du Läuten?“
„Beethoven, Klingeln, Läuten! Das spielt keine Rolle,“ sagt Teresa, „geh-einfach-ran!“
„Und das Alltägliche und der Kühlschrank?“
„Darum hättest du dich früher schon kümmern können. Geh ran!“
„Das ist bestimmt Birgit,“ sage ich.
„Wie willst du das wissen?“
„Es ist immer Birgit, die um diese Zeit anruft.“
„Ja. Vielleicht,“ sagt Teresa, „aber wir werden es nicht erfahren, wenn du nicht rangehst.“
„Ich? Ich bin nicht neugierig.“
„Spring doch einmal über deinen Schatten!“
„Was hat das mit meinem Schatten zu tun?“
„Phiiiliiipp! Geeeh-ran!“
„Okay. Wenn du es partout willst.“
„Ciao Filippo, ich bin's, Brigida, wollt mich nur zurückmelden.“
Natürlich ist es Birgit. Sie passt die Vornamen ihrem jeweiligen Urlaubsland an. Letztes Jahr nannte sie sich Brigitte. Französisch ausgesprochen. Und mich Philippe.
„Und?“ fragt Teresa.
„Es ist Birgit.“
„Sag ihr, du stehst mit der Einkaufstasche im Gang!“ sagt Teresa.
„Wer klopft da bei dir herum? Habt ihr die Handwerker im Haus?“ fragt Birgit.
„Nein, nein. Wahrscheinlich habe ich unbeabsichtigt mit dem Finger aufs Mikrofon getippt.“
„Unbeabsichtigt, Filippo? Ich habe schon verstanden. Du hast keine Lust, mit mir zu quatschen!“
„Gib mir Birgit!“ bellt Teresa und greift nach dem Hörer.
„Sie heißt jetzt Brigida und hat soeben aufgelegt.“
„Das ist wieder mal typisch für dich,“ sagt Teresa und wirft mir diesen gewissen Blick zu.
„Für mich? Es ist Birgit, die aufgelegt hat.“
„Und? Was schlägst du nun vor?“
„Was ich vorschlage? Im Moment nichts.“
„Und über den Moment hinaus?“
„Innehalten, wenn das Telefon klingelt.“
„Innehalten? Wozu denn das?“
„Um erstmal herauszufinden, ob wir überhaupt angerufen werden wollen. Und nicht vielleicht was ganz anderes vorhaben. Die meisten Anrufer geben dann ohnehin auf. Falls nicht, schaltet sich der Anrufbeantworter ein. Reicht die Ausdauer des Anrufers oder der Anruferin bis zum Ende einer bewusst ausladend formulierten Ansage, erfahren wir seine oder ihre Identität. Dann können wir immer noch entscheiden, ob wir mit ihm oder ihr reden wollen. Oder eben nicht. Warum sollten wir uns von der spontanen Gesprächslaune etwaiger Anrufer oder Anruferinnen gängeln lassen? Und ein bereits gefasstes Ziel wieder aus den Augen verlieren?“
„Du lieber Himmel, Philipp! Dann kannst du dich genauso gut über Rauchzeichen verständigen.“
„Warum nicht? In manchen Kulturen hat das jahrhundertelang funktioniert. Muss ich mich einer Zeit anpassen, in der bereits Kleinkinder in eigene Handys sabbern?“
„Wow! Du verdrehst meine Gedanken solange, bis sie den denselben Verwirrungsgrad aufweisen wie deine eigenen,“ sagt Teresa.
„Wenn du dich schon auf Proust berufst, dann zitiere ihn bitte korrekt!“
„Proust? Du meinst Marcel Proust? Was hat der denn damit zu tun?“
„Vergiss es! Jedenfalls verfehlt dein Satz den Kern der mir von dir aufgedrängten Auseinandersetzung.“
„Mannomann! Der Kern der dir von mir aufgedrängten… Geht‘s noch verschachtelter? Was ist denn nun dieser Kern der dir angeblich von mir aufgedrängten Auseinandersetzung, deiner Ansicht nach?“
„Dass sie, wie jede andere, in ein Dilemma führt. Abheben und Einkaufen war nun mal nicht zeitgleich zu schaffen.“
„Grundgütiger! Im Alltag müssen wir alle fortwährend Verschiedenes gleichzeitig tun. Wenn das jedes Mal in ein Dilemma führte, wären wir praktisch denk- und handlungsunfähig.“
„War es nicht deine Idee, mich mit dem Alltäglichen zu beschäftigen?“
„Bravo, Philipp! Bravo, bravo!“ sagt Teresa und klatscht ihre Handflächen mehrmals aufeinander, „du hast es geschafft, mich so lange in Unergiebiges zu verwickeln, dass der Supermarkt inzwischen zu ist. Wie du das nur immer hinkriegst, mit sophistischen Winkelzügen die allgemein gültige Wirklichkeit solange zu verquirlen, bis du sie in deine eigene verwandelt hast?“
„Oh! Interessant. Was hältst du denn für die allgemein gültige Wirklichkeit?“
„Die, aus der du dich herausmogelst. Indem du Sachliches und Persönliches vermischst. Um Streit herbei zu polemisieren. Und damit jedem Gespräch eine gemeinsame Basis entziehst. Unmöglich, nicht Ball in deinem Spiel zu werden. Um es mal mit deinen Worten zu sagen. Nützt es deinen Argumenten, berufst du dich auf die Logik. Wenn nicht, wirfst du sie über Bord. Verweigerst dich evidenten Zusammenhängen. Kannst dich plötzlich an nichts mehr erinnern. Ist dir jedoch ein logisch kohärentes Vorgehen opportun, verfolgst du deine und meine Aussagen jahrzehntelang zurück. Stülpst das, was außen war nach innen. Schubst alles zuvor Gesagte aus deinen und meinen Sätzen. Und biegst sie dir nach deinem Gutdünken zurecht. Kurz gesagt: du redest dir die Erde eckig. Und die Äpfel zu Bananen.“
„Äpfel? Bananen?“
„Ach hör doch auf, dich an meine Worte zu klammern und sie aus dem Kontext zu reißen, sie dadurch zu entkräften und immer wieder bei den Grundsatzdebatten anzukommen.
Ist das, was wir sehen, auch das, was wir sehen? Oder nur das, was wir zu sehen meinen? Existiert, was wir um uns herum wahrnehmen? Oder phantasieren wir es uns nur zusammen? Sind wir selbst überhaupt da? Oder werden wir nur in all das, was wir sehen hineingeträumt? Oder träumen es aus uns heraus. Und so weiter, und so weiter…“
Teresa hält inne. Schaut einmal um sich. Wirft mir einen schelmischen Blick zu.
„Immerhin,“ lacht sie und klatscht wieder in die Hände, „immerhin ist es mir gelungen, dich von deiner Panik abzulenken. Schau raus auf die Straße! Alle Lampen sind an. Und aus den Fenstern leuchtet dir Licht entgegen. Die Dämmerung ist vorüber.“
„Ja, du hast recht. Aber morgen Abend wird sie neuerlich da sein.“
„Glaub mir, Philipp!“ seufzt Teresa und sieht mich besorgt an, „du solltest einen Therapeuten aufsuchen!“
„Wird er die Rotation unseres Planeten zum Stillstand bringen können?“
Teresa schüttelt den Kopf.
„Irgendwann wird es mal nicht gut ausgehen mit deinen unsinnigen Nachtfluchten. Glaub mir! Ich spüre das.“
Teil 1
Abenddämmerung
Wie eine Insel im Regen
Natürlich legt auch der nächste Tag wieder diesen Zwischenhalt ein, der sich quälend dahinzieht. Bis sich der Tag in Nacht verwandelt hat. Und wieder flüchte ich von irgendwo nach nirgendwo. Um der Dunkelheit zu entkommen, die anfangs kaum wahrnehmbar heranschleicht. Sich dann immer fordernder über den Tag wölbt. Beharrlich saugt und saugt. Bis sie alles Licht in sich hineingeschlungen hat. Und nichts mehr von ihm übrig ist.
Feiner Spätsommerregen sprüht ein schlieriges Tropfennetz auf die Windschutzscheibe. Ich versuche mich auf etwas Alltägliches zu konzentrieren. Das laut Teresa immer helfe. Aber natürlich fällt mir wieder nichts ein. Das ist so, als ob man aufgefordert würde, an irgendetwas oder an nichts zu denken. Was ist irgendetwas? Was ist nichts? Eben.
Ich schaue an der Hauswand entlang nach oben. Ein letzter Purpurstreifen verblasst an der Dachrinne. Nur aus ihrem Fenster dringt Licht. Wo sind die anderen Bewohner? Es ist zu früh am Abend, um alle schlafend zu vermuten. Eher unwahrscheinlich auch, dass alle aushäusig sind.
Es nützt nichts. So komme ich nicht weiter. In meinen Handflächen fängt es schon an zu schwitzen. Als nächstes werden meine Finger beben. Dann mein ganzer Körper.
Ich versuche, mich auf das Blubbern des Motors zu konzentrieren. Schaue nach oben. Beobachte, wie der Vorhang an ihrem Fenster beiseite gleitet. Ein Fensterflügel klappt nach innen. Und ich kann ihr Gesicht erkennen. Ihre zusammengesteckten Haare lösen sich. Fallen über den Mauerrand unterhalb des Fensterrahmens.
Wie bei Rapunzel, denke ich, nur nicht so lang.
Es nützt nichts. In meinem Brustkorb pocht es heftig. Als befänden sich zwei Herzen in ihm. Die arrhythmisch gegen meine Rippen trommeln.
Ich schaue noch einmal zu ihrem Fenster hoch. Die Bewegungen ihrer Arme dehnen sich zu riesigen Schatten. Jetzt streift sie ihr T-Shirt ab. Schlüpft in ihr Nachthemd. Ich kann ihre Brüste unter dem dünnen Stoff wippen sehen. Dann zieht sie die Vorhänge zu. Das Licht an ihrem Fenster erlischt. Der Streifen an der Dachrinne hat sein Purpur verloren. Die Herzen in meiner Brust hämmern gegeneinander an. Als wollte eins von ihnen die Oberhand gewinnen. Mein Körper bebt. Mein Hemd klebt an meinem Rücken.
Denk an was Alltägliches! Ermahne ich mich. Ja, ich weiß, aber an was? Irgendwas? Ja, irgendwas! Ich schüttele den Kopf. Mir fällt nichts ein.
Das dunkle Fenster hebt sich nun nicht mehr von all den anderen ab. Sie ist ins Bett gegangen. Sie geht immer früh ins Bett. Um Licht zu sparen. Sagt sie.
Und während ich weiter nach Alltäglichem Ausschau halte, wird es immer dunkler um mich herum. Ich schalte die Scheinwerfer ein. Sie schieben die hereinbrechende Nacht von mir weg. Aber ich spüre, wie sie mich seitwärts und von hinten umzingelt.
Schließlich halte ich es nicht mehr aus.
Ich drehe das Lenkrad abrupt nach links. Um aus der Parklücke auszuscheren. Der schwere Wagen fährt los. Poltert über die gepflasterten Bodenwellen. In diesem Teil der Stadt fahren nur wenige Autos. Auch die Gehwege sind menschenleer. Eine überflüssige Ampel schaltet von Gelb auf Rot. Ein erster Impuls in mir sagt: weiterfahren! Ein zweiter Impuls lässt mich auf die Bremse treten. Der Wagen macht einen Ruck. Ich kippe gegen das Lenkrad. Wippe wieder zurück an die Sitzlehne. Während mein linker Fuß das Kupplungspedal durchdrückt.
Das Rot der Ampel zerfließt auf dem nassen Asphalt.
Der Motor blubbert in leicht verminderter Drehzahl weiter. Ich spüre, wie Schweißtropfen aus meinem Nacken perlen. Und eiskalt über meine Schulterblätter rinnen.
Die Ampel leuchtet immer noch rot. Habe ich die Grünampel verpasst, als ich nach Alltäglichem suchte? Jetzt verschwindet das Rot. Die Ampel schaltet auf gelbes Dauerblinken um. Und der Wagen fährt ohne mein Zutun los. Wie von einem autonomen Navigationssystem geleitet, biegt er in die nächste Querstraße. Manövriert sich durch ein Gewirr kleiner Straßen bis zur großen Ausfallstraße. Rollt an einer endlosen Reihe von Laternen der herannahenden Nacht entgegen.
Nach Osten hin nimmt die Stadt kein Ende. Eine Siedlung reiht sich an die andere. Die Häuser sehen alle gleich aus. Balkonlos. Mit kleinen abweisenden Fenstern.
Ein Wolkenbruch wirft einen dichten Perlvorhang vor die Häuserfassaden. Die Herzen in meiner Brust stampfen wie ein Schiffsmotor.
Um diese Stunde fahren kaum noch Autos in Richtung Grenze. Der Regen fällt dichter. Noch sehe ich rote und gelbe Lichtflecken durch die Wasserwand schillern. Dann flammen endlich die Laternen auf. Ducken sich unter den schwindenden Tag. Und drücken die Nachtdecke nach oben.
Mein Auto fährt mich an den Straßenrand. Bleibt dort stehen. Der Motor läuft weiter.
Die Wolkenwand zieht sich zurück.
Ein Kribbeln geht durch meinen Körper. Meine Füße fühlen sich an, als wären meine Schuhe mit kaltem Wasser angefüllt.
Denk an was Alltägliches! ruft es in meinem Kopf.
In diesem Moment erhellt sich ein Fenster in einem der Wohnblocks neben der Straße.
Bleiben die andern im Dunkeln sitzen, um Licht zu sparen? Überlege ich. Oder sind sie noch nicht von der Arbeit zurück? Und einer ist gerade nach Hause gekommen? Vielleicht haben auch alle schon geschlafen, und nur dieser eine muss jetzt zur Nachtschicht raus? Vielleicht ist er auch nur aufgewacht, weil er auf die Toilette muss?
Nur noch vereinzelt klopfen schwere Tropfen auf das Autodach. Mein aufgestauter Atem strömt mit einem langen Seufzer aus meinem Brustkorb.
Es ist vorüber.
Tag und Nacht haben sich getrennt. Das Zittern weicht aus meinem Körper. Die beiden Herzen haben sich wieder zu einem vereinigt. Das ruhig und gleichmäßig vor sich hin klopft. Meine Hände sind noch immer nass. Der Schweiß auf meinem Rücken fühlt sich jetzt warm an.
Jetzt könnte ich wieder umkehren und zurückfahren. Denke ich noch. Dann überfällt mich eine dumpfe Müdigkeit. Ich spüre, wie ich immer schwerer und schwerer werde. Bis der Autositz unter mir wegsackt. Und mich mit sich mitnimmt.
Ein gleichbleibender Ton holt mich in die Nacht zurück. Es klingt wie eine Fanfare. Vielleicht auch eine Posaune. Oder so.
Wer bläst um diese Zeit in einem Wohnblock Fanfare, Posaune oder ein ähnliches Blasinstrument? Frage ich mich.
Dann merke ich, dass es aus mir heraustönt.
Mein Kopf liegt schwer auf dem Lenkrad und drückt den Hupring nach unten. Ich muss eingenickt sein.
In den seitlichen Wohnblocks leuchten weitere Fenster auf. Immer mehr Bewohner stehen zur Nachtschicht auf. Können nicht schlafen. Oder wollen nicht. Unwahrscheinlich, dass sie alle kollektiv zum Pinkeln aufgestanden oder alle auf einmal nach Hause gekommen sind. Vielleicht habe ich sie auch mit meinem Hupen geweckt.
Ja, das ist wohl am wahrscheinlichsten.
„Klar,“ sagt Teresa, „das Wahrscheinlichste erscheint in deinem Kopf an letzter Stelle.“
Das Wahrscheinliche ergebe sich von selbst. Es benötige keinen Platz in unseren Köpfen. Da es, wie das Wort schon sagt, ohnehin meist eintreffe.
„Womit du wieder das letzte Wort hast,“ sagt Teresa.
Ich sei weder am letzten, noch am ersten Wort interessiert.
„Eben,“ sagt Teresa.
Das ist auch so eine Sache. Wenn die Spannung nachlässt, muss ich pinkeln. In den unpassendsten Momenten. Doch, ich weiß jetzt schon, kaum bin ich ausgestiegen, lässt der Harndrang wieder nach. Und während ich wartend, mit offenem Hosenschlitz, am Straßenrand stehe, verdunkeln sich einige Fenster wieder. Und andere leuchten auf. Als gäben sich die Bewohner geheime Zeichen. Oder sie beobachten mich. Wollen mir zu verstehen geben, mich von der Straßenlaterne wegzubewegen. Um sie nicht zum unfreiwilligen Beobachten meiner Pinkelversuche zu zwingen.
Die Luft zittert wie ein fein gewebter Schleier um mich herum. Ich habe keine Lust mehr, weiter zu warten, ob sich in Sachen pinkeln vielleicht doch noch was tut. Ziehe den Reißverschluss wieder hoch. Öffne die Autotür. Lasse mich auf den Sitz fallen. Beschließe, nicht weiter über die Vorgänge in den Wohnblocks zu rätseln. Ich muss ja nun nicht mehr Alltägliches herbeidenken. Ich übernehme das Kommando über mein Auto. Doch statt umzukehren, fahre ich in östlicher Richtung in die Nacht hinein.
Als ich bei der nächsten Tankstelle halte, ist der Harndrang wieder da. Ich trete von einem Bein aufs andere. Und lasse für zwanzig Euro Sprit in meinen Tank fließen. Mehr tanke ich nie. Immer nur für zwanzig Euro. Egal wie die Spritpreise stehen. Das ist ein Prinzip von mir. Hätte ich eine irreparable Panne, die mich zwingen würde, mein Auto zu veräußern, würde ich ungern unnötig bezahlten Sprit im Tank zurücklassen.
„Was für ein unsinniges Prinzip,“ meldet sich jetzt Teresa, „wärst du vorhin umgekehrt oder, besser noch, gar nicht erst losgefahren, hättest du überhaupt keinen Sprit verbraucht.“
Die junge Frau an der Kasse hat fettige pickelige Gesichtshaut. Und einen Ring in einem Nasenflügel. Sie lässt die Schublade klingelnd aufspringen.
„Kann ich erst -?“
Ich presse meine Schenkel zusammen und deute auf meinen Unterbauch.
Sie zuckt mit dem Kinn in eine Richtung. In der ich mich trippelnd entferne.
„Puuuuh,“ sage ich, als ich zurückkomme. Lege einen Zwanzigeuroschein auf das Ablagebrettchen vor der Kasse. Und nenne die Nummer der Zapfsäule. Sie nimmt meinen Schein. Faltet ihn glatt. Schichtet ihn auf einen Packen weiterer Zwanzigeuroscheine. Presst mit beiden Daumen nach. Und drückt die Schublade mit ihrem Bauch wieder zu.