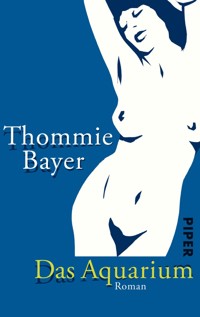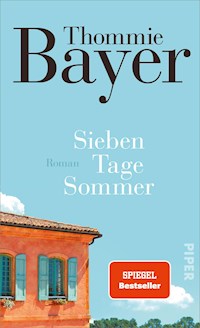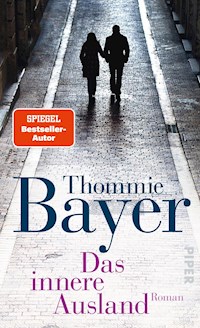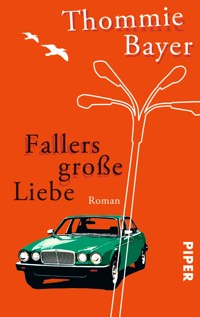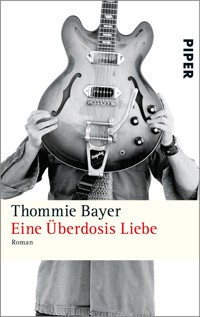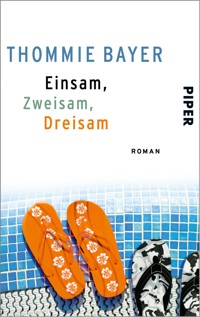8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wieder einmal hat Urs seinen Job verloren. Doch nun packt er seine Koffer und fährt nach Freiburg zu seiner Schwester Irene, die gerade eine Buchhandlung aufmachen will. Sie kann seine Unterstützung gut gebrauchen, und Urs beschließt zu bleiben. Er hilft im Laden, erkundet die Musikszene und macht neue Bekanntschaften. Doch die Beziehungen und Verhältnisse sind nicht gerade einfach: Irene ist gar nicht seine wirkliche Schwester, und dann taucht auch noch die rätselhafte Marie auf, die Irene und Urs gleichermaßen in ihren Bann schlägt. Zwischen den Dreien entspinnt sich eine Liebesgeschichte, so zärtlich und leicht wie der Sommer, der am besten niemals enden sollte …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für Volker
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Taschenbuchausgabe
2. Auflage 2008
ISBN 978-3-492-96030-4
© 2005 Piper Verlag GmbH, München Erstausgabe: Eichborn AG, Frankfurt am Main 1994 Umschlaggestaltung: Dorkenwald-Design, München Umschlagmotiv: Alexey Klementiev / Fotolia.com Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck
The birds they sang at the break of day
Start again I heard them say
(L. Cohen)
one · two · three · four …
EINS
Es ist Sommer. Der letzte meiner Kindheit. Wobei ich vielleicht gleich dazusagen sollte: meine Kindheit war rekordverdächtig lang. An meinen achtundzwanzigsten Geburtstag kann ich mich zum Beispiel nur noch sehr vage erinnern – er mag so etwa fünf, sechs, sieben Jahre her sein. Jetzt, in diesem Sommer, bin ich jedenfalls kein Schlagzeuger mehr. Und auch kein Artikelschreiber, der anfangs Schlagzeuge, dann Schlagzeugcomputer und dann nur noch deren Software für ein Musikermagazin testete, um schließlich von einem jungen Streber mit Bürstenschnitt in die Anzeigenabteilung abgedrängt zu werden. Ich schreibe auch keine Science-fiction-Geschichten mehr für einen Heftchenverlag, und mein Taxischein vergilbt irgendwo und verwandelt sich in Staub, aber das nehme ich nur an – ich hatte keinen Grund mehr, nach ihm zu suchen, denn er gilt schon seit Jahren für die falsche Stadt.
Und seit einer Woche bin ich auch kein Fahrer mehr, der Kurierpost, Reinzeichnungen von Grafikern, Dokumente, Unterlagen, Rohschnitte von Filmen oder Masterbänder mit Musik von einem Ort zum andern bringt. Ich bin gerade mal wieder gar nichts mehr.
Ich kenne diesen Zustand gut und fände nichts dabei, wenn nicht diesmal etwas grundlegend anders wäre: Auf einmal schmeckt das alles nicht mehr nach Aufbruch, Neuland oder Endlich-wieder-frei-Sein, sondern muffig und schal, so als hätte ich mir aus Versehen die Zähne mit der anthroposophischen Zahnpasta meiner Eltern geputzt.
Daran erkenne ich, daß meine lange und glückliche Kindheit nun endgültig vorbei ist.
Das ist natürlich Unsinn, ein unhaltbarer Satz – das Endgültige an einem Zustand erkennt nur, wer tot ist, und damit wird’s erst recht verzwickt, denn ich glaube nicht an ein Leben nach dem Tod. Nicht für mich jedenfalls. Ich muß es vorher schaffen.
Ich denke also nur: Jetzt ist es passiert. Mußte ja so kommen. Jesus hat in meinem Alter schon aus der Hüfte geblutet, und alles hat mal irgendwann sein Ende.
Klar, klar, ich weiß genau, was ihr jetzt altklug einwerfen werdet: Jedes Ende ist der Anfang von etwas Neuem. Danke, nett, daß ihr mich erinnert, und danke auch fürs Wachbleiben, nur: so schlau bin ich selber. Und das Altklugsein könnt ihr euch auch gleich abschminken. In dieser Geschichte hier ist nur einer altklug: ich. Es geht darum, daß der Anfang, wovon auch immer, diesmal schmeckt wie ein ungewürztes Tempotaschentuch.
Aber es ist Sommer, und ich bin nicht wirklich deprimiert, nur so ein Gefühl wie ein ganz leichter aber dafür anhaltender Kreislaufkollaps weicht nun schon seit Tagen nicht mehr aus meinem Körper, genauer gesagt, aus der Gegend zwischen Schlüsselbein und Knie. Die Stadt hier hab ich satt, sie ist mir fremd wie irgendeine, alles, was mich halten könnte, gilt mir nicht mehr viel. Was? Einen leichten Kreislaufkollaps gibt es nicht? Mag sein. Aber Widerworte von Lesern gibt’s auch nicht. Mir steht im Augenblick der Sinn nach einem gewissen Ton grimmiger Heiterkeit, denn ich steuere geradewegs auf die Aussage zu, daß ich ein Versager bin, blauäugig, sentimental, körperlich zu groß geraten, um in der Masse zu verschwinden, aber vom Wesen her zu scheu für einen Platz im Mittelpunkt.
Meine Augen sind im übrigen braun, die Bläue ist bildlich gemeint. Metaphorisch. Also praktisch im übertragenen Sinne.
Gut. Können wir? Geht’s wieder? Prima.
Sommer. Ich kann’s auch noch genauer: Ein Wochentag im Juni, fußgängerfeindliches Föhnwetter, bronchienfeindliche Ozonkonzentration und gehörfeindliche Straßenmusik an jeder akustisch günstigen Ecke. Und in mir dieses hoffnungsfeindliche Flimmern zwischen Schlüsselbein und Knie.
Ich will meine Schwester besuchen, Sirene, die ich liebe, seit ich denken kann. Das fällt mir immer dann ein, wenn ich unglücklich bin. Sie heißt in Wirklichkeit Irene, aber ich nenne sie Sirene, weil sie jeden in den Abgrund singen kann, wenn sie es darauf anlegt. Früher, als sie noch lange blonde Locken trug, hätte es auch genügt, sich, wie die Loreley, sichtbar und ausführlich zu kämmen – der Gesang dazu hätte vom Band kommen können, so schön ist sie, wenn sie will- aber als ich sie das letztemal sah, trug sie ihr Haar bleistiftkurz und karottenrot, und nur ein armseliges Zöpfchen an der Seite wäre noch kämmenswert gewesen, wenn sie es gelöst hätte. Den Rest ihrer beeindruckenden Erscheinung versteckte sie in unförmigen Pullovern, Blaumännern und Hausmeisterkitteln, weil sie gerade eine avantgardistische Phase hatte und die Männerblicke leid war, die zu nichts als Mißverständnissen führten. Sirene liebt Frauen. Ich war immer stolz auf sie.
Sie ist nicht wirklich meine Schwester. Ihre Eltern adoptierten mich, als meine starben. Ich erinnere mich an nichts, ich mag nur keine engen geschlossenen Räume. Fahrstühle, Nachtschalter mit automatischen Türen, Flugzeuge – alles nicht mein Fall. Bevor ihr euch aber jetzt einen Hitchcockfilm ausdenkt: Schluß damit, vergeßt es, ich war damals eineinhalb Jahre alt. Wenn ich ab jetzt von »meinen Eltern« spreche, dann meine ich damit Sirenes Eltern, Hedy und Armand, die natürlich irgendwann einmal Hedwig und Hermann hießen, aber damit in ihrem Beruf wohl nicht sehr weit gekommen wären.
Ich konnte immer zu Sirene kommen, wenn’s mir schlechtging. Da ich, wie alle naiven Kinder gegen Sarkasmus immun bin und sie, bei aller Frechheit, immer Trost für mich hatte, kam ich an als vor Selbstmitleid schlotterndes Häufchen Elend und ging, wenn ich wieder mutig war, mit Muskeln auf der Seele und dem Gefühl, meine Narben seien ein feiner exotischer Schmuck. Und restaurierte das Blau meiner Augen. Bildlich.
Jetzt kann ich’s ja zugeben. Ich war schon ein paarmal am Ende meiner Kindheit angelangt, hatte es jedenfalls geglaubt, bis mir Sirene wieder klarmachte: der Himmel ist hoch, die Gegend ist weit, und du hast noch nicht alles versucht. Und dann ging ich gestärkt in eine neue Richtung und traute mir etwas zu, probierte aus, lernte neu, nur aufwärts ging es nie, aber das lag nicht an ihr, sondern vielleicht daran, daß ich keine Fahrstühle mag.
Danke fürs Wachbleiben.
Er schloß das Notizbuch und sah sich um. Skateboardfahrende Jungs mit verkehrtherum aufgesetzten Baseballkappen und weiten bunten T-Shirts flitzten durchs Bild in so regelmäßigen Abständen, als stünde irgendwo ein Turnlehrer, der sie einen nach dem anderen auf die Bahn schubste. Sie schlängelten sich geschickt durch die Menge, um vielleicht einen Kreis zu fahren und sich am Ausgangspunkt in die Schlange für den nächsten Start einzureihen. Eine Zigeunerin saß vor dem Lederwarenladen und verzog ihre Leidensmiene zum Ausdruck noch größeren Elends, wenn sich jemand näherte, der irgendwie christlich, ökologisch oder friedensbewegt aussah.
Noch während er geschrieben hatte, waren die Peruaner abgezogen. Die Menge, die sich immer findet, wenn buntgekleidete Menschen im Kreis hintereinander hergehen, und »EI Condor pasa« spielen, hatte sich zerstreut; er wollte gerade aufstehen und sich auf den Weg zum Bahnhof machen, da kamen vier Männer mit einem Handwagen um die Ecke und bauten ihre Instrumente auf. Nach kurzem Stimmen legten sie los mit einer Mazurka. Sie spielten gut.
Das leicht verstimmte Hackbrett mit seinem seltsam indirekten Klang verwandelte den Platz in eine Kirche, der Kontrabassist schlug stampfend und stoisch einen Rhythmus, der viel mehr an Rock'n'Roll erinnerte als an folkloristische Musik, der zweite Geiger, ein Junge mit glasigem Blick und Pubertätsflaum auf der Oberlippe, fegte Offbeats zwischen die pumpenden Viertel des Basses, so schnell und präzise wie ein Reggaemusiker, dem man statt der Tagesdosis Ganja die doppelte Menge Speed untergeschmuggelt hat, und der Primas ließ die Geige schreien, als hätte er ein verstecktes Wah-Wah-Pedal im Einsatz. Es war faszinierend. Aber niemand blieb stehen.
Doch. Eine junge Frau stellte ihre Reisetasche ab, als wäre sie von dem Klang gestoppt worden. Sie starrte auf die Musiker.
Auf die Passanten wirkte sie wie ein statisch aufgeladenes Stückchen Materie, das alle Staubpartikel in seiner Reichweite anzieht: Immer mehr blieben stehen und lauschten, und immer mehr gesellten sich dazu. Die Kapelle spielte einen Walzer, und da der Kreis der Zuhörer sich dicht und in mehreren Reihen um sie geschlossen hatte, stand Urs von seiner Bank auf, um sich durch die Menge zu schieben.
Obwohl er körperliche Nähe zu Fremden nicht mochte, stellte er sich mitten ins Gedränge, um von dieser Musik keinen Ton und keine Handbewegung zu versäumen. Er sah die Frau sich bücken und etwas in ihrer Reisetasche suchen. Sie wühlte, und gleich darauf kam ihre Hand mit einer schwarzen Baskenmütze zum Vorschein. Sie sah sich suchend um, fand seine Augen und griff, mit einem kurzen, prüfenden Blick auf ihn, nach der Reisetasche, brachte sie her und stellte sie ihm vor die Füße.
»Paß auf, ja?« Die Mütze in der Hand ging sie nun zum Primas, der sie zuerst mißtrauisch ansah, dann aber lächelnd nickte, als sie ihm in Zeichensprache klargemacht hatte, daß sie für die Kapelle kassieren wollte. Urs fischte in seiner Hosentasche nach Geld, und bis er einen Fünfer ertastet hatte, war schon einiges an Silber in der Mütze gelandet. Er hob den Kopf und hörte es klimpern. Sie ging von einem zum andern, und ihr Charme, den sie kokett ausspielte, brachte die Leute dazu, stehenzubleiben und sich nicht, wie sonst, wenn’s ans Zahlen geht, verlegen aber schnell zu verdrücken. Jeder wollte dieses Lächeln auch auf sich beziehen können.
Auf ein Zeichen des Primas hin brach die Kapelle den Walzer ab und begann eine schnelle, virtuose Polka. fiebrig und hetzend der Rhythmus und wie von irrsinnigem, ans Hysterische grenzendem Jubel die Geige des Primas, schien das Stück mit seiner großen Geste als Dank für die spendablen Zuhörer gedacht zu sein.
Die Musik war zu Ende, und die Umstehenden applaudierten lange und laut, als die Frau den Inhalt der schwer zwischen ihren Händen durchhängenden Mütze in einen der Geigenkästen leerte.
Schnell zerstreute sich das Publikum. Noch ehe die Musiker ihre Instrumente verpackt und sich Zigaretten angezündet hatten, war außer Urs und der jungen Frau schon niemand mehr da. Sie war vertieft in eine teils zweisprachige und teils nonverbale Diskussion mit dem Primas, der ihr eine Handvoll des Geldes entgegenhielt. Urs stellte ihre Tasche ab und stupste sie an. Noch bevor sie den Kopf wandte, zuckte ihr linker Arm vor den Mund, als rechne sie mit Schlägen, und erst als sie Urs erkannte, wich der gehetzte Ausdruck aus ihrem Gesicht.
Sie wehrte den Primas ab, hüpfte wie ein Vögelchen zurück, als er versuchte, Münzen in die Tasche ihres Hemdes zu schütten, und lächelte Urs nur so nebenhin an. »Danke« sagte sie und war schon wieder damit beschäftigt, das Geld abzulehnen.
Er ging zum Bahnhof. Auf der Domplatte stand, von allem Trubel unberührt, ein weißgeschminkter Mann, in pathetisch nachdenklicher Haltung erstarrt, und spielte lebende Statue. Niemand beachtete ihn. Urs hatte den Mann schon öfter gesehen und nie so recht gewußt, ob er ihn bewundern oder belächeln sollte. Oder vielleicht beides. Heute lächelte er.
Er kaufte ein Buch. »Der Fänger im Roggen.« Das wollte er schon lange mal wieder lesen. Dann mußte er sich auf einmal beeilen, denn der Intercity nach Süden fuhr zu jeder vollen Stunde. Es war drei Minuten vor eins.
Er rannte zum Gleis sieben und erwischte den Zug. Erst als er saß, fiel ihm auf, daß er keine Fahrkarte hatte. Egal, in seiner Tasche war genügend Bargeld, die sechs Mark Nachlösegebühr konnte er sich leisten.
Lag es an den vier Jugendlichen, deren großspurige Gespräche ihn ablenkten, an dem Kassettenrecorder, auf dem sie Hardrock spielten, oder an dem seltsamen inneren Lächeln, von dem Urs seit der Szene auf dem Wallrafplatz nicht mehr losgelassen wurde – er schlug das Buch nicht einmal auf, sondern sah aus dem Fenster und hing seinen Gedanken nach. Und immer wieder schob sich das verschlafene Gesicht der jungen Frau dazwischen. Ja, sie hatte verschlafen ausgesehen. So, als müsse sie sich gleich recken und strecken und gähnend zur nächsten Kaffeemaschine stolpern. Und dann beim Kassieren war sie wie ausgewechselt gewesen. Als hätte diese Frau einen Schalter, mit dem sie eine Art Innenbeleuchtung anknipsen konnte.
Die Jugendlichen stiegen aus. Ein Müllberg blieb auf ihrem Tisch zurück, und ein Aufatmen ging durch den Großraumwagen. Urs schlug das Buch auf, aber schon die erste Seite mußte er zweimal lesen. Er klappte es wieder zu und genoß die Landschaft.
Ich sehe so aus, wie ich heiße. Urs heißt Bär. Meine Eltern, ich meine jetzt die richtigen, verstorbenen Eltern, waren Schweizer. Meine bärige Statur hat mich als Kind vor den Folgen dieses hierzulande leider originellen Namens beschützt. Die Spötter wurden kleinlaut, wenn ich mich vor ihnen aufbaute. So gelang es mir ganz gut, meine dünne Haut zu verbergen. Das kann ich heute noch, wenn ich glaube, daß es sein muß. Aber nicht daß jetzt Mißverständnisse aufkommen. Ich bin kein guter Mensch. Nur eben kein Kämpfer und keiner, der Streit auch nur in Ordnung findet. Ich vermeide ihn wo ich kann, weil ich nicht nur den Körper, sondern auch das Gedächtnis eines Elefanten besitze. Kränkungen heilen bei mir sehr langsam, und die Narben brechen leicht wieder auf. Das war jetzt wieder bildlich.
Meine grimmig-heitere Stimmung ist übrigens einer Art Gelassenheit gewichen. Erstens wirkt Zugfahren beruhigend auf mich, zweitens freue ich mich auf Sirene und drittens hat mir die kleine Pfadfinderin mit ihrer guten Tat eine unzerstörbar gute Laune gemacht. Ach ja, und die Jungs mit ihrem Kassettenrecorder waren zwar gewöhnungsbedürftig, vor allem für Leute wie mich, die ihre Lebensdosis Musik schon abgekriegt haben, aber ein paar der Songs gefielen mir, und drei Nummern waren von Carmine, einer Band, bei der ich getrommelt habe. Ist immer schön, sich zufällig zu hören. Stahlwerke Böhler nannte man mich damals, weil ich einer der Lautesten und Stursten war. Das war höchst angesagt zu dieser Zeit. Laut, weil die Monitoranlagen noch nicht viel taugten und man den Bühnenlärm der Gitarristen übertönen mußte und stur, weil damals gerade alles, was nach Einfallsreichtum klang, verpönt war. Den Beat zu halten, war die Religion.
Der Zug hielt. Urs verstaute das Notizbuch in seinem silberglänzenden Metallkoffer. Ein hektisch an seinem eingeklemmten Gepäck zerrender alter Mann ließ ihn unfreiwillig in die Schlange der zum Ausgang Drängenden. Jetzt schimpfte der Alte, weil just in dem Augenblick, als Urs sich vor ihm einreihte, der Koffer endlich befreit war und der Mann sich um seinen guten Platz geprellt sah. »Den jungen Leuten kann’s nicht schnell genug gehen.«
Urs, der sich von dem giftigen Ton nicht die Stimmung verderben lassen wollte, schob sich zwischen zwei Sitzbänke und ließ den Mann mit ironischer Höflichkeit vorbei. Sein Gemurmel versuchte er erst gar nicht zu entziffern, reichte ihm noch den Koffer auf den Bahnsteig, sagte laut »Gern geschehen«, als er keinen Dank vernahm, und ging dann zielstrebig zum Ausgang.
Es war herrliches Wetter, so heiß, daß die Menschen wieder menschlich rochen, weil keine Chemie und kein Parfüm eine Chance gegen den Flüssigkeitsverlust hatten. Man konnte förmlich den Lack von den Autos dampfen sehen. Am Rollgeräusch der Reifen hörte man, wie schwer sich Gummi und Asphalt voneinander trennten.
Am Kiosk versperrten einige Berber mit Hunden und Plastiktüten, drei Punks und ein verächtlich dreinschauendes Mädchen den Weg, und die indignierten Passanten mußten sich mit künstlich abwesendem Gesichtsausdruck zwischen den unappetitlichen Erscheinungen durchschieben.
Urs blieb stehen. Für ihn waren Bahnhöfe immer etwas Besonderes gewesen. Nadelöhre der Sehnsucht. Schon als Kind hatte er sich dort herumgetrieben, wann immer es ging. Später, auf seinen vielen Reisen, war es ihm hin und wieder gelungen, das Gefühl für diese eigenartige Atmosphäre wiederzufinden: verquirlte Aufbruchs- und Abschiedsstimmung, gestreckt mit Langeweile, gesalzen und gepfeffert mit Kleinkriminalität und dem schlechten Gewissen auf Abwegen schleichender Spießer. Die Formulierung »Nadelöhr der Sehnsucht« benutzte er nur für sich selbst, er sprach sie nie aus, denn so poetisch und gefühlsduselig wollte er sich anderen nicht zeigen.
Dieser Bahnhof war eher ein Schutthaufen. Eine riesige Baustelle, die das armselige Gebäude aus den Sechzigerjahren fast ganz umgab, zeigte allerdings, daß dies nicht so bleiben und demnächst hier ein Palast des Fortschritts seinen Glanz verbreiten sollte. Bis dahin hätte man sicher auch die Berber vertrieben, und keine Dame könnte mehr ihre Achselnässe mit Angstschweiß verwechseln.
Ein schwarzbrauner Welpe stand auf gummiweichen Beinchen im Weg, als Urs durch die Gruppe der Obdachlosen steuerte. Bevor er sich noch bücken konnte, um mit dem Tier über eine Freigabe des Durchgangs zu verhandeln, flog es, von einem Tritt des Mädchens geschleudert, fiepend zur Seite. »Heh, mach Platz«, lallte sie, und Urs ging schnell zu dem Hund, um ihn hinterm Ohr zu kraulen und auf die Flanke zu klopfen, bis er nicht mehr zitterte.
»Spinnst du?« fragte er das Mädchen, das schon wieder apathisch und offenbar sehr betrunken am Geländer lehnte. Ein Mann richtete sich drohend auf, aber als Urs den Hund auf den Arm nahm und dasselbe tat, verschwand die Drohung aus der Gebärde des Mannes. Alle sahen zu ihm her.
»Heh, das ist doch mein Hund«, nölte das Mädchen mit einer Stimme, wie sie Kinder haben, wenn sie andere aufwiegeln wollen.
»Laß den Hund los«, sagte der Mann und versuchte, wieder drohend zu wirken. Aber auch er war betrunken, und die Hitze tat seiner kampfbereiten Pose nicht gut.
Der Hund leckte Urs inzwischen den Hals und knabberte an seinem Kragen. Jetzt war die Angewohnheit, Geld lose in der Tasche zu tragen, ihm endlich mal von Nutzen, denn Urs konnte einhändig und lässig einen Fünfzigmarkschein hervorziehen und fragen: »Krieg ich ihn?«
Das Mädchen gab ein verächtliches Geräusch von sich und winkte ab, nahm aber dann sofort den Schein und stopfte ihn in ihre Jeans, worauf sich alle Umstehenden ihr zuwandten und die Verwendung des Geldes zu planen begannen. Urs konnte unbemerkt seinen Koffer nehmen und verschwinden. Den Hund behielt er auf dem Arm.
»Was bist denn du für einer?« sagte er leise, und der Hund antwortete mit seiner nassen Zunge. Urs überquerte die Straße und ging in einem kleinen Bogen zurück zu den Taxis, die vor dem Bahnhof standen. Mit Koffer und Hund wollte er nicht durch die Stadt, obwohl der Weg nicht weit war.
»Soll das mal ein Hund werden?« fragte der Taxifahrer und wackelte mit dem Zeigefinger vor der Nase des Welpen.
»Auf jeden Fall«, sagte Urs, »wir sind noch nicht mal bei der ersten Bellstunde angekommen. Im Augenblick übt er das Stehen.«
»Wuff«, sagte der Taxifahrer und fuhr los, nachdem Urs ihm als Ziel die Adelhauser Straße genannt hatte.
Auf das Armaturenbrett des Wagens war ein Mercedesstern geschraubt, genau in der Mitte hinter dem Lenkrad. Dafür war keiner auf der Kühlerhaube. Vom Innenspiegel baumelte ein kleiner Stoffadler, dessen Klauen ein Schildchen umklammerten, auf dem, schief mit Metallbuchstaben aufgeklebt, der Name »Joe« stand.
»Das ist der erste Benz mit Innenstern, den ich sehe«, sagte Urs.
»Vielleicht der einzige.« Die wortkarge Antwort des Taxifahrers paßte zu seinem martialischen Maskottchen. Und zu den langen Koteletten unter dem Haarschnitt eines Elitesoldaten.
Auf einer längeren Geraden beugte er den Kopf, um einen vor ihnen her radelnden jungen Mann zu betrachten. Er schien ihn zu erkennen, denn zufrieden grinsend schaltete er herunter und schwenkte, nachdem er den Mann mit laut aufheulendem Motor überholt hatte, haarscharf vor ihm wieder nach rechts. Automatisch drehte Urs den Kopf und sah, daß der Radfahrer schlingerte, bremste und abstieg. Dabei grinste auch er übers ganze Gesicht und schien überhaupt nicht wütend zu sein.
»Kleiner Privatkrieg«, sagte der Taxifahrer markig.
»Heh, na so was, was machst du denn hier? Seit wann hast du’n Hund?« Irene strahlte und streichelte den Kopf des Welpen. Urs lächelte.
»Ich hab keinen Hund.«
»Dann ist das aber ’ne komische Katze.« Irene zog ihn herein und küßte ihn auf den Mund. Diese Gelegenheit nutzte der Hund, um ihr das Gesicht zu lecken, und gleichzeitig spürte Urs, wie sein Arm und Bauch naß wurden.
»Du hast einen Hund. Ab jetzt.« Urs hielt ihr das wollige Bündel hin und lächelte noch breiter.
Sie nahm ihn, drückte ihr Gesicht in sein Fell und rümpfte die Nase. »Du spinnst. Ich kann doch keinen Hund gebrauchen.«
»Aber er braucht dich.«
Irene bekam ihren mütterlichen Blick, schüttelte den Kopf und sah ihn an, als sei er wieder sieben Jahre alt und habe seine ganze Schulklasse spontan zum Kakaotrinken nach Hause eingeladen.
»Er braucht ein Bad, das steht fest«, sagte sie, und Urs hörte an ihrer Stimme, daß ihr die alte Rollenverteilung gefiel, in der sie die Resolute spielte und er den Träumer, der ständig die Karten neu mischt, weil er das Spiel nicht versteht. »Und was zu trinken.«
»Und ich ein frisches Hemd«, sagte Urs, weil er spürte, daß ein kleiner Luftzug die Nässe kühlte.
Als sie aus dem Badezimmer kamen, hatte der Hund erheblich an Umfang verloren. Die Nässe enthüllte eine kläglich zarte Kindergestalt. Aber ein paar Läuse und viel Dreck weniger waren den vorübergehenden Imageverlust wert, fand Urs, zumal der Hund alles geduldig mitgemacht hatte. Wenn auch ohne Begeisterung.
»Wie heißt er?« fragte Irene, die eine Flasche Wein und zwei Gläser auf den Tisch gestellt hatte. »Halt! Sag nichts. Ich nehm die Frage zurück. Du hast schon drei Bären, eine Katze, ein Auto und zwei Puppen von mir Alfons getauft, du eignest dich nicht zum Namenausdenken. Laß mich selber überlegen.«
Sie schnitt den Bleimantel vom Flaschenhals und bohrte den Korkenzieher vorsichtig bis zur Hälfte in den Korken. Dann hielt sie inne und sagte nachdenklich: »Also, er heißt auf jeden Fall nicht Alfons, das macht es schon um etwa ein Tausendstel einfacher.« Sie zog den Korken heraus und schenkte ein. »Ach, das hat auch noch Zeit bis morgen. Erst mal muß er zum Tierarzt.«
»Er?« fragte Urs.
»Es von mir aus. Das Hund muß geimpft werden. Und dann wissen wir auch, ob es ein Er oder eine Sie ist.«
»Wie wär’s mit Nachsehen?«
»Geht auch«, Irene lachte und nahm das nasse Ding hoch. Nach einem prüfenden Blick unter seinen Bauch sagte sie: »Hat ein Spitzchen. Ist ein Kerl.«
Urs nahm ihre Hand und küßte sie. »Ich freu mich«, sagte er.
»Ich auch.« Irene legte die Hand auf sein Gesicht und ließ sie dort eine Zeitlang liegen. »Bist mein Lieblingsbruder.«
Kunststück, ich bin der einzige, dachte er, und das noch nicht mal blutsverwandt, aber er fand sich dabei kleinlich und schwieg.
»Ist bei dir grad wieder eine Ära zu Ende?« fragte sie, und Urs wollte schon beleidigt reagieren, als sie hinzufügte: »Das wär das Beste, was mir passieren kann. Ich brauch deine Hilfe.«
»Wozu?«
»Ich mach meinen Laden auf.«
Sie klang so stolz und glücklich, wie eine Frau, die ihrem Mann eröffnet, daß sie ein Kind erwartet, und wie vielleicht dieser Mann bekam Urs zuerst einen Schreck, denn er konnte sie sich nur schwer als Unternehmerin vorstellen, reagierte dann aber sofort auf die Begeisterung in ihrer Stimme und behielt seine Skepsis für sich.
»Was?« fragte er. »Wo?«
Irene sprang auf. »Ich zeig’s dir. Ist nicht weit.«
Eigentlich war er müde und hatte eben angefangen, das Gefühl der Erleichterung in seinen ausgestreckten Beinen zu genießen, aber er stand auf und nahm schnell noch einen Schluck von seinem Wein. »Finden wir was als Leine?«
Sie holte eine Schnur aus der Küchenschublade. »Das hier.«
Sie hielten die Schnur gemeinsam, und der Hund zog in alle Richtungen, so daß sie die ganze Zeit achtgeben mußten, nicht über ihn zu stolpern.
»Hund betreten verboten«, sagte Urs, »vielleicht sollten wir ihm ein Schild auf den Rücken binden?«
Irene legte den Kopf an seine Schulter. »Schön, daß du da bist.«
»Wir gehen Hand in Hand wie ein Liebespaar«, sagte er. »Hund in Hund.« Irene wäre fast gefallen, denn die Schnur hatte sich um ihre Beine gewickelt. Urs befreite sie und nahm das tapsige Ding auf den Arm.
Hinter einem imposanten Stadttor bogen sie rechts ab, und nach wenigen Schritten blieb Irene stehen und zeigte auf ein leeres Schaufenster. »Hier«, sagte sie, »meine Buchhandlung.«
Urs starrte durch das Fenster und versuchte, den Raum dahinter zu erkennen, aber es war zu dunkel, und das wenige was er sah, wirkte nicht sehr einladend. »Muß man aber noch entmuffen«, murmelte er, worauf ihn Irene in den Oberarm zwickte. »Dich muß man entmuffen. Was ist los? Bist du skeptisch oder was?«
»Das kostet doch ein Höllengeld«, sagte er, ohne sie anzusehen, »hast du das?«
»Bißchen ich, den Rest die Bank. Der Platz ist Spitze, glaub mir. Hier, das ist direkt die Fahrradeinflugschneise in Richtung Uni.«
Er riß sich zusammen. Schließlich war er der Versager in der Familie. Irene war weder leichtsinnig noch dumm. Schon gar nicht bei einer so wichtigen Sache. Und mit fünfzehnjähriger Erfahrung als Buchhändlerin würde sie wissen, was sie tat. »Nörgel-Ende«, sagte er, »tut mir leid.«
»Und?« Sie faßte ihn an beiden Schultern. »Hast du Zeit? Bleibst du?«
»Ja.«
Sie küßte ihn impulsiv und naß auf den Mund, genau so, wie sie wußte, daß er es nicht leiden konnte.
»Welche Ära ist denn nun zu Ende? Die Kurier-Ära oder hab ich schon eine verpaßt?«
»Nein, die war’s«, sagte Urs. »So schnell dreht sich’s bei mir auch nicht mehr.«
Sie gingen zurück, Irene hakte sich bei ihm unter, und der Hund eierte auf seinen weichen Beinchen brav neben ihnen her.
»Was war denn vorher drin«, fragte Urs, »ich meine, in dem Laden?«
»Eine Buchhandlung.«
»Eine Buchhandlung? Und die hat Pleite gemacht?«
»Du wolltest doch nicht mehr nörgeln.« Irene schloß die Wohnungstür auf. »Die war schlecht geführt.« Urs holte nur tief Luft und schwieg.
Wenn es nicht so sinnlos wäre, in diese Frau könnte man sich verlieben. Sirene sieht phantastisch aus. Zum Glück ist ihre avantgardistische Phase vorüber, und sie bringt ihre einsachtzig mit souveräner Lässigkeit zur Geltung. Der halblange Haarschnitt steht ihr wunderbar, er unterstreicht ihr schönes scharfes Kinn und paßt zu diesem breiten, klaren Mund.
Und ich? Anstatt ihr Komplimente zu machen und sie zu unterstützen, kriege ich vor lauter Genörgel die Augenbrauen gar nicht wieder vom Haaransatz runter. Dabei gefällt mir die Aussicht, eine Zeitlang hier zu bleiben. In Köln war ich lange genug. Fürs erste jedenfalls. Morgen biete ich meine Wohnung bei der Mitwohnzentrale an und kaufe eine Leine für den Hund.
Ein Bißchen ängstigt mich’s ja, wie leicht mir das Weggehen immer noch fällt. Habe ich zu lange als Musiker gelebt? Warum finde ich so wenig dabei, einfach abzuhauen, die Freunde in den Wind zu schießen und die Nachbarn, die Gemüsefrau, den Postboten gleich mit? Oder liegt es daran, daß ich noch immer nicht die Freunde habe, die man nicht mehr in den Wind schießt? Und wessen Schuld ist das? Deren oder meine? Dieser Rotwein ist ein Schraubenzieher, es klappert und rieselt in meinem Kopf, ich schlaf lieber, bevor ich noch vollends besinnlich werde.
Irene lächelte, als sie das Notizbuch vorsichtig zuklappte, um Urs nicht zu erschrecken. Sie legte es neben ihn auf den Boden, damit es aussah wie aus seiner Hand gefallen. Er wollte bestimmt nicht, daß sie darin las, aber das war zuviel verlangt. Sie war schon immer neugierig gewesen. Was man nicht verschloß oder verbarg, war nach ihrer Lesart öffentlich. Der Unterschied zwischen einem herumliegenden Brief und einer Zeitungsannonce war ihr noch nie gravierend erschienen.
Schlaf noch gut, Bär, dachte sie und schloß die Küchentür hinter sich, damit ihn der Lärm der Kaffeemaschine nicht weckte.
Sie hatte schlecht geschlafen. Natürlich war der Hund in ihrem Bett gelandet. Den Versuch, ihn ins Wohnzimmer und auf Urs zu bugsieren, hatte er mit Hecheln und einem höflichen Knicken seines linken Ohres belohnt; es war völlig sinnlos gewesen, auf ihn einzureden und ihm den schlafenden Mann zu zeigen. Zielstrebig war er hinter ihr hergetrottet und wupp, wieder auf ihren Bauch gehopst. Das mußte sie ihm abgewöhnen. Gleich heute nacht.
Während sie versuchte, den Zeitpunkt zu erwischen, an dem ihr der Kaffee nicht mehr die Zunge verbrannte, aber noch heiß genug war, um zu schmecken, schrieb sie eine Liste der Dinge, die sie heute erledigen wollte.
Es klopfte an der Wohnungstür. Sylvie trat gähnend ein und schnüffelte erwartungsvoll. »Kaffee«, sagte sie, »her damit.«
»Danke, daß du kommst.« Irene küßte Sylvie flüchtig neben den Mund. »Hast du was gegen Flöhe?«
»Deine oder seine?« Sylvie deutete auf den Hund, der Irene gefolgt war und jetzt einen ihrer Schuhe zu frühstücken versuchte.
»Gestern waren’s noch seine.« Irene kratzte sich in der Armbeuge.
»Du brauchst Jacutin und er ein Halsband.«
Die Zuckermenge, die Sylvie in ihre Tasse schaufelte, war beeindruckend. Vier gehäuft volle Löffel. Irene schüttelte sich bei dem Anblick.
Sylvie, keine Freundin von mütterlichen Ratschlägen oder wohlmeinender Mißbilligung schippte extra noch einen fünften Löffel hinterher.
»Das Jacutin hat den Vorteil, daß du auch gleich deine Filzläuse loswirst.« Sie rührte vorsichtig in ihrer Tasse, damit der fünfte Löffel Zucker sich nicht auch noch auflöste.
»Wie heißt’n die kleine Straßenkreuzung?«
»Nicht Alfons«, sagte eine Männerstimme hinter ihr, »guten Morgen.«
Sylvie drehte sich erstaunt um. Einen Mann hier zu sehen, morgens um halb zehn, brachte sie aus der Fassung. Sie kannte Irene von »Lila Luder«, einer Lesbengruppe, die sich schon lange nicht mehr traf, seit die meisten von ihnen zum Kinderkriegen wieder heterosexuell geworden waren.
Irene grinste breit. Sie genoß den Anflug von Stirnrunzeln auf Sylvies Gesicht und ließ absichtlich eine kleine Pause entstehen, bevor sie sagte: »Mein Bruder. Urs. Das ist Sylvie. Sie ist Tierärztin und macht einen TÜV beim Hund.«
Sylvie nickte Urs zu, wandte sich aber gleich wieder ab, um den Hund auf ihren Schoß zu heben. »Wollen mal sehen, was wir da haben«, murmelte sie, und man hörte ihrer Stimme noch die Unsicherheit an. »Nicht-Alfons, das ist ein schöner Name für so eine halbe Portion. Du gibst ja noch nicht mal ein Mittagessen.«
Mit ähnlich ruppigen Zärtlichkeiten besprach sie den Hund weiter und untersuchte ihn nebenher. Sie zog seine Augenlider nach unten, schaute ihm ins Maul, tastete ihn ab und betrachtete dann das Löchlein unter seinem Schwanz. »Popo-Putzen mußt du auch noch lernen.«
Urs hatte eine Tasse aus dem Schrank genommen und sich den Rest des Kaffees eingegossen. Er fühlte sich unwohl. Immer wenn Lesbenkolleginnen bei Irene waren, kam er sich verachtet vor. So wie diese Sylvie eben nach einem kurzen Nicken zur Tagesordnung übergegangen war, so benahmen sich fast alle. Abweisend und unfreundlich. Er hatte oft mit Irene gestritten deswegen.
Schnell trank er den Kaffee aus und schlüpfte in die Schuhe. »Ich kauf mal Hundebedarf«, sagte er, »Nicht-Alfons braucht zwei schöne, seriöse Plastikschüsseln, sonst lachen ihn die anderen Hunde aus. Gibt’s hier ein Zoogeschäft mit Chevignon-Artikeln?«
Sylvie mußte lachen: »Ihr fangt ja schon richtig an.«
»Willst du nicht was essen?« rief Irene, als Urs schon im Flur verschwunden war.
»Kann er nicht für sich selber sorgen?« murmelte Sylvie.
»Nein danke, Sirene. Mein Magen schläft noch.« Urs zog die Tür ins Schloß.
»Vor allem kann ich für mich selber sorgen«, fauchte Irene. Sylvie versteckte sich hinter dem Hund. Leider war er zu klein, um sie vor Irenes zornigem Blick zu schützen, deshalb entschloß sie sich zur Gegenwehr und parierte in entschuldigendem Tonfall, aber mit ätzender Wortwahl: »Ja Mami, tut mir leid, Mami, hab ich das Männchen beleidigt, krieg ich trotzdem Nachtisch?« Und sie hielt ihre Tasse hoch.
Irene schüttelte den Kopf und schnippte mit Daumen und Zeigefinger ein imaginäres Staubkorn in Sylvies Richtung. »Ich erklär’s dir mal, wenn deine Hormone wieder stimmen.«
»Ha, ha, meinst du, der Testosteronspiegel müßte runter«
»Komm, hör auf.« Irene mußte lachen. Immer gab es Gerangel mit Sylvie ums letzte Wort. Sie benahmen sich wie Streithähne, obwohl sie einander mochten. Einen Nachmittag lang waren sie sogar ein Paar gewesen, aber das war lange her und hatte in Gelächter und einem verheerenden Whiskyrausch geendet.
»Wenn du die Kerle nicht magst, dann benimm dich nicht wie einer«, sagte sie gnädig und machte sich an der Kaffeemaschine zu schaffen.
Ende der Leseprobe