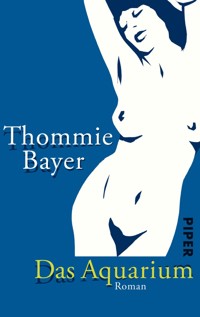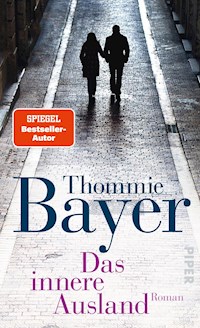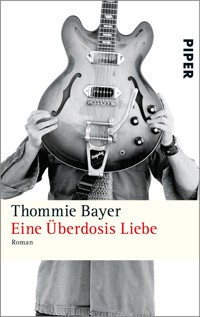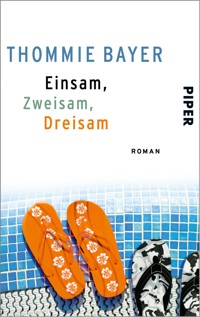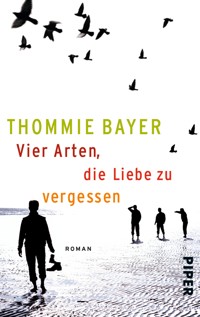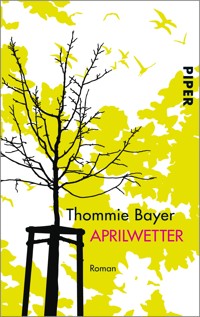10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Ist Ihr Mann treu? Finden Sie es heraus.« Vera bietet ihre Dienste als Lockvogel an: Sie verschafft eifersüchtigen Frauen Gewissheit – und kann über Nacht Ehen zerstören. Bislang hat sie noch jeden Mann in ihr Bett und auf Video bekommen. Doch dann wird sie auf den Schriftsteller Axel Behrendt angesetzt, der gar nicht auf einen Seitensprung aus zu sein scheint. Aber Behrendt will unbedingt Veras Geschichte erfahren, und ihre Treffen werden zu einem Ringen um Nähe und Distanz, zu einem Spiel um Vertrauen und Betrug. Denn Behrendt geht es um viel mehr als nur eine gute Story …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für Jone
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Taschenbuchausgabe
4. Auflage 2011
ISBN 978-3-492-96022-9
© 2004 Piper Verlag GmbH, München Umschlaggestaltung: R.M.E Roland Eschlbeck und Kornelia Rumberg Umschlagmotiv: Kornelia Rumberg Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck
I’ve looked at love from both sides now
From give and take, and still somehow
It’s love’s illusions I recall
I really don’t know love at all
Joni Mitchell
In Wirklichkeit tut Liebe weh. Das wissen alle, aber alle träumen weiter. Von dem Mann, dessen Leidenschaft nie versiegt, ebensowenig wie sein Verständnis und seine Zärtlichkeit, der nach zwanzig Jahren Ehe noch immer behauptet, er wolle jetzt, in diesem Moment, gern wissen, was durch ihren Kopf geht. Nach zwanzig Jahren Ehe weiß er noch immer nicht, daß es sich um Schuhe dreht, die zwar weh tun, aber größer machen, oder darum, ob die beiläufige Bemerkung einer Bekannten vielleicht eine versteckte Gemeinheit enthielt. Er sieht gut aus, genießt hohes Ansehen und hat nur Augen für sie.
Ich träume nicht mehr.
1 Es war Ende August. Die Strahlen der Nachmittagssonne drangen nur vereinzelt, gefiltert vom Laub der Linden, zu mir durch, ich genoß die schläfrige Spätsommerstimmung – meine Nachbarn waren noch in den Ferien, ihre Kinder gingen sonstwem auf die Nerven, das Verkehrsgebrumm wurde gedämpft von den Gärten ringsum, und die Katzen dösten, jede in ihrem eigenen Sonnenfleck. Nur Valentino lag wie immer auf dem Schreibtisch, eine Pfote lässig auf mein Mauspad gelegt, als wolle er noch im Schlaf sagen: Das gehört mir, so wie du mir gehörst und jeder Platz, auf dem du sitzt oder liegst oder stehst. Er träumte vielleicht, vergaß das Schnurren, atmete flach und hatte den zufriedenen Ausdruck auf seinem Gesicht, um den ich ihn, seit er bei mir ist, beneide.
Ich starrte auf den Bildschirm, sah den blauen Kästchen zu, die sich zielstrebig vermehrten, während das Programm meine Festplatte aufräumte. Ich lasse es jede Woche laufen. Mir gefällt der Anblick.
Ich lebe hier im Büro. Alles, was ich brauche, und fast alles, was ich liebe, ist hier. Hunderte von Fotos an den Wänden, die meisten selbst geknipst, vor Jahren, als ich eine Zeitlang dieser Leidenschaft verfallen war, die CDs, die ich höre, die Kleider, die ich trage – Jeans, Pullover, T-Shirts und drei verschiedene Dufflecoats –, die Gewürze, die ich zum Kochen benutze, und, im Flur vom Boden bis zur Decke, die Bücher, die ich nach dem Lesen nicht verschenkt habe. Hier in diesen drei Erdgeschoßzimmern hat jede Katze ihren Platz, ein Kissen, eine Decke, einen reservierten Sessel oder die Lehne des zerkratzten Sofas – die Möbel sind ein stilistisches Durcheinander, manche von Geburt an häßlich, manche ehemals elegant, aber jetzt alle mit Patina, Wunden und Geschichte. Und alle von mir geliebt. Kein Stück dürfte fehlen.
Hier, in dieser Höhle, fühle ich mich sicher, hier weiß ich, wer ich bin, und außer mir und den Katzen setzt höchstens mal ein Handwerker seinen Fuß über die Schwelle. Und einmal im Jahr der Tierarzt.
Meine Wohnung nebenan ist das glatte Gegenteil: Designermöbel, Marmorbad und High-Tech-Küche, aus deren Kühlschrank ich allenfalls mal eine Flasche Champagner nehme. Die Kühlschranktür schließt mit dem satten Geräusch einer Mercedestür. Ich mag übrigens keinen Champagner. In der Wohnung bin ich nur, um meinem Beruf nachzugehen. Ich habe einen abseitigen Beruf: Ich schlafe mit Männern. Wenn ihre Frauen das wollen.
Sie rufen mich an, wenn sie meine Anzeige sehen: Ist Ihr Mann treu? Finden Sie es heraus. Ich schalte den Text einmal im Monat hier in der Stadt und in einer überregionalen Tageszeitung. Man sollte nicht glauben, wie viele Frauen sich bei mir melden. Manche aufgelöst, manche von vornherein feindselig, manche verlegen und beschämt, weil sie glauben, paranoid und im Unrecht zu sein, manche forsch, als müßten sie mich für einen Putzjob examinieren, und manche, das sind die wenigsten, sprühend vor guter Laune und aufgesetzter Lässigkeit, weil sie wollen, daß ich das Ganze für einen Witz oder eine Wette unter Freundinnen halte. Und fast alle brechen zusammen, wenn sie kriegen, was sie wollten: ihren Mann auf Video. Mit mir.
Ich bin keine Privatdetektivin, eher eine Art Lockvogel. Ich stelle den Männern Fallen, verführe sie, biete mich an, bin der Traum, den sie längst schon nicht mehr zu träumen wagten, die Frau für eine Nacht, die aus dem Nichts kommt, keine Forderungen stellt und am nächsten Morgen wieder im Nichts verschwindet. Sie gehen verjüngt und stolz nach Hause, wo sie vielleicht schon vom Inhalt ihres Kleiderschranks auf der Straße erwartet werden, mitsamt der Eisenbahn, der Videokamera und dem zerschmetterten Computer. Oder von einer leeren Wohnung mit der Nummer des Anwalts auf dem Küchentisch. Oder ihrer Frau, die mit ausdruckslosen Augen einem Handwerker beim Austauschen der Schlösser zuschaut.
Und man sollte nicht glauben, wie gut ich verdiene. Tausend bar im voraus und tausend nach Vollzug. Ich brauche dem Geld nicht nachzulaufen, bisher hat noch jede Frau bezahlt. Vielleicht, weil sie nie wieder mit mir zu tun haben wollen. Der Gedanke, ich könnte vor ihrer Tür stehen, die Frau, die ihren Mann geritten hat, der Inbegriff ihrer Demütigung, dieser Gedanke muß sie so ängstigen, daß sie umgehend bezahlen. Auch wenn sie mich für den Rest ihres Lebens hassen. Genau wie ihre Männer.
Obwohl, das ist nicht immer so. Einer stand mit einem Strauß Rosen vor der Tür und wollte mit mir ein neues Leben anfangen, und ein anderer, einer der Netteren, brachte mir seine Katze und bat mich, für sie zu sorgen. »Meine Frau haßt das Tier«, sagte er, »sie würde es einschläfern lassen.«
»Warum nehmen Sie es nicht zu sich?« fragte ich, aber bevor er noch erzählen konnte, daß er gekündigt und eine Asienreise gebucht hatte, strich die Katze mir schon um die Beine und hatte mich um den Finger gewickelt. Das geht leicht bei mir. Wenn man eine Katze ist. Der Mann gab mir einen Hunderter, ging in die Knie, küßte die Katze auf den Kopf und trollte sich. So kam Valentino zu mir. Er war der letzte.
Natürlich hat man mir auch schon die Scheiben eingeworfen, Pakete mit ekelhaftem Inhalt geschickt oder versucht, mich mit Telefonterror zu quälen, aber das betrifft alles die Wohnung, und dort bin ich nicht. Von meinem Büro wissen die Herren nichts. Niemand weiß davon.
Und man sollte nicht glauben, wie einfach es für mich ist, die Männer reinzulegen. Hätte ich, bevor ich diesen Beruf ergriff, noch an das Gute im Menschen, speziell im Manne, geglaubt, dann wäre ich bitter enttäuscht worden. Aber ich wußte, worauf ich mich einließ, denn die Zeit, in der mich ein Mann ohne Gier angesehen hatte, lag auch damals schon lange zurück. Der letzte, der mich als Menschen betrachtet hat, war mein Vater. Ich vermisse ihn.
Ich glaube, er hat mich vergöttert. Und mich, seit ich denken kann, wie eine Erwachsene behandelt. Meiner Mutter paßte das nicht. Wie ihr überhaupt nichts paßte, was zwischen ihm und mir vor sich ging. Wäre sie nicht zu feige dazu gewesen, dann hätte sie mich umgebracht. Ihn umzubringen war leichter. Sie ging immer den leichteren Weg.
Ich war sechzehn, als ich begriff, was mit mir nicht stimmte. Bis dahin war ich ein Mädchen wie jedes andere gewesen, das seinen Körper zu plump, die Augen zu schmal, den Mund zu breit und die Haare zu dünn fand – sah ich in den Spiegel, dann war ich so unglücklich wie alle, die ich kannte. Von meinen Fehlern und Mängeln besessen, kam ich mir dumm, häßlich und ausgestoßen vor und sehnte den Tag herbei, an dem ich endlich aus dem Madenkörper schlüpfen und als entzückender Schmetterling hinaus ins glamouröse Leben schwirren würde. Ich hatte nicht mitbekommen, daß das längst geschehen war. Während ich noch darauf wartete, daß meine Beine länger und mein Haar kräftiger werden sollten, bemerkte ich nicht, was mit den Männern vor sich ging, wenn sie mich sahen. Die waren von der Made hypnotisiert.
Als sich meine Schulnoten in den Fächern, die von Lehrerinnen gegeben wurden, immer weiter verschlechterten, schrieb ich das noch meinen eigenen Leistungen zu und gab mir Mühe, meine Schwächen mit Fleiß zu kompensieren. Und daß die Jungs sich mir gegenüber noch ekelhafter aufführten als bisher, hielt ich für eine Folge meiner Häßlichkeit. Ich beneidete die Mädchen, deren Verehrer ihnen mit Scheu und Zartgefühl nachstellten, und verabscheute mich selbst dafür, nur von den Verächtlichen, Aggressiven und Zudringlichen verfolgt zu werden. Sie fixierten mich und griffen sich in den Schritt oder ließen ihre Zungen aus den Mündern schnellen wie Eidechsen beim Fliegenfang, sie benutzten gemeine Vokabeln und betatschten mich einfach, als müsse man eine wie mich nicht vorher fragen. Sie waren ein pulsierender, glitschiger Brei mit Gesichtern, der auf mich einblubberte und mich verschlingen wollte.
Anders die erwachsenen Männer, die waren so nett und zuvorkommend wie ihre Frauen feindselig. Ich weiß nicht, wie lange ich gebraucht hätte, um zu verstehen, was da vor sich ging, wenn ich nicht eines Tages mit meiner Mutter und Herrn Öhlmann zusammengestoßen wäre, als sie angeregt plaudernd um den Stadtsee schlenderten und ich mit meinem Fahrrad in einer unübersichtlichen Kurve fast in sie hineinraste. Ich kam vom Querflötenunterricht, in meinem Kopf dudelte eine schwierige Stelle mit Oktavierungen, die ich beim Üben zu Hause geschafft, aber in der Stunde natürlich wieder versiebt hatte, und auf einmal standen die beiden vor mir. Ich bremste so scharf, daß mein Vorderrad auf dem Kies zur Seite rutschte und ich mit Geschepper und einem Schrei in der Böschung landete.
Herr Öhlmann kümmerte sich nett um mich, half mir auf und sah sich die Schürfwunde an, die ich mir am Knöchel zugezogen hatte. Ich sagte: »Nicht schlimm«, und lachte, und als meine Mutter mich ihm vorgestellt hatte, fragte er dies und das, was ich auf der Flöte spiele, was ich beruflich vorhabe, ob ich studieren wolle, solches Zeug eben, die übliche Fragerei von Erwachsenen. Meine Mutter stand stumm dabei mit ihrem typischen Maskengesicht, auf dem sich immer dann, wenn Herr Öhlmann zu ihr hinsah, blitzartig ein Lächeln ausbreitete. Sie hatte es eilig wegzukommen. Von mir. »Ich brauch einen Kaffee«, trällerte sie mit schriller Fröhlichkeit, »du auch?« Er war so nett, mich einzuladen, aber noch bevor ich selbst antworten konnte, bellte sie: »Vera muß los.«
Herr Öhlmann richtete mir noch den Lenker, der sich verzogen hatte, und ich fuhr meiner Wege.
Außer daß meine Mutter diesen Mann, der erst vor kurzem eine Villa am Hang bezogen hatte und sein Leben als wohlhabender Müßiggänger genoß, duzte und ganz offenbar mit ihm befreundet war, dachte ich nichts weiter und fuhr nach Hause, um zu duschen, mich umzuziehen und ein Pflaster auf die Schürfwunde zu kleben.
Ich stand am Fenster und übte dieses vertrackte Überblasen, als meine Mutter zur Tür hereinkrachte und mir wortlos eine Ohrfeige gab, deren Wucht die Flöte aus meinen Händen und nach draußen schleuderte. Noch bevor ich den Schmerz spürte, hörte ich die Flöte unten im Hof mit einem ekelhaften Geräusch aufschlagen und meine Mutter zischen: »Mach das noch einmal, und ich vergesse mich!«
»Was denn?« schrie ich, aber sie war schon aus der Tür und trampelte die Treppe hinunter, ohne mir zu antworten.
Ich ließ die Flöte liegen, wo sie war, und ging nicht mehr zum Unterricht. Die Flöte war ein Geschenk gewesen. Von meinem Vater.
Ich lag fast die ganze Nacht wach, betastete mein geschwollenes Gesicht und schmiedete Fluchtpläne. Aber der einzige Mensch, zu dem ich hätte gehen können, war Murmi, die Mutter meines Vaters in Berlin, und dort würde mich die Polizei sofort wieder abholen. Es war ausweglos. Ich war meiner Mutter ausgeliefert, die mich nie gemocht hatte und nun auch noch schlug.
Und dann kam mir zu Bewußtsein, was geschehen war: Herr Öhlmann hatte sich für mich interessiert! Deshalb war sie so ausgerastet. Daß ich ihm gefallen hatte, war der Grund! Ohne die Ohrfeige hätte ich nichts bemerkt, er schien mir nett wie alle Männer, ich hatte damals keine Augen für das, was in ihnen vorgeht. Meine Welt waren die Jungs, der blubbernde Brei – ich wußte nichts von Männern. Ich schlief todunglücklich und zufrieden ein. Ich gönnte meiner Mutter, daß sie sich neben mir wie ein Schluck Wasser vorgekommen war. Ich malte mir Szenen aus, in denen das wieder und wieder geschah, und genoß das festgezurrte Angstlächeln auf ihrem Gesicht, während ich in den Schlaf glitt. Draußen fingen schon die Vögel an zu singen. Ich vergaß zum erstenmal seit einem Jahr, mit meinem Vater zu reden. Das tat ich damals immer. Das war meine Art Gebet.
Am nächsten Morgen schenkte ich meiner Mutter ein strahlendes Lächeln. Sie saß in der Küche mit einer Gesichtsmaske, sah mich erstaunt und mißtrauisch an, ich sagte nichts, kein Wort, ging an ihr vorbei nach draußen und wußte: Unter der Maske ist sie alt. Und sie kann es nicht ertragen. Und das gönne ich ihr.
Eine Menge mehr wußte ich von diesem Tag an. Dinge, die ich bisher wohl wahrgenommen, aber nicht verstanden hatte: warum das Gesumm der Stimmen, immer wenn ich einen Raum betrat, entweder lauter oder leiser wurde, warum ich in Mathe bei Herrn Lehner eine Zwei plus hatte und in Englisch bei seiner Frau eine Vier, warum ich nicht mehr per Anhalter fuhr, nachdem ich immer und immer klebrige Hände von mir wischen, klebrige Sprüche an mir abgleiten lassen mußte oder an der klebrigen Luft im Wageninnern fast erstickt wäre, warum nichts in meinem Leben mehr zart und schön und liebevoll war und warum ich seit Stefanie keine Freundin mehr gehabt hatte.
Das tolle Gefühl, der Glaube, ich sei eine Art Königin und könne nun, da ich wußte, daß die Männer auf mich flogen, über mein Leben selbst bestimmen, währte nur so lange, bis ich begriff, daß der Brei einfach größer geworden war. Die Männer gehörten jetzt auch dazu. Das war alles. Nichts war besser. Nur gegenüber meiner Mutter verschaffte es mir die nötige Verachtung, die ich ihr gnadenlos zeigte, aber die war eigentlich schon vorher dagewesen. Ich hatte das nur bis zur Nacht nach der Ohrfeige nicht gewußt. Jetzt wußte ich’s und freute mich daran, sooft sich die Gelegenheit ergab.
Arlette saß in der Tür und gurrte. Sie hatte Hunger. Als einzige will sie ihr Essen gegen fünf Uhr nachmittags, die anderen frühstücken ausgiebig und sind den ganzen Tag zufrieden. Sie nicht. Sie ist was Besonderes. Obwohl, wir sind hier alle was Besonderes. Arlette mit ihrem Fünfuhrtee, Tino mit seinem Schreibtischplatz, Josef mit dem eifersüchtig verteidigten Privileg, an meinem Kopf zu schlafen und seine Pfoten in mein Haar zu wühlen, Sabinchen mit ihrem luxuriösen Speiseplan (Thunfisch und eine rare Sorte amerikanisches Trockenfutter immer abwechselnd) und Fee mit ihrer strikten Beschränkung auf das Sommersche Rosenbeet als Toilette.
Letzten März, keine sechs Wochen nach ihrem Einzug, stand Frau Sommer schon vor mir, ganz Vorwurf und Mißbilligung: »Könnten Sie Ihrer Katze beibringen, daß sie woanders hinmacht? Die Rosen leiden unter dem scharfen Urin.«
»Bringen Sie einer Katze mal was bei«, sagte ich, »das geht nicht. Wie wär’s mit robusteren Rosen?«
Wir brauchten nur ein paar Sätze, bis die Luft brannte. Sie wollte sich über mich beschweren, ich fand, das solle sie ruhig tun, sie wollte sich was einfallen lassen, wie sie die Katze von dem Beet fernhielte, ich fand, das solle sie besser lassen …
Seither reden wir nur noch das Nötigste. Der Pfeffer, den sie großzügig um die Rosensträucher verteilte, hatte nur den Effekt, daß Fee ihr Geschäft jetzt eben niesend erledigte, und von einem Fernhaltespray hält Frau Sommer nichts. Es kostet Geld und ist Chemie. Beides kommt für sie nur im Notfall in Frage. Sie beschwerte sich bei der Hausverwaltung und verlangte, man solle mich abmahnen, aber der Verwalter zuckte nur mit den Schultern und sagte wie immer in solchen Fällen: »Frau Sandin hat lebenslanges Wohnrecht, sie kann machen, was sie will.« Er lügt in meinem Auftrag. Das Haus gehört mir. Das brauchen die Mieter nicht zu wissen. Sonst kann ich mich dreimal in der Woche um tropfende Wasserhähne oder klappernde Fensterläden kümmern. Diesen kleinen Trick habe ich von Murmi geerbt. Zusammen mit dem Haus.
Murmi hat mich damals gerettet. Irgendwann stand ich mit meiner Reisetasche vor der Tür und sagte, ich will bei dir bleiben. Da war ich achtzehn, hatte das Abitur, und meine Mutter konnte mich mal. Murmi ging schnurstracks in ihr Schlafzimmer und schob ihre Sachen im Schrank zur Seite, damit der Inhalt meiner Tasche Platz fand. Seither lebe ich hier.
Sie führte ein bescheidenes Leben von ihrer Pension. Daß ihr das Haus gehörte, wußte ich nicht. Die Mieteinnahmen sparte sie, damit ich später, falls es notwendig würde, renovieren konnte. Das erfuhr ich alles erst nach ihrem Tod. Als ich zu ihr zog, schien sie gerade so über die Runden zu kommen, und ich sah mich sofort nach einem Job als Bedienung um, damit ich ihr nicht auf der Tasche lag.
Ich studierte ein bißchen, brach aber alles wieder ab, was ich angefangen hatte: Psychologie, Germanistik, Theaterwissenschaft, länger als zwei Semester hielt ich es nirgendwo aus, und dann ließ ich es ganz, denn meine Trinkgelder waren üppig, und ich gewöhnte mich daran, die Nächte hinter irgendeiner Theke mit dem Zapfen von Bier und dem Gelaber betrunkener Männer zuzubringen. Und hin und wieder, wenn es mich juckte oder das Geld knapp war, auch in irgendwelchen Hotelzimmern mit einem, dem die Augen übergingen, wenn ich mir die Bluse über den Kopf zog. Das Folgende ging immer schnell – ich hatte nach kurzer Zeit den Dreh raus, manche kamen sogar, trotz Alkohol, bevor ich sie anfassen konnte oder sie in mich eindrangen; danach war ich um hundert Mark reicher und stieg zufrieden ins Taxi.
Immer wenn meine Arbeitgeber mitbekamen, daß ich nebenher anschaffte, flog ich entweder, weil sie Ärger mit der Sitte fürchteten, oder kündigte selbst, weil sie ihre Duldung in Naturalien bezahlt haben wollten. Und irgendwann verpfiff mich einer von ihnen an einen Zuhälter, der mich so unter Druck setzte, daß ich Angst bekam und von der Szene verschwand.
Ich hatte mich an das leichte Geld gewöhnt. Es fiel mir schwer, mich wieder einzuschränken und mit dem Gehalt einer Schreibkraft auszukommen, aber es ging. Wir aßen ein paar Delikatessen weniger, ich kaufte meine Kleider und Bücher secondhand und gab das Rauchen auf.
In dieser Zeit starb Herr Sutorius, ein pensionierter Orchestermusiker, Fagottist, der die kleine Wohnung nebenan mit seiner Katze Fee bewohnt hatte und für Murmi so etwas wie ein Freund gewesen war. Die Katze trauerte um ihn. Sie bekam von uns Wasser und Futter, aber sie miaute ein paar Wochen lang vor der leeren Wohnung, es klang hoffnungslos. Und eines Tages war sie weg.
»Nimm du doch die Wohnung«, schlug Murmi vor, »dann hast du deine eigenen vier Wände.«
Die Miete strapazierte mein ohnehin schon schmales Budget, aber es reichte so eben hin. Wir kochten und aßen immer noch zusammen und sahen uns Murmis Lieblingsfilme im Fernsehen an, aber dann, wenn sie schlafen ging, konnte ich weiterleben, lesen, Musik hören oder Gedichte schreiben, die ich hinterher immer wegwarf.
Eines Morgens saß ein kleiner zerzauster Kater vor dem Fenster. Er hatte riesige Ohren und schrie zum Gotterbarmen mit schiefgelegtem Kopf. Er war winzig, vielleicht sechs oder sieben Wochen alt. Murmi öffnete das Fenster und holte ihn herein. Sie gab ihm mit Wasser verdünnte Milch und schickte mich los, ein paar Dosen Futter zu kaufen.
Als ich zurückkam, hatte der Kater schon auf den Teppich gepinkelt, seinen Namen bekommen, Josef, und schlief eingerollt im Sessel mit einem entspannten Lächeln auf dem Gesicht. Ich kniete mich hin und sah ihn an.
»Warum streichelst du ihn nicht?« fragte Murmi von der Küchentür, »der will hierbleiben, das seh ich genau. Er mag uns.«
Ich stand auf und ging nach nebenan. Mich hatte das Elend gepackt, und ich warf mich heulend aufs Bett.
Irgendwann stand sie da und fragte: »Was ist denn los?«
Ich war damals sechs. Mein Vater hatte die Katze von einem Kollegen bekommen, sie war gestreift und winzig, so wie Josef, kaum von der Mutter entwöhnt, und piepste mit einem ebenso winzigen Stimmchen. Er setzte sie mir in die Hände und sagte: »Sie wollte zu dir.« Ich schlief kaum in dieser Nacht, stand immer wieder auf, um nach der Katze in ihrem Schuhkarton zu sehen, sie anzufassen und mir zu überlegen, wie ich sie nennen würde. Entweder Urmel oder Minou. Urmel war meine Idee, ich durfte damals die Augsburger Puppenkiste im Fernsehen anschauen, Minou war der Vorschlag meines Vaters, weil er meinte, sie sähe wie eine kleine Französin aus.
Am nächsten Tag nach dem Kindergarten rannte ich den ganzen Weg, fiel zweimal hin und kam außer Atem zu Hause an, und die Katze war verschwunden. Meine Mutter hatte sie zu einem Bauern gebracht. »Da geht’s ihr besser«, sagte sie, »ich kann hier kein Vieh gebrauchen.«
»Das war aber meine Katze.« Ich stotterte und hyperventilierte vor Entrüstung. »Die kannst du doch nicht einfach weggeben. Die hat mir Papa doch geschenkt.«
»Ich hab hier immer noch was mitzureden«, sagte sie zu der Pfanne, in der sie rabiat herumrührte, und damit war die Diskussion beendet.
Ich brauchte fast eine Woche, um herauszufinden, welcher Bauer das war, meine Mutter weigerte sich, seinen Namen zu nennen. Schlag dir das Vieh aus dem Kopf, sagte sie immer, wenn ich fragte. Mein Vater half mir nicht. Er war wütend, aber machtlos. Er versuchte, mich aufzumuntern, entschuldigte sich für sein vorschnelles Handeln und nahm alles auf sich. Er hätte es mit ihr besprechen müssen, sagte er, dann wäre mir die Enttäuschung erspart geblieben.
Ich fragte so lange bei den Nachbarn, meinen Kindergartenkameraden und in den Läden, wo wir einkauften, bis ich auf dem dritten Bauernhof, zu dem ich geradelt war, von einem schmutzigen Jungen die Auskunft bekam, meine Mutter sei hiergewesen und sein Vater habe die Katze gleich ersäuft.
»Das ist ja unerträglich«, flüsterte Murmi in meinem Rücken. Sie legte eine Hand auf meinen Hinterkopf und schwieg. Dann hörte ich sie wieder: »Und damals hast du dir vorgenommen, keine Katze mehr gern zu haben? Ich hab mich schon gefragt, wieso du Fee immer links liegenlassen hast.«
Ich nickte.
»Und jetzt hörst du auf damit. Diese hier hast du gern, und wenn sie schlau ist, lebt sie lange und macht uns lange Freude.«
»Meine Mutter ist eine widerliche Sau«, sagte ich, »sie ist bösartig von Geburt an.«
»Nein, Schätzchen, das ist sie nicht. Sie hat nur so furchtbar viel Angst, daß man ihr Verhalten nicht mehr von Bösartigkeit unterscheiden kann.«
»Angst? Vor was denn?«
»Davor, nicht bewundert zu werden, nicht geliebt zu werden, nicht geachtet zu werden. Wie jede Frau. Wie jeder Mensch. Das wird bei den Männern nicht anders sein.«
Sie schloß die Tür und ließ mich in Ruhe. Ich nahm ein Bad, legte mich ins Bett und mußte bald eingeschlafen sein, denn das nächste, was ich mitbekam, war Mondlicht im Zimmer und ein Rasseln an meinem Ohr. Josef lag hinter mir, die Pfoten in mein Haar vergraben, und schnurrte. Ich zupfte an den Haaren auf seinem Kopf und schlief wieder ein.
Und am Morgen war Sabinchen da. Seine Schwester. Sie hatten es gemacht wie zwei schlaue Tramper. Nur andersherum. Das Mädchen stellt sich an die Straße, und wenn einer hält, schlüpft der Junge aus dem Gebüsch. Und eine Woche vor dem ersten Schnee saß auch Fee wieder vor der Tür und ging schnurstracks zu dem dunkelroten Sofa, das ich als einziges Möbelstück von Herrn Sutorius behalten hatte. Seltsam: Weder Josef noch Sabinchen hatten sich’s je darauf gemütlich gemacht. Es war reserviert.
Ein weißes Auto hielt vor dem Tor, und ein Mann mit Glatze stieg aus, nahm etwas vom Beifahrersitz und klingelte. Bei mir. Ich höre die Wohnungsklingel hier, ich habe sie mir ins Büro legen lassen. Ich ging dem Mann entgegen. Blumen.
Nein, eine einzelne Rose. Auf dem Kärtchen stand: Sie sind unglaublich gemein, aber ich werde Sie bestimmt nicht vergessen. Mit stocksaurem Gruß. Roland Semmig.
Ich mußte lächeln. Der Mann hat Stil. Er war mein jüngster Fall, ich hatte ihn am Samstag zuvor erlegt. Auf einem Ärztekongreß. Er tat mir fast leid.
Seine Frau war das typische teuer eingekleidete Püppchen, das sich den Eintritt in die bessere Gesellschaft über eine Arzthelferinnen- oder Krankenschwesternausbildung verschafft und jetzt, da sie Haus und Kind beisammen hat, den Kerl nicht mehr braucht. Sie saß vor mir und sagte: »Er kommt nächste Woche hierher zum Kongreß, und man weiß ja, wie’s da zugeht.«
»Wie denn?« fragte ich zu patzig, einfach weil sie mir unsympathisch war und ich es ihr nicht leichtmachen wollte.
»Ich bin seine zweite Frau«, sagte sie kühl, »mit uns hat es auch auf einem Kongreß angefangen.«
Und dann bist du ganz schnell schwanger geworden, dachte ich, während sie den Sitz ihrer Strümpfe kontrollierte und artig einen Schluck Mineralwasser nahm, hast ihn in allem, was er sagte, verstanden, dich für alles, was er dachte, interessiert und ihn so richtig den Unterschied zwischen dir und seiner Frau spüren lassen, hattest immer Lust, wenn er wollte, hast einen Irrsinnslärm dabei gemacht und ihm das Gefühl gegeben, er sei der Größte. Und jetzt hast du ein Haus und die Aussicht auf saftigen Unterhalt. Jetzt reicht es dir mit seinem öden Gequatsche, den immergleichen Geschichten aus der Klinik oder Praxis, von Aktienfonds, Kollegen, Golf oder was auch immer dich vorher so brennend interessiert hat. Jetzt könnte dann langsam der Prinz mit Haaren und ohne Bauch übernehmen.
Sie legte tausend Euro und ein Foto auf den Tisch – ich hatte richtig geraten, der Mann war wesentlich älter als sie und fast kahl, nur ein dünner Kranz von Haaren fusselte um seinen Kopf –, erklärte mir noch, wofür er sich am meisten interessiert: Theater und Architektur, und bestellte das volle Programm. Ich sollte nicht nur ausprobieren, ob er vielleicht geneigt wäre, sondern wirklich mit ihm schlafen, und sie wollte das Video als Beweis. Das wollen die meisten.
Ende der Leseprobe