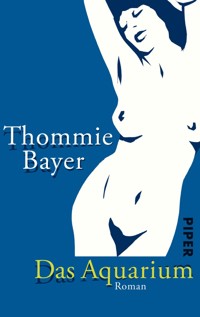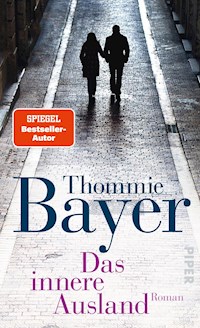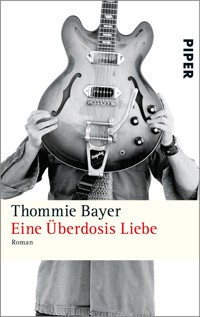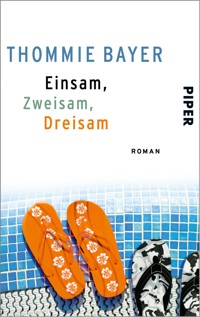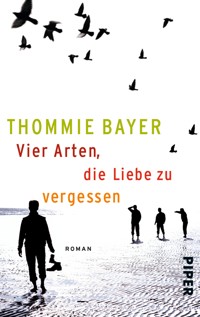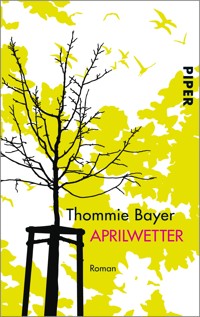8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was wäre, wenn wir mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit reisen könnten? Namentlich über 2000 Jahre zurück ins Galiläa des Jahres Null? Würde sich dann die These bewahrheiten, die Bibel sei heute noch gültig? Kann das wirklich stimmen? Denn dort spazieren wir durch eine staubige Gegend, erweitern unsere Hygienevorstellungen, modifizieren unsere Moralvorstellungen, beschließen, unser Handy, elektrisches Licht und fließend Wasser nicht zu vermissen – aber wir haben unseren heutigen Kopf, unser heutiges Herz und unseren heutigen Lebensstil dorthin mitgenommen … Lassen Sie sich überraschen von einem ungewöhnlichen Experiment!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Taschenbuchausgabe
1. Auflage 2010
ISBN 978-3-492-96025-0
© 2009 Piper Verlag GmbH, München Erstausgabe: Haffmans Verlag GmbH, München Umschlaggestaltung: Cornelia Niere, München Umschlagabbildung: Gray Jolliffe / Die Illustratoren Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck
Vorwort
Dies ist die Geschichte von Jesus, der ein Sohn von Josef war, der wiederum ein Sohn von Elis war, der seinerseits ein Sohn von Matthat war, der undsoweiter undsoweiter … bis zu Adam, dem ersten Menschen. Die Zeit, in der die Geschichte spielt, hatte es noch nicht so mit den Nachnamen. Sollte euch also einer was von Jesus Leblanc oder Jesus Anzengruber erzählen, vergesst es. Er hat den Falschen. Der Echte ist nur echt ohne Nachnamen. Zwar hängt man hin und wieder ein »von Nazareth« dran, das klingt irgendwie adlig, meint aber nur, dass er aus der Gegend kommt, nicht dass ihm die gehört. Wie zum Beispiel beim Labbadudl aus der Glabbagass.
Damals war das üblich. Usus, wie der Römer sagt, der statthaltend, scheppernd und unbeliebt in der Gegend, der wir uns nun zuwenden, zuhauf und völkerrechtlich nicht ganz hasenrein, sein Unwesen trieb.
Aber zurück zu Jesus und der langen Ahnenlatte: Ist natürlich keine Kunst, von Adam abzustammen, das tun wir alle. Und hier liegt genau der Zaunpfahl im Pfeffer! Jesus ist nämlich einer von uns. So sagt es jedenfalls die sympathische Pfarrerin im Fernsehen mit der fetzigen Claudia-Roth-Frisur immer wieder, sie wird nicht müde, darauf herumzureiten, obwohl das als Gedanke jetzt erstmal nicht so augenfällig naheliegt, denn
1. hat Jesus viel früher gelebt als wir, er ist
2. ein Weltstar, wir nicht, eine Zeit lang war er
3. sogar populärer als die Beatles, und er ist
4. keine Frau, im Gegensatz zur Hälfte von uns.
Allerdings könnte es lustig sein, sich vorzustellen, die sympathische Pfarrerin hätte recht, Jesus wäre so wie wir und seine Geschichte noch heute lesbar, von Bedeutung und lehrreich für uns alle. Das tun wir jetzt mal.
Es fing alles ganz harmlos an. Nämlich so:
1. Buch
Jesus und die Jungs
aus der Nachbarschaft
Josef und Maria haben ein Problem
[MATTH. 1,18–25]
Josefs Braut, Maria, um die er von der halben Stadt beneidet wird, ist zwar eine Klassefrau, aber sie hat auch durchaus hier und da mal eine schwächere Performance. So was begründet sich heute biorhythmisch, morgen anders, man mag das launisch nennen oder sanguinisch, aber man muss es hinnehmen wie Zugverspätung, Regenwetter oder Verwandtenbesuch.
Eines Abends kratzt die Skyline von Nazareth besonders hübsche Zacken aus dem Sonnenuntergang, und Maria fängt an, so irgendwie deutlich, aber doch verhalten herumzudrucksen.
Nun ist Gedrucks und Ratmalwaslosist so ziemlich das Letzte, wonach sich Josef sehnt, er hat es mehr mit Klartext und aufgeräumter Ansage, aber glamouröse Frauen brauchen Pflege, also geht er auf sie ein.
»Was hast du denn, Süße?«
»Ach nichts«, und sie druckst weiter.
Unter Männern wäre das ein Signal gewesen, das Thema zu wechseln oder lieber gleich die Klappe zu halten, aber unter Paaren gilt ein anderer Code, und Josef weiß, dass jetzt Einfühlung gefragt ist. Mit innerem Seufzer stellt er sich also auf eine längere Exploration ein und fragt ihren Scheitel – ihr Gesicht kann er nicht fragen, weil sie auf die Tischplatte starrt – so lange, bis sie endlich nicht mehr »Was soll denn los sein?«, »Wieso denn?« und »Nichts, hab ich doch gesagt« unterm Pony hervormurmelt, sondern herausrückt mit ihrem Problem, allerdings erst, nachdem er versprochen hat, nicht sauer zu sein:
Sie sei nämlich schwanger, aber habe überhaupt nichts gemacht. Ganz bestimmt nicht. Ehrlich nicht.
Drucks.
»Für wie blöd hältst du mich eigentlich?«, schreit Josef und würde sich selbst am liebsten die Ohren zuhalten, so laut ist seine Stimme. Nicht nur, dass er brav auf Papi und Mami gehört hat, die sagten, »So du aber nicht die Pfoten von der Kleinen lässt als bis dass der Trauschein vorliegt, soll dir eine um die andere geschallert werden, bis dass eine gnädige Ohnmacht dich vorübergehend scheidet«; nicht nur, dass Maria ihm offenbar Hörner aufsetzt; nein, sie will ihn auch noch mit so einem Quark abspeisen. Nichts gemacht. Geht’s noch?
»Wer?«, fragt er, so scheinbar cool wie möglich.
»Wie, wer?«, Maria stellt sich naiv.
»Wer war’s?!« Schon ist es wieder vorbei mit der Coolness.
»Echt keiner, wirklich wahr. Ich schwör’s.«
»Haha«, lacht Josef bitter.
»Wieso lachst du?«
»Ich lache nicht. Ich wiederhole die Frage nur nonverbal.«
»Josef, bitte«, Marias Stimme franst schon aus. »Es war ganz wirklich keiner. Wirklich.«
»Schon klar«, sagt Josef müde, »du hältst mich für saublöd, und es war der Heilige Geist. Starke Geschichte. Guter Plan.«
Jetzt ist sie von den Socken. Woher er das wisse?
»Woher weiß ich wa … Wie bitte?« Josef wird schlecht, aber jetzt kann er nicht aufs Klo. »Du wirst mir doch nicht erzählen wollen …?«
»Doch, genau. Der Heilige Geist. Er war’s. Ehrlich.«
Jetzt heult sie natürlich, das ist immer so, erst kommt der Vorschlaghammer, dann die Wutbremse, eine weinende Frau schreit man nicht an. Wohl oder übel muss Josef sein Taschentuch rausrücken. »Da, nimm.«
Jetzt ist er wehrlos, die Diskussion beendet, alles was noch kommen kann, muss tröstend klingen, sonst heißt es »Tilt«, und Maria macht schlapp.
Ganz kann Josef seinen Ärger nicht wegdrücken, aber sein Tonfall klingt nur noch enttäuscht, und er brüllt nicht mehr, er versucht sogar, etwas Ritterliches in seine Stimme zu legen, als er weiterspricht: Da drehe er nichts wie Däumchen und mache den lieben Kuschelheinz, während sein sauberes Fräulein Braut nichts Eiligeres zu tun habe, als nur ja nix anbrennen zu lassen. »Nee Süße. Also wirklich. Nicht mit mir.«
Nun hat er sich doch wieder in Rage geredet. Er haut auf die Tischplatte und steht auf. »Nicht mit mir, Prinzessin. Das Taschentuch will ich gewaschen zurück.«
Ein guter Abgang.
Innerlich kochend vor Wut, aber äußerlich ganz Mann von Stil, brummt er an der Tür noch ein lässiges »Tschau« und lässt sie sitzen. Soll sie sehen, wie sie Alimente kriegt vom Heiligen Geist. Er muss was trinken.
Einen solchen Schluck Schicksal packt auch der stärkste Seemann nicht ohne Kläranlage weg, und er ist doch bloß ein Zimmermann.
Im Verlaufe des anschließenden Zugs durch die Gemeinde muss er entweder was Falsches gegessen haben, aber es waren eigentlich nur zwei salzige Gürkchen und eine Art Falafel, oder die letzten beiden Gläser waren weniger bekömmlich als die ersten elf. Der Heimweg jedenfalls ist navigationstechnisch eine Herausforderung, geht bergauf und bergab, ähnelt mehr einem Labyrinth als der gewohnten Strecke und erweist sich immer wieder als verschlungen und beschwerlich.
Endlich findet er ein Bett, das seinem eigenen ähnelt, und haut sich hinein in voller Montur. Er schläft sofort ein und träumt ein Zeug zusammen, das man grad verfilmen könnte. Leider ist er zu blau, um einfach aufzuwachen. Da muss er durch. Unter anderem träumt er einen Typen, der behauptet, er sei der Heilige Geist.
»Ach nee«, anraunzt ihn Josef, »wenn du ein Duell willst, ich schick dir meinen Sekundanten. Aber nicht vor sechzehn Uhr. Ich muss noch was ausschlafen.«
»Falsch geraten«, gibt sich der Heilige Geist jovial, »ich will mich nicht mit dir schlagen«.
»Ich aber«, trumpft Josef auf.
»Josef, du verstehst mich falsch. Jetzt hör doch mal zu, damit du kapierst, worum es geht.«
Josef lallt sogar im Traum: »Ess gip nichssu kaphieren, ess gip wassu fhrikassieren, und swar dich.«
Der Heilige Geist gibt auf. So hat das keinen Sinn. Zurück im Büro, bittet er einen seiner Engel, die Sache für ihn zu klären.
»Der Typ nervt. Ich komm nicht klar mit dem.«
Als Josef kurz darauf den Engel sieht, glaubt er, schon den Sekundanten vor sich zu haben und knarzt grantig: »Ich hab doch gesagt, sechzehn Uhr.«
»Unsinn«, sagt der Engel, »halt mal den Rand, bis ich fertig bin. Okay?«
»Von mir aus«, raunzt Josef. »Bin eh zu schlapp und zu blau, ich streit mich jetzt nicht rum.«
Geduldig spricht der Engel: »Also hör zu: Du nimmst Maria auf, heiratest sie, bist nett und behandelst sie anständig, kriegst einen Sohn, und der heißt Jesus und wird berühmt. Klar?«
»Kann ich ihn Eddi nennen?«
»Jesus hab ich gesagt, und damit basta! Du kannst einem aber auch auf die Nerven gehen. Der Prophet hat nämlich gesagt: Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, einen Sohn wird sie gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben …«
»Na bitte, und wieso nicht Eddi?«
»… das heißt übersetzt: Gott ist mit uns.«
»Und was krieg ich dafür?«
Josef klingt schon ein bisschen kleinlauter, als wolle er sich doch auf die Sache einlassen. Und schließlich, warum nicht, wenn was dabei rausspringt?
»Du kriegst die Klassefrau und den guten Platz in der Geschichte«, sagt der Engel.
»Das ist alles?«
»Das reicht! Vor allem reicht’s mir jetzt gleich!«
Dem Ton des Engels nach zu urteilen, muss die Sache doch recht offiziell sein, also gibt Josef klein bei. Was soll’s. Das Aushandeln von Verträgen ist keine seiner Stärken.
»Macht doch was ihr wollt. Von mir aus.« Er will seine Ruhe.
Morgens, so gegen vierzehn Uhr, nachdem sich seine Augen an das schmerzende Tageslicht gewöhnt haben, geht Josef mit seinem stoppelbärtigen Katergesicht zu Maria und sagt: »Schwamm drüber, Süße. Ich heirate dich, und der Kleine heißt Jesus.«
»Kann ich ihn nicht Sascha nennen?«
»Jesus hab ich gesagt, und damit basta! Dass du gleich weißt, wo ab jetzt der Hammer hängt. Und noch eins«, fügt er hinzu, »stöpselmäßig läuft nichts, bis der Bengel ausgeschlüpft ist. Kannst dich gleich drauf einstellen.«
»Ach Josef«, seufzt Maria, »du bist doch ein prima Kerl.«
»Wo ist mein Taschentuch?«, bellt er. Sie soll nicht merken, dass ihm das wie Öl runtergeht.
»Hier. Gewaschen und gebügelt, Monogramm hab ich dir auch eins reingestickt.«
Josef knurrt was Unverständliches. Er will sein mürrisches Image nicht gleich wieder loswerden. Aber eins ist klar, die Ehe wird gut laufen, denn der Engel hatte recht: Maria ist eine Klassefrau.
Statistik
[LUK. 2,1–7]
Bei den Römern ist derzeit exaktes Wissen populär. Irgendein Sesselfurzer im statistischen Büro hatte Langeweile und redete seinem Kaiser Augustus ein, dass man das Volk im ganzen Imperium zählen müsse. Dann habe er, der Sesselfurzer, für die nächsten Jahre was zu rechnen und der Kaiser das ganze verstreute Gesindel besser im Griff. Da Augustus auch gerade Langeweile hatte, fand er diesen Vorschlag phänomenal, und jetzt muss Josef mit seiner Familie in die Vaterstadt Bethlehem latschen, sich vor einen Schreibtisch stellen und sagen: »Ich bin ein Mensch«. Dann trägt der Römer die Zahl eins ein und damit hat sich’s. Genial. Gegen Langeweile. Und Maria ist hochschwanger.
Die Reise ist beschwerlich, nur gelegentlich nimmt mal ein Eselskarren das trampende Paar für eine kurze Strecke mit. Bei Bethlehem setzen die Wehen ein. Sie schaffen es noch bis zur Stadt, und dort haben sie Glück, denn ein freundlicher Bauer lässt sich breitschlagen und offeriert seinen Stall als Unterkunft.
Gerade noch rechtzeitig.
Rechts steht eine Kuh, links ein Esel, und beide verzichten für eine Weile auf ihre Tischmanieren, denn in der Mitte liegt das Baby und strampelt und gluckst und freut sich zu leben. In der Krippe, in der normalerweise das Abendessen serviert wird.
Und das Kind heißt Jesus. Und nicht Sascha.
Besuch
[LUK. 2,8–20]
Hirten lungern den ganzen Tag draußen herum, und es ist bekannt, dass sie sich aus lauter Langeweile ein experimentelles Essverhalten angewöhnt haben. Sie probieren ein hier gezupftes Beerchen, ein dort gerupftes Pilzchen und ein anderswo vom Strunk geknicktes Knöspchen für den Fall, dass die Hirse mal knapp wird und man Alternativen braucht. Wenn es giftig war, dann kostet es mal einen Hirten hier und da, aber das ist der Preis für ein Leben als Avantgarde. Meistens ist es nicht giftig. Manchmal ist es sogar wirklich interessant, und das Knöspchen oder Pilzchen bietet gewisse Vorteile visionstechnischer Art, deshalb ist der Hirtenberuf auch recht beliebt. Erstens kommt man leicht an den Stoff, und zweitens schaut einem kein Römerbulle von der Drogenfahndung auf die Finger. Oder in den Kochtopf.
Bei den Hirten, die sich in der Nähe des Stalls gerade zu einer zwanglosen kleinen Einwerfung versammelt haben, schmurgelt zum Beispiel ein außerordentlich pompöser Pilz in der Pfanne. Beziehungsweise der Rest davon. Der größte Teil des Pilzes ist nämlich schon in den Mägen und schickt verwegene Impulse durch die Blutbahn in Richtung Hirnrinde. Es ist ein sogenannter Kinopilz. Man sieht Filme, wenn man ihn verzehrt.
Die Hirten sind schon mitten in einem groß angelegten Kostümepos. Da singen Engel und tanzen und behaupten, der Messias sei geboren. Er sei in Windeln gewickelt, läge gleich hier nebenan in einer Krippe, und wer’s nicht glaube, solle halt mal gucken gehen. Der Film ist phantastisch ausgeleuchtet, die Musik mit allen Schikanen produziert, und wenn er nicht so abrupt aufgehört hätte, wären die Hirten nie auf die Idee gekommen, mal nachzusehen, ob die Botschaft stimmt.
In bester Pilzlaune rumpeln sie hintereinander in den Stall, verstummen aber sofort, als da tatsächlich ein Kind liegt. Sie müssen den Pilz verwechselt haben. Das war kein Kinopilz, sondern ein Wahrheitspilz. Die sind so selten, dass man’s gar nicht glaubt, wenn man einen hat.
Die Hirten fallen auf die Knie, sagen: »Schön, dass du da bist, Messias«, und entschuldigen sich für die späte Störung. Und dann sagen sie es weiter, denn Geschichten über Pilze sind in Hirtenkreisen sehr beliebt, und das Finden eines Wahrheitspilzes ist in etwa so ein Hammer wie der Abschuss eines Wolpertingers. Oder Einhorns.
Die ersten Fans
[MATTH. 2,1–12]
König Herodes macht seinen täglichen Verdauungsspaziergang. Er ist keineswegs bester Laune, denn es stinkt in der Hauptstadt! Nach allerlei totem Viehzeug, nach billigen Gewürzen, Kloake und armer Leute Schweiß. Unangenehm.
Lieber würde er im Palasthof lustwandeln, wenn schon lustgewandelt sein muss. Da ist er sowieso kein Freund von. Aber die Public-Relations-Berater finden, er müsse täglich unters Volk, das käme gut an. Und wenn er es bloß tue, damit die Leute sehen, dass er keine Angst vor ihnen hat.
»Und was ist, wenn sie mich dumm anquatschen?«, hat er gefragt. »Was ist, wenn sie schreien: König hier, König da, zu viel Steuern, zu wenig Spaß und so weiter. Was mach ich dann?«
»Die quatschen dich schon nicht an«, sagten die PR-Leute. »Die glotzen ein bisschen, mehr nicht.«
Damit hatten sie recht. Man lässt ihn in Ruhe. Normalerweise. Aber heute ist leider der Wurm drin. Daran, dass nämlich ahnungslose Touristen, die ihn, Herodes, einfach nicht kennen, nach Jerusalem kommen könnten, haben die hoch bezahlten Werbefritzen leider nicht gedacht. Und heute scheint genau die Sorte gleich massenweise angekommen zu sein. Und alle wollen was von ihm.
Gerade jetzt stellt sich schon wieder so einer vor ihm auf. Der kommt aus dem Osten, das sieht man an der Kleidung. Das ist nun schon der Dritte. Und immer dieselbe Frage. »Kannst du mir sagen, wo es zum neuen König der Juden geht? Ich will ein Autogramm von ihm.« Herodes lässt den zudringlichen Kerl einfach stehen.
Den Ersten hat er noch gefragt, ob er wisse, wen er vor sich habe, der Zweite bekam eins auf die Nase, aber jetzt hat Herodes den Blödsinn satt. Wütend stürmt er an den Palastwachen vorbei und schreit: »Hohepriester und Schriftgelehrte zu mir, aber so eilig wie geschwind, wenn ich bitten darf!« Dann setzt er sich auf seinen Thron.
In der Stadt kommt Hektik auf. Die einen tuscheln miteinander – hast du das mitgekriegt? Der König ist angemacht worden. Echt? Ja, Touristen! –, die anderen gehen noch mal schnell mit der Bürste durch den Schnurrbart und schnipsen eine Schuppe von den Schultern, weil sie gleich zum König müssen. Sie sind Hohepriester und Schriftgelehrte.
Die Honoratioren haben es nicht leicht, sich einen Weg durch die tratschende Menge zu bahnen. Da helfen auch die Plaketten »Hohepriester im Einsatz« nichts, denn keiner achtet darauf. Sie haben natürlich Angst, zu spät zu kommen. Herodes ist als ziemlicher Ungustl bekannt.
Als alle da sind, ergreift er das Wort: »Hört mal her, meine Herrn. Auf offener Straße blöken mich Ausländer an, es gäbe einen neuen König der Juden, und a) weiß ich nichts davon, b) find ich’s nicht so toll und hätte deshalb c) gern einen Tipp von euch Geistesgrößen, was der Scheiß eigentlich soll. Ist vielleicht Fasching oder was?!!! Ihr seid doch sonst so schlau!«
»Das sind Sterndeuter«, sagt einer der Priester. »Ach was!«, brüllt Herodes schon wieder. »Noch auf dem letzten Symposium tönte es doch massiv aus euren Reihen, dieses Sterngedeute sei eine Mode wie jede andere auch und gehe vorbei in einem Zeitraum nicht länger, als eine Geiß für einen Pups benötige.«
Noch kleinlauter als eben antwortet der Hohepriester: »Ja schon, aber jetzt sind wir die Angeschmierten. In den Sternen steht die Neuigkeit, und die Doofen sind wir, weil wir den Anschluss verpasst haben. So ist es nun mal.«
Der Priester gehörte zu den Befürwortern des Sterndeutens auf dem Symposium und freut sich jetzt heimlich, dass die Gegner eine Flappe ziehen.
»Lasst mich bloß zufrieden mit eurem Wissenschaftlergedöns«, sagt Herodes, »ich hab auch noch was anderes zu tun.« Er klopft ungehalten mit den Fingerknöcheln auf die Armlehne seines Throns. »Klartext bitte, meine Herrn. Was ist das für ein Schmarrn mit diesem Zweitkönig?«
»Also der Prophet sagt …«, meldet sich ein Schriftgelehrter zu Wort.
»Hört, hört, der Propheeet«, unterbricht ihn sein erbittertster Gegner. »Du meinst, dein Kaffeesatz hat sich wieder mal gemeldet oder eine Portion Hühnergedärm hat was auf deinen Anrufbeantworter gesprochen, hä?«
»Ruhe!«, schreit Herodes, »Jetzt reicht’s mir aber! Was ist denn das für ein Kindergarten hier! Lass ihn gefälligst ausreden. Was sagt der Prophet?«
Stolz, dass ihn der König vor seinem Widersacher beschützt, referiert der Schriftgelehrte: »Also das ist so. Dieser Messias oder so soll in Bethlehem in Judäa geboren werden. Ich zitiere …« Und er holt eine Kladde vor, aus der ihm erst mal prompt ein paar Blätter zu Boden fallen. Dann hat er endlich die richtige Seite gefunden. So würdevoll es geht, liest er vor: »Und du, Bethlehem im jüdischen Lande, bist mitnichten die kleinste unter den Städten in Juda; denn aus dir soll mir kommen der Herzog, der über mein Volk Israel ein Herr sei.«
»Das ist doch Lyrik«, schreit der Querkopf von eben, »und keine exakte Wissenschaft!«
»Lass gut sein«, spricht Herodes ein Machtwort, »das Thema kannst du in etwa zweitausend Jahren totreiten. Deine Uhr geht ein bisschen vor.« Dann schmeißt er die Streithammel raus.
Er schickt seine Leibwächter los, die Touristen herzuschaffen. Wenn das Sterndeuter sind, denkt er, dann hab ich ein paar Fragen.
Tatsächlich werden die drei Herren nach kurzer Zeit nur wenig beschädigt bei Hofe abgeliefert, und Herodes kann ihnen in aller Ruhe Löcher in den Bauch fragen.
Sie staunen nicht schlecht, dass er der König von dieser Gegend ist, und finden ihn eigentlich ganz nett.
Nach einem launigen Plausch entlässt er die drei mit der Bitte, doch auf dem Rückweg noch mal reinzuschauen und ihm die Adresse des neuen Königs zu geben. Er wolle ihm gelegentlich dann alles zeigen. Den Palast und so, und wie der Laden so läuft. Das Regieren sei ja auch ein Lehrberuf, und man könne nicht früh genug anfangen, sich mit den Gegebenheiten vertraut zu machen. Und so.
Das leuchtet den dreien ein, und sie sagen: »Wird gemacht.« Sie fühlen sich doch auch ein bisschen geehrt. Sie gehen los. Tagelang immer dem Stern hinterher, bis er nicht mehr wackelt. »Ist schon ein irres Gefühl«, sagen sie. »Kommt gut.« Sie meinen den Stern und alles. Der steht jetzt nämlich direkt auf dem Giebel eines Hauses, als wäre er die Verzierung.
Ende der Leseprobe