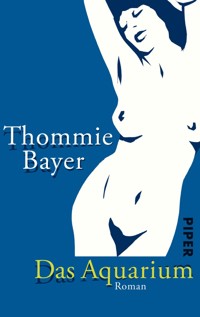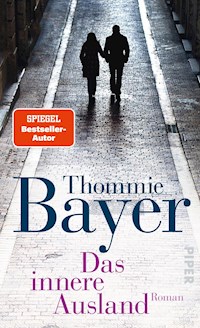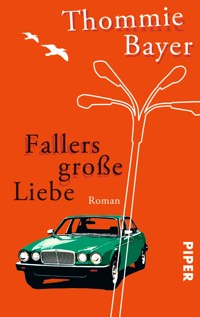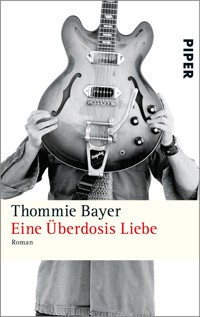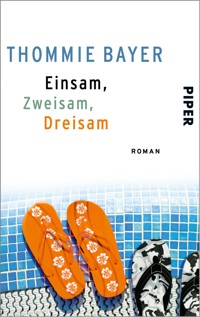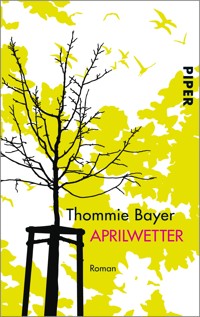
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Daniel, Benno und Christine – drei Liebende, ein Betrogener, die klassische Situation. Thommie Bayer erzählt sie auf grandiose, mitreißende Weise neu und erfindet dabei einen Helden, der in seiner Selbstlosigkeit ebenso berührend wie unzeitgemäß ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für Jone
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Taschenbuchausgabe
1. Auflage April 2010
© Piper Verlag GmbH, München 2010
Umschlaggestaltung: semper smile, München
Umschlagabbildungen: Mikio Kato, Tokio (Hintergrund) und Neubauwelt (Baum)
Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck
ISBN 978-3-492-95102-9
»He’s a walking contradiction, partly truth and partly
fiction, taking every wrong direction on his
lonely way back home.«
Kris Kristofferson
Hier ist alles, was er braucht. Hier weiß Benno, wer er ist. Von neun Uhr morgens bis abends um sechs steht er hinter der Theke und macht Espresso, Cappuccino und Milchkaffee. Mehr als Gruß und Lächeln wird hier nicht von ihm erwartet; für den Text der Unterhaltung sorgen alle lieber selbst. Sie sind mit sich beschäftigt, ihren Plänen, ihren Wunden, ihrer Einsamkeit. Der sich die meisten just entronnen glauben, hierher in den Rauch und Kaffeeduft, das Stimmengewirr und Klappern von Geschirr, zu den anderen, zu ihm, ins La Storia.
Sie fühlen sich unter Gleichen, aber auch wenn die Gemeinsamkeiten überwiegen – alle schlafen, essen, sehnen sich und werden sterben –, ist doch das, was sie trennt, von Gewicht: ihr Bild von der Welt. Bei Günther Jauch würde sich jeder woanders geschlagen geben. Der eine hat noch nie von Montessori gehört, die andere nicht von Eichmann, der dritte hält eine Synapse für etwas aus der Bibel, und die vierte Willy Brandt für einen Schauspieler. Natürlich kennen sie alle Einstein, Hitler und Lady Di, vielleicht auch Gandhi, Bob Dylan und Mao, aber das hilft ihrer Orientierung in der Welt und Geschichte etwa so viel, als glaube man Deutschland zu kennen, wenn man in Hamburg war.
Benno mag seine Gäste. Er hält sich nicht für etwas Besseres, nur weil er weiß, dass jeder in seiner eigenen Provinz lebt, die ihm Mittelpunkt der Welt ist, und er sich darin selbst kein Rätsel, sondern Teil einer Ordnung, eine Sonne, umgeben von Planeten.
—
Das La Storia ist zwar klein, eine klassische italienische Kaffeebar mit fünf Stehtischen und einer Theke auf vierzig Quadratmetern, liegt jedoch sehr gut, am Weg von der Uni zur Stadtmitte, und entwickelt sich zur Goldgrube, weil Benno sie mit nur zwei Leuten betreibt, die Miete überschaubar ist und sein Kaffee einen gewissen Ruf hat. Er bezieht ihn von einer kleinen Rösterei im Schwarzwald, zwar teurer als die großen Marken, dennoch lohnt es sich. Er hat keine Angst vor Starbucks oder Lavazza und Co. Es scheint sogar, als hätten die Angst vor ihm, denn noch ist keiner aufgetaucht. Hier, in dieser überschaubaren Stadt mit ihrem gemächlichem Tempo ist Benno Krantz der Platzhirsch. Seit nunmehr bald zwei Jahren.
Das verdankt er nicht nur seinem Charme, Geschick und Fleiß, sondern vor allem Daniel, der ihn in Nashville aus dem Alkohol- und Muckersumpf gezogen und in diese stille Ecke seiner Heimatstadt verpflanzt hat.
—
Damals besaß Benno nicht viel mehr als ein paar Kleidungsstücke, Radio, Toaster, Dieselgenerator, eine Gitarre, die 59er Fender Stratocaster, die er schon seit Jahren spielte, und den Camper, in dem er wohnte, der ihn sechshundert Dollar gekostet hatte und sich nicht mehr vom Fleck rührte – den Motor hatte irgendwer schon ausgebaut, bevor Benno so naiv gewesen war, das ehemals silbern glänzende, nun aber nur noch grau-rostige Exvehikel zu kaufen, so schief, wie es da auf einem platten und drei mit Restluft verschieden vollen Reifen stand.
Er spielte viermal die Woche in der Hausband der Carson Lounge, eines leidlich frequentierten Countryschuppens, der auf Open-Stage-Abende spezialisiert war. Die Band begleitete Nachwuchstalente und hin und wieder einen hereingeschneiten Star, der sich überreden ließ, einen seiner Hits zu singen.
Um diesen Job nicht auch noch zu verlieren, beherzigte Benno eine eiserne Regel: kein Drink vor zwölf. Er half sich mit Mineralwasser und kaltem Tee, bis der Barkeeper die letzte Bestellung ausrief, erst dann gab er sich den ersten, zweiten und dritten Bourbon und erst zu Hause in seinem Schrottmobil auf dem Trailerpark die Kante. Wenn er nicht gerade die Nacht mit einer Nachwuchssängerin verbrachte, was hin und wieder drin war, denn solange sie ihn nicht trinken sahen, fanden ihn die Frauen interessant.
—
Es war kurz vor halb elf, ein ganz normaler Abend, zur Hälfte schon überstanden, nach zwei leidlich talentierten Nobodys und einem Garth-Brooks-Klon, den man von der Bühne gepfiffen hatte, obwohl das Publikum an diesem Tag überwiegend aus Touristen mit Karohemden und Basecaps bestand, die normalerweise alles bejubeln, weil die Carson Lounge im Preis ihres Busausflugs inbegriffen ist. Aber Pseudogarth konnte weder singen, noch stand ihm die Arroganz, die er an den Tag legte, in irgendeiner Weise zu. Er selbst hielt sein Benehmen augenscheinlich für Humor, vielleicht sogar für Selbstironie, aber das Publikum wusste es besser und erkannte in ihm den Trottel, der sich in seinen Möglichkeiten täuscht.
Danach kam eine junge Frau auf die Bühne, ein unscheinbares Mädchen mit Mausaugen und Kurzhaarschnitt, und bat die Band, Red Dirt Girl von Emmylou Harris in E-Dur zu spielen. Und sie brauchte nur ein paar Takte, bis sogar der Barkeeper sein Geschirrtuch über die Schulter warf, sich mit beiden Händen an der Theke abstützte, jedes Geräusch vermied und zuhörte. Die Kneipe war zum Konzertsaal geworden, das Publikum gefesselt, und Benno wusste für einen Augenblick wieder, wozu er auf der Welt war.
Er konnte, wenn er wollte, die Sänger so unterstützen, dass sie über sich hinauswuchsen. Wenn ihm danach war, wenn der Musikant in ihm erwachte, verabreichte er dem Nobody vor sich eine Selbstvertrauensinfusion, dass der sich fühlte, als schwebe er über allem und träume den schönsten ersehnlichen Traum: vom Einssein des Sängers mit dem Publikum, der Band, der Musik, dem Augenblick. Benno spielte dann so, dass er einerseits die Stellen ausfüllte, an denen der Sänger im rhythmischen Netz allein bliebe, und andererseits so, dass er zweite und dritte Stimmen zu hören glaubte, wo er fürchten konnte, dünn zu klingen.
Nick, der Pedal-Steel-Player, stieg immer mit ein, wenn Benno auf Qualitätsmusik umschaltete, und Tyler, Dave, Warren und Stephen grinsten vor sich hin, gaben Bass, Drums, Acoustic und Fiddle dieses Milligramm mehr Druck und Seele, mit dem man den Dienst nach Vorschrift hinter sich lässt und spielt, als käme es drauf an. So machten sie gelegentlich aus mittelmäßigen gute Sänger und aus guten Sängern Stars. Wenn auch nur für diesen Abend. Draußen in der richtigen Welt kam es dann wieder auf mehr und anderes an, als sie dazu tun konnten.
Für dieses Mädchen machten sie die Schachtel auf. Sie gaben ihr alles, was sie brauchte, um sich ganz vom Gefühl in diesem Song tragen zu lassen. Bei der Zeile »I was standing there with her when the telegram come – For Lillian« weinte sie, aber ohne dass ihre Stimme brach. Ihr liefen nur zwei, drei Tränen übers Gesicht. Und sie war glücklich in diesem Moment.
Der letzte Akkord verklang. Das Mädchen stand mit gesenktem Kopf, die Hand ums Mikrofon gelegt, und war in sich selbst, den Raum, den Moment und die Erinnerung an das eben Gesungene versunken. Benno lauschte dieser speziellen Stille, die sich erst nach Sekunden in frenetischem Applaus mit Trampeln und Johlen auflösen würde, dem Lärm, der die Geister der Ergriffenheit verscheuchen sollte.
Aber jemand hatte eine bessere Idee: Ein lautes Furz geräusch, wie es entsteht, wenn man den Handrücken an den Mund legt und bläst, zerstörte alles, was der Moment enthielt, das Mädchen erschrak, wurde rot vor Scham, und ihr Blick suchte den Raum nach Fluchtwegen ab. Die Köpfe drehten sich nach dem Störenfried um – es war Pseudogarth, der es nicht ertrug, seine eigene Niederlage durch den Triumph dieses Mädchens ins Groteske gesteigert zu sehen. Er hob sein Bierglas, prostete den empörten und verachtungsvollen Blicken zu und schien zufrieden, sich für den Augenblick als Provokateur neu erfunden zu haben.
Das alles geschah innerhalb weniger Sekunden, und länger brauchte Benno nicht, um den Gitarrengurt zu lösen, seine Strat an den Verstärker zu lehnen und von der Bühne zu hechten, um das Furzgesicht brachialkosmetisch zu behandeln – dieser Ausdruck überheblicher Genugtuung verlangte eine Korrektur. Er stieß zwei Stühle um, sah, wie der Kerl begriff, dass ihm das, was da auf ihn zuschoss, schlecht bekommen würde, aufsprang und zum Ausgang flüchtete – Benno setzte ihm nach, blind und taub vor Zorn, er wollte den Kerl bluten sehen. Da stellte sich ihm jemand in den Weg: Daniel.
Erst jetzt kam zögerlicher Applaus auf, vereinzelt und schüchtern, jeder schämte sich für diese miese Einlage, man wollte die Sängerin trösten und die peinliche Fast-Schlägerei vergessen machen und hatte nichts anderes parat, als lahmes Klatschen und verlegene Bravorufe. Inzwischen saß die junge Frau am Bühnenrand und weinte.
»Was machst du denn hier?«, sagte Benno und ließ Daniel stehen, ging zur Bühne zurück, setzte sich neben die Weinende, legte seinen Arm um sie und versprach ihr, der Tag sei nicht mehr fern, an dem Leute wie dieser Niemand vor ihr im Staub lägen. Dann solle sie kräftig zutreten. Ihre Tränen machten ihn ratlos, und er hätte alles getan, damit sie versiegten, aber die Frau schluchzte lauter, und ihm blieb nichts, als sie an seine Schulter zu drücken und sich ausweinen zu lassen. Es gab keine Garderobe, sie war den Blicken ausgeliefert, vor denen er sie nicht beschützen konnte.
Daniel kam heran und setzte sich auf den Bühnenrand. »Du spielst toll«, sagte er.
Benno schwieg.
Vor ihnen stand der Barkeeper, einen Whisky in der Hand, den er der Sängerin lächelnd hinstreckte: »You’ re fantastic«, sagte er, »I’m sorry for the moron. Just forget about him. Please.« Er warf einen kurzen, skeptischen Blick auf Benno, dessen Jagd auf den Störer ihm nicht gefallen zu haben schien, aber jetzt war nicht der Moment, ihn deswegen anzuraunzen, denn das Mädchen wischte sich die Tränen mit dem Ärmel ab und nahm den Whisky. Sie lächelte und trank einen Schluck.
»Tut mir leid«, sagte sie, »das war ja wohl die Katastrophe.«
Zuerst begriff Benno nicht, dass dieser deutsche Satz aus ihrem Mund gekommen sein musste – er hatte eben noch selbstverständlich englisch mit ihr geredet, aber dann wurde ihm klar, dass sie mit Daniel gesprochen hatte. Der lächelte, setzte sich um, weg von Benno, an ihre Seite, und nahm sie in den Arm.
»Nur die Wildsau«, sagte er, »und vielleicht auch noch die Jagd. Aber dein Auftritt war toll.«
»Danke«, sagte sie zu Daniel und lächelte Benno an. Sie war ungeschminkt, die Tränen hatten ihr Gesicht weicher und durchscheinender werden lassen, ohne Verwüstungen darin anzurichten.
Daniel stellte vor: »Meike, das ist Benno. Wir haben uns zwölf Jahre nicht gesehen. Und jetzt rockt er hier den Laden.«
»Das war sie«, sagte Benno. »Hallo, Meike.«
Er musste sich beherrschen, um nicht nach dem Whisky zu greifen, den sie neben sich gestellt und offenbar vergessen hatte.
Hinter ihnen begann Warren, seine Zwölfsaitige nachzustimmen, es wurde Zeit für den nächsten Set. Die Pausen waren immer kurz, da sie nur zum Pinkeln oder Rauchen eingelegt wurden.
»Ich muss wieder mucken«, sagte Benno, »seh ich euch noch?«
Er tat, als wohne Daniel um die Ecke und schneie jeden dritten Tag herein. Und hätte doch nie damit gerechnet, ihn jemals wiederzusehen.
»Ich bring Meike nach Hause«, sagte Daniel nach einem schnellen Blick zu ihr, »sie muss telefonieren. Dann komm ich wieder. Hau nicht ab.«
»Wir spielen bis zwölf.« Benno griff nach seiner Strat. Nick war schon mitten im Vorspiel von Tennessee Waltz, und Benno musste sich beeilen, sein Plektrum zwischen die Finger zu kriegen. Den Spaß machte sich Nick immer wieder. Und Benno verpasste den Einsatz nie.
Zum Glück hatte Meike ihren Whisky mitgenommen – er hätte es nicht ausgehalten, zwanzig Minuten lang draufzustarren, ohne doch noch danach zu greifen.
—
Die Musiker konnten gehen, ohne abzubauen, es war ein Dienstag. Nur donnerstagnachts musste die Bühne leer sein, weil freitags und samstags die Gastspiele gebucht waren, mit denen der Club sein Geld verdiente. Montag bis Donnerstag brachte mit den Open-Stage-Veranstaltungen nur eben so die Unkosten ein. Benno legte seine Gitarre in den Koffer, die ließ er niemals zurück, der Laden konnte abbrennen. Und alles durfte passieren – vielleicht war ihm schon alles passiert –, nur diese Gitarre durfte nicht verloren gehen. Er ließ sie nicht mal im Camper liegen, wenn er am Wochenende unterwegs war – er gab sie dann immer dem Platzmanager zur Verwahrung. Der hatte ein solides Haus.
Als Daniel endlich kam, stand Benno vor der Tür und spürte langsam Ärger in sich aufsteigen, er hatte noch keinen Schluck getrunken und zudem war es kühl. In seinem Gemüt kam Aprilwetter auf, wenn sich der erste Drink zu lang hinauszog, er konnte dann ebenso jäh entzückt wie sarkastisch werden. Derartige Ausreißer jedoch, wie seine Jagd auf das Furzgesicht, kannte er bislang nicht von sich. Das war eine neue Steigerung seiner Entzugsradikalität.
»Hab mich verfranst«, sagte Daniel, »entschuldige.«
»Geht noch«, sagte Benno versöhnlich.
»Trinken wir was?«
»Unbedingt.«
—
Er nahm zuerst einen Whisky und später zwei Bier in der Bar von Daniels Hotel, es fiel ihm erstaunlich leicht, so zu tun, als risse der Durst ihn nicht von innen auf, er trank langsam und schob einen Espresso dazwischen, um den Stoff wenigstens schnell durch die Blutbahn zu jagen. Daniel merkte nichts. Hab ich’s also noch im Griff, dachte Benno, gut so. Ich bin sowieso nicht der Typ, dem die Hände zittern. Bei mir tobts eher innerlich. Daniel redete.
Das Mädchen sei die Tochter eines Bekannten, der ihn gebeten habe, sie sich mal anzuhören, wenn er in Nashville sei. »Sie träumt von Musik«, sagte er, »aber sie macht hier die Korrespondenz für eine Softwarefirma.«
»Sie ist gut«, sagte Benno.
»Und du erst.« Daniel trank einen Schluck. »Geht mir kalt und heiß den Rücken runter. Man müsste in Tränen ausbrechen beim Zuhören.«
»Bist du aber nicht, oder?«
»Nein. Doch. Innerlich.«
»Danke.«
Obwohl er den Blick nicht von der leeren Sitzgruppe wandte, die er schon seit Minuten studierte, als müsse er sie morgen in einer Prüfung zeichnen, spürte Benno, dass Daniel ihn ansah. Er ließ es zu, sagte nichts, störte nicht bei der Bestandsaufnahme. Er wusste in etwa, was Daniel sehen würde: ein hageres Gesicht, glatt rasiert, kurze Haare, die sehnige Gestalt eines Mannes, der nicht mehr jung ist. Benno hatte sich in den letzten Jahren zu einer Edward-Hopper-Figur entwickelt. Gott sei Dank war er schlank geblieben, da er normalerweise die Finger von Bier und Wein ließ.
»Machst du’s noch gern?«, fragte Daniel irgendwann.
»Musik?«
»Ja.«
»Nein.« Jetzt wandte Benno den Kopf und sah Daniel vorsichtig, fast schüchtern lächeln.
»Ich hab ’n Vorschlag. Wenn’s dich anmacht.«
Er habe sein Elternhaus geerbt, erzählte Daniel, und wolle im Erdgeschoss ein Café aufmachen. Und da er inzwischen weit weg, nämlich in Berlin lebe, könne er sich nicht um die Mieter der Wohnungen kümmern. Er wolle Benno das Café einrichten und im ersten Jahr mietfrei überlassen, dafür solle der ihm die Hausverwaltung abnehmen. Sonst müsse er jemanden dafür engagieren, und das wolle er nicht, oder immer wieder von Berlin herfliegen, und das würde teuer und lästig und lohne sich nicht.
Benno tat so, als überlege er, dabei war ihm sofort klar, dass dieses Angebot ihn retten konnte. Es war die Chance zum Absprung vom absteigenden Ast. Er wollte nach dem Bierglas greifen, aber stoppte die Bewegung. Wieso er das tat, wusste er nicht, aber in diesem Moment stand fest, dass Schluss sein musste mit dem Saufen. Keinen Tropfen mehr.
»Du müsstest mir das Geld für den Flug leihen«, sagte Benno zur Theke. Daniel sollte nicht sehen, wie sehr er sich freute.
»Wann kannst du hier weg?«
»Morgen. Jetzt gleich. Mir egal.«
—
Am nächsten Nachmittag saß er im Flugzeug nach Cincinnati und ein paar Stunden später im nächsten nach Frankfurt. Ohne schlechtes Gewissen, dass er die Band hängen ließ – mussten Nick und Stephen eben ein paar Tage lang ein bisschen mehr arbeiten, um die fehlende E-Gitarre zu kompensieren. Spätestens nächste Woche hätten sie einen neuen Mann gefunden. In der Stadt standen die Musiker Schlange, und wenn sie ihn eine Weile vermissen würden, weil der Neue nicht so gut war, na und?
Auch Joseph, der Barkeeper und Geschäftsführer der Lounge würde fluchen und Benno einen Bastard nennen, weil er ihm noch zweihundert Dollar schuldete – ebenfalls na und. Er konnte das verkraften. Das übliche Publikum sollte eigentlich nichts vermissen, die kannten den Unterschied nicht zwischen guter und sehr guter Musik, nur der eine oder andere Nobody mochte sich wundern, dass er nun auf einmal doch wieder nichts Besonderes war, und auf die Idee kommen, es fehle der Schutzengel im Hintergrund. Nicht Bennos Problem.
Er hatte Daniel nichts gefragt. Nicht, ob er mit Christine zusammen war, nicht, ob er noch Musik machte, ob er Kinder hatte, was er in Nashville tat, nichts. Er hatte das Dollarbündel genommen, das Daniel am nächsten Morgen bei American Express besorgt hatte, sich erklären lassen, wo er den Schlüssel zu seiner kleinen Zweizimmerwohnung abholen sollte, und nicht mal Danke gesagt dafür, dass Daniel ihn aus der Sackgasse gelotst und ihm ein neues Leben angeboten hatte. Ein andermal. Irgendwann.
—
Aus dem Fenster sah er die Lichter einer Insel im Atlantik, vielleicht schon die Hebriden oder Irland, vielleicht auch erst Neufundland, er hatte geschlafen und kein Zeitgefühl mehr, auf den Monitoren lief ein Film, die ersten Entzugserscheinungen machten sich bemerkbar, kalte Hände, heißer Kopf und ein Muskelzucken unterm Schlüsselbein links, aber er nahm es hin, wie man Regenwetter hinnimmt, weil er wusste, dass er sich nicht die Stirn an der Wand blutig schlagen würde oder weiße Mäuse sehen oder Amok laufen. Er würde das überstehen. Er konnte nur eine Zeit lang nicht für seine Manieren garantieren. Woher er das wusste, wieso er sich dessen so sicher war, hätte er nicht erklären können. Er wusste es eben.
Und ihm war auf einmal klar, dass er nie wieder auf einer Bühne stehen wollte. Dieser Gedanke war aufregend, fühlte sich an wie ein Versprechen für die Zukunft, ein Angebot, endlich zu leben wie ein Mensch, nicht wie diese seltsame, eulenhafte, engelhafte, geisterhafte Art von Wesen, die sich für ein paar Stunden in der Nacht mit dem Publikum verbündet, um sich entweder, wenn die Musik nicht wirklich gut ist, zu schämen, zumindest der Peinlichkeit des Augenblicks bewusst zu sein, oder sich, wenn alles stimmt, aufzulösen in ein Mischwesen aus Zuhörern, Musikern, Seele, Schwingung, Tönen, was auch immer, ein Irgendwas, das keine Grenzen kennt. Wenn die Musik nichts taugt, ist sie der Mühe nicht wert, und wenn sie was taugt, ist der Unterschied zum richtigen Leben, dem Rest des Tages, den man trotzdem irgendwie herumbringt, zu groß.
Vielleicht war er inzwischen alt genug, um zu wissen, dass das Leben kein Rausch sein kann, oder auch, dass ein Rausch nicht ohne Kater zu haben ist, und dass der Gedanke »Ich fliege und brauche Kerosin«, mit dem er oft den ersten Stoff des Tages eingefüllt hatte, so wahr wie dumm gewesen war. Und dass er das nicht mehr wollte. Und dass er Daniel dankbar war.
—
Nach der Landung in Frankfurt fand er Deutschland verändert. Zwölf Jahre war er nicht mehr hier gewesen. Alles schien schneller, lauter und nervöser, die Frauen geschminkt und kokett inszeniert, die Männer mit Stirnglatzen, Halbglatzen, fingergliedkurzen Haaren und Anzügen, die ihnen zu eng am Leib spannten, oder Jacken, die irgendwie sportlich wirken sollten, als gäbe es nur noch Banker und Trainer, das Geld war nicht mehr dasselbe, in den Auslagen mit Zeitschriften erkannte er nur wenige Titel wieder, der Bahnhof am Flughafen war eine Raumstation, und der Hightechzug, in den er stieg, um ein Vielfaches komfortabler und eleganter als das eben verlassene Flugzeug.
Er kam sich vor wie ein Westernheld, der aus der einen Fremde kommt und in der nächsten Fremde verweilt, um den Job zu tun, nach dessen Erledigung er in eine neue Fremde ziehen wird.
—
Das war falsch. Er hatte nach Hause gefunden. Dieser Ort, La Storia, mit seiner konzentrischen Betriebsamkeit und dennoch behäbigen Konstanz ist das Richtige für ihn. Niemand erwartet was von ihm, glaubt ihn zu kennen oder fragt sich, was mit ihm los sei. Er ist der, der er sein will. Der Mann, der Kaffee ausschenkt. Alle, die ihn von früher hätten kennen können, sind längst weitergezogen oder haben ein Bild von ihm in Erinnerung behalten mit Bart und langem Haar, dem er nicht mehr ähnelt, er fügt sich ein, gehört zum Stadtbild und hat seine Ruhe. La Storia ist die Höhle, in der er sich zum Winterschlaf seines restlichen Lebens niedergelassen hat.
—
Heute ist einer dieser Tage, an denen nicht mal der Milchschaum gelingt. Benno weiß das jetzt schon, obwohl die Maschine erst aufwärmt. Er riecht diese Tage – sie haben etwas Staubiges, Elektrisches und Metallisches an sich, das ihn, schon wenn er die Tür aufschließt, stört und bis in die Nacht verfolgen wird.
Viel mehr noch aber stört ihn, dass er putzen muss, weil kurz vor sieben Frau Wernke angerufen hat, sie könne nicht, ihr Kind sei krank. Hätte sie ihm das gestern Abend gesagt, kein Problem, aber so musste er sofort aus dem Bett und hetzen, anstatt wie sonst allmorgendlich beim Bäcker Croissants, Baguette und Toastbrot zu holen, oben in der Wohnung die Sandwiches und Tramezzini herzurichten, um dann entspannt gegen halb neun unten aufzuschließen, die Maschine anzustellen, alles nachzufüllen, Zucker, Süßstoff, Streichholzbriefchen, die Tageszeitung mit Heftklammern vor dem Zerfleddern zu schützen und auf die ersten gähnenden Gäste zu warten.
Benno hasst das Putzen. Vor allem in den Toiletten. Natürlich hat Frau Wernke letzte Nacht nur zu viel getankt und kam deshalb nicht aus den Federn. Er hat ein Auge für die Sorte. Und erkennt den Sound einer verkaterten Stimme. Vielleicht hat er sie nur deshalb eingestellt, als eine Art Wiedergutmachung. Als Dominotaktik. Wenn jeder gerettete Säufer einen weiteren rettet, dann zahlt er irgendwie seine Schulden zurück.
Aber wenn sie ihm das zu oft bringt, lässt er sie fallen. Einmal im Monat maximal, mehr ist nicht drin.
Er wird von ihr verlangen, dass sie abends kommt. Dann kann er, wenn was schiefgeht, einspringen oder umdisponieren. Zum Glück hat er Souad auf dem Handy erreicht und konnte ihr den Gang zum Bäcker auftragen. Wenn sie da ist, wird er oben duschen und die Snacks machen. Er fühlt sich schmutzig. Nicht in der Form, seine Gäste zu empfangen.
—
Die ersten drei muss er vertrösten. Bis zehn, halb elf wollen die meisten frühstücken. Zur Entschädigung spendiert er jedem einen Orangensaft und bittet um Geduld. Und betet, dass Souad sich beeilt.
Sie ist eine Schönheit. Und sie ist gut. Noch im wildesten Trubel wirkt sie gelassen, ohne dass jemand auf die Idee käme, sie beeile sich nicht. Sie stammt aus Algerien und versteht es perfekt, die Balance zwischen Freundlichkeit und Kühle zu halten. Jeder, der ihretwegen kommt, und das sind viele, glaubt, sie freue sich, ihn zu sehen, aber keiner, der seine fünf Sinne beisammen hat, kann sich Chancen ausrechnen, bei ihr zu landen. Benno hat einiges von ihr gelernt.
Leider beklaut sie ihn.
Sie verschwindet gelegentlich mit der Kellnerbörse aufs Klo, immer dann, wenn sehr viel los ist. Er kennt den Trick von früher. In Arkansas hat er sich das Greyhound-Ticket mit Kellnern verdient, als er eine Zeit lang nicht an sein Konto kam. Er lässt sie. Aber ihr Gehalt hat er nicht erhöht, als er Valerios erhöht hat. Der ist ehrlich. Hoffentlich verplappert er sich nie, sonst kann sie behaupten, Benno diskriminiere sie. Dabei hofft er, dass sie ihm lang erhalten bleiben möge. Er verdankt ihr eine Menge verträumter, beschwingter und verliebter Gäste.
Als sie endlich auftaucht, ist die Dämmerstimmung im Café noch intensiver als sonst, weil ein Berliner Umzugswagen vor der Tür steht. Daniel und Christine ziehen in den zweiten Stock.
—
Die kleine Wohnung sieht noch fast genauso aus wie kurz nach Bennos Einzug vor zwei Jahren. Im Schlafzimmer eine Matratze, eine Kleiderstange mit Regal darunter, daran und darin sechs weiße Hemden, drei schwarze Hosen und ein Paar Jeans, Wäsche, Socken, Schuhe, braun und schwarz, im Wohnzimmer ein Sofa, zwei Sessel, ein kleiner runder Tisch, die Strat, der Verstärker, ein kleiner Fernseher, in der Küche ein riesiger Kühlschrank, Spüle, Arbeitsplatte, Geschirrkommode. Das reicht. Kein Bild an irgendeiner Wand, keine Stereoanlage, kein Buch.
Wenn er hier ist, sitzt er vor dem Fernseher und spielt Gitarre dazu. Er begleitet und ergänzt die Filmmusik oder klimpert zu Nachrichten, Talkshows, Comedysendungen. Ihm ist egal, was läuft, und egal, was er spielt. Er hört sich nicht zu. Er spielt, weil ihn das beruhigt und in eine Art Schwebezustand bringt, bis er müde genug ist. Jeden Abend.
Jetzt, unter der Dusche, würde er am liebsten stehen bleiben, einfach nicht aufhören, nicht sauber werden, so lange, bis er draußen niemandem mehr begegnen kann. Aber vorher wäre vermutlich seine Haut von ihm abgewaschen – es geht nicht, er muss raus, natürlich muss er raus, ins Café und in einen Tag, der wie jeder andere sein wird.
Mit dem einzigen Unterschied, dass Christine heute auftauchen muss und er Angst davor hat, sie wiederzusehen. Wenn die Möbelpacker da sind, wird sie auch da sein. Um zu dirigieren. Irgendwann im Laufe des Tages wird sie vor ihm stehen. Nach vierzehn Jahren. Und er hat keine Ahnung, wie er sich dann fühlen wird, ob er sie überhaupt noch erkennt, vielleicht ist sie inzwischen sportgestählt und hennarot, mit praktischer Frisur und strassbestickten Jeans, vielleicht ist sie eine Spießerin geworden oder auf diese gewisse Art fade, wie manche Menschen werden, wenn all ihre Ziele erreicht sind und sie begreifen, dass es nur noch ums Festhalten geht und alles, was man festhält, weniger wird, wenn die innere Stimme verklungen ist, die sie angetrieben, angefeuert und angefleht hat, etwas zu machen aus ihrem Leben, jemand zu werden, alles Krumme und Kleinliche abzuwerfen, um sich groß genug zu erschaffen, dass es reicht für den Blick in den Spiegel.
Am meisten Angst hat er davor, dass ihre Gegenwart ihn wieder zurückwerfen könnte. An den Anfang. Oder das Ende. Den Zustand jedenfalls, in dem er sich vor vierzehn Jahren befunden hat.
—
Sie war die Art Frau, in der man nicht mehr das kleine Mädchen sieht, das sie mal gewesen sein musste, die Art, deren Anblick wehtut. Keine augenfällige Schönheit, keine, die bei einer Misswahl auftreten oder gar reüssieren würde, und nicht die Sorte Titelbildgesicht, von der simple Gemüter träumen, aber wer das Wort Anmut schon mal gehört hatte, wusste, wenn er sie sah, was es bedeutete. Ihre unordentlich frisierten dunklen Locken verstärkten seltsamerweise die Aura von Ruhe und Kompetenz, die um sie lag, und ihre Stimme klang samtig und präsent wie die einer leicht verruchten Sängerin.
Benno war damals ein Häufchen Elend, zerfressen von Schuldgefühl, weil er Daniel ohne dessen Einverständnis in der Nervenklinik abgeliefert hatte, und sie war dort Schwester.
Daniel stand bis zum Kragen unter Drogen, aber noch im tiefsten Tran gelang es ihm, seinen Abscheu gegenüber Benno zu zeigen. Dafür, dass er ihn hierhergebracht hatte. »Wenn ich raus bin, will ich nichts mehr mit dir zu tun haben«, sagte er, und Benno wand sich unter Daniels unstetem, aber immer dann, wenn er doch mal traf, vernichtendem Blick.
»Das musste aber sein«, sagte Benno betreten und verdruckst, »du hättest wer weiß was angestellt.«
»Ich dachte, du bist mein Freund«, sagte Daniel. Und dann sagte er nichts mehr.
»Er ist dein Freund«, sagte Christine, die danebenstand, leise, aber Daniel schien es nicht zu hören. Sie sah, wie Benno sich quälte, und versuchte, ihn aufzurichten. »Es war richtig«, sagte sie, »das einzig Richtige, was du tun konntest.«
»Ich will dich nicht sehen.« Daniel sprach jetzt zum vergitterten Fenster und drehte sich nicht mehr um, bis Benno irgendwann aufgab und ging.
—
Daniel war von einem Tag zum anderen durchgedreht. Sie bewohnten damals eine Villa, ein großzügiges Holzhaus am Hang mit Ulmen, Birken und Lärchen im Garten, einem kleinen Studio im Kellergeschoss und einem Stockwerk für jeden.
Irgendwann nachts wachte Benno mit rasendem Herzschlag auf. Da war ein seltsamer Lärm – es klang wie betrunkene Einbrecher. Er schlich sich an, verkrampft vor Angst, und war zuerst erleichtert, dann jedoch umso mehr entsetzt, als er Daniel im Flur sah, auf den Knien, wie er im Lichtkegel einer Taschenlampe mit Brachialgewalt den Telefonanschluss aus der Wand meißelte. Bennos Telefon. In Bennos Flur. Jetzt sah er auch, dass alle Lampenkabel zerschnitten waren. Daniel hatte eine Gartenschere neben sich liegen. Wenn er damit schon im Studio gewesen war, dann hatte er Tausende von Mark vernichtet.
»Was wird das?«, fragte Benno eingeschüchtert, denn Daniels verbissene Betriebsamkeit sah so fanatisch und kraftvoll aus, dass zu fürchten war, er gehe auf jeden los, der den Sinn dieser Tätigkeit anzweifelte.
»Die hören alles mit«, sagte Daniel nur und riss und hackte weiter. Er fiel nach hinten, als er endlich Kabel und Dose in Händen hielt.
»Wer?«
Daniel lächelte nur mitleidig oder herablassend in sich hinein, er sah nicht einmal auf dabei.
»Hör doch auf damit, bitte.« Bennos Stimme klang jämmerlich. Daniel griff nach seinem Werkzeug und ging damit in die Küche. Ein Blick auf den offen stehenden Sicherungskasten zeigte Benno, dass der Strom immerhin abgestellt war.
Benno hatte Angst vor Daniel, obwohl der ihn gnädig ignorierte, aber es war klar, dass in seinem Kopf eine zentrale Schraube draußen sein musste und Benno nichts tun konnte, außer das Studio zu retten, indem er es abschloss. Falls es nicht schon verwüstet war.
Das tat er – es war noch unversehrt –, dann sah er Daniel eine Zeit lang zu, wie er mit grimmiger Gründlichkeit alle Steckdosen und Schalter in der Küche zerstörte und sich dann über Herd und Kühlschrank hermachte. Benno war gelähmt und verzweifelt. Und Daniel ganz ruhig. Er pfiff leise durch die Zähne, eine Melodie, an der sie seit Stunden konzentriert arbeiteten, sie hatten die Figur einer Amsel abgelauscht und sich geärgert, sie nicht geistesgegenwärtig mit dem Walkman aufgenommen zu haben, denn jetzt, da sie ein schönes Stück daraus gemacht hatten, würden sie am liebsten den Part der Amsel als Original einspielen.
Benno zog sich an und ging nach draußen. Er wusste nicht, was tun. Die Polizei holen? Das ging nicht. Das war einfach nicht drin. Nicht nur wegen der Koksbriefchen, die noch herumliegen konnten, und dem Gras in irgendeiner Jackentasche, es kam einfach nicht infrage, den Freund an die Bullen zu übergeben. Ihm musste etwas anderes einfallen.
—
Es war Mai, kurz nach vier Uhr morgens, und die ersten Vögel begannen, noch in der Dunkelheit zu singen. Er ließ den Wagen stehen, ging zur großen Straße und darauf abwärts in Richtung Stadt. Niemand sonst war unterwegs, zu früh für die Zeitungszusteller und schon zu spät für die letzten Nachtschwärmer. Höchstens ein unausgeschlafener Bäcker auf dem Weg zur Arbeit konnte ihm begegnen.
Ende der Leseprobe