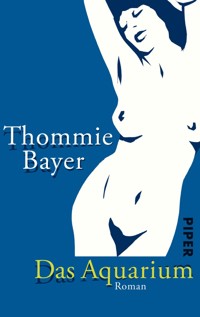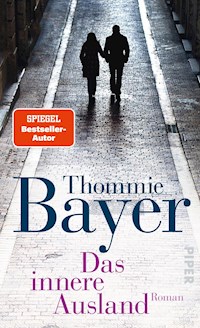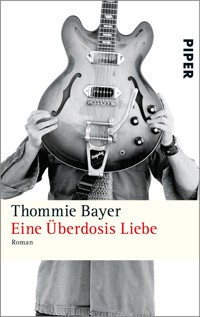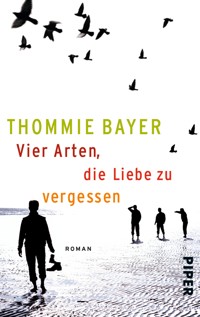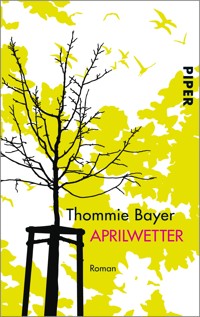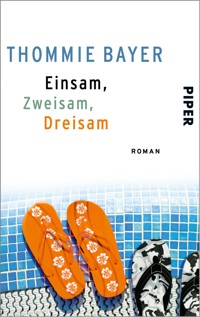
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Von seiner langjährigen Freundin Karin verlassen, bricht Sig zu neuen Ufern auf. Da begegnet er der rätselhaften Regina, die nicht einmal ihre Telefonnummer preisgibt. Die müsse er selbst herausfinden, meint sie. Doch das Schicksal kommt ihm zur Hilfe und führt ihn wieder zu ihr. Schon bald kommen sich die beiden immer näher. Aber Regina ist von einem seltsamen Geheimnis umgeben, hinter das Sig erst kommt, als es zu spät ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Taschenbuchausgabe
1. Auflage 2007
ISBN 978-3-492-96027-4
© 2007 Piper Verlag GmbH, München Erstausgabe: Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek 1987 Umschlaggestaltung: Dorkenwald-Design, München Umschlagmotiv: Ruslan Kudrin (Männer-Flipflops) und Sandor Jackal / beide Fotolia.com Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck
Zum Beispiel:
Ein amerikanischer Filmregisseur in den vierziger Jahren stellt sich den Himmel als einen Platz vor, an dem Irving Berlin, Cole Porter und George Gershwin Poker spielen. Wenn einer von ihnen vier Asse hat, dann sind das As-dur, As-moll, As-major-seven und as Marilyn got her Skirt blown up by the goddam Luftschacht.
Für einen französischen Regisseur wäre Catherine Deneuve die beste Wahl für die Rolle von Gott. Yves Montand könnte die Mutter Maria spielen. Isabelle Huppert und Nathalie Baye als Heiliger Geist würden abwechselnd den großen Citroen durch die Wolken steuern.
In Italien so etwa dasselbe, nur haben die Frauen riesengroße Brüste und steht mehr Essen auf dem Tisch.
In England kommt man gar nicht auf so eine Idee, denn erstens würde die Schauspielergewerkschaft verlangen, daß zwei Drittel Engländer auf ein Drittel Engel kommen, und zweitens würde Hitchcock auf seiner obligatorischen Nebenrolle bestehen.
Grund genug, die ganze Sache zu vergessen, oder?
Ein deutscher Regisseur (wir verraten nicht, welcher) könnte sich nicht entscheiden, ob er Angela Winkler, Angela Winkler oder Angela Winkler als Maria besetzen soll.
Aber die Filmleute sind wohl die einzigen, die sich den Himmel mit Vorspann und Musik vorstellen. Ein Lastwagenfahrer wird eher eine kerzengrade Autobahn vor seinem geistigen Auge sehen. Ohne Geschwindigkeitsbegrenzung, aber dafür mit Captagon-Tankstellen alle zwanzig Kilometer.
Ein Polizist (wir verraten nicht, welcher) träumt von einer Art Amok-Avus, auf der er den Wasserwerfer mal so richtig bis Hundertzwanzig hochjaulen kann, und ein Melancholiker aus der provinziellsten Großstadt Deutschlands stellt sich Gott so ähnlich wie seinen Turnlehrer vor.
Wir sind da ganz anderer Ansicht. Etwa der, daß im Himmel eine straffe Organisation herrscht. Auch in dem Teil, der für die sogenannte Freie Welt zuständig ist, also Amerika-Erde, Europa-Erde und noch ein paar Gegenden mehr.
Zwar wird in katholischen Kreisen etwas mehr gegessen und getrunken, in evangelischen dagegen eher Leibesertüchtigung getrieben und bei den Orthodoxen getanzt und gemalt, aber allen gemein ist die strenge Hierarchie und die heitere Unterordnung der Menschen.
Das heißt, Mensch ist man ja nicht mehr, wenn man erst mal im Himmel gelandet ist. Eher Seele.
Es gibt wohl den einen oder anderen buddhistischen, hinduistischen oder islamischen Manöverbeobachter, aber alles in allem ist die Stimmung im christlichen Himmel vom entsagungs- und gemütvollen Charakter der Christen geprägt.
In der Sektion Europa-Erde ist die Gelassenheit allerdings auf manchem Gesicht nur vorgetäuscht. Erst in den letzten Jahrtausenden haben sich die Machtverhältnisse verschoben, und es gibt noch manchen Unentwegten, der dem alten Himmel, wie er noch in seiner Jugend war, nachtrauert. Und nicht nur das.
Vor allem die Griechen, die stärkste Fraktion der Unzufriedenen, sind Sand im Getriebe. Sie sabotieren den christlichen Himmel, um das «Scheiß-System», wie sie es nennen, «ganz gezielt zu schwächen».
Agenten!
So manche zynische Zote kann man hören, wenn man in der Baby-Herstellung und im Baby-Versand in die Nähe von kleinen Grüppchen dunkelhaariger, fanatisch dreinschauender Männer kommt. Und wenn keiner hersieht, vertauschen sie die Babies.
Die arglosen Himmelsmanager auf der Verwaltungsebene haben keine Ahnung von diesen Machenschaften. Sie sind sogar so naiv, an «Himmlisches Versagen» beziehungsweise «Schusseligkeit» zu glauben, wenn mal eine Reklamation kommt.
So geht das nun schon seit Jahrhunderten.
Die Presbyterianer-Abteilung in der USA-Halle hat nur ein einziges Förderband. Der «Geburtenservice», der für dieses Band zuständig ist, weiß genau den Tagesbedarf an Babylieferungen für presbyterianische Haushalte. Der Agent der OEF, so kürzt sich die Olympische Einheitsfront ab, hatte leichtes Spiel, als er in der Mittagspause wieder einmal ein halbfertiges Baby vom stehenden Band nahm, es durch ein ebenso halbfertiges aus der Deutschland-Halle ersetzte und schnell wieder zurückhastete, um das gestohlene Ami-Baby in die Lücke des Bandes bei der deutschen Babyherstellung zu schmuggeln.
Die deutsche Babyherstellung heißt «Selbstverwirklichungs-GmbH».
Keiner merkte was. Die Aktion lief so glatt wie immer, denn die Unterschiede in den einzelnen Babymodellen sind innerlich. Von außen sieht eines wie das andere aus.
So kam Joe nach Freiburg.
Mit der eingebauten Idealismus-Begrenzung, dem Kommunismus-Katalysator (Commie-Cat im Fachjargon) und dem sogenannten «Good-Groove-Goal», einer Art Problembewußtseinslimiter im seelischen Schaltkreis, sah sein Lebensplan natürlich völlig anders aus als einer, der sich im Schwarzwald verwirklichen ließe.
Nämlich etwa so:
Tragen einer roten Schildmütze werktags / Eines weißen Stetson sonntags / Rauchen von Marlboro nicht unter einer Schachtel pro Tag / Fahren eines Mack-Trucks / Verachten aller Neger mit Ausnahme des einen guten, den man kennt und gelegentliches Vernaschen einer Drive-in Kellnerin, die die Hamburger auf Rollschuhen serviert.
Hier heißt er Josef. Josef Scharmer.
Die Nachbarskinder riefen ihn Säbby-Bäbby, seine Schulkameraden nannten ihn Sepp. Später nannte er sich selber Kid, dann Jody, dann Joe. Die Namensänderung kostete ihn so viel Lebensenergie, daß er schlecht in der Schule war, aus zwei Lehren flog und seinen armen Eltern überhaupt recht wenig Freude bereitete.
Seine offenbare Ruhelosigkeit und Fehlanpassung legte sich erst, als sogar seine Mutter eingewilligt hatte, ihn Joe zu nennen.
Und nicht mehr Josef oder Josselchen.
Er wurde Taxifahrer, verdiente eigenes Geld, und seine Eltern konnten endlich beruhigt altern. Sie widmeten sich dem Kegeln (was Joe beharrlich «Bowling» zu nennen pflegte) und pusselten den lieben langen Tag in einem kleinen Garten herum, wo sie allerlei eßbares Grünzeug anpflanzten.
Joe hatte nun zwar eine sinnvolle Beschäftigung und eigenes Geld, aber die große Unlust seiner Jugend war geblieben. Irgendwo tief drinnen spürte er, daß er am falschen Platz herumfuhrwerkte. Er wurde das Gefühl nie ganz los, daß man ihn gar nicht beachte. Nie geht es um mich, dachte er manchmal, und das stimmte. Wann immer er im Leben anderer vorkam, war es als Nebensache oder Störfaktor.
Selbst in dieser Geschichte geht es nicht um Joe. Aber wenn er schon hier rumsteht und die Aussicht auf wesentliches verstellt, dann können wir ihn uns auch genausogut ein bißchen genauer anschauen.
Also: Es sieht zwar aus, als wäre es bloß eine Lederjacke mit Koteletten drüber, aber es ist Joe. Lässig lehnt er am Tresen und hat sein Spielbein so angewinkelt, daß er mit dem Absatz des Cowboystiefels in die Chromstange kurz über dem Boden einhakt.
Er läßt die Bauchmuskeln spielen, damit sein Gürtel knarrt. Er mag es, wenn sein Gürtel knarrt. Knarren von Leder ist seit jeher das Geräusch, von dem er sich am besten repräsentiert fühlt. Das klingt so nach Ranch-Koppel in Arkansas.
Knarz.
Also, Joe steht am Tresen angelehnt; der Tresen ist stilistisch an ein englisches Pub angelehnt; die ganze Kneipe ist an so eine dunkelgebeizte Idee von einsamer Männlichkeit angelehnt, und die männlichen Gäste sind größerenteils an Karl Heinz Köpke angelehnt.
Wenn man bloß mal den Bart nimmt.
Frauen kommen hier nicht so vor. Die wenigen, die man sieht, sind an ihre Männer angelehnt. Oder an das, was mal ihre Männer werden soll. Die Frauen sehen aus, als wären sie gerade aus der Brigitte herausgehüpft, und zwar direkt von der Diät-Frisuren-und-Kosmetik-Seite. Auf dieser Seite gibt es immer zwei Bilder von derselben Frau. «Vorher» und «Nachher». Die Frauen hier sehen alle aus wie «Nachher». Nachher, das ist, wenn der Retuscheur seine fünfzig Mark verdient hat. Nachher können die Frauen sich wieder in die Kneipe trauen.
Die Kneipe heißt «Schnakenloch».
In Joes Sprache hieße das «Mosquito-hole» und ergäbe auch nicht mehr Sinn. Schnaken wohnen nicht in Löchern. Sie haben welche, winzigkleine, durch die der Rhesus-Faktor rein kann in das hungrige Schnakenbäuchlein, aber nach diesen Löchelchen ist die Kneipe nicht benannt. Das behaupten wir jetzt mal.
Im Schnakenloch gibt es «Über zwanzig Biersorten», und für jedes dieser Biere kommt einmal der Moment, wo es heißt Abschied nehmen vom heimeligen Faß und an irgendeinem Bart vorbei in den Bierhimmel fließen.
Im Augenblick sitzen nur drei Männer ohne Bart hier. Einer davon ist Joe.
Wer möchte übrigens mal raten, welche Biersorte er trinkt? Richtig. Budweiser.
Die Bärte sind von dieser seitlich anrasierten Art, wie sie bei Hauptfeldwebeln, Karl Heinz Köpke, dem Mann von der Allianz-Versicherung und der Besatzung der niederen Ränge im Tierversuchslabor vorkommt. Der Fachhochschulbart also.
Man muß sich die Gäste etwa so vorstellen: Gerade noch Friedensbewegung, aber schon nicht mehr Tempolimit.
Lauter als Joe jemals mit dem Gürtel knarren kann, knallt Musik aus den Lautsprechern an der Decke, Das muß so sein. Liefe keine Musik, dann redete keiner der Gäste mehr ein einziges Wort. Man könnte es ja hören und womöglich widersprechen. So nickt man einfach mit dem Kopf, wenn man sieht, daß einer den Mund auf, und zumacht, und der ist dann zufrieden, daß er endlich mal so richtig sagen konnte, was er auf dem Herzen hat.
Die Lautsprecher sagen gerade «China Girl».
Scheißmusik, denkt Joe, denn für ihn ist alles Scheißmusik. In seinem Kopf läuft schon seit Jahren eine Endlos-Schleife von «I’m proud to be an Okee of Muskogee», und alles, was nicht dieses Lied ist, ist eben Scheißmusik.
Auf dem Kugelschreiber, an dem er gedankenverloren herum-nagt, steht «Sparkasse Mörfelden». Der Kuli ist das Souvenir von einem «One night stand», oder besser «Half night stand». Sie war «eine politische», und wenn Joe was nicht leiden kann, dann «politische». Je mehr sie von ihren Demos und Aktionen schwärmte, desto mürrischer wurden Joes Antworten, und je mürrischer seine Antworten wurden, desto schmiß sie ihn schließlich raus. Bevor noch «Ficktechnisch», wie Joe das nennt, was hätte laufen können, saß er schon wieder im Taxi und hatte die Chance vertan. Blöde Politkuh, dämliche. Der Kuli schmeckt fusselig.
Joe zerquetscht einen Bierdeckel, auf dem «Schlösser Alt» steht, der aber nach «Guiness extra stout» riecht, und geht sich selber auf die Nerven.
Uns auch.
Am Tisch neben der Eingangstür sitzen Happe und Stefan, Taxifahrer wie Joe, und reden über den hundertneunziger Diesel. Da sie sich den aber nicht leisten können, machen sie ihn runter, daß keine gute Speiche an seinen Felgen bleibt. «übermotorisiert» schreien sie und hauen die Faust auf den Tisch. Die gehn uns auch auf die Nerven.
Ein bißchen weiter rechts, den Rücken zur Wand, die Tür im Blick und wie Joe an einem Kuli nagend, sitzt Thommie Bayer, der diese Geschichte schreibt.
Genau wie Joe ist Thommie von der OEF aufs falsche Band gelegt worden. Während der Feierstunde, die alljährlich an Maria Verkündigung stattfindet, nahm ihn ein höhnisch «Hosianna» hauchender Saboteur vom Band der «Frauenentwilderungsciété», das ist die französische Babyversorgung, und schmuggelte ihn rüber zur «Selbstverwirklichungs GmbH».
So geistert er als verirrter Franzose mit dem «Oh-la-la-l’amour-Quirl» im Herzen durchs finstere Grübel-Deutschland und sucht nach La Leichtigkeit, Liebe am Nachmittag und Savoir vivre.
In der Feinkostabteilung von Karstadt kauft er Baguette, Vinaigre und Dijon-Senf zu überhöhten Preisen. Er geht mit Baskenmütze ins Bett, versäumt keinen Film mit Piccoli, und tränke er Bier, dann wäre das Kronenbourg. Er hat aber ein Glas Beaujolais vor sich stehen.
Von Statur und Erscheinung her ist er diese feinnervige Künstlertype, die in den Truffaut-Filmen immer die besten Plätze belegt. Es kann als sicher angenommen werden, daß Jean-Pierre Leaud nur deshalb existiert, weil die Aktion der OEF entdeckt wurde und sich die «Frauenentwilderungs-société entschloß, dasselbe Modell noch mal zu liefern. Als Entschädigung für Frankreich.
Thommie gegenüber sitzt eine Person und trinkt nichts, hat keine Kleider an, keinen Körper drunter, kein Gesicht und keine Stimme. Noch nicht. Es ist der Held der Geschichte. Thommie denkt nach.
Thommie schreibt einen Satz.
Plötzlich sitzt ein T-Shirt vor ihm. Ein T-Shirt mit nichts drin! Er schreibt ausgebleichte Jeans in sein Notizbuch, und gleich sitzen sie auch schon unter dem T-Shirt und rutschen unruhig auf dem Stuhl herum.
Zum Glück sind alle Benutzer des Schnakenlochs ausschließlich mit sich selber beschäftigt, so daß keiner die seltsame Erscheinung bemerkt. Ein T-Shirt mit Jeans, denen Thommie gerade seine Schuhe hinstellt. Als er unter dem Tisch vorkommt, schreibt er Arme, ein Gesicht und eine Stimme aufs Blatt, spendiert dem Wesen noch eine Armbanduhr und lehnt sich beruhigt zurück.
Das Wesen holt sich ein Glas Wein an der Theke. Thommie wirft ihm seinen Geldbeutel zu, denn die Jeanstaschen sind noch leer. Kein Hausschlüssel, kein Personalausweis, kein Geld, keine Fotos. Leer.
Erwartungsvoll schaut Thommie dem Wesen entgegen, als es, Geldbeutel und Weinglas in derselben Hand, wieder an den Tisch kommt. Das Wesen setzt sich.
«Was willst du von mir?» fragt es.
Thommies Gesicht zeigt zuerst einen etwas überheblichen Gesichtsausdruck. Dann wird es nachdenklich, dann fast so etwas wie bestürzt. Er zündet sich eine Zigarette an, sieht dem Wesen direkt in die Augen und fragt:
«Wie meinst du das?»
«Na, ganz einfach», sagt das Wesen, «du hast mich gerufen, und ich will wissen, wozu.»
«Gerufen? Ich hab dich erschaffen. Ich meine, ich bin dabei, dich zu erschaffen. Ich schreib dich hier einfach so hin.»
Das Wesen lächelt amüsiert, nimmt Thommies Zigarette aus dem Aschenbecher und zieht daran:
«Erschaffen, so? Frag mal Gott, wie das Erschaffen geht. Frag ihn auch gleich, was seine Schöpfung mit ihm vorhat.»
«Mit ihm?» Nun ist Thommies Ausdruck eindeutig bestürzt. «Die Schöpfung mit ihm?»
«Ich fürchte, du wirst dich noch ziemlich wundern», sagt das Wesen. Thommie scheint die Fassung wiedergewinnen zu wollen. Er hat ein Detektivgesicht aufgesetzt: «Wenn du all das weißt, was du zu wissen vorgibst, woher weißt du es?»
«Weiß nicht», sagt das Wesen und zuckt die Schultern. «Aber laß es uns andersrum versuchen. Wie soll ich sein?»
Thommie stottert ein bißchen: «Also… äh… schlagfertig und so ein bißchen… äh… arrogant … Ich meine so ein bißchen im Besitz der einzigen Wahrheit, oder so … vielleicht so ein bißchen undurchsichtig.»
«Soll ich dir ähnlich sein?»
«Nein, um Gottes willen! Höchstens so ein bißchen, was du denkst und so. Aber nicht sehr.»
«Gut», sagt das Wesen, «da muß man aufpassen. Wenn man mir eine verpaßt, hast du den blauen Fleck. Was erlebe ich denn?»
«Oh», Thommie strahlt, «eine richtige Liebesgeschichte. Richtig toll, mit einer wunderbaren Frau.»
«Aha», sagt das Wesen mißtrauisch, «und wie geht sie aus?»
«Das weiß ich nicht, du mußt sie erst erleben.»
«Ich weiß nicht,. ich weiß nicht», murmelt das Wesen.
Thommie schreibt in sein Buch. Das Wesen sieht sich in der Kneipe um. Das Wesen denkt:
Regina du fehlst mir. Du fehlst mir so. Hast mir schon gefehlt als du noch da warst, jetzt fehlst du nur noch mehr. Das heißt, jetzt fehlst du anders. Ich muß mir dich vorstellen. Ganz alleine. Als du da warst, hast du die Vorstellung, die ich mir von dir machen sollte beeinflußt.
Du hast dich mir als Idee angeboten. Ich sollte ausprobieren, ob du eine gute Idee bist, und du würdest dann entscheiden ob du diesen Prototypen in Serie gehen lassen wirst. Du haus geübt. Hast mich als Vorkoster benutzt.
Und ich hab das alles für ein Versprechen gehalten.
Deine Hände, dein Gesicht, dein Körper und dein Schweigen … alles hat mir etwas versprochen. Wolltest du das einlösen? Ich warte. Ich warte schon lang und fühl mich langsam angebrannt. Angebrannt an den lebenswichtigen Stellen in mir.
Du hast mir immer so viel von dir gegeben, daß ich süchtig bleiben mußte. Einen Entzug hast du nicht zugelassen. «Hab Geduld, es kommt noch was», schienst du immer zu sagen. Es kommt noch was? Wo ist es? Ich warte Ich habe noch nichts davon gesehen.
Anfangs dachte ich, es kommt von hinter deinem Stöhnen, wenn du mit mir schläfst. Aber vielleicht war das Stöhnen, wenn du mit mir schläfst. Aber vielleicht war das Stöhnen schon alles? Einfach nur ein Geräusch, das zur Lust gehört. War das schon das Wirklichste, das Geheimste? Daß du Lust empfinden kannst an mir?
Ich habe nach dir gesucht. Ich suche immer noch. Ich habe dir Namen gegeben. Helle, dunkle, gläserne, eiserne. Und keinen wolltest du tragen. Du hast meine Namen abgestreift, als wären sie billige Fummel, die man für Fasching kauft und an Aschermittwoch wegschmeißt. Damit ich dich nicht fassen konnte.
Ja, ich wollte dich fassen. Fassen, nicht fesseln. Ich wollte dir gut sein. Ich hätte dich nicht abgefressen, wie ein Hund den Gummibaum. Ich hätte dich nicht ausgespuckt.
War das die nächste Nähe, daß ich Lust empfinden darf an dir? Immer hast du was in der Hinterhand, immer gibst du mir Zeichen, daß noch was kommt, daß ich mich nicht satt essen soll vor der Zeit. Vor welcher Zeit denn? Wann kommt die? Wer kriegt dich?
Ich hab manchmal das Gefühl, du könntest von meiner Einzigartigkeit nicht sehr überzeugt sein. Ich bin aber einzigartig. Ich bin keine Kaufhauspizza, die man eben noch mal bestellt, wenn man sie runtergeschmissen hat. Ich bin kein Stellvertreter. Ich repräsentiere nichts. Ich bin ich.
Warum sagst du nicht «Ja» zu mir? Zu jedem Menschen muß ein anderer ja sagen, sonst existiert er nicht.
Ach Regina, gibst du es nicht her, oder hast du es nicht? Dein Geheimnis ist, daß du, immer einen Schritt voraus sein mußt. Du diktierst das Geschehen, als wärst du der Regisseur. Macht es dir denn nichts aus, daß das Ganze dadurch bloß ein Film ist? Genügt dir das? Willst du nicht mehr? Warum inszenierst du, anstatt zu erleben? Willst du irgendwas korrigieren?
Wenn du vor dem Spiegel stehst, suchst du dann deinen Körper nach Fehlern ab? Sicher tust du das. Und sicher findest du auch welche. Ich würde keine finden.
Vielleicht ist mein Ideal dir ähnlicher als dein eigenes?
Warum hältst du mich wie an einer Abschleppstange? Ich kann nicht weg und darf nicht da sein.
Und jetzt bist du weg, und ich soll mich überraschen lassen, ob du bloß mal eben Zigaretten holst oder nach Australien bist.
Zusammengesunken wie ein verlassener Rucksack sitzt das Wesen auf seinem Stuhl. Thommie schaut prüfend über den Tisch, als wäre er der Mann vom Fundbüro und müsse entscheiden, ob man das Ding jetzt ins Regal packt oder wegschmeißt.
«Was war das?» fragt das Wesen. «Was war das, was ich da eben gedacht hab?»
Thommie scheint verlegen. Es tut ihm leid, daß er seinen Helden so traurig gemacht hat: «Das gehört eigentlich gar nicht hierher.» «Dann streichs wieder raus!»
Das klingt wie der Schrei eines geschlagenen Kindes, und Thommie schämt sich. Mit solchem Schmerz hat er nicht gerechnet. «O.k., ich streichs», sagt er leise.
«Wer bin ich?» fragt das Wesen.
«Du bist ein junger Mann, der heut seinen einunddreißigsten Geburtstag feiert. Du bist sympathisch und beweglich. Du wirst es gut haben in dieser Geschichte, hab keine Angst. Jetzt mußt du aber los. Die Hauptgeschichte fängt gleich an.»
«Gib mir noch was zum Anziehen. Ich will nicht im T-Shirt raus. Außerdem hab ich noch deine Schuhe an. Ich will eigene.»
«O.k.» Thommie schreibt alles nötige hin, und ein seltsam, aber warm gekleideter junger Mann verläßt das Lokal. An der Tür winkt er noch einmal zurückt, dann ist er verschwunden.
«Viel Glück», murmelt Thommie.
Und das klingt ein bißchen traurig.
Für Walter, Ingrid, Erna, Konstantin, Anna, Moritz, Hermann, Fritz, Elfriede und Emiliobert.
Und Simone und Georg, obwohl die bloß Puppen sind.
Und für den Tiger.
Wenn Kinder innerhalb der Regeln nicht gewinnen können, dann schreien sie einfach laut: «Das giltet nicht!» Sig Baumbusch konnte bis heute nicht gewinnen. Auch er versucht, sich selbst davon zu überzeugen, daß es «bis jetzt nicht gegolten habe».
Er fühlt sich unter Zeitdruck, denn heute ist sein Geburtstag. Geburtstage sind individuelle Sylvester, an denen man von sich verlangt, was man sich bisher geschenkt hat.
Sig hat sich irgendwie das Leben geschenkt. Er hat sich so durchgetrödelt, dachte, wenn er jeden Abend müde sei, wäre das genug, und er müsse nur gelegentlich den Schoß hinhalten, in den ihm das Glück dann schon irgendwann fallen würde.
Es fiel aber nicht.
Die OEF-Agenten im Himmel machen nicht nur räumliche Vertausch-Aktionen, sondern auch zeitliche. Sig ist das Opfer solch einer Zeit-Aktion. Er hätte in den frühen zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts einunddreißig werden sollen. Ein Maler in einer Zeit, in der die Malerei noch zu neuen Ufern aufbrach.
Damals hieß die «Selbstverwirklichungs-GmbH» noch «Kanonenfutter-Beschaffungs-Amt», und die OEF-Leute legten Sig jahrelang Tag für Tag auf dem Band nach hinten. So daß er fast sechzig Jahre lang nicht ausgeliefert wurde.
So war er, als er schließlich doch zur Welt kam, völlig veraltet. Er wurde geboren mit einer mittlerweile total unzureichenden Ausrüstung an Einsicht, Globalität und Anpassungsfähigkeit.
Kein Wunder, daß ihm das Glück nicht mehr in den Schoß fiel. Es war längst in den Schoß eines anderen gefallen. Und der hatte nichts damit anfangen können. Was sollte ein einfacher Breslauer Lohnbuchhalter in den zwanziger Jahren auch mit dem Angebot eines gewissen Gustav Klimt aus Wien anfangen, er solle am Beethovenfries mitarbeiten? Nichts, natürlich.
Der brave Georg Prittwice, so hieß der Buchhalter, schmiß den Briefeinfach weg, denn er hielt ihn für einen der weniger gelungenen Scherze seiner Sangesbrüder von der «Harmonia Breslau», die immer zu Dummheiten aufgelegt waren.
So kommt es, daß Sig als Maler immer noch daran arbeitet, die Gegenständlichkeit zu überwinden, während seine Kommilitonen an der Kunstakademie schon längst die Malerei überwunden haben.
Er sitzt im Zug von Stuttgart nach Freiburg. Eben fuhr Horb vorbei, und die Abenddämmerung ist schon in ihr letztes, farbloses Stadium getreten.
Wie oft zu dieser Tageszeit, ist Sig in einer seltsamen Mischung aus Melancholie und Aufgeregtheit glücklich. Andere fühlen sich so, wenn Vollmond ist. Sie raseninnerlich und wissen nicht, wohin. Bei Sig ist es die Dämmerung, die ihn bodenlos und grenzbereit macht.
Im Gepäcknetz über ihm liegt eine Mappe mit Arbeiten, die er Freiburger Galeristen vorlegen will. Eine Verabredung hat er schon. Morgen, zehn Uhr in der Galerie Eberwein. Pünktlich, hat der Galerist am Telefon gesagt, denn um elf müsse er nach Zürich. Deshalb fährt Sig schon heute abend.
Mittlerweile ist es Nacht geworden. Eine hübsche Nacht. An den Hängen des Neckartals liegen Dörfer, deren Häuser man gar nicht mehr sieht. Was man noch sieht, ist immer ein Schwung Lichter, die aussehen wie ein paar Händevoll Sterne, von einem achtlosen Engel verstreut und nicht wieder aufgeputzt.
Wenn jetzt noch eine Raffinerie vorbeikäme, dann wär die Weihnachtsstimmung perfekt, denkt Sig. Aber zwischen Horb und Rottweil gibt es nichts dergleichen. Nun ja, die gefallenen Sterne sind schön genug.
Der Walkman hüllt Sig ein in die traurig-voluminöse Musik von Pekka Pohjola. Wenn er die Augen schließt, dann sieht er schwarze Seen, schwarze Wolken und schwarze Wälder. Und wenn er die Augen wieder öffnet, huschen diese hübschen Sternflecke vorbei. Auf einmal sitzt da ein Mädchen.
Sie schaut ihm direkt in die eben aufgeschlagenen Augen. Vor lauter Überraschung lächelt er. Er kann gar nicht anders. Eben kommt er von den schwarzen Seen, und das Mädchen sitzt so mittendrin in seinem Blickfeld, daß er gar nicht anders kann, als sie ins Bild aufzunehmen. Er heißt sie willkommen auf ihrem schwitzklebrigen Zweiter-Klasse-Plastik-Sitz. Statt der Sterne.
Wie lang sie wohl schon da sitzt?
Sie lächelt auch. Sie scheint etwas zu sagen. Ihr Mund bewegt sich.
«Was?»
Er muß geschrien haben, denn jetzt lacht sie und legt einen Finger an die Lippen.
Die Lippen! Er hat einen Stempel im Herzen. Der wird nie wieder rausgehen, das weiß er jetzt schon. Er erinnert sich an das Bild eines Präraffaeliten, dessen Namen er vergessen hat: Hellrote Rosen in einer Vase. Die Rosen sind nicht mehr weit vom Welken entfernt, aber sie tragen noch in sich das Sehnen, die elegante Gier, das Feuchte und Versprochene des Zeitpunktes, an dem sie verschenkt wurden, und des Grundes, aus dem sie angenommen wurden. Eine dieser Rosen liegt, kaum festgehalten von einer müden Mädchenhand, auf einem Tisch. Das Mädchen hat den Kopf auf die Arme gelegt, als warte sie auf das Welken der Rosen. Die eine in ihrer Hand vertrocknende Rose stirbt als Beweis für das Vergehen der Liebe, das Versiegen der Begierde, und die ganze Melancholie zittert vor erinnerter Wollust.
Genau diese Farbe, genau dieses blasse Rot schimmert von den Lippen des Mädchens. Große, weiche Lippen, die genau in der Mitte von einem fordernden Zeigefinger durchgestrichen werden.
Die Lippen lachen über ihn. Offenbar schaut der ganze Waggon zu ihnen her. Sig macht eine entschuldigende Geste und nimmt die Kopfhörer ab.
Noch bevor ihn der Mut, den ihm sein eigenes unverhofftes Lächeln gemacht hat, wieder verlassen kann, sagt er: «Ich dachte immer, Poesie und Wirklichkeit seien so was wie Feinde, aber heute liegen Sterne mitten in der Wirklichkeit rum, und eine Frau hat Rosen im Gesicht.»
«Rosen?»
«Vielleicht ist es bloß dein Mund, aber es sieht genau wie Rosen aus.»
Sie versucht nach unten, über ihre Nasenspitze weg zu schielen. Als er lacht, sagt sie: «Quatsch.»
«Das ist kein Quatsch», sagt er, «das ist Poesie.»
Sie sieht ihm ernst in die Augen: «Dann wollen wir aber hoffen, daß du kein Dichter bist.»
Das bezeichnet er als Tiefschlag. Sie erklärt ihm, so tief wie einer sinken müsse, um die Botanik für seine Gefühle herhalten zu lassen, könne man gar nicht schlagen.
Er ist ernstlich beleidigt.
So was nenne der Psychologe eine Projektion. Woher sie wisse, daß er von Gefühlen rede? Außerdem bemühe er die Botanik höchstens in transzendierter Form, nämlich in der Malerei. Er habe ein Bild zitiert. Das wisse sie eben nicht.
«Aber eine Nummer kleiner als Rosen wär’s doch gegangen», sagt sie in entschuldigendem Ton.
Sig ist nicht zu versöhnen: «Hab ich Baccara gesagt? Ich könnte ja ganz kleine Röschen meinen. Heckenröschen zum Beispiel.»
«Warum nicht Veilchen?»
«Ein Veilchen ist der Zustand eines Auges.»
«Oje, ein Schläger.»
Er bietet ihr an, das Veilchen wieder in die Blumenfamilie aufzunehmen, sie müsse nur zugeben, daß er zu Recht beleidigt sei. Sie findet, da er eh kein Dichter sei, könne er die Goldwaage auch wieder wegpacken.
«Frieden?» fragt er.
«Bis zum Zielbahnhof», sagt sie.
Er könne auch Musik hören, wenn sie wolle.
Das könne sie dann auch, müsse sie sogar, sein Walkman sei nämlich undicht.
«Das hat er mit mir gemeinsam», murmelt Sig. «Er ist kein Dichter.»
Er schaut zum Fenster raus, denn jetzt kann er nicht riskieren, sie anzusehen. Er hofft, daß sie über seine Antwort lachen muß, aber er traut sich nicht, es nachzuprüfen. Am liebsten bisse er in die Fingernägel, aber das hat er nie getan. Das kann er jetzt nicht anfangen. Vielleicht sollte er ein bißchen im Matchsack herumkramen? Ach was. Er wird jetzt einfach den Kopf drehen und so tun, als wolle er die andere Seite des Waggons betrachten. Dabei kann er ja mal flüchtig über ihr Gesicht huschen und sehen, was los ist.
Sie muß darauf gewartet haben. Sie läßt ihm keine Chance, ihr Gesicht bloß zu streifen. Sie hält seine Augen mit ihren fest und sagt: «Ja, ich hab gelacht.»
Mein Gott, die kann Gedanken lesen! Es bleibt ihm nichts anderes übrig, als schon wieder zum Fenster rauszusehen. im gruppentherapeutischsten Ton, den er hinkriegt, sagt er: «Du, ich empfinde dich ein Stück weit als unheimlich aggressiv mir gegenüber … du … echt.»
Sie lacht.
«Jetzt lachst du schon wieder über mich.»
«Ich finde, da hast du unheimlich recht», sagt sie.
Sie müssen schweigen bis Rottweil, denn ein Herr in grenzschutzgrünem Anzug hat sich zu ihnen gesetzt. Sie sehen aber beide in aufeinander passenden Winkeln aus dem Fenster, so daß sich ihre Augen treffen. Sie collagieren sich gegenseitig mit der vorbeiflitzenden Dunkelheit. Einmal lächelt sie, und als er auch lächelt, ist es wie ein Schrecken, der ihn lähmt.
Ein freistehendes Lächeln ohne Text und ohne Ausrede ist wie mitten ins Herz gefaßt. Bis der Mann endlich ausgestiegen ist, vermeidet Sig, ihren Augen zu begegnen.
Sie deutet auf die Mappe im Gepäcknetz und fragt, was da drin sei.
«Bilder», sagt er, und sie dürfe sie ansehen, wenn sie wolle. Das wolle sie, sagt sie und holt die Mappe aus dem Netz. Er blättert ihr vor, und nach dem fünften Bild fragt sie: «Malst du die?»
«Ja», sagt er und ist schüchtern geworden. Er wartet auf ein Lob.
Ihm gefällt, wie sie die Bilder ansieht. Mittlerweile blättert sie selbst. Es scheint, als habe sie ihn vergessen. Manchmal brummt sie etwas vor sich hin, das er nicht verstehen kann, und einmal blättert sie zurück und sagt: «Das gefällt mir.»
Ein andermal deutet sie auf eine Einzelheit und sagt: «Ui.»
Jetzt ist er so schüchtern geworden, daß er seine eigenen Schluckgeräusche hört, wie das Dröhnen einer Steinbruchsdetonation. Aber zu der Verlegenheit ist auch das spannende Kitzeln der nahen Wärme ihrer Haut gekommen. Er ist nicht nahe genug, die Wärme zu spüren. Ein Zentimeter fehlt. Um das Kitzeln auszukosten, konzentriert er sich darauf, nicht näher an sie heranzurücken. Er will die Wärme wissen. Er will sie nicht spüren.
Seinetwegen könnte der Zug jetzt mit Maschinenschaden stehenbleiben. Aber dann wären in einer Viertelstunde genügend Busse da. Es ist leider nicht mehr so wie in den alten Filmen, wo der Drehbuchschreiber sich raussuchen konnte, welche Katastrophe er zum besseren Kennenlernen der Hauptdarsteller heranziehen will.
«Sehr düster», sagt sie zu einem Bild. Drei Blätter weiter nimmt sie eines in die Hand, um Einzelheiten zu enträtseln. Sie dreht das vorhergegangene Bild um, damit sie einen weißen Hintergrund hat, und legt das Blatt in die Mitte. Es ist eine Mischtechnik aus Aquarell, Kaffee, Tusche und Bleistift. Sie probiert verschiedene Abstände aus, sieht es aus verschiedenen Blickwinkeln an, hält es näher ans Licht des Mittelgangs und studiert es richtig, als wäre es eine Aufgabe, die sie zu lösen hat. Dann sagt sie: «Das ist aber sehr schön.»
Sig räuspert sich: «Es heißt Das definitive Vielleicht.»
«Und wie heißt du?»
«Sig.»
«Sig?»
«Oder Siggi, wenn dir das besser gefällt.»
Sie lächelt amüsiert: «Nicht vielleicht Siegfried oder so?»
«Doch schon. Aber ich verbiete alles außer Sig und Siggi.»
Sie zuckt die Schultern: «Na gut, ich heiße Regina. Nicht Reg oder Reggie.»
So ein blöder Name wie seiner sei das zwar nicht, aber passen würde das auch nicht zu ihr, findet er. Klänge so streng.
«Ich kann streng sein», sagt sie und blättert weiter durch die Mappe.
Schließlich lehnt sie sich zurück und klappt die Mappe zu. Sie zündet sich eine Zigarette an und sagt: «Danke fürs Zeigen.»
Sig, der das Bild, das sie so mochte, vor dem Verstauen der Mappe herausgenommen hat, sagt: «Schenk ich dir», und legt es in ihren Schoß.
In seiner Hand hat es sich eben angefühlt, als müsse es welken, wenn er es nicht sofort hergibt. Sie sagt nichts, schaut bloß in ihren Schoß, und Sig ist froh, auch dorthin sehen zu dürfen.
«Nein.»
«Doch.»
Ihre Augen suchen etwas zu gründlich nach einer Erklärung in seinem Gesicht. Schnell, um nicht doch noch rot zu werden, sagt er: «Ich schenk’s dir zu meinem Geburtstag. Ich bin heute einunddreißig geworden.»
Gott sei Dank sieht sie wieder das Bild in ihrem Schoß an. Es liegt dort, als könne es gleich loskrabbeln. Schließlich holt sie ein Buch, groß wie ein Schulatlas, aus ihrem Korb und legt das Blatt vorsichtig zwischen Deckblatt und erste Seite. Sie packt alles in den Korb zurück und sagt leise: «Das kann ich nicht verstehen.»
«Ich auch nicht», sagt Sig, «aber es fühlt sich gut an.»
Wieso ist er nur so mutig. So kennt er sich gar nicht. Er kann schon reden, aber nicht bei Menschen, die ihn interessieren. Nur Leute, die ihn innerlich kaltlassen, kommen normalerweise in den Genuß seiner Schlagfertigkeit. Wenn ihm jemand gefällt, ist er eher wortkarg. Und wenn ihm jemand so sehr gefällt, wie ihm diese rosenmundige Regina gefällt, dann müßte er eigentlich stumm wie ein Fisch nach dem Kochen sein. Er ist aufgeregt.
Sie kramt eine Tüte aus ihrem Korb, und aus der Tüte fingert sie zwei belegte Brote. Eins davon hält sie ihm vors Gesicht, als wäre er ein kleiner Hund, den sie vorhat, ohne Genehmigung des Herrchens zu verwöhnen.
«Salami», sagt sie und «Mmmmmhhh».
Er schaut sich das Brot wohl etwas zu zweifelnd an. Vor allem weit davon entfernt, sofort zuzuschnappen. Sie fragt: «Kein Hunger?»
«Nicht auf Salamibrot.»
«Auf was denn?»
«Rosensalat.»
«Du bist frech.»
«Ja.»
«Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.»
Es ist der zweiundzwanzigste April im Jahre Neunzehnhundertfünfundachtzig, und wenn Sig nur sechzig Jahre alt wird, hat er das Ärgste schon hinter sich.
Er möchte sehen, wie ihre Lippen sich bewegen, deshalb fragt er sie aus. Vor lauter Lippen hört er allerdings kaum zu. Nur am Rande bekommt er mit, daß sie im zwölften Semester Deutsch studiert, eigentlich fürs Lehrfach eingeschrieben ist, aber nicht an die Schule will. Sie will in Wahrheit nicht mal fertig werden. Will sich an der Uni verkriechen. Sagt, in der richtigen Welt sei mit ihr nichts anzufangen. Die guten Eigenschaften, die sie habe, hätten in der richtigen Welt keine Bedeutung, und ihre neutralen Eigenschaften gälten dort als schlechte.
Kaum rätselt Sig darüber nach, was sie wohl mit «Der richtigen Welt» meinen könnte. Kaum fragt er sich oder sie, was denn diese guten, schlechten und neutralen Eigenschaften seien. Kaum denkt er nach über die Frage, wo sie denn zu leben glaube, wenn das hier nicht die richtige Welt sei. Er stellt Fragen, an die er sich gleich nicht mehr erinnern kann. Er will nur, daß sie nicht aufhört zu reden.
Wann immer sie aus dem Fenster schaut, versucht er seinen Blick auf ihren Pullover zu schmuggeln. Leider trägt sie die Art von Pullover, die unbefugte Blicke sofort zurückwirft. Er kann die Form ihrer Brüste nicht erraten. Ihre schulterlangen, walnußbraunen Locken sind mit zwei Kämmen über die Ohren nach hinten gefaßt. Die graublauen Augen haben opalisierende Lichtflecke. Er vermutet, daß diese Augen auch kahl wie Schiefer oder weich wie das Fell einer Maus sein können. Ihr zarter Körper verschwindet fast zu zwei Dritteln in dem viel zu großen Pullover. Daß er so wenig von ihr sehen kann, steigert Sigs Sehnsucht und Begierde.
Sie macht seltsame Gebärden mit den Händen. Die schlanken Finger mit breiten Knöcheln vollführen kleine Tänze, die oft mitten in der Bewegung abbrechen, so daß die Hände in der Luft stehenbleiben, wie unschlüssige kleine Hubschrauberchen. Er ist verliebt in diese halbfertigen Gesten.
Wann immer sie ihre tiefliegenden Michelangelo-Augen nicht auf ihn gerichtet hat, findet er Einzelheiten, die er innerlich mitschreibt: Eine anrührende Erfahrenheit dieser Hände, die erst so zielsicher in eine Richtung toben und dann plötzlich innehalten, als genüge auch der Entwurf einer Gebärde. Wie der Ein-Uhr-Schatten einer Resignation sieht das aus, wenn sie sich aus Bewegungen zurückzieht und die Oberseiten ihrer Finger an die Wangen legt, als erhoffe sie dort Kühlung. Aber die leicht konkav gewölbten Seiten ihres Gesichts machen eher den Eindruck, als habe es erst kürzlich in ihrem Kopf gebrannt. Auch die Ränder der Augen sehen aus, als hätte die Tränenfeuerwehr was zu löschen gehabt.
Sig ist nicht nur in die Gebärden verliebt. Nahezu fassungslos spürt er in den Fingerspitzen, wie es wäre, ihr Kinn, weich wie das eines Kätzchens, zu berühren. Nahezu fassungslos sieht er verschiedene Gesichter über sie flackern und verschwinden, bevor er sie noch recht erkennen kann, und nahezu fassungslos spürt er, wie sein Magen nach unten fällt, weil der Zug bremst und eine blecherne Stimme sagt: «Freiburg Hauptbahnhof, Freiburg Hauptbahnhof. Der eingefahrene Eilzug fährt weiter nach Basel Schweizer Bahnhof.»
Hastig greift er nach der Zeichenmappe, dem Matchsack und seiner Jacke. An allerlei Ecken und Kanten anstoßend, rennt er hinter ihr her zur Tür, wo er sich schon durch einsteigende Reisende durchquetschen muß.
Bei dem Dextro-Energen-Automaten auf dem Bahnsteig zieht sie an der Schublade und fährt mit dem Finger hinter das Geldrückgabe-Kläppchen. Wie ein kleiner Streuner. Fünfzig Meter weiter dasselbe beim Zigarettenautomaten in der Halle. In dem Augenblick, da sie sich ihm zuwendet, um sich zu verabschieden, sagt er:
«Ich würde gern noch mit dir zusammensein.»
«Das geht mir zu schnell», sagt sie.
«Würdest du mitmachen, wenn’s langsamer wäre?»
«Vielleicht.»
Dieses «Vielleicht» sagt sie mit einem Fragezeichen in der Stimme, das ihm genauso am Herzen schmirgelt wie der Griff ins Geldrückgabefach. Er fragt nach ihrer Telefonnummer. Sie sagt, die müsse er selber herausfinden, das gehöre dazu. Wozu, fragt er und erntet einen lehrerinnenhaften Blick. Ihr Nachname sei Hodler.
«Du bist nett», sagt er.
«Vielleicht», sagt sie, wieder mit diesem Fragezeichen in der Stimme, geht um die Ecke und ist verschwunden.
Er kommt sich selber wie verschwunden vor. Es würde ihn nicht erstaunen, wenn er sein eigenes Spiegelbild im Kioskfenster nicht finden könnte. Er steckt die Hand in die Hosentasche, und nichts darin scheint ihm bekannt. Den Schlüssel, den er zweifelnd zwischen den Fingern reibt, könnte er wohl wegschmeißen. Der paßt garantiert in keine ihm bekannte Tür.
Regina Hodler.
War im Bahnhof noch die wetterlose Niemandslandstimmung aller Bahnhöfe, so herrscht draußen schon der rauschende Frühling. Die, die immer um den Bahnhof herumstreichen, weil sie annehmen, das, worauf sie warten, passiere hier, haben die Jacken, die Hemdkrägen, die Gesichter und, in einigen weniger appetitlichen Fällen, sogar die Hosen aufgeknöpft.
Die zweite Sorte Bahnhofsbenutzer, die nicht darauf warten, daß irgendwas passiert, sondern, daß ein Zug einfährt, werden von den andern heute weniger angepöbelt als sonst. Normalerweise herrscht Krieg zwischen den beiden Lagern. Aber an einem Tag wie diesem kann man sie auf den ersten Blick kaum auseinanderhalten. Die, die etwas vorhaben, gehen langsamer, und die, die nichts vorhaben, schlendern schneller als sonst. Und alle lassen das Take-it-easy-Gesicht aus dem Hemdkragen sprießen.
Sig dreht noch mal um, denn er will die Mappe im Schließfach deponieren. Auf dem Weg dorthin fällt ihm auf, daß niemand ihn prüfend ansieht, ob er nicht vielleicht Türke, Student oder sonst-was zum Verachten ist. Außerdem geht nichts schief. Das ist auch selten. Er hat das Kleingeld fürs Schließfach passend, das Schließfach ist nicht defekt und obendrein auch noch groß genug für die Mappe.
Das muß am Datum liegen.
Der Frühling schmiert die arthritisch knarzende Welt mit frischem öl, und die Sehnsüchte flutschen wieder in alle Richtungen. Wie auch ihre pflanzlichen Verwandten, die Samen.
Ob sie mit dem Schweizer Jugendstilmaler Ferdinand Hodler verwandt ist? Seine Enkelin? Im Telefonbuch stehen drei Hodlers. Irma, Krankenschwester, Christian, ohne Berufsangabe, und Regina, ebenfalls ohne Berufsangabe. 373391. Ob sie allein wohnt? Er wird sie jedenfalls nicht nach einem Freund fragen. Das ist nicht sein Stil. Zu ungeniert. Vielleicht kommt sie ja mal selber auf das Thema zu sprechen.
Heute kann er noch nicht anrufen, das steht fest. Das geht mir zu schnell, hat sie eben gesagt. Aber morgen. Ja, morgen auf jeden Fall.
Er kann eine Woche bleiben. Das heißt, er kann eigentlich bleiben, so lang er will. Er ist sozusagen frei.
Die Wohnung im Stuttgarter Westen hat er vor drei Tagen verlassen. Das Zimmer leerzuräumen war keine große Sache gewesen. Seine Bücher hat er verschenkt, seine Farben und die Staffelei bei seiner Mutter untergestellt, und alles, was er sonst besitzt, paßt in diesen Matchsack.
Vor einer Woche hat ihn Karin, seine langjährige «Beziehung», verlassen. Per Post. Auf Kreta über Ostern eine unheimlich intensive Beziehung aufgebaut und jetzt total das Bedürfnis, sich zu engagieren. Sollte sie. War ihm gerade recht. An seinem eigenen Aufatmen merkte er, daß ihm die ganze, auf die Bedürfnisebene hochgewuchtete Erlebnisgeschaftlhuberei nicht gutgetan hatte. Ohne große Enttäuschung zog er einfach aus, bevor sie aus dem Urlaub zurück war und dem «Bedürfnis, mit ihm die Situation zu klären», hätte nachkommen können.
Nicht einmal gewundert hat er sich. Das Ganze kam ihm schon viel zu bekannt vor. Genau derselbe Film lief ja dauernd neben ihnen ab. Warum sollte die Kamera nicht irgendwann auch mal auf sie gerichtet sein? Die Pärchen fangen an zu diskutieren, organisieren ihre Gemeinsamkeiten nach Stundenplan, entdecken plötzlich das Bedürfnis nach Freiräumen, in denen sie feste was für sich selbst entwickeln, und alle Freunde und Bekannten nehmen Anteil.
Dann wechseln die Bezeichnungen. Alles, was sich fühlen läßt, bekommt einen medizinischen, soziologischen oder psychologischen Namen. Wunsch heißt Bedürfnis, Lust heißt Orgasmus, Kummer heißt Probleme oder, besser noch, Problematiken. Plötzlich sind die Menschen Versuchskaninchen im eigenen Labor geworden. Sie geben sich selber die Spritze, schauen sich selber beim Zappeln zu und werfen sich schließlich selber in den Mülleimer. Der Kadaver ist nicht tot, nur unzufrieden. Er hat unheimlich das Bedürfnis, mit sich alleine klarzukommen. Deshalb geht er in Urlaub, wo er sich sofort verliebt. Damit ihm ein anderer wieder Leben einhaucht.
So ist das.
Sig ist nur über eines wirklich traurig. Daß er Karin, mit der er sechs Jahre gelebt hat, so einfach hinter sich lassen kann, wie man dreißig Bände Karl May hinter sich läßt: Ohne Bedauern, aber auch ohne das Gefühl, etwas mitzunehmen.
Noch bevor er auszog, grundierte er alle Porträts von Karin, bis auf eines, das er ihr zurückließ, neu, um sie zu übermalen. Er wird keine Menschen mehr malen. Überhaupt keine erkennbaren Dinge mehr. Das Erkennbare ist eh nur Stellvertreter für die reine Form. Oft hatte er das Gefühl, die Betrachter sehen nicht das Bild, sondern die Person darauf.
Er schiebt die Gedanken an Karin weg von sich. Sie soll ihn jetzt nicht stören. Schlittschuh-Unglück auf der Beziehungs-Ebene, denkt er, kann vorkommen.
Das ist sein Frühling. Nicht Karins. Die hat ihren eigenen. Mit Winfried oder Sebastian, oder wie die Männer, bei denen man sich echt engagieren will, eben heißen. Karins Frühling, denkt er hämisch, riecht nach frischgewaschener Latzhose, Turnschuh-Schweiß und einer auf den halben Preis runtergehandelten Ledertasche.
Sein Frühling riecht nach Urin, Staub und Koffer, nach Bratwurst und Taxiauspuff. Aber es ist seiner. Sein ganz eigener, uneinnehmbarer Originalfrühling.
«Mein erster zweiter Frühling», flüstert er ins Schließfach. Und weil Schließfächer ein Geheimnis behalten können, sagt er noch: «Ich bin froh, daß ich ihr meinen Geburtstag gestohlen hab.»
Das dunkle Schweigen der Schließfächer hat etwas angenehm Verbotenes, denkt er, muß ich mir merken.
Ab morgen kann er bei Andrea schlafen. «Mindestens eine Woche», hat sie gesagt. Es klang, als würde sie sich freuen. Für heute nacht muß er noch ein Hotel finden. Andrea ist nicht der Mensch, den man einen Tag vor der Verabredung überrascht.
Auf der geraden Straße vom Bahnhof zur Innenstadt läßt er einige Hotels, die zu teuer aussehen, links liegen. Ob er Andrea noch gern haben wird? Seit einigen Jahren haben sie nur noch brieflichen Kontakt miteinander. Er hat keine Ahnung, ob sie noch die Ecke in seinem Herzen ausfüllt, die er ihr seit jeher freigehalten hat.
Ein seltsamer Papagei geht da die Straße entlang. Sig sieht aus wie seine eigene Geburtstagstorte. Die Jeans und die violette College Jacke könnten der Standard-Uniform eines südstaatenrockseligen Hippies entstammen. Der Kaschmir-Schal und die italienischen Schuhe gehören eher zum Popper-Dress. Die kurzen braunen Haare streichen einen weiteren konzertanten Mißton in den psychedelischen Sirar-Sound seiner Kleidersinfonie, die vollends zur Kakophonie wird, wenn man den Matchsack mit den bunten Sternchen, die türkisfarbenen Schnürsenkel mit goldenem Blitzmuster und das Fünfziger-Jahre-Hemd mit Flugzeugen, Ozeanriesen und Straßenkreuzern gewahr wird.
Ende der Leseprobe