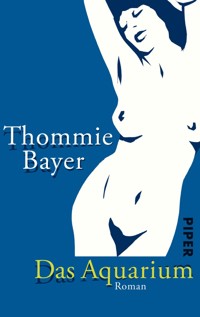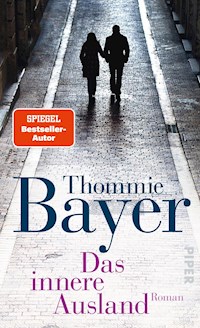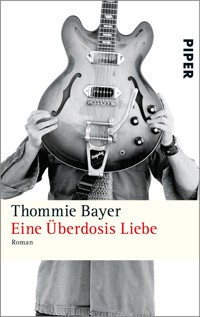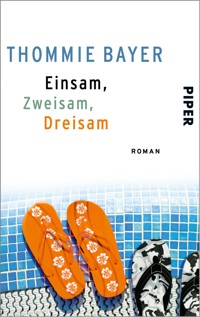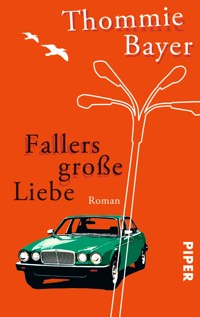
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Nehmen Sie auch eine ganze Bibliothek?« Eines Tages steht Faller bei ihm im Laden. Neugierig sieht sich der junge Antiquar Alexander Storz die Sammlung an, alles Kostbarkeiten, Erstdrucke. Sie kommen ins Gespräch – und spontan unterbreitet ihm Faller ein Angebot: »Begleiten Sie mich auf eine Reise. Sie fahren, ich bezahle Sie.« Schon am nächsten Tag gleiten die beiden in einem dunkelgrünen Jaguar dahin. Über das Ziel lässt ihn der unergründliche Faller im Dunkeln, und Storz versucht ein Muster, eine Idee hinter den Orten zu erkennen, die sie anfahren. Geht es hier um eine Schuld? Um Rache oder die Liebe? Je länger sie unterwegs sind, je länger sie über das Leben und die Liebe reden, desto klarer wird Alexander, dass er endlich Gewissheit über Agnes bekommen muss, seine eigene große Liebe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für JoneLa Storia siamo noi.
Francesco de Gregori
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Taschenbuchausgabe
6. Auflage 2013
ISBN 978-3-492-95097-8
© Piper Verlag GmbH, München 2010
Umschlaggestaltung und Illustration: R.M.E. Roland Eschlbeck und Kornelia Rumberg
Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck
Als ich am Morgen den Laden aufschloss, fühlte ich mich wie nach einer langen Reise, aber es war nur eine kurze Nacht, die hinter mir lag. Mich empfing der liebenswürdige Mief gebrauchter Bücher, die stolz, geknickt oder gleichgültig auf ein zweites Leben warteten. Die wollten was von mir. Ich sollte für sie da sein. Mir war ein wenig übel und schwindlig, aber das würde sich geben. Ich musste dazu nur die Brille absetzen, das unterwegs gekaufte Sandwich essen und ein bisschen Luft hereinlassen.
Es gibt Tage, da sollte man nicht vor die Tür gehen, nicht mit der S-Bahn fahren, sich nicht vom eigenen Spiegelbild in Schaufenstern erwischen lassen und vor allem nicht mit einer neuen Brille experimentieren: Nieselregen verwandelt das Sommerjackett in einen Lappen, mürrische Lehrlinge mit blondierten Haarspitzen drängen einem unschöne Musik auf, die blechern aus ihren Handys gellt, sondern grelle Gerüche ab und glotzen wie Fische durchs Glas des Aquariums unverständig in die ihnen offenbar rätselhafte Welt; im Fenster der Dessous-Boutique sah ich aus wie ein nur zufällig noch nicht ergrauter Sechzigjähriger, und das auch noch verzerrt, weil mein Gehirn noch nicht mit den stärkeren Brillengläsern zurechtkam, an die ich mich erst noch gewöhnen musste.
Mit der S-Bahn war ich gefahren, weil ich nicht zu Hause übernachtet hatte, sondern bei einer Frau, mit der mich wohl nicht mehr verband als der Wille, sich einander schönzureden, um dem Abend unter allen Umständen ein Quantum an Zärtlichkeit abzutrotzen – sie wohnte auf dem Land, und ich musste zur Arbeit in die Stadt. Ich war nicht sechzig, sondern vierunddreißig und nicht mehr weit entfernt von der Erkenntnis, dass ich ohne höhere Berufung oder verborgene Größe durchs Leben ging, dem Eingeständnis, dass ich nichts Besonderes war, trotz meines leidlichen IQ und umgänglichen Wesens, ich war nur, was die meisten sind: irgendwie am Leben, ohne Hunger, ohne Not und ohne Ziel. Aber noch war es nicht so weit, noch hielt ich mich für ein Unikat, nur eben eines mit nicht allzu viel Fortüne.
Die klassische Philologenkarriere Eins-B hatte ich schon hinter mir, Germanistik und Kunstgeschichte abgebrochen, Rezensionen und kleine Artikel für eine provinzielle Tageszeitung, ABM-Kraft im kommunalen Kino, Taxi, Reiseleiter – was noch fehlte, war Kellner, Fahrradkurier und ABM-Kraft in einem Literaturhaus. Meine Studienfächer hatte ich im Glauben gewählt, dort auf die seelenvollsten Frauen zu treffen, aber besonders viel Seele war für mich nicht abgefallen – ich bin schüchtern und hochnäsig, und das Helfersyndrom ist nicht mehr modern – keine verschwendete einen zweiten Blick an mich notorischen Eckensteher.
Meine längste »Beziehung« hatte drei Jahre gehalten und war vor siebzehn Monaten mit einem Schulterzucken zu Ende gegangen. Mit zwei Schulterzucken eigentlich, einem von ihr, einem von mir. Sie hatte einen anderen, und ich wollte wissen, was ihr an dem besser passe als an mir, worauf sie die Schultern hob und fragte, wieso mich ihre Bedürfnisse auf einmal interessierten, da waren meine Schultern dran.
Ich war nicht einmal wirklich verletzt, ich nutzte nur die Gelegenheit, ihr ein schlechtes Gewissen zu machen, weil es sich eben ergab und ich mein Selbstmitleid auskosten wollte. Dabei war die Aussicht, ohne sie weiterzuleben, weder besonders erschütternd noch überraschend für mich – ich hatte mir das hin und wieder ausgemalt, es mir manchmal sogar gewünscht, nur nie den Mut gehabt, Schluss zu machen, und fühlte mich deshalb eher beschwingt als gelähmt – nur vor mir selbst gab ich nicht zu, dass mein vorherrschendes Gefühl Erleichterung war. Und schon gar nicht vor ihr. Es war einfach zu verlockend, sie ins Unrecht zu setzen.
Vermutlich hatte sie mir auf die Frage nach seinen Vorzügen nicht geantwortet, um mich zu schonen, hatte sich auf die Zunge gebissen, um nicht zwei ellenlange Listen, eine meiner Mängel und eine seiner Stärken, herunterzubeten – den Teil mit meinen Mängeln kannte ich, den anderen wollte ich nicht hören. Eigentlich sollte ich ihr dankbar sein, aber das gelingt mir nicht, weil ich sie vor Kurzem mit schwangerem Bauch gesehen habe und seither der Lesart zuneige, sie habe sich von ihrer biologischen Uhr auf die Suche nach einem Versorger schicken lassen und mich deswegen abserviert. Ich hätte gern ein Kind gehabt. Eine Tochter. Ich wäre auch ein ordentlicher Hausmann geworden. Und ein guter Vater. Ich hätte Geduld gelernt.
Ich ließ die Ladentür offen, ging mit dem Staubsauger durch, legte mein Wechselgeld in die Kasse, setzte einen Kaffee auf – Filterkaffee, der meinem Magen nicht bekommt, aber eine Maschine für Espresso oder Cappuccino konnte ich mir nicht leisten, zumindest glaubte ich das und verkniff mir deren Kauf – stattdessen schüttete ich eben viel warme Milch dazu, die ich auf einer kleinen Platte erhitzte. Ich stellte die beiden Kästen mit Wühlware vor die Tür, die mir hin und wieder Laufkundschaft in den Laden brachte, und ließ den Blick einmal prüfend über die Regale, Stapel und Tische gleiten. Inzwischen schien draußen wieder die Sonne, und ein bisschen von ihrem Licht drang auch in meine halbschattige Höhle.
Ich hatte gerade eins der Bücher aufgeschlagen und den Eindruck gewonnen, es könne sich als lesenswert entpuppen, da klapperte ein Fahrrad vor der Tür, und meine Lieblingskundin wehte herein. Sie weht immer. Vermutlich ist sie eine Fee oder so etwas, die Schwerkraft spielt jedenfalls keine Rolle bei ihr.
»Hallo Kati«, sagte ich, »hast du keine Schule?«
»Freistunde.« Sie zog sich die beiden weißen Ohrstöpsel heraus und steckte sie in ihre Jackentasche, wo der iPod beständig weiterzirpte, weil sie nicht auf die Idee kam, ihn abzuschalten.
Kathrin ist dreizehn, hat immer das Haar zu einem Pferdeschwanz gebunden, dessen Gummi mit einem Blümchen, einem Bärchen oder einer Kirsche verziert ist, sie trägt eine bunte Brille und liest alles, was es über Pferde gibt. Ich lege schon automatisch jedes neu hereinkommende Pferdebuch für sie zur Seite und präsentiere ihr den Stapel, wenn sie vorbeikommt. So auch diesmal. Sie ließ nur eines liegen, weil sie es schon hatte, die vier anderen, darunter ein illustriertes Buch für Sechsjährige und einen Bildband über nordamerikanische Ponys, wollte sie haben.
»Acht Euro für alle«, sagte ich.
Sie zog einen Zehner aus der Jackentasche, ich gab ihr eine Zweiermünze raus, die sie in die andere Jackentasche schob, und weil ich in meiner Schublade kein dickes Gummi fand, um ihr die Bücher zusammenzuspannen, nahm ich eine alte Plastiktüte aus dem Karton unter der Kasse und bot sie ihr an. Sie schüttelte den Kopf. »Passt alles in den Korb«, sagte sie und nahm die Bücher unter den Arm.
»Willst du nicht zwischenrein auch mal was anderes lesen?«, fragte ich sie, »mit den Pferdebüchern bist du bald durch. Was machen wir, wenn’s keine neuen mehr gibt?«
»Dann ist immer noch Zeit«, sagte sie und lächelte. »Aber hast du auch was mit Musik?«
»Wie, mit Musik, was meinst du? Ein Sachbuch? Über Instrumente? Oder eine Musikerbiografie? Oder was über einen Komponisten?«
»Nein, eine Geschichte. Aber es sollen Sachen drin vorkommen, mit denen ich im Musikunterricht glänzen kann.«
»Neuer Lehrer?«
Sie errötete ein bisschen und schwieg.
Ich ging nach hinten zum Regal mit meinen Lieblingen, von denen ich nie so recht weiß, ob ich sie nun loswerden oder behalten will, und nahm ein Buch von Michael Schulte heraus, Rosi und andere Frauen fürs Leben, die Geschichte eines Geigers, der in Kurorchestern spielt. Das Buch war witzig und leicht. Es konnte ihr gefallen.
»Hier«, sagte ich, »genau zwei Euro. Jetzt bist du pleite.«
»Nein, ich bin reich. Fünf Bücher.«
Sie grub die Münze aus ihrer Tasche, gab sie mir, nahm das Buch und wehte hinaus in den Sommermorgen.
Ich subventionierte Katis Leselust nach Kräften, diese fünf Bücher waren nicht gerade ein gutes Geschäft für mich gewesen, genau genommen gar keines – allein das Ponybuch hatte mich sechs Euro gekostet – es war mal teuer gewesen und gut erhalten.
Sie kam so etwa alle zwei Wochen zu mir und dürfte inzwischen eine beeindruckende Pferdebibliothek zu Hause haben, weil sie nie ohne einen ganzen Armvoll aus dem Laden ging. Anfangs, vor fast zwei Jahren, war sie noch schüchtern gewesen, und ich hatte ihr alles aus der Nase ziehen müssen, aber bald wurde sie altklug und vorlaut und behandelte mich wie eine Art Onkel oder großen Bruder. Ich mochte das. Und immer wenn sie wieder draußen war, fiel ich in melancholische Stimmung, weil ich damit rechnete, dass sie schon beim nächsten Mal ihr kindliches Selbstbewusstsein verloren haben könnte und geschminkt, pseudocool, unsicher und versuchsweise blasiert hier vor mir stünde, eine Grimasse zukünftiger Weiblichkeit, von der man fürchten muss, dass sie ihren ursprünglichen Charme nicht wiederentdeckt, wenn der Hormonorkan vorübergezogen sein wird. Dann würde sie auch nicht mehr wehen, mir nicht mehr in die Augen sehen, nicht mehr mit geschürzter Unterlippe ihre Stirnfransen wegblasen und nicht mehr ihre Leidenschaft auf Pferde und alles, was mit ihnen zu tun hat, richten, sondern auf irgendeinen Boygroup- oder Soapstar, der nur dazu auf der Welt ist, ihresgleichen das Taschengeld abzuziehen und die Seele zu verschmieren. Vielleicht ist es doch gut, dass ich kein Vater bin – diesen Wandel würde ich nur schwer verkraften.
–
Bis zum Mittag kamen noch drei Kunden und ein Journalist, der mir einen ganzen Karton voller nagelneuer eingeschweißter Bücher brachte. Rezensionsexemplare. Er machte kein sehr gutes Geschäft, ich gab ihm maximal drei Euro pro Buch, aber er kann nicht riskieren, sie im Internet zu verkaufen, wo er zwar leicht den halben Ladenpreis bekäme, aber auch von einem der Verlage erwischt werden konnte. Dann wäre Schluss mit dem kleinen Zubrot.
Ich musste die Folien abnehmen, damit die Bücher gebraucht wirkten, sonst unterlägen sie der Preisbindung, dann stellte ich sie in ein extra Regal für die aktuelle Frühjahrsproduktion. Es gab ein paar Kenner unter meinen Kunden, die sich gezielt dort umsahen, weil ich immer noch billiger war als Amazon und manchmal auch ganz gut sortiert, denn ich hatte nicht nur diesen einen Journalisten, sondern auch noch zwei seiner Kollegen und hin und wieder Leute, die mir geschenkte Bücher brachten. Wenn ich diese Bücher selbst las, dann tat ich das sehr vorsichtig, um sie nicht zu beschädigen – sie brachten mir ein bisschen mehr Geld ein als der übliche Schamott aus Wohnungsauflösungen, Umzugsvorbereitungen und Kinderzimmer-Aufräumaktionen, der zudem immer ältlicher und gestriger wurde, weil sich alles Aktuelle auch im Internet gut verkauft.
Manchmal warf ich auch Bücher weg. Wenn sich zu viele wie Die Zitadelle, Tycho Brahes Weg zu Gott, oder Das Tal der Puppen, die in den Sechzigerjahren Bestseller waren und heute von keinem Menschen mehr gelesen werden, bei mir stapelten und auch in der Wühlkiste keine Flügel bekamen, dann sortierte ich sie aus und ging mit blutendem Herzen zum Container. Bücher wegzuwerfen ist Barbarei. Aber es gab niemanden, dem ich sie schenken konnte, und ich brauchte Platz für das, was ging.
Am Nachmittag war ein bisschen mehr los, aber als ich abends aufräumte und meine Tageseinnahmen in die Hosentasche steckte, waren das gerade mal knapp fünfzig Euro – kein berauschendes Ergebnis. Mit solchen Erlösen würde sogar ich an die Wand fahren, wenn es nicht auch hin und wieder bessere Tage gäbe. Die Miete für meine kleine Wohnung, die für den Laden, Krankenversicherung, Nebenkosten, meine bescheidenen Mahlzeiten und der Bücherankauf brauchten mindestens zweitausend im Monat, und das auch nur deshalb, weil die Ladenmiete so verrückt günstig war. Vierhundertzwanzig. Das war für Köln im Allgemeinen und für die Südstadt im Besonderen ein Witz. Die Hausbesitzerin, eine alte Dame, wollte einfach nicht auf ihre Kinder hören, die ihr seit Jahren einen Blick auf den Mietspiegel nahelegten. Sie war so eigensinnig wie reizend und erhöhte nur hin und wieder mal die Umlage für Heizung und Strom. Ihr reichte das Geld zum Leben. Ein Fossil. Mein Glück. Solange sie am Leben blieb.
Über den Sommer würde ich immerhin kommen, weil ich vor einigen Tagen eine ganze Sammlung übernommen hatte, die ich mit Gewinn über einen echten Antiquar weiterverkaufen konnte. Signierte Erstausgaben von Doderer, Musil, Brecht und einige wirklich alte Bücher aus dem achtzehnten Jahrhundert. Es war schnell gegangen. Fast wie ein Drogen- oder Waffendeal. Der Antiquar hatte alles in Kommission genommen und, einige Telefonate später, zu erstaunlichen Preisen weiterverkauft. Mit ihm arbeitete ich immer zusammen, wenn ich zufällig an etwas Wertvolles geriet. Er hatte die richtige Kundschaft.
Nur mein Gewissen plagte mich. Ich hatte der Frau, einer überforderten und vom Unfalltod ihres Sohnes erschütterten Rentnerin bei der Wohnungsauflösung tausend Euro für alle Bücher geboten, und sie hatte dankbar angenommen, weil sie das für einen fairen Preis hielt. Ich schämte mich. Mir blieben von dem Handel knapp viertausend, und für den Antiquar waren es fast zwei. Ich dachte nicht gern daran. Ich bin wohl nicht der geborene Kaufmann. Oder doch. Vielleicht schämen die sich auch.
–
Ich hatte gerade die beiden Kisten mit Lockstoff, Taschenbüchern für einen Euro pro Stück, in den Laden getragen und war dabei, abzuschließen, als ein Mann, der zuerst an mir vorbeigegangen war, innehielt, als habe ihn mein Anblick auf eine Idee gebracht, sich zu mir umwandte und fragte: »Nehmen Sie auch eine ganze Bibliothek?«
»Wenn ich sie mir leisten kann, ja«, sagte ich.
»Haben Sie jetzt Zeit?«
»Ja.«
»Dann kommen Sie. Ist nicht weit.«
Er ging ein paar Schritte, drehte sich dann zu mir um und streckte die Hand aus: »Faller«, sagte er. »Ich werfe Ballast ab.«
Ich nahm seine Hand und sagte: »Storz«, dann eilte er weiter, und ich hatte Mühe, mit seinem Tempo Schritt zu halten. Ein paar Minuten später betraten wir einen Hinterhof, fuhren in einem Aufzug, den Herr Faller mit einem Schlüssel bediente, in den fünften Stock hoch, traten dort in ein Entree mit Garderobe, Schiffsmöbeln und Einbauschränken, von dem fünf Türen, vier normale und eine gläserne Flügeltür, in eine offenbar erst kürzlich ausgebaute Dachwohnung führten. Alles war perfekt, keine Ecke angestoßen oder abgeschabt, kein Fleck auf der Tapete und kein Kratzer im Parkett.
»Hier entlang«, sagte Faller und stieß die Flügeltür auf. Ich stand in einem schönen, von großen Fenstern erhellten Raum, der mit Bildern, einem Esstisch und Stühlen eingerichtet war. Die Bilder, allesamt Originale, waren abstrakt und blass, Informel oder Minimalismus in der Tradition von Klein und Tapies und vielleicht wertvoll. Eine weitere Flügeltür führte in einen gleich großen, aber ganz anders eingerichteten Raum: Bücherregale, die alle vier Wände bedeckten, nur durchbrochen von den Fensteröffnungen, ein Ledersofa, das alt und amerikanisch aussah, ein Lounge Chair von Eames in dunklem Palisanderholz und ein weiterer Sessel, der in der gleichen Art wie das Sofa gearbeitet war, ein Fernseher, nicht sehr groß, aber sehr schön und ein größerer niedriger Tisch, auf dem einige Architekturzeitschriften, Geo, Focus, Spiegel und zwei aufgeschlagene Bücher lagen.
Ich stand nur da und ließ mich überwältigen. Das hier war ein Traum, den ich nie träumen dürfte, die Wohnung eines reichen Menschen mit Geschmack.
»Trinken Sie was?«, fragte Faller.
»Gern«, hörte ich mich sagen, aber wie durch eine Schicht Handtücher oder Tischdecken hindurch. Meine eigene Stimme klang wie die eines Fremden, der irgendwo weiter weg stand und mich nichts anging.
»Ein Glas Rotwein?«
»Sehr gern, ja.«
Er verschwand – ich hörte die Geräusche, die zum Öffnen einer Flasche, Herausnehmen und Bereitstellen zweier Gläser und Einschenken gehören, und rührte mich nicht vom Fleck, bis er wiederkam und mir eins der Gläser reichte, seines erhob und einen Schluck nahm. Ich tat es ihm nach – natürlich war der Wein exquisit, ein Vino Nobile oder Barolo, dessen Preis ich mir gar nicht erst vorstellen wollte. Ich machte ein respektvolles Geräusch, als ich das Glas vom Mund absetzte, und er lächelte mich an.
»Chianti«, sagte er, »mein derzeitiger Liebling.«
»Ich würde nie mehr was anderes trinken«, sagte ich.
»Die Idee hat was. Man muss das Gute nicht mit der Suche nach Besserem beleidigen. Sie haben recht.«
Aus den Fenstern sah man über die Dächer, aber ich konnte mich nicht in den Anblick verlieren, denn Herr Faller sagte jetzt: »Hier, diese Bücher. Ich will sie alle auf einmal loswerden, kein Einzel-Hin-und-Her und kein Feilschen. Ganz oder gar nicht.«
Ich hatte schon eine große Menge Bände der Anderen Bibliothek erkannt, nicht die in Leder, sondern die bunte Papierausgabe, und zog einen heraus, den ich an seinem gelb-grün schräg gestreiften Rücken erkannte: Fromme Lügen von Irene Dische. Dies Buch allein war schon an die hundert Euro wert.
»Das sind die ersten zwölf Jahre komplett«, sagte Faller, »hundertvierundvierzig Bände. Alle im Bleisatz gedruckt.«
»Das ist vielleicht eine Nummer zu groß für mich«, sagte ich und hätte mir am liebsten gleich danach auf die Zunge gebissen. So handelt man nicht. Man gibt nicht zu, dass etwas wertvoll ist.
»Schauen Sie sich einfach mal um, dann sehen wir weiter«, sagte er und ließ mich allein.
Ich fand noch weitere Kostbarkeiten: Paul Celans Der Traum vom Traume, Die junge Parze, Sprachgitter, das sogar signiert, und die Vierundzwanzig Sonette von Shakespeare in seiner Übersetzung. Das allein waren schon zweitausend Euro oder mehr, dannNemesis Divina von Carl von Linné, zwei Erstausgaben von Sigmund Freud, Radetzkymarsch von Roth, einige aus zumindest frühen Auflagen von Lion Feuchtwanger, Erfolg, Der jüdische Krieg und Exil – ich griff nicht mehr nach weiteren Büchern, es war klar, dass ich mir das hier aus dem Kopf schlagen musste. Es war ein Vermögen wert. Soviel Geld würde mir niemand leihen und auch mein Profi-Antiquar nicht vorstrecken können. Selbst wenn er sich mit den kostbareren Sachen abgeben durfte – er lebte wie ich von der Hand in den Mund.
»Sind Sie Germanist?«, rief ich, und Faller antwortete aus der Küche, wo ich ihn mit Glas und Flasche hantieren hörte: »Nein. Ich wollte mal ein Leser werden.«
Ich ging zu ihm, Exil noch in der Hand – er stand auf einem Balkon, der von der Küche aus zu betreten war, und rauchte eine Zigarre.
»Das sind Kostbarkeiten«, sagte ich, »wenn ich mich trauen würde, Sie zu bescheißen, dann könnte ich mir ein bisschen was leihen und zusammen mit meinem Ersparten Fünftausend bieten, aber das ist ganz und gar unangemessen. Ich hatte schon zwei Bücher in der Hand, die allein je tausend Euro bringen würden. Und noch keines, das weniger als fünfzig wert ist.«
Er sah mich an und zog an seiner Zigarre.
»Ehrlich sind Sie schon mal«, sagte er und bückte sich nach der Weinflasche, die neben ihm auf dem Boden stand, richtete sich auf und senkte den Hals in Richtung auf mein Glas. Es war leer. Ich war überrascht, dass ich es so schnell ausgetrunken hatte. Er schenkte nach.
»Und wenn Sie alles in Kommission nehmen, und wir machen halbe-halbe?«
»Dann bin ich für zwei Jahre saniert«, sagte ich, »aber es zieht sich hin, und Sie machen eventuell das schlechtere Geschäft.«
Er sah über die Dachlandschaft und zündete seine erloschene Zigarre wieder an.
»Sie sagten, Sie wollten mal ein Leser werden, sind Sie keiner?«, fragte ich, und er hob die Schultern: »Jedenfalls nicht der, der ich werden wollte.«
Ich sah ihn nur fragend an. Er legte die schon wieder erloschene Zigarre aufs Balkongeländer und trank einen Schluck.
»Ich hatte gedacht, die Welt verschwindet beim Lesen, aber sie verschwand nicht.«
Ich hatte das Gefühl, dass ich nicht weiter nachfragen sollte – etwas Trauriges oder Enttäuschtes hatte sich hier eingeschlichen –, also trank ich auch einen Schluck, obwohl ich schon spürte, dass mir der schwere Wein auf nüchternen Magen zu schaffen machte.
»Was ganz anderes«, sagte er, »haben Sie ein bisschen Zeit? Ein, zwei Wochen?«
»Wann, wofür?«
»Jetzt. Ab morgen, wenn Sie so schnell können. Ich muss eine Tour durch einige Städte machen und habe keinen Führerschein.« Er hob sein Glas. »Deswegen. Die haben mich mit eins Komma zwei erwischt.«
Ich dachte überhaupt nicht nach, ich antwortete sofort: »Zeit hab ich, Führerschein hab ich, und den Laden kann ich eine Weile zumachen, oder ich finde jemanden, der ihn für mich hütet.«
»Tausend in der Woche, bar, schwarz, wenn Sie wollen, okay?«
»Ja«, sagte ich und konnte nicht verhindern, dass ich ihn breit anlächelte. Eigentlich wollte ich cool und beiläufig wirken, aber dieses Angebot war einfach umwerfend.
Er lächelte zurück. Aber nur kurz. Dann sagte er: »Sie machen mir den Eindruck, dass man mit Ihnen plaudern kann, wenn’s passt, und auch schweigen, wenn das besser passt.«
»Der Eindruck ist korrekt«, sagte ich.
»Die Spesen gehen natürlich auf mich.« Er nahm die Zigarre und betrachtete sie kurz, ob es sich lohnte, sie noch mal anzuzünden, dann entschied er sich dagegen und warf sie in hohem Bogen zwischen die Häuser. »Essen, Hotel, was immer Sie brauchen unterwegs – Ihr Honorar bleibt unangetastet«, sagte er, »haben Sie ein Handy?«
»Ja.«
Er wollte mir erneut nachschenken – ich hatte schon wieder ausgetrunken, aber ich hielt die Hand übers Glas. Inzwischen war mir schwummrig, ich musste unbedingt was essen. Er goss sein eigenes Glas voll, und die Flasche war leer. Kein Wunder, dass er keinen Führerschein mehr hatte. Ich würde aufpassen müssen, dass ich meinen unterwegs nicht auch noch loswurde.
Er schrieb mir seine Telefonnummer auf einen Zettel und bat mich anzurufen, wenn ich bereit sei.
»Morgen Mittag vielleicht«, sagte ich, »oder schon morgen früh.«
»Das mit der Bibliothek machen wir dann später«, sagte er, »bis morgen«, und ich war entlassen. Er starrte über die Dächer, während ich noch einmal in die Bibliothek ging, das Buch an seinen Platz im Regal zurückstellte, dann zum Aufzug und nach unten und nach draußen.
–
Auf dem Weg zurück zum Laden überlegte ich mir, wen ich bitten könnte, mich zu vertreten, aber mir fiel niemand ein, dem ich genügend Vertrauen entgegenbrachte. Ich war erst seit einem knappen Jahr hier, hatte den Laden von einem Aussteiger, der jetzt auf Gomera lebte, übernommen und, außer flüchtigen Bekanntschaften wie der von letzter Nacht, noch keine Freunde gefunden. Wenn ich so blieb wie ich war, nämlich immer noch schüchtern und hochnäsig, dann würde ich auch keine mehr finden. Ich hatte eigentlich schon das Alter, in dem man zurück in die Heimatstadt zieht und sich als Lokalreporter oder Heilpraktiker neu erfindet – jedenfalls wenn man, wie ich, nichts zustande gebracht hat draußen in der richtigen Welt. Oder man steigt in den Betrieb der Eltern ein, um ihn alsbald zu übernehmen.
Das hatte schon mein Bruder getan, der meinen Vater zwar nicht leiden konnte, aber pragmatisch und diszipliniert seine Zeit als Juniorchef des familieneigenen Taxiunternehmens abriss und darauf wartete, dass sich der Alte endlich in die Rente verabschiedete. Das war nicht meine Welt. Einmal im Jahr zu Weihnachten, mehr nicht. Diese Besuche waren schon Mühsal genug – kaum auszuhalten, was bei uns zu Hause den Tag über geredet wurde: Der falsche Umgang der Nachbarn rechts mit ihrem Garten, der falsche Umgang der Nachbarn links mit ihren halbwüchsigen Kindern (meine Mutter), der falsche Umgang des Staates mit Unternehmern, Steuergeldern und den neuen Bundesländern (mein Vater), der falsche Umgang unserer Mitarbeiter mit den Wagen oder Fahrgästen (mein Bruder) – es ging nur darum, dass andere alles falsch machten, und daraus folgte dann unausgesprochen, dass wir alles richtig machten oder richtig machen würden. Wenn man uns nur ließe.
Dass ich ein Versager war, wurde netterweise nicht thematisiert, jedenfalls nicht, wenn ich dabei war. Das blieb den Nachbarn vorbehalten – die konnten sich das Maul zerreißen über die falsche Erziehung, die meine Eltern mir hatten angedeihen lassen.
In dieser Familie hatte ich meine Hochnäsigkeit erworben, und dort, bei meinen seltenen Besuchen, brauchte ich sie auch am dringendsten – sie rettete mich über die Tage, ließ mich, einsam aber irgendwie dennoch großartig, das Zusammensein mit meinen Leuten ertragen, so wie ich es als Kind schon geübt hatte. Da war ich ein Prinz gewesen, den man in der Klinik verwechselt und der falschen Mama ins Bett gelegt hatte.
Ich würde den Laden einfach zumachen. Ich suchte mir ein paar Bücher für unterwegs aus, malte ein Schild, Betriebsferien bis Mitte Juli, stellte es ins Fenster, ging raus und drehte den Schlüssel um.
–
Ende der Leseprobe