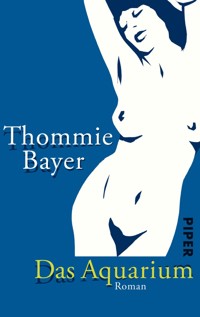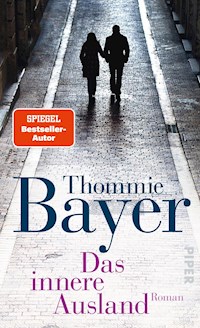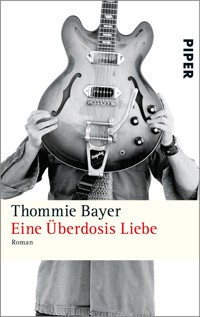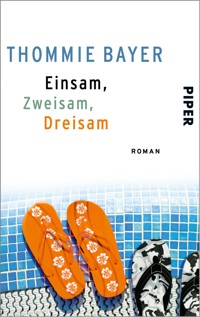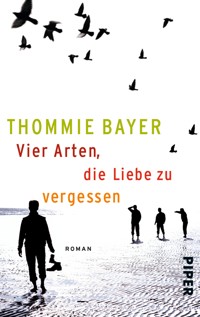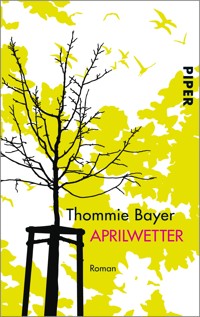9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Spät ist ihm klar geworden, dass er immer nur geflohen ist. Dass er abgehauen ist, wenn es brenzlig wurde. Möglicherweise aber ist dies jetzt der Ort, nach dem er sein Leben lang gesucht hat: ein Bungalow inmitten von Weinbergen und Tabakfeldern, Ahorn und Holunder. Ein Idyll. Sofort schließt er Freundschaft mit der Katze, die schon vor ihm dort lebte. Auch Carmen, der Vermieterin des Bungalows, kommt er schnell näher, teilt ihre kleinen Geheimnisse und öffnet sich ihr. Er lernt wieder, einen Unterschied zwischen Einsamkeit und Alleinsein zu machen. Und schließlich erzählt er auch, was damals mit seiner Frau und seinem Sohn geschehen ist. Mit kleinen Worten und ungewöhnlichen Mitteln widmet sich Thommie Bayer einem großen Thema – der Liebe und dem Sinn, den wir in unserem Leben suchen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für Jone
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
1. Auflage 2011
ISBN 978-3-492-95367-2
© Piper Verlag GmbH 2011 Umschlaggestaltung: Kornelia Rumberg Umschlagmotiv: Neubauwelt
Nur in ihren Träumen werde ihr richtig warm,
sagte sie, und deshalb träume sie gern.
Werner Koch,
»Sakrament, bist du schön.« Die weiße Katze mit den grauen und schwarzen Flecken saß auf einem Holzstoß am Wegrand. Ich ging unwillkürlich langsamer, um sie nicht zu erschrecken, näherte mich bis auf etwa zwei Meter und blieb dann stehen.
Wäre sie am Boden gesessen, hätte ich mich in die Hocke begeben. Das tue ich immer, denn der Charme von Katzen weht mich seit jeher an wie eine Botschaft oder Ahnung, etwas, das ich zwar empfange, aber nicht verstehe und deshalb umso aufmerksamer beachte – vielleicht ist es nur das: Wenn ich eine Katze sehe, dann weiß ich, dass ich lebe.
»Das ist kein Grund zu fluchen«, sagte sie.
»Wie bitte?«
»Hast du schon verstanden.«
»Sprichst du?«
»Klar.«
»Menschensprache?«
»Nicht direkt. Es kommt in deinem Kopf als Menschensprache raus, ich spreche nicht wirklich, es passiert innen, ich muss nicht mal den Mund aufmachen dafür. Oder siehst du mich miauen?«
Sie gähnte, streckte sich, zuerst nach vorne, dann nach hinten, dann nahm sie wieder ihre sitzende Haltung von eben ein und schaute vor sich hin, als warte sie auf das Erscheinen einer Maus direkt zwischen ihren Pfoten. Für mich sah das ein bisschen gelangweilt aus, aber ich konnte mich täuschen, mir war schon klar, dass unsere Körpersprache sich von der katzischen unterscheidet.
»Darf ich näher kommen?«, fragte ich.
»Klar.« Das klang nun aber wirklich gelangweilt.
»Langweile ich dich?«
»Das ist keine Katzenkategorie. Langeweile gibt es nur für Menschen.«
Das klang nun eindeutig arrogant für mich, aber sie darauf hinzuweisen, schien mir sinnlos – ich sah ihre Antwort voraus, auch Arroganz sei keine Katzenkategorie. Also ignorierte ich den Anflug von Ärger, den mir ihr blasierter Ton verursachte, und ging zu ihr, lehnte mich an den Holzstapel und sah ihr in die Augen. Grün und Bernstein. Sie gähnte wieder. Sie hatte Mundgeruch.
»Und das, was du gerade tust, also hier liegen und in die Gegend schauen, wie fühlt sich das an? In Katzenkategorien gedacht?«
»Wie Vordemjagen, Nachdemschlafen oder Vordemspielen oder Nachdemessen.«
»Verarschst du mich?«
»Nein. Ich mag dich.«
»Warum?«
»Weil du mich magst. Und ich seh dir an, dass du schon mal um eine wie mich getrauert hast. Dein Blick ist liebevoll und sehnsüchtig, so als könnte ich vielleicht eine Wiedergängerin derjenigen sein, deren Fehlen du immer noch manchmal an deiner Haut spürst.«
Damit traf sie ins Schwarze. Und zwar mit solcher Wucht, dass ich den Blick von ihr abwandte, weil ich nicht wollte, dass sie sah, was in mir vorging.
Die Augen auf die Wiese gerichtet, versuchte ich, das Thema zu wechseln: »Du denkst also nur deinen Teil des Dialogs und schickst ihn dann auf irgendwie telepathische Weise in mein Gehirn, wo er sauber übersetzt in Menschensprache ankommt?«
»So etwa. Ja.«
»Dann bist du echt was Besonderes.«
»Gleichfalls. Du auch.«
»Wieso?
»Dem Hübschen macht der Spiegel Komplimente.«
Obwohl das nun ganz sicher was Nettes war, wurde ich den Verdacht nicht los, dass sie mich herablassend behandelte. Schon die Form ihrer Antwort, dieser Orakelton, war überheblich.
»Ist ein Spiegel eine Katzenkategorie?«
»Ein Spiegel ist ein Ding, und eine Kategorie ist was zum Denken. Und mit den Unterschieden von Katzensicht und Menschensicht würden wir endlos Zeit vertun«, sagte sie, »tut mir leid, dass ich davon angefangen hab. War meine Schuld.«
Ich legte beide Ellbogen auf den Holzstoß und betrachtete die Wiese mit den Sommerblumen und den etwas weiter entfernten Waldrand. Wo die Katze hinsah, wusste ich nicht, ich jedenfalls schaute auf die sonnige Lichtung und versuchte, die Bienen oder Hummeln zu entdecken, deren Summen ich hörte.
Dieser Ort war wie geschaffen zum Glücklichsein. Der Moment eigentlich auch, aber irgendetwas störte. Anstatt die Unterhaltung mit einer Katze, einer wunderschönen obendrein, zu genießen, stellte ich misstrauische Überlegungen darüber an, ob sie sich eventuell über mich lustig machte. Und wenn schon. Was gab es daran auszusetzen?
»Geht’s dir gut?«, fragte sie neben meinem Ohr.
»Ich weiß nicht so recht«, sagte ich, »manchmal weiß ich’s nicht so recht. Jetzt grad ist das der Fall.«
Ich spürte ihre feuchte Nase an meinem Kinn, dann ihren Pelz, sie war aufgestanden und rieb sich an mir. Dann spürte ich ihre raue Zunge in meinem Haar – sie putzte mich.
»Und jetzt?«, fragte sie nach einigen Minuten intensiver Fellpflege.
»Geht’s mir gut«, sagte ich.
Sie schnurrte.
Dann legte sie sich neben mich, ihre Brust an meinem Oberarm und eine Pfote auf meinem Unterarm. Ihr Schnurren war beruhigende Musik und mischte sich mit dem Geräusch der Bienen oder Hummeln, die ich noch immer nicht sah, aber jetzt auch nicht mehr suchte. Was ich vor Augen hatte, war mir schön genug.
»Hast du einen Namen?«, fragte ich nach einer ziemlich langen Zeit.
»Wir haben nur einen Geruch. Das reicht bei uns. Aber nenn mich ruhig, wie du möchtest. Mir ist jeder Name recht.«
»Flecki?«
»Das musst du mit dir selbst ausmachen. Wenn du den Namen gut findest, dann heiße ich so. Kein Problem.«
Ich gehöre eigentlich zu der Sorte von Menschen, die ihre Katzen irgendwie ironisch tauft, weil sie sich der eigenen Zuneigung schämt, sich vielleicht gar davor ängstigt und deshalb gewollt nüchtern gibt. Ein so kindlich-zärtlicher Name wie Flecki wäre mir früher nicht in den Sinn gekommen – eher irgendwas Verzicktes und verquält Albernes wie Kopernikus, Elvis, Frau Müller oder Erynnie. Um nur ja nicht von etwaigen Besuchern für sentimental gehalten zu werden. Als ob der Ausdruck von Liebe automatisch auf Kitsch rauslaufen müsste. Oder als ob Liebe zu einem Tier eine Art Verfehlung wäre, etwas Blamables, Peinliches, Zweitklassiges.
»Schön, dich zu spüren, Flecki«, sagte ich, und ihr Schnurren wurde von einem erneuten Gähnen unterbrochen, das mit einem Klacken des Gebisses endete.
»Gleichfalls«, sagte sie und schnurrte weiter.
»Unter Menschen geht so was nicht«, sagte ich, »jedenfalls nicht unter Fremden – dass man sich einfach aneinanderschmiegt und freundliche Geräusche dazu macht.«
»Ist auch unter Katzen nicht direkt üblich.«
»Nein? Wieso eigentlich nicht?«
»Isso.«
»Wie?«
»Das. Ist. So.«
»Ach so. Isso. Klar.«
»Und bestimmt ist es eher gut so«, sagte sie, »zumindest bei euch. Stell dir die Missverständnisse vor, die daraus entstehen würden. Du fährst mit dem Zug durch die Nacht, und die Person auf dem Sitz neben dir legt ihren Kopf in deinen Schoß und schläft. Dazu lässt sie noch vertrauensvoll ihre Hand auf deinem Schenkel liegen – wie fühlt sich der Gedanke an?«
»Du hast recht«, sagte ich, »nur mit sehr viel Zusätzlichem erträglich. Nein, eigentlich gar nicht erträglich. Was auch immer ich mir dazu denke – es ist eine Frau, sie ist schön, ich bin einsam und auf der Suche, sie ist ungebunden und mit mir schon fündig geworden, sie ist nicht nur schön, sondern auch klug und mild, genau der Mensch, mit dem ich verbunden sein will, verbunden sein kann, sie denkt dasselbe von mir, wir haben beide die Statur, einander durch alle künftigen Verwandlungen hindurch zu begleiten, und so weiter, und so weiter – es geht nicht. Unmöglich.«
»Nur zwischen Menschen und Katzen.«
»Und da auch nur zwischen manchen, oder?«
»Jetzt hast du’s«, sagte sie, »nur bei denen, die echt was Besonderes sind.«
»Weil sie telepathisch dolmetschen?«
»Das würde ich nicht direkt zur Voraussetzung machen – es ginge auch ohne Gespräch. Überhaupt ist es eigentlich auch nichts Besonderes, was Besonderes zu sein.«
»Und wie meinst du das nun wieder?«
»Wir Katzen sind alle was Besonderes, und die Menschen, die das bemerkt haben, auch. Fertig. Isso. Kein komplizierter Gedanke.«
»Mir wird schwindlig. Du bist eine Rabulistin.«
»Nein, ich bin nur die erste Katze mit Humor, der du begegnest – zumindest die erste, bei der du’s merkst.«
»Du verarschst mich also doch.«
»Wenn du das Verarschen nennst.«
»Was denn sonst?«
»Verbale Zärtlichkeit vielleicht? Plaudern? Ein Streicheln mit Worten, ohne gleich allzu ranschmeißerisch zu sein?«
»Na dann. Gut, dass wir darüber gesprochen haben.«
»Sollen wir ein bisschen schlafen? Es ist so schön warm.«
Sie gähnte wieder, streckte sich und sah mich an.
»Ja. Machen wir«, sagte ich und kletterte auf den Holzstoß, legte mich hin, einen Arm unter den Kopf, den anderen so ausgestreckt, dass sie sich dranschmiegen konnte – sie tat es, schnurrte wieder, und ich spürte ihre Krallen, die sich in mein Handgelenk bohrten. Es war nicht sonderlich bequem, fühlte sich aber dennoch sehr, sehr gut an. Ich schlief ein.
˜
Es war überhaupt nicht bequem gewesen, das wurde mir klar, als ich aufwachte und vor mir zwei kichernde Mädchen und ein ängstlich dreinblickender Junge standen, alle drei mit Fahrrädern und New-York-Yankees-Mützen, und alle drei mit je einem Fuß auf dem Pedal, um sofort losflitzen zu können, falls ich mich als Sittenstrolch, flüchtiger Verbrecher oder sonst wie gefährlich herausstellen sollte. Flecki war verschwunden.
»Seid ihr schon lang da?«, fragte ich.
»Nein«, sagte eins der Mädchen, und: »Sie haben geschnarcht«, das zweite. Der Junge schwieg, schaute aber jetzt ein bisschen weniger ängstlich drein. Vielleicht weil ich seine Sprache beherrschte.
»Habt ihr eine Katze gesehen?«
Der Junge antwortete: »So eine … äh … irgendwie …«
»Weiße?«, fragte ich hoffnungsvoll.
»Ja«, sagte der Junge, »mit so … äh …«
»Flecken?«
»Nein«, sagte der Junge.
»Wenn du sie nicht gesehen hast«, fragte ich, »woher weißt du dann, dass sie weiß war?«
»Weiß ich ja nicht«, sagte er jetzt mutiger, weil er es geschafft hatte, mich reinzulegen, »haben Sie gesagt.«
Schon wieder Humor. Schon wieder auf meine Kosten. Irgendwas stimmte nicht mit diesem Tag. Lag ich vielleicht im Koma, rannten Ärzte um mich herum, die um mein Leben rangen, und mein Gehirn spendierte mir zur Entlastung einen lustigen Landausflug mit Katze, Kindern und Hummeln?
Die Kinder fuhren los – ich war nicht mehr interessant, weder eine Leiche noch ein Verbrecher, nur ein schnarchender Mann auf einem Holzstoß.
»Flecki«, rief ich, als ich die Kinder außer Hörweite glaubte, aber sie blieb verschwunden. Ich suchte noch die Wiese ab, dann den Waldrand, rief immer wieder, dann lehnte ich mich noch eine Zeit lang an den Holzstoß und merkte, dass ich traurig wurde. Ich hatte eine sprechende Katze gefunden und schon wieder verloren.
Und mir wurde klar, dass Flecki nicht der richtige Name für sie war. Ich hätte sie Isso nennen sollen. Oder Groucho. Ich ging zurück zu dem Haus, das ich gemietet hatte, um endlich eine dringende Arbeit in Angriff zu nehmen, einen Essay, den ich schon vor einiger Zeit versprochen, aber so lange vor mir hergeschoben hatte, bis der Ablieferungstermin immer greller im Kalender blinkte. Über die Grenze zwischen Wahrnehmung und Einbildung, den Punkt, an dem Realität zu Fiktion wird, und die Frage, wieso wir uns mit solchen Fragen überhaupt abquälen, da doch alle Wirklichkeit erst durch unsere Wahrnehmung transponiert als Repräsentation, als Erzählung, als Quasi-Fiktion bei uns ankommt. Eine Art Wiedersehen mit der Welt als Wille und Vorstellung. Das würde keinen interessieren. Es interessierte ja nicht mal mich. Aber es gab Honorar, darauf konnte ich nicht verzichten, und ich hatte zugesagt, also musste ich auch liefern.
Die Sonne stand tiefer, das Haus lag jetzt im Schatten, aber es war noch immer so heiß wie zu Beginn meines Spaziergangs und schien auch nicht mehr kühler werden zu wollen. Ich schwitzte von dem kurzen Weg und merkte, dass meine Haut im Gesicht spannte und juckte – ich hatte mir beim Schlafen auf dem Holzstoß einen Sonnenbrand geholt.
Als ich den Schlüssel ins Schloss steckte und herumdrehte, hörte ich ein gutturales Geräusch, es klang nach Taube, war aber Katze.
»Isso?«, rief ich und hörte sie antworten: »Hier. Guck nach oben.«
Sie saß auf dem kleinen Vordach und schaute zu mir herunter. »Schließ auf«, sagte sie, »mach schon. Ich hab Durst.«
˜
Sie sprang mir zuerst auf die Schulter – sie fühlte sich erstaunlich schwer an – dann auf den Boden und ging gleich, als ich die Tür geöffnet hatte, zur Küche. Kannte sie sich aus, oder waren hier alle Küchen rechts vom Eingang? Vielleicht folgte sie auch dem Geruch, Katzen haben feine Nasen. Als ich bei ihr ankam, war sie schon auf die Theke gesprungen und putzte sich die linke Flanke. Nur die linke.
»Wasser?«
»Ja bitte.«
Ich brauchte eine Weile, um ein Schälchen zu finden, sie putzte sich währenddessen weiter, es klang hübsch. Wie eine kleine Bürste, mit der jemand einen kleinen Mantel traktiert.
Als ich das Wasser vor sie hingestellt hatte und sie zu trinken begann, erlebte ich so etwas wie einen Flashback: Mit dem Schnurren und der einen oder anderen Musik ist dieses Geräusch eines der schönsten, an die ich mich erinnere. Es klang vertraut und machte mich traurig.
»Du kannst mir von ihr erzählen«, sagte Isso, ohne ihr Trinken zu unterbrechen.
»Ein andermal«, sagte ich und suchte nach einer brauchbaren Übersprungshandlung, mit der ich meinen schwindelerregenden Anfall von Nostalgie verbergen konnte. Mir fiel nichts ein, außer einem Blick in den Kühlschrank, der mir aber nichts Neues zeigte, denn ich hatte am Vormittag eingekauft und alles Verderbliche verstaut.
»Ich kauf dir Brekkies.«
»Brauchst du nicht.«
Hatte sie gemerkt, dass ich sie verlocken wollte, bei mir zu bleiben? War ihre Antwort eine Absage an diesen Wunsch? Der dezente Ausdruck für ihre Absicht, gleich wieder weiterzuziehen?
»Es ist Sommer«, sagte sie, »ich hol mir eine Maus, wenn ich Hunger habe.«
Las sie meine Gedanken? War sie überhaupt weiblich? Ich hatte ihr nicht indiskret unter den Schwanz geschaut, war einfach davon ausgegangen, dass sie eine Kätzin sei, aber ihre Witze und die etwas kurz angebundene Art hätten auch zu einem Kater gepasst. Allerdings hatte ich keine Ahnung, worin sich Kater und Kätzinnen in der Redeweise unterscheiden könnten. Dass sie überhaupt redeten, war neu für mich.
So wie sie durchs Haus ging, kannte sie sich aus. Sie war nach dem Trinken von der Theke gesprungen und hatte sich, zielstrebig wie mir schien, aufgemacht ins Wohnzimmer, wo sie aufs Sofa hüpfte und sich hinlegte. Die Pfoten vor der Brust nach innen gefaltet. Sie lag da wie ein Brot. Oder ein Schiff.
»Du bist wirklich schön«, sagte ich.
»Hattest du schon erwähnt.« Sie gähnte und machte wieder dieses klackende Geräusch beim Schließen der Kiefer. Dann kniff sie die Augen zu, und ich nahm das als Aufforderung, sie in Ruhe zu lassen.
Ich öffnete die Terrassentür, um ihr ganz beiläufig zu signalisieren, dass ich sie nicht einsperrte, dass sie jederzeit gehen konnte, ich hoffte, ihr mit dieser Geste das Bleiben zu erleichtern. Bei mir funktioniert das. Wer mich zu fest umarmt, wird mich schnell wieder los, wer locker lässt, behält seine Anziehungskraft.
˜
Ich spürte wieder meinen Sonnenbrand im Gesicht und wusste nicht, was ich jetzt tun sollte. Auch schlafen? Nein, dazu war es zu spät. Wenn ich jetzt noch schliefe, dann würde ich zerschlagen und verwirrt aufwachen und nicht mehr in den Abend zurückfinden. Ich nahm mein angefangenes Buch vom Tisch und ging damit nach draußen auf die Terrasse. Eigentlich wäre ich gern dringeblieben und hätte dem Schlaf von Isso gelauscht, aber auf einem Stuhl wär’s mir zu unbequem gewesen, das Sofa gehörte jetzt ihr (oder ihm, falls sie ein Kater war), und den Sessel hatte ich am Morgen nach draußen gebracht, zusammen mit einem Schemel, um den Ausblick auf die Weinberge und Tabakfelder zu genießen.
˜
Ich hatte dieses Haus im Internet gefunden und mich sofort verliebt. Der leicht heruntergekommene Bungalow mit den Rosenbüschen und Holundersträuchern im Garten, dem Ahorn rechts und den drei Birken links der Terrasse, das alles sah schon auf den Fotos aus wie der Ort, nach dem ich ein Leben lang gesucht hatte. Ohne allerdings davon zu wissen – es brauchte den Zufall, die nervöse Lähmung, die mich in der Stadt befallen hatte, den Fluchtreflex und nicht zuletzt dieses näher rückende Abgabedatum, um mir zu zeigen, was ich eigentlich wollte: hier sein und von niemandem bedauert werden.
Eigentlich ließen meine Finanzen solche Extravaganz nicht zu. Ein Ferienhaus zu mieten, nur um eine Arbeit in Angriff zu nehmen, hieß, weit über meine Verhältnisse zu leben. Aber der Charme dieser Bilder im Internet war stärker gewesen als meine ansonsten verlässliche Zurückhaltung beim Geldausgeben. Vielleicht verbarg sich ja etwas für mich bis dahin Unhörbares und Undenkbares als Flüstern im Subtext: Hier wartet die sprechende Katze auf dich.
Ich spürte, wie sich mein Gesicht verzog – ich lächelte amüsiert über mich selbst. Die sprechende Katze gab es natürlich nur in meinem Kopf. Da drinnen im Haus schlief zwar eine echte, aber dass sie mir Rede und Antwort stand, bildete ich mir selbstverständlich ein. Ich bin nicht der heilige Franziskus. Und ich bin kein Spinner. Nicht dass ich wüsste jedenfalls.
Ich bin ein Realist. Zumindest versuche ich einer zu sein, auch wenn ich mich in angstvollen Momenten dabei erwische, dass ich Gott oder irgendetwas Ähnliches anrufe. »Bitte mach, dass der Befund negativ ist«, sage ich dann zum Beispiel in meinen vor lauter Panik leeren Kopf hinein und will glauben, wenigstens in diesem Moment, dass jemand die Macht hat, dieser Bitte zu entsprechen. Ich brauche einen Gott, wie jeder Mensch, dabei weiß ich, dass es keinen geben kann. Die Faktenlage spricht dagegen.
Ich hatte sie nicht kommen gehört. Auf einmal sprang sie in meinen Schoß, blickte mich an und sagte: »Kannst du eine Weile stillhalten?«
»Sicher«, sagte ich, und sie kringelte sich rund, legte den Schwanz um sich und die Pfoten nebeneinander auf meinen Schenkel und schaute ins Tal. Das heißt, ich nahm an, dass sie ins Tal schaute, ich sah ihr Gesicht nicht.
»Sehr aufgeräumt siehst du aus«, sagte ich.
Sie gähnte.
˜
Ende der Leseprobe