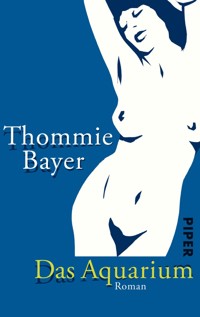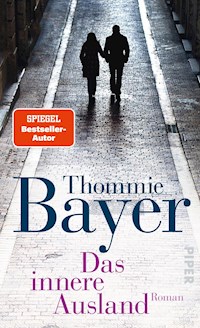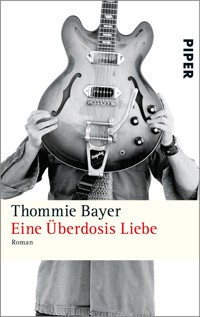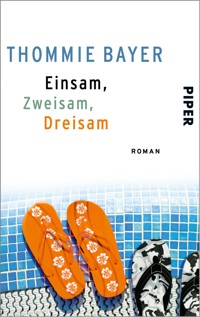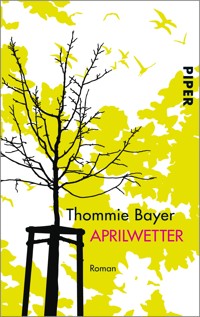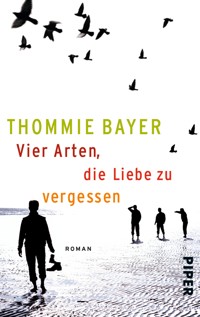
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nicht wenige Trauergäste haben nach ihrem Gesang Tränen in den Augen.Und gleich an Emmis Grab beschließen die vier alten Schulfreunde, sich noch einmal zu treffen, auf ein Wochenende in Venedig. Sie begegnen einanderals Fremde, Michael, Bernd, Wagner und Thomas. Doch in der weltläufigen Atmosphäre des venezianischen Palazzo, in den Michael sie zuihrer großen Überraschung eingeladen hat, legen rasch alle ihre Masken ab. Dahinter kommen Erfolge und Enttäuschungen hervor. Vor allem aber diegroße, unbeantwortete Frage nach der Liebe – und warum sie alle so kläglichan ihr gescheitert sind. Allen voran Michael, dem das Leben nach Emmis Beerdigung vielleicht noch eine letzte Chance gibt.»Vier Arten, die Liebe zu vergessen« erzählt von den großen Themen des Lebens: Respekt, Freundschaft, Liebe und der Kraft, unsere Enttäuschungen zu überwinden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für Jone
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Taschenbuchausgabe
1. Auflage 2013
ISBN 978-3-492-95842-4
© 2012 Piper Verlag GmbH, München Stadtplan: cartomedia, Karlsruhe Umschlaggestaltung: Kornelia Rumberg Umschlagmotiv: plainpicture / Arcangel Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck
If I knew where the good songs come from,
I’d go there more often.
Leonard Cohen
Prolog
Die kleine Maschine flog durch ein Gewitter, wurde hin und her geschlagen von Böen, sackte in Luftlöcher und schien nur mit Mühe voranzukommen durch das immer wieder von Blitzen erleuchtete Dunkelgrau. Michael war froh, nichts weiter im Magen zu haben als einen Espresso und ein Stückchen Pansecco, das würde im Ernstfall (noch zwei Luftlöcher mehr) in den Pappbecher passen, den man im Gepäcknetz am Sitz vor ihm beim Putzen übersehen hatte.
Der Platz neben ihm war leer, und die Stewardess saß zum Landeanflug angeschnallt hinten, also konnte niemand Michaels weißes Gesicht und seine um die Sitzlehnen gekrampften Hände sehen. Nicht, dass ihm das besonders peinlich gewesen wäre, aber den besorgten Blick einer Stewardess wollte er jetzt nicht auf sich ziehen. Auch wenn die Uniformen nicht mehr so flott und streng und dunkelblau wie in den Siebzigerjahren waren und die Frisuren nicht mehr im damaligen Einheitslook nach hinten gebunden und von Spangen oder Knoten gezähmt, der Anblick einer Stewardess beschwor ihm noch immer zuverlässig den Anblick seiner Mutter herauf. Und dieser Anblick tat noch immer weh.
Nicht mehr wie damals natürlich, nicht mehr wie ein Medizinball, sondern eher wie eine hart geworfene Murmel auf dem Solarplexus, aber dennoch, es blieb ein Reflex, den er in sechsunddreißig Jahren nicht losgeworden war: Er sah das im Haar festgesteckte blaue Käppi, die grauen Augen und roch den Vanilleduft seiner Mutter, als sie sich über ihn beugte, mit der Hand über seine fiebrige Stirn strich und sagte: »Papa passt auf dich auf, ich bin übermorgen wieder da. Werd schnell gesund, mein kleiner Schwan.« Und dann hupte unten auf der Straße der Wagen, der sie abholte und zum Flughafen brachte, wo sie den Jumbojet mit der Flugnummer 540 bestieg, der acht Stunden später in Nairobi zwischenlanden und kurz nach dem Start wieder auf den Boden aufschlagen und explodieren würde.
Die Böen ließen nach, je tiefer die Maschine sank. Als die Landebahn in Sicht kam, ging alles wieder glatt, der Spuk war vorbei, vom Aufsetzen der Räder fast nichts zu spüren, und mit dem Langsamerwerden des Flugzeugs änderten die Regenschlieren am Fenster ihren Lauf von fast waagerecht zu schließlich senkrecht. Nur Michaels Fingerknöchel waren immer noch weiß wie das Innere von Radieschen.
Den Blick der Stewardess mied er, als er an ihr vorbeikam, er sagte Arrivederci zum hellgrünen Teppichboden und tat so, als müsse er seine Hose nach unten zupfen. Auf dem Weg zum Mietwagenschalter kam ihm zu Bewusstsein, dass er ja aus Süden angeflogen war und jetzt wieder nach Süden fahren musste – er würde dasselbe Gewitter noch mal abkriegen. Diesmal von oben. Mit festem Boden unter sich. Aber wohl erst in einer halben Stunde oder später – hier am Flughafen Franz-Josef-Strauß regnete es nur noch Bindfäden. Das Dunkelgrau wartete weiter südlich auf ihn.
Als der Kunde vor ihm die Autoschlüssel an sich nahm, sah Michael sich in der Halle um, ob er vielleicht einen seiner Freunde von damals entdecken würde. Wenn sie nicht mehr in München oder in der Nähe lebten, konnten sie auch geflogen sein und müssten, wenn sie pünktlich zur Beerdigung kommen wollten, jetzt oder in den nächsten Minuten zu einem der Mietwagenstände oder den Taxis eilen. Es war kurz vor zehn. Die Feier sollte um elf anfangen. Höchste Zeit.
~
Als er endlich die Autobahn nach Salzburg erreicht hatte, war es schon nach halb elf. Von Thomas, Bernd oder Wagner hatte er nichts gesehen, das wäre wohl auch zu viel Zufall gewesen. Er näherte sich dem Dunkelgrau, aber als die Tropfen auf seiner Windschutzscheibe zahlreicher wurden, war er längst wieder von der Autobahn abgebogen und fuhr auf ein Wäldchen zu, und erst als er dieses erreicht hatte, ging es richtig los.
Ob seine Fingerknöchel schon wieder weiß waren, interessierte Michael jetzt nicht, er hatte beide Hände am Steuer und konzentrierte sich auf das bisschen, was er sah. Der Wagen, hässlich, aber handlich, wühlte sich durch den Regen, die überforderten Scheibenwischer schlugen hektisch hin und her, ohne Chance, den stetigen, schlierigen Strom für länger als den Bruchteil eines Augenblicks von der Frontscheibe zu werfen. Ihr schnelles, dumpfes Klopfen zerrte an Michaels Nerven, es klang, als prügle sich der Wagen durch einen wütenden Mob. Das Gesicht nah an der Scheibe, um den Straßenverlauf zu erraten, ging Michael vom Gas, sobald er eine Wegeinfahrt entdeckt hatte, in der er den Volvo endlich zum Stehen bringen konnte.
Er war noch nicht ganz eingebogen, da brüllte ein Motor hinter ihm auf, ein schwarzer Geländewagen schoss rauschend vorbei, und eine Wasserwand wurde gegen die Fahrerseite des Volvos geschleudert.
Arschloch, dachte Michael, fahr heim nach Neanderthal. Oder an den nächsten Baum. Meinetwegen auch an den übernächsten.
~
THOMAS sah fast nichts, aber was sollte es da auch groß zu sehen geben. Senkrechtes Wasser und eine waagerechte Straße? Arschloch, dachte auch er, als der silberne Volvo vor ihm auftauchte und immer noch langsamer wurde, was Thomas zu einem bei diesem Wetter riskanten Schlenker nötigte. Zum Glück steckte der Cayenne das weg, ohne auszubrechen und in den Wald zu krachen.
~
BERND wurde durchgeschüttelt. Dieser Weg war nichts für einen Mercedes und erst recht nicht bei diesem Wetter. »In fünfhundert Metern rechts abbiegen«, sagte die irgendwie toupiert klingende Stimme seines Navis, und er antwortete ihr wie immer höflich: »Mach ich, Gundi. Danke.« Dass er seine Navi-Stimme Gundi nannte, wusste niemand, er sprach nur mit ihr, wenn er allein unterwegs war.
Diesmal hatte sie seine Höflichkeit strapaziert, hatte ihn auf diesen schmalen Waldweg gelotst, wo er befürchtete, in irgendeiner Kiesgrube zu landen, deshalb fuhr er langsamer, als es der dichte Regen ohnehin schon erzwang, um einen eventuellen Abbruch der Straße rechtzeitig zu erkennen.
»Rechts abbiegen«, sagte Gundi jetzt wieder, und daran erkannte Bernd, dass er sich kurz vor der Abzweigung befinden musste. Dieser Regen war eine Sintflut. Man sah höchstens vier, fünf Meter weit und nur schemenhaft. Den Scheibenwischern gelang es kaum, die Wassermassen wegzustemmen.
Bernd wurde noch langsamer, denn jetzt stand da ein silberner Wagen quer auf dem Weg und blockierte ihn. Er hupte zweimal kurz und hoffte, der Wagen stünde nicht ohne Fahrer da, sonst könnte er hier schwarz werden oder umdrehen und Gundi irgendwo, zurück in der Zivilisation, wieder neu rechnen lassen.
~
MICHAEL erschrak. Arschloch von hinten, Arschloch von rechts, und das alles unter Wasser, dachte er und startete den Motor, um den Förster oder was das war, von weiterem Gehupe und Geblinke abzuhalten. Er bog in die Straße ein – inzwischen lag die Sicht wieder bei etwa sechs Metern –, als er gerade auf dreißig Stundenkilometer beschleunigt hatte, fegte der Förster schon zischend an ihm vorbei und verschwand in der großen, wild gewordenen Waschanlage vor ihm.
Nicht die Laune verderben lassen, nahm er sich vor, obwohl es da eigentlich nichts mehr zu verderben gab. Dieses Wetter war, in der Luft wie am Boden, eine Zumutung, das Auto war ihm fremd, und er fuhr zur Beerdigung seiner alten, verehrten Lehrerin. Trotzdem sang er laut und noch erstaunlich intonationsfest: We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.
Der Regen ließ nach, das Gefuchtel des Scheibenwischers verlangsamte sich automatisch, und die Stimme des Navis unterbrach seinen Gesang: »Dem Straßenverlauf folgen.« Er beschleunigte und fühlte sich entkommen, nach wenigen hundert Metern fielen die letzten Tropfen und öffnete sich der Blick in eine weite, sattgrüne Hügellandschaft mit Zwiebeltürmen, Schafherden, einer Hochspannungsleitung, die sich von Mast zu Mast schwang und hier und da von einer Gruppe pausierender Vögel besetzt war.
Als ihn ein Taxi überholte, spürte Michael, dass er sich bei der Unterwasserfahrt verkrampft hatte, und massierte sich mit der rechten Hand notdürftig den Nacken, drehte den Kopf hin und her, legte ihn schief, überdehnte den Hals nach vorne und hinten, bis der Atlas knirschte, und schuf sich so ein wenig Erleichterung. Noch acht Komma vier Kilometer bis zum Ziel zeigte der Bildschirm des Navis.
~
WAGNER gab den Versuch auf, seinen Artikel zu Ende zu lesen. Der Taxifahrer war Gott sei Dank schweigsam. Nicht einmal der Starkregen vorhin hatte ihn aus seiner stoischen Geradeausorientierung gebracht, er war nur vom Gas gegangen, hatte eine Art sarkastisches Grunzen verlauten lassen, vielleicht war es auch ein Lachen gewesen, ein halbwegs missbilligendes Geräusch jedenfalls – dann hatte er sein Taxi in die Nässe gebohrt und sich nicht weiter über diesen widrigen Umstand geäußert.
Wagner saß hinten, die Süddeutsche Zeitung jetzt auf den Knien, und hörte ein Lied in seinem Kopf: I’d like to be under the sea, in an octopus’s garden in the shade. Er war dem Fahrer dankbar, dass er ihn nicht mit Gerede behelligt hatte, und deshalb entschlossen, ein lobendes Trinkgeld auf den Fahrpreis draufzulegen. Die Tauchfahrt hatte zum Glück nicht lange gedauert, vielleicht zehn Minuten, höchstens zwölf, Wagner konnte instabile Zustände nicht leiden. Schon als Kind hatte man ihn weder auf eine Achterbahn noch auf ein Riesenrad oder auch nur Skier locken können – eine Rolltreppe oder ein Aufzug waren das Äußerste an Bodenturbulenz, das er ertrug. Ihm wurde nicht übel, sein Magen war robust, das Problem musste irgendwo in seinem Gehirn liegen: Es war Angst, was ihn erstarren, erbleichen und nach der nächstbesten Ablenkung suchen ließ, wenn der Seismograf in seinem Innern ausschlug.
Kapitel 1
MICHAEL musste auf den Grasstreifen neben der schmalen Straße ausweichen, als ihm kurz vor dem Friedhof das Taxi wieder entgegenkam. Auch der Taxifahrer lenkte seinen Wagen vorsichtig mit höchstens fünf Stundenkilometern halb über die Wiese, sodass sie, jeder mit erhobener Hand den anderen grüßend, ohne Kratzer aneinander vorbeikamen.
Der Parkplatz war voll, aber kein Mensch mehr zu sehen. Also kam er zu spät. Michael sah auf seine Uhr: Viertel nach elf. Ohne den Regen hätte er es vielleicht noch pünktlich geschafft, jetzt musste er sich möglichst unauffällig hineinschleichen und hoffen, dass er die Trauerfeier nicht allzu sehr störte.
Die Zentralverriegelung quietschte und klackte, als er den Knopf auf dem Schlüssel drückte. Er schob seinen Krawattenknoten zurecht und kontrollierte dessen Sitz im Außenspiegel. Dann nahm er eine Zigarette aus der Packung, die er schon beim Aussteigen in der Hand gehalten hatte, und zündete sie mit einem Streichholz an. Er benutzte nie ein Feuerzeug, jedenfalls nicht, solange Streichhölzer in Reichweite waren, er mochte den Geschmack des Schwefels beim ersten Zug, obwohl er wusste, dass das Rauchen so noch schädlicher war.
Er ging die hundert Meter bis zur Kapelle langsam, um die Strecke mit der Zigarettenlänge in Übereinstimmung zu bringen, trat vor der Tür die Kippe aus, bückte sich danach, hob sie auf und warf sie in einen Papierkorb. Bevor er den scheußlichen geschmiedeten Türgriff in die Hand nahm, um die noch scheußlichere geschnitzte Tür möglichst leise aufzuziehen, dachte er noch, Emmi, ich bin da.
Drinnen sprach ein Pfarrer. Michael sah Wagner, Bernd und Thomas in der zweiten Reihe. Nichts schien sie miteinander zu verbinden, ihrem Aussehen nach konnte man sie für Fremde halten, die nur zufällig nebeneinandersaßen. Wagner wirkte ungepflegt mit langen Haaren und gammeliger Kleidung, Bernd sah drahtig und übertrainiert aus, Thomas war korpulent geworden und trug eine Art aggressiver Zufriedenheit zur Schau.
Sie hatten einen Platz für ihn frei gehalten. In der voll besetzten ersten Reihe kannte er niemanden außer Angela, der Tochter der Verstorbenen, und weiter hinten sah er noch zwei Klassenkameraden, an deren Namen er sich nicht mehr erinnerte, und einen sehr krummen alten Mann, in dem er den Internatsleiter von damals zu erkennen glaubte.
Thomas winkte ihm mit solch überdeutlicher Unauffälligkeit zu, dass sich alle Blicke sofort auf Michael richteten und er, so schnell er konnte, zum freien Stuhl ging und sich setzte.
»Auch schon da«, flüsterte Thomas und lenkte damit auch noch den Unmut des Pfarrers auf sie.
»Halt die Klappe«, sagte Michael sehr leise und nickte dem Pfarrer zu, um sich zu entschuldigen und zu signalisieren, dass er seine Ansprache fortsetzen solle.
Die handelte vom Frieden in der Welt, den jeder Einzelne schaffen könne, indem er achtsam auf seinen Nächsten blicke und sich dessen Sorgen und Nöte vergegenwärtige. Dann haben also die Nachbarn von Hitler versagt, dachte Michael und gab sich Mühe, seinen Gesichtsausdruck nicht die Geringschätzung spiegeln zu lassen, die er für solch gratisgütiges Gerede empfand. Er warf einen vorsichtigen Blick auf die anderen und sah, dass Bernd aufmerksam in seinen Schoß starrte, als befürchte er, dort eine Erektion zu entdecken, und Thomas ausdruckslos das (natürlich ebenfalls scheußliche) Buntglasfenster an der Kapellenwand fixierte, nur Wagner hatte den Kopf in den Händen, die Ellbogen auf den Knien und beugte sich interessiert und offenbar einverstanden mit den Textbausteinen des Redners nach vorn.
Bernd sah her und nickte. Michael nickte zurück und gab sich den weiteren Worten des Pfarrers hin. Wenigstens kam er jetzt auf Emmi Buchleitner, die Verstorbene, erzählte von ihrer Kindheit als adoptiertes Flüchtlingskind auf einem Bauernhof, ihrem zähen Willen, etwas aus ihrem Leben zu machen, ihrem segensreichen Wirken als Lehrerin am hiesigen Internat, den Fächern Englisch, Französisch und Musik, die sie erfüllt habe mit ihrer Leidenschaft und Güte – das stimmte immerhin: Sie war eine mitreißende Lehrerin gewesen, und nicht nur Michael, Thomas, Bernd und Wagner hatten sie geliebt.
Jetzt ging es noch um ihre Zeit als Chorleiterin hier in der Stadt, ihr ehrenamtliches Engagement und die Freundschaften, die sie bis zuletzt gepflegt habe und die ihr Halt und Stütze in manch schwerer Stunde gewesen seien – es driftete wieder ab ins Beliebige, und endlich kam auch Gott ins Spiel, der sie nun im Alter von sechsundsiebzig Jahren zu sich gerufen habe und sich ihrer annehme, wie er sich aller annehme, die ihr Leben in seine Hände legten etc.
Mit Gott hatte sie zu unserer Zeit nichts am Hut, dachte Michael, der war ihr herzlich egal. An der Musik lag ihr mehr. Und an uns. Ihren Nachtigallen. Von denen sie zum letzten Mal vor zwanzig Jahren besucht worden war, nach einem Klassentreffen, an dem Emmi wegen eines gebrochenen Oberschenkels nicht hatte teilnehmen können.
Der Pfarrer schlug sein Buch zu, und in den letzten Reihen entstand Bewegung. Michael hatte sich noch nicht ganz umgedreht, da sang schon ein Chor – ziemlich gut – das Ave-Maria von Bach-Gounod. Er sah nicht zu Thomas, Bernd und Wagner hin. Falls sie ungerührt von der Musik blieben, wollte er das nicht wissen.
~
Am Grab, nachdem der Pfarrer ein Gebet gesprochen hatte, zog Angela die kleine Schaufel aus dem Erdhügel, in dem sie steckte, warf damit ein wenig Erde auf den Sarg und reichte die Schaufel an Michael weiter, obwohl sie damit den Chor und einige andere Leute überging, die näher am Grab standen und eher an der Reihe gewesen wären. In Angelas Augen stand etwas wie Trotz und auch etwas wie Zuneigung, es war, als wollte sie sagen, euch hat sie mehr geliebt, ihr seid als Nächste dran. Michael nahm die Schaufel aus ihrer Hand, warf Erde ins Grab und gab an Thomas weiter. Der gab an Wagner weiter und dieser an Bernd. Erst dann kam der Rest der Trauergemeinde an die Reihe. Es war ein seltsamer Augenblick: Sie gehörten auf einmal wieder zusammen.
Ohne sich verständigt zu haben, blieben sie stehen, als die anderen Trauergäste sich nach den Beileidsbekundungen auf den Weg zum Ausgang machten. Es war Bernd, der leise sagte: »The parting glass, oder?«
Die anderen nickten nur, und Thomas gab wie früher den Ton vor. Er summte ein A, ein Fis und ein D und zählte ein. Es klang nicht so wie damals, aber doch erstaunlich sicher, so sicher, dass Emmi es zu schätzen gewusst hätte, als sie sangen: Oh, all the money ever I had, I spent it in good company, and all the harm that ever I’ve done, alas, it was to none but me …
Michael spürte eine Gänsehaut und musste sich beherrschen, um die aufsteigenden Tränen zu unterdrücken und seiner Stimme kein Schwanken zu erlauben. Sie sangen alle drei Strophen, die Augen stur aufs Grab gerichtet, und Michael fühlte sich zum ersten Mal an diesem Tag Emmi wirklich nahe. Es tat ihm leid, dass sie nicht mehr leben durfte, es tat ihm leid, dass er nie mehr hier gewesen war, es tat ihm leid, dass ihre Nachtigallen seit vielen Jahren nichts mehr miteinander zu tun hatten, dass sie sang- und klanglos weiterlebten, als wären sie nicht durch etwas verbunden gewesen, das sie Emmi verdankten und ihr zu Ehren hätten festhalten müssen. Das Lied klang mit jedem Vers besser.
Nach dem letzten Ton blieben sie einen Moment stehen, und sie waren nicht mehr vier Fremde wie noch wenige Minuten zuvor, sondern eine Einheit wie damals, und erst als sie spürten, dass langsam wieder ein Blatt Papier zwischen sie passen würde, wandten sie sich zum Gehen.
Da stand die gesamte Trauergemeinde. Alle waren noch einmal zurückgekommen. Leise, so leise, dass das Quartett sie nicht hatte hören können, trotz des Kieses auf den Wegen. Niemand klatschte, aber mancher hatte Tränen in den Augen, einige schluchzten oder schnäuzten sich, andere hatten diese leeren Mienen aufgesetzt, die ihr Innerstes vor den Blicken der Umstehenden verbergen sollten. Angela, mit nassen Augen, aber breitem Lächeln, kam her und küsste sie alle vier auf die Wangen. Es war ein so erhebender wie peinlicher Moment. Als Angela Michael küsste, hörte er sie flüstern: »Das wird sie euch nicht vergessen.«
Dann hakte sie sich bei ihm unter und sagte: »Wir gehen zum Haus.«
~
Auf dem Weg nach draußen fanden sich, ohne dass jemand bewusst den Schritt beschleunigt oder verlangsamt hätte, nach wenigen Metern die Trauergäste zu Grüppchen zusammen, und als Angela sich um den Schulleiter und seine ähnlich gebrechliche Haushälterin kümmerte und zurückblieb, waren die vier Nachtigallen wieder unter sich. Michael bot seine Zigarettenschachtel an, aber nur Bernd griff zu und ließ sich Feuer geben. Wagner sagte, er habe damit aufgehört, und Thomas schniefte verächtlich und antwortete auf Michaels fragenden Blick: »Das ist unter meiner Würde.«
Auf dem Parkplatz wurde auch klar, was er damit gemeint hatte, denn er holte sich eine Zigarre aus dem Handschuhfach seines Wagens und zündete sie mit entsprechendem Zeremoniell an: Spitzen abschneiden, Mundstück nass lecken, paffen und mit geschlossenen Augen den ersten Zug nehmen, dann genießerisch zustimmend nicken und die Zigarre mustern, als habe er ein besonders wohlschmeckendes Exemplar erwischt.
Jetzt zeigte sich auch, dass Michael der Anfänger gewesen war, der Thomas und Bernd im Regen behindert hatte. Michael wusste, was sie dachten, als er die Tür des Volvos öffnete, um die Zigarettenschachtel auf den Beifahrersitz zu werfen. Er lächelte.
»Wir hätten Kolonne fahren können«, sagte er.
»Dann wären wir jetzt noch nicht da«, sagte Thomas.
»Ich bin doch da.«
»Rechthaber.«
Sie standen eine Weile schweigend, sahen den anderen Trauergästen beim Einsteigen und Wegfahren zu und spürten dem Verebben ihres Zusammengehörigkeitsgefühls nach. Wagner, der nichts in den Händen hatte, um seine Verlegenheit zu überspielen, verwickelte die Amsel in der Akazie über ihnen in ein Zwiegespräch. Er pfiff ihre Melodie nach und spornte sie dadurch zu immer gewagteren Kadenzen an, es klang artistisch und gut gelaunt, wie die beiden sich immer größeren Herausforderungen stellten und schließlich in Respekt voreinander verstummten.
Bernd, Michael und Thomas klatschten, als der kleine Sängerwettstreit beendet war und sich die Amsel mit Schwung in die Luft erhoben und nach irgendwohin schwirrend verabschiedet hatte.
»Du kannst es noch«, sagte Bernd.
Wagners Talent als Vogelstimmenimitator hatte ihnen den Namen gegeben und eine ihrer beliebtesten Nummern hervorgebracht. Damals waren bei einem Auftritt im Freien drei der Mikrofone ausgefallen, und Wagner überbrückte spontan die peinliche Pause mit seiner Nachtigallenimitation, die er bis dahin allenfalls in Sommernächten vor den Fenstern der Mädchenschlafräume zum Besten gegeben hatte. Thomas, der an dem kleinen Mischpult herumfummelte, dessen Funktionen er nicht so richtig kannte, probierte Bassdrumgeräusche aus, und als die hörbar waren, sang Michael eine Kontrabasslinie, bis auch sein Mikro wieder im Spiel war, Bernd zischte den Rest eines Schlagzeugs dazu, bis der fliegende Soundcheck fertig war und Thomas den Song einzählte, den sie eigentlich hatten singen wollen: Yes it is von den Beatles. Damals bestand die Hälfte ihres Repertoires aus Beatles- und Beach-Boys-Stücken und der Rest aus Schlagern der Dreißiger- und Fünfzigerjahre, ein paar Folksongs und zwei Broadway-Nummern.
Wagner musterte die Autos der anderen, den nicht mehr ganz neuen Mercedes-Kombi von Bernd, den Porsche Cayenne von Thomas und den schafsgesichtigen Volvo, den Michael gemietet hatte, bevor er fragte: »Kann ich bei dir mitfahren?«
»Klar«, sagte Michael. Er wusste, was Wagner dachte: Mercedes und Porsche waren Symbole von Wohlstand und Gediegenheit, die er für sich ablehnte, der Volvo war es aus unerklärlichen Gründen nicht. Schwedische und französische Autos wurden von den richtigen Leuten gefahren, Porsche, Mercedes und BMW von den falschen.
~
Als die drei Wagen vom Parkplatz des Friedhofs fuhren und eine Kolonne bildeten, hatte sich das Gefühl zusammenzugehören wieder verflüchtigt. Jetzt waren nur noch vier Männer Mitte vierzig in derselben Richtung unterwegs, die jeder für sich das Altwerden von sich wiesen: der eine, indem er, um seine Stirnglatze zu kompensieren, das ergrauende Haar bis auf den Hemdkragen wachsen ließ, der andere, indem er sich beim Squash quälte, um das Äußere eines asketischen Topmanagers mit ultrakurzen Haaren und elastischem Gang zu kultivieren, der Dritte, indem er sich so gehen ließ wie eh und je, ohne wahrhaben zu wollen, dass Faulheit, gutes Essen und viel Alkohol ihre Spuren hinterließen, und der Vierte mit einer Art gepflegter Neutralität, die ihn fast unsichtbar machte.
Zu dieser Neutralität passte auch der Volvo, den Michael steuerte. Natürlich hatte er ihn nicht ausgesucht, er war ihm einfach zugeteilt worden, und ihm war egal, was, er fuhr vom Münchner Flughafen hierher und wieder zurück. Nicht egal aber war ihm der Anzug, den er trug: Er kleidete sich zurückhaltend, aber gut, was ihm gelegentlich interessierte Blicke nicht mehr ganz junger Frauen einbrachte, die er allerdings nicht als Lob oder gar Avancen verbuchte, sondern als schlichten Existenzbeweis.
~
WAGNER hatte sich immerhin rasiert. Mehr Aufwand schien ihm nicht angebracht. Zu seinen langen Haaren passten das angejahrte und nicht sehr saubere dunkelbraune Cordjackett, die verblichenen schwarzen Jeans, die Turnschuhe und das blau-weiß karierte Hemd, das er ohne Krawatte trug. Er hätte das Gefühl gehabt, seine eigene Persönlichkeit, die er immer noch mit Hingabe studierte, erklärte und wichtig nahm, zu verbiegen, wenn er Emmi zuliebe im Anzug gekommen wäre. Im eigenen Kleiderschrank hätte er keinen gefunden, sein Geiz, den er für ökologisches Bewusstsein hielt, hätte ihm verboten, einen zu kaufen, und in seinem Bekanntenkreis hätte er keinen zum Ausleihen aufgetrieben, weil man dort ebenfalls keine Anzüge trug. Anzüge waren so etwas wie Mercedesse: Ausdruck falschen Bewusstseins.
~
BERND hatte sich einen Anzug gekauft. Seit Jahren war dies die erste Beerdigung, an der er teilnahm, und sein Gefühl für das, was Emmi erfreuen würde, ließ keine andere Möglichkeit zu. Er hatte im Schrank einen blauen und einen grauen für seltene berufliche Anlässe, ein schwarzer hatte ihm noch gefehlt. Die knapp dreihundert Euro, die er im Outletcenter dafür hatte hinlegen müssen, reuten ihn zwar ein bisschen, aber es musste eben sein.
~
THOMAS hatte nur in die Kammer gehen müssen, die ihm als Kleiderschrank diente, sich einen der drei schwarzen Anzüge von der Stange nehmen, ein dunkelgraues Trussardi-Hemd, eine rohseidene Krawatte in Schwarz- Grau- und Sandtönen von Missoni dazu, und fertig. Alles, was hier lag und hing, war sichtbar teuer und für alle Eventualitäten vom offiziellen Empfang bis zur lässigen Gartenparty sortiert. Sich anpassen und trotzdem auffallen war Thomas’ Überschrift für seinen Kleidungsstil – ebenso wie Wagner betrachtete er alles, was er an und um sich hatte, als Zeichen.
~
MICHAEL kannte die Strecke zu Emmis Haus und fuhr jetzt nicht mehr wie ein alter Mann. Aber er hatte das Gefühl, am falschen Ort zu sein. Er hätte nicht herkommen sollen. Oder vielleicht ein andermal, nicht heute, nicht zur Beerdigung.
Weder auf dem Weg zwischen Kapelle und Grab noch auf dem Parkplatz hatte einer der vier gefragt, was die anderen machten, wie es ihnen ging, wie und wo sie lebten, ob sie noch die Berufe ausübten, von denen sie zwanzig Jahre zuvor beim Klassentreffen erzählt hatten, ob sie noch mit ihren damaligen Frauen und Familien zusammen waren – keiner hatte sich eine solche Zutraulichkeit erlaubt, denn es war klar, dass sie weit voneinander entfernt in verschiedenen Welten lebten und die Gefahr bestand, dass sie einander nichts oder nur Unfreundliches zu sagen hätten, wenn einer seine Vorsicht aufgäbe und sich zu nah heranwagte.
Eine Art Zwischenschritt machte nun Wagner, als Michael den Wagen in der Nähe des Rathauses abstellte, weil in dem engen Sträßchen vor Emmis Haus kein Parkplatz mehr zu finden war. Er fragte: »Hast du sie mal gesehen in der letzten Zeit?«
»Emmi? Nein, seit damals, als wir sie im Krankenhaus besucht haben, nicht mehr. Ich hab ein schlechtes Gewissen deshalb. Ich hab einfach nicht mehr an sie gedacht, und jetzt ist sie tot.«
»Ich hab ihr mal geschrieben«, sagte Wagner, »ist aber auch schon neun Jahre her.«
Dass er sie nur um ihre Unterschrift für eine Petition an den Bundestag gebeten hatte, in der es um die Teilnahme am Afghanistankrieg gegangen war, verschwieg er.
»Jetzt ist es jedenfalls zu spät«, sagte Michael und schloss den Wagen ab. Es war heiß, aber bewölkt – sie zogen beide ihre Jacketts aus, als sie den kurzen Fußweg zum Haus antraten.
~
Angela hatte im Garten ein Buffet angerichtet. Die Trauergäste saßen auf Bierbänken und beschäftigten sich mit den vor ihnen stehenden Tellern, Kaffeetassen, Weißwein- und Wassergläsern. Die Gespräche klangen gedämpft und tastend, weil der Garten nicht groß genug war, um jedem der Grüppchen, die sich auf dem Weg vom Grab gefunden hatten, einen eigenen Platz zu bieten – jetzt saß man wieder Fremden gegenüber, die man nicht kannte und nichts zu fragen wagte.
Bernd und Thomas standen schon vorn in der Schlange am Buffet, als Michael und Wagner eintrafen und sich an deren Ende stellten.
»Ihr habt schön gesungen«, sagte eine Frau, die vor ihnen in der Reihe wartete, »das war echt ergreifend.«
»Vor allem war’s ein Wagnis«, sagte Michael, »das hätte auch schiefgehen können.«
»Ist es nicht«, sagte die Frau. »Kennt ihr mich eigentlich noch?«
»Ehrlich gesagt, nein«, antwortete Wagner, »sei nicht böse. Ich jedenfalls nicht«, und er sah Michael fragend an, in der Hoffnung, der rette womöglich die peinliche Situation.
»Siggi«, sagte sie lächelnd. »Sigrid Möhlin, damals Gerstner.«
»Au, du hast dich verändert. Entschuldige«, sagte Michael. »Hallo, Siggi.«
»Klar hab ich das. Ihr auch. Ich hätte euch auch nicht erkannt, wenn ihr nicht gesungen hättet.«
Jetzt kam das Gespräch auf, das sie bislang vermieden hatten. Siggi erzählte von ihrem Beruf als Sportlehrerin in Passau, ihren gelegentlichen Besuchen bei Emmi, die ihr sehr geholfen, der sie viel zu verdanken und mit der sie bis vor Kurzem noch hin und wieder telefoniert habe. Aber nicht mehr im Krankenhaus, alles sei so schnell gegangen und Emmi auf einmal tot gewesen.
Weil Siggi danach fragte, erfuhr Michael, dass Wagner noch immer in Erlangen lebte, nicht mehr beim Sozialamt, sondern inzwischen beim Wohnungsamt arbeitete, dass sein Sohn gerade mitten im Abitur steckte und seine Frau Corinna leider nicht kommen konnte, weil sie auf einer Tagung in Island war, aber alle herzlich grüßen lasse und später mal alleine Emmis Grab besuchen wolle.
Die beiden redeten weiter, aber Michael hörte nicht mehr zu, weil sich Corinnas Bild vor die Unterhaltung schob. Sie war so etwas wie ihr Groupie gewesen und, immer wenn sie konnte, zu den Auftritten mitgekommen, hatte Plakate verschickt, bei den Proben zugehört – sie war niemandem lästig gefallen, weil alle vier ein bisschen verliebt in sie und vertraut mit ihr gewesen waren.
Zu Emmi hatte sie eine vorsichtige, vielleicht auch von Eifersucht eingetrübte Distanz gehalten, aber die beiden Frauen waren arbeitsteilig in einer Art stillschweigender Übereinkunft dafür zuständig gewesen, die Nachtigallen zusammenzuhalten, indem sie deren Rivalität untereinander so abfederten, dass das Ensemble nicht auseinanderflog. Von Emmi und Corinna fühlte sich jeder der vier geachtet und gemocht, vielleicht sogar geliebt, zumindest so gewürdigt, wie es die anderen Bandmitglieder nicht immer zustande brachten.
Später, als der Kontakt zu Emmi lockerer wurde, weil sie alle zum Studium nach München gezogen waren, übernahm Corinna das Management, und sie versuchte auch, die Rolle als Seele des Quartetts, als dessen Muse auszufüllen, aber Emmis Schatten war zu groß – Corinna konnte nicht darunter hervortreten –, bis das Ganze schließlich allen um die Ohren flog, weil die Musik nicht mehr das Wichtigste in ihrem Leben war.
Corinna hatte sich nie mit einem der vier eingelassen, es aber immer vermocht, jedem das Gefühl zu geben, er sei der von ihr Begehrte, nur könne man nicht miteinander ins Bett fallen, weil sonst die Band in Gefahr geriete. Irgendwann hatte Michael geglaubt, sie inszeniere sich als ein Versprechen, das sie nicht halten wollte. Umso erstaunter war er gewesen, als er später von der Hochzeit mit Wagner erfahren hatte.
Am Buffet stand Angelas Tochter, eine junge Frau mit ebenso flachsblondem Haar und aufrechter Haltung wie ihre Mutter und Großmutter. Sie reichte den Gästen Besteck, Servietten und Getränke. Siggi griff so ungeschickt nach ihrem Besteck, dass es ihr gleich wieder aus der Hand fiel, Michael hob es auf, Angelas Tochter reichte ihr ein neues, und Michael sah Siggis gerötete Wangen und erkannte, dass sie von der Tochter betört und deshalb unsicher und verwirrt war. Hier konnte der Ursprung ihrer Dankbarkeit liegen. Emmi hatte ihr vielleicht geholfen, zu akzeptieren, dass sie sich in Frauen verliebte. Michael empfand Stolz auf Emmi in diesem Moment. Wer weiß, wie viele dankbare Menschen jetzt hier waren, denen Emmi in einem wichtigen Augenblick ihres Lebens den richtigen Rat gegeben hatte.
Michael warf einen zweiten Blick auf die Tochter und sah, was Siggi so berührt haben mochte: Die Frau hatte diesen Perlmuttschimmer der Jugend an sich, der bald vergehen würde, aber jetzt noch alles an ihr weich und selbstlos erscheinen ließ. Sie wirkte wie jemand, der noch nicht allzu viele Entscheidungen gefällt und Menschen verletzt haben konnte.
Er nahm sich Kartoffeln, Bohnen, Salat und etwas von der Sauce (den Braten ließ er liegen) und sah sich um nach den anderen, aber sie saßen verstreut, und der Platz war zu knapp – neben Thomas und Bernd war nichts mehr frei, also musste er, da Wagner sich noch immer angeregt mit Siggi unterhielt, sein Glas Wasser auf der Fensterbank abstellen und im Stehen essen.
~
Über Emmi sprach nach einer Stunde niemand mehr. Wie jede Trauergesellschaft hatte auch diese nach dem bedrückenden Teil der Veranstaltung zu einer nervösen Hochstimmung gefunden, in der Anekdoten, Witze und Lebensgeschichten erzählt wurden, und die Nachtigallen waren nach einigen Rochaden schließlich doch am selben Tisch gelandet, wo sich Bernd inzwischen angeregt mit der Tochter unterhielt, was Angela, die ebenfalls mit am Tisch saß, missfiel, denn die beiden flirteten miteinander. Bernd flirtete immer. Ein weibliches Wesen ohne Bart oder Missbildungen war ihm von jeher als Beute erschienen, die er mit aller ihm zu Gebote stehenden Nonchalance umschlich. Angela versuchte immer wieder vergeblich, ihn und auch ihre Tochter an sein Alter zu erinnern, indem sie ihn auf Ereignisse von früher ansprach, aber es nutzte nichts – die Tochter zappelte schon in Bernds Fängen, der sich für ihr Medizinstudium, ihren Musikgeschmack, ihre Urlaubsreisen und Karrierepläne interessierte, als gäbe es nichts Wichtigeres für ihn als die Lebensumstände und Weltsicht dieser jungen Frau.
Thomas leerte sich den Wein in etwa derselben Menge in den Mund, wie ihm der Schweiß aus den Poren trat. Es war gespenstisch anzusehen. Michael hatte ihn vor einigen Minuten am Buffet beobachtet, wie er sich gleich zwei Gläser einschenkte, eines leerte, wieder auffüllte und dann beide mit sich zum Tisch nahm. Auch dort hielt ihr Inhalt nicht lang vor.
Inzwischen redete er auf ihren alten Mathematiklehrer ein, der sich von Thomas’ Erwähnung seiner Arbeit als Immobilienmakler hatte beeindrucken lassen. Der Lehrer wollte ins Altersheim ziehen und sein Haus verkaufen, und Thomas erging sich in Spekulationen über den Preis und die Möglichkeiten, »die Braut vorher aufzuhübschen«, wie er es nannte.
Wagner hatte in Siggi eine Wesensverwandte gefunden – ihre gemeinsame Begeisterung für Gärten lieferte ihnen Gesprächsstoff, der sie alles andere ignorieren ließ. Bis auf den Flirt zwischen der Tochter und Bernd, den Siggi mit ähnlich verdunkelten Blicken wie Angela unauffällig, aber nicht für Michael, verfolgte.
Jetzt sitzen wir schon mal zusammen und reden doch nicht miteinander, dachte Michael, aber es war ihm recht. Sympathie empfand er nicht mehr für die ehemaligen Gefährten, wie er eigentlich schon seit Jahren für die wenigsten Menschen noch Sympathie empfand.
Dennoch, dieses eine Lied an Emmis Grab erinnerte ihn an das, was sie verbunden hatte – es war eine verschenkte Gelegenheit. Sie hätten jetzt für einen Moment, einen Nachmittag lang, an diesen glücklichen Punkt ihres Lebens anknüpfen, sich ihrer Freundschaft erinnern und Emmis Rolle bei deren Entstehen würdigen können. Stattdessen spulte jeder sein Programm ab und versuchte so wenig wie möglich anwesend zu sein.
Dabei wurden sie von den anderen Gästen als etwas Besonderes angesehen. Immer wieder bemerkte Michael Blicke, die auf ihnen ruhten, seit sie am selben Tisch saßen – sie waren wieder ein bisschen berühmt. Das Lied hatte etwas angerührt in den Gästen, den Abschied zu einem wirklichen Abschied gemacht, die Trauer für einen kurzen Moment aufscheinen lassen, die man sonst von sich weggehalten oder abgestreift hätte, weil das Leben weiterging und die Toten, sosehr man sie auch verehrt haben mochte, nicht mehr zählten.
»Meine Mutter hat euch so vergöttert, dass ich manchmal richtig eifersüchtig war«, sagte Angela jetzt zu ihm. Vielleicht wollte sie sich vom Anblick ihrer strahlenden Tochter mit diesem knochigen älteren Mann ablenken. Die beiden hatten jetzt einen gurrenden, halblauten Ton in den Stimmen und waren wie in einer eigenen Umlaufbahn von ihrer Umgebung abgekoppelt. Daran, dass sie miteinander im Bett landen würden, war wohl nichts mehr zu ändern. Da störte weder der Abdruck eines Eherings an Bernds Finger noch die Tatsache, dass Sarah, die Tochter, einen Freund hatte, der für sie kochte, ihre Arbeiten schrieb und in Regensburg auf sie wartete.
Michael, der mittlerweile entschlossen war, bald aufzubrechen, kam nicht mehr zu einer Antwort, denn jetzt fuhr ein Wagen vor, ein weißer Audi mit Münchner Nummer, und aus diesem stieg Erin.
Schwarzes Kostüm, schwarzes Haar, die blasse Haut der Iren, eine Frau Ende dreißig mit der Haltung einer Aristokratin – aller Augen wandten sich ihr zu, als sie aus dem Wagen gestiegen war und zum Gartentor hereinkam. Angela und Michael standen auf und gingen ihr entgegen, die anderen sahen sich den Auftritt nur an.
»Erin, dass du gekommen bist«, sagte Angela, und die beiden Frauen umarmten einander.
»I’m so sorry«, sagte Erin, »das Flugzeug war ausgefallen und erst nach einer Stunde ein anderes da.«
Sie löste sich von Angela und sah Michael an. »Hi, Michael«, sagte sie. Sie sprach seinen Namen englisch aus.
»Hi, Erin«, sagte er und küsste sie auf beide Wangen. »Das ist schön, dich zu sehen.«
»Auch mit einem traurigen Grund«, sagte sie und lächelte zuerst ihn an, dann in die Runde der Gäste, die sich jetzt wieder pro forma miteinander unterhielten, um nicht unhöflich zu wirken. Einige nickten ihr zu, manche lächelten. Michael, der sonst fast immer wusste, was die Menschen dachten, war sich diesmal nicht sicher, ob ihnen klar war, wen sie da vor sich hatten, ob sie begriffen, dass Erin ein Star war, oder ob sie nur von der Ausstrahlung und Selbstsicherheit dieser schönen Frau beeindruckt waren.
Sie war sogar ein Weltstar. Allerdings in anderen Weltgegenden. Jemand, der mit dem Autoradio hinreichend versorgt war und dessen musikalischer Horizont sich von Phil Collins bis Tina Turner erstreckte, würde nichts mit ihrem Namen anzufangen wissen.
Wagner und Thomas kannten sie. Sie sahen gebannt und ein bisschen verdutzt zu ihnen her – Wagner rückte sogar zur Seite, in der Hoffnung, Michael möge sich mit seiner illustren Begleitung wieder zu ihnen setzen.
Aber sie wollte zu Emmis Grab. Michael bot an, ihr den Weg zu zeigen. Sie stiegen in den Audi, der ohnehin so mitten auf der Straße nicht stehen bleiben konnte, und fuhren zum Friedhof. Aus dem Augenwinkel sah er noch, wie Wagner und Thomas die Köpfe zusammensteckten und Bernd sich ihnen zuwandte und seine bis eben noch angehimmelte Sarah links liegen ließ.
~
Das Grab war bedeckt mit einem Berg von Blumen und Kränzen. Sie gingen schweigend darauf zu, wie sie auch schweigend hierhergefahren waren, und Michael sagte wenige Meter davor: »Ich lass dich alleine, ja?«
Erin hob ihren Arm, ohne Michael anzusehen, und berührte ihn an der Schulter. Er ging zum Parkplatz zurück, um dort auf sie zu warten.
Aber er war noch nicht wieder ganz an der Kapelle vorbei, als er sie singen hörte. Dasselbe Lied. The parting glass. Er blieb stehen.
Noch aus dieser Entfernung, vielleicht dreißig oder vierzig Meter, klang ihre Stimme so verletzlich wie strahlend, und die verspielten irischen Schlenker ließen das Lied natürlich und kunstvoll zugleich wirken wie den Gesang eines sehr besonderen Vogels.
Michael ging leise den Weg wieder zurück, vorsichtig auf dem Grasrand balancierend, um sich nicht durch das Knirschen seiner Schritte zu verraten. Er näherte sich Erin bis auf etwa fünfzehn Meter – weiter wollte er nicht, um ihr Alleinsein mit Emmi nicht zu stören. Sie stand da, eine schwarze Silhouette, die Hände vor dem Schoß ineinandergelegt, den Kopf gesenkt, und sang die letzten Zeilen: But since it falls unto my lot that I should rise and you should not; I gently rise and softly call, goodnight and joy be with you all.
Er wäre gern noch geblieben, aber er wandte sich ab und ging zurück, wie er gekommen war, um nicht als Lauscher entdeckt zu werden. Schon wieder spürte er Tränen in den Augen, aber diesmal weinte er nicht um Emmi Buchleitner – es war Erins Stimme, das Lied, die Geste des Respekts und der Liebe, die hier einem Menschen nachgerufen wurde. Und es war die Stille auf dem menschenleeren Friedhof in der schwülen Nachmittagshitze. Und vielleicht auch die Tatsache, dass er so unverhofft mit Erin zusammengetroffen war.
»Hey«, rief sie hinter ihm, und jetzt hörte er auch ihre Schritte. Er blieb stehen und drehte sich um. Immerhin war er schon fast wieder bei der Kapelle angelangt, sie musste nichts von seinem Anschleichen mitbekommen haben.
»Das war ein Lieblingslied von ihr«, sagte Erin, »sie hat es mir beigebracht, obwohl ich Irin bin und es eigentlich kennen musste.«
»Wir haben das auch gesungen«, sagte Michael, »meine Freunde und ich. Vorhin bei der Beerdigung.«
»Das gleiche Lied?«
»Ja. Vierstimmig. A cappella. Sie hat es auch uns beigebracht. Sie hat uns genauso zu Musikern gemacht wie dich ein paar Jahre später. Nur dass wir keine geblieben sind.«
»Du hättest mit mir zusammen singen können«, sagte sie.
»Da hätte ich geheult. Das hätte nicht gut geklungen.«
»Ach komm«, sagte sie und sah ihn zweifelnd an. Aber weil sie in seinem Gesicht keine Ironie fand, gab sie ihm einen kleinen Boxhieb an die Schulter. »Rubbish.«
~
Emmi hatte ihn damals angerufen, ob er mit ihr eine Sängerin anhören wolle, die in München im MUH auftreten sollte. Es werde ihm gefallen, sagte sie, und ihr wäre lieb, sie würden einander kennenlernen. Die Sängerin sei eine Schülerin, die jetzt bald nach Irland zurückkehren werde, und wenn er sie gehört habe, wisse er, warum ihr das so wichtig sei.
Er war damals fast fertig mit dem Studium, die Examensarbeit in Anglistik hatte er schon abgeliefert, für Romanistik musste er noch arbeiten. Die Nachtigallen hatten sich aufgelöst, nachdem Wagner ihnen immer öfter mit der Frage »Wo stehen wir eigentlich?« auf die Nerven gegangen war. Anfangs gab es noch ironische Antworten wie: »Schwabing, Giselastraße«, aber irgendwann waren sie diese immer penetranter werdenden Forderungen, man dürfe kein bourgoises l’art pour l’art machen, sondern müsse politisch relevant und parteilich sein, so leid geworden, dass Wagner damit nur noch Müdigkeit und Ärger auslöste. Er war dem Verband Sozialistischer Kulturschaffender beigetreten und akzeptierte nur noch Eisler, Weill, Theodorakis und Jara als Komponisten und Tucholsky, Brecht, Mehring und Neruda als Texter. Schließlich hatte sein ständiges Nörgeln und Dozieren nur eine einzige Wirkung: Sie schmissen in einem sehr kurzen und sehr lauten Streit alles hin und verloren einander zügig aus den Augen.
Erst nach dem Ende des Quartetts wurde klar, dass es schon vorher nicht mehr existiert hatte – der Körper des Ganzen war nur noch von seinen Kleidern zusammengehalten worden, die Nachtigallen hatten sich von einem Tag auf den anderen in Luft aufgelöst. Ohne Reminiszenzen, ohne Nachwehen, ohne den Versuch, sie zu reanimieren.
Das Musikalische Unterholz, wie der volle Name des Folkclubs lautete, lag in der Hackenstraße. Es war ein Mittwoch und nicht sehr viel los, auf dem Programmzettel standen für diesen Tag lauter Namen, die Michael nichts sagten: Peter Finger, Holger Paetz, Erin Conally und John Vaughan.
Ende der Leseprobe