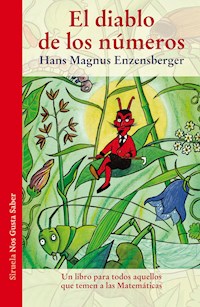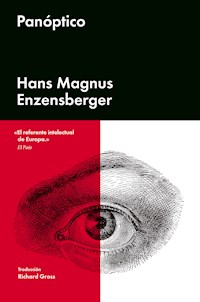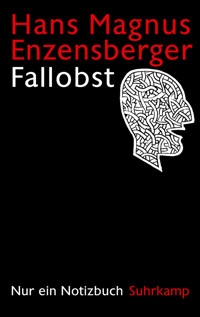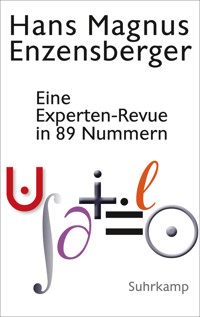12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die zwölf Kapitel des Romans handeln vom Leben und Sterben des spanischen Metallbauers Buenaventura Durruti, der nach einer militanten und abenteuerlichen Jugend zur Schlüsselfigur der spanischen Revolution von 1936 geworden ist. Das Buch beginnt mit einem Prolog "Die Totenfeier" und endet mit einem Epilog über "Die Nachtwelt". Dazwischen wird die Geschichte eines proletarischen Helden erzählt, von seiner Kindheit in einer kleinen nordspanischen Stadt bis zu den "sieben Toden" Durrutis, die niemals aufgeklärt worden sind.
Die Darstellung beruht auf zeitgenössischen Broschüren, Flugblättern und Reportagen, auf Reden und Memoiren und auf Interviews mit Augenzeugen, die Durruti gekannt haben. Die literarische Form des Romans steht zwischen Nacherzählung und Rekonstruktion. Der Widerspruch zwischen Fiktion und Dokument hält die politischen Widersprüche der spanischen Revolution fest. Auf den Spuren vergessener, halb verdrängter Kämpfe wird das Buch zur Recherche. In acht Glossen, die in die Handlung des Romans eingesprengt sind, stellt der Autor den historischen Kontext dar.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 451
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Die zwölf Kapitel des Romans handeln vom Leben und vom Sterben des spanischen Metallarbeiters Buenaventura Durruti, der nach einer militanten und abenteuerlichen Jugend zur Schlüsselfigur der spanischen Revolution von 1936 geworden ist. Das Buch beginnt mit einem Prolog »Die Totenfeier« und endet mit einem Epilog über »Die Nachwelt«. Dazwischen wird die Geschichte eines proletarischen Helden erzählt, von seiner Kindheit in einer kleinen nordspanischen Stadt bis zu den »sieben Toden« Durrutis, die niemals aufgeklärt worden sind. Die Darstellung beruht auf zeitgenössischen Broschüren, Flugblättern und Reportagen, auf Reden und Memoiren und auf Interviews mit Augenzeugen, die Durruti gekannt haben. Die literarische Form des Romans steht zwischen Nacherzählung und Rekonstruktion. Der Widerspruch zwischen Fiktion und Dokument hält die politischen Widersprüche der spanischen Revolution fest. Auf den Spuren vergessener, halb verdrängter Kämpfe wird das Buch zur Recherche. In acht Glossen, die in die Handlung des Romans eingesprengt sind, stellt der Autor den historischen Kontext dar.
Hans Magnus Enzensberger, 1929 in Kaufbeuren geboren, lebt heute in München. Sein Werk im Suhrkamp Verlag und im Insel Verlag ist auf S. 302 dieses Bandes verzeichnet.
Hans Magnus Enzensberger
Der kurze Sommerder Anarchie
Buenaventura DurrutisLeben und Tod
Roman
Suhrkamp
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2016
Der vorliegende Text folgt der 18. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 395.
© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1972
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Umschlagfoto: Renate von Mangoldt
Umschlaggestaltung: Göllner, Michels, Zegarzewski
eISBN 978-3-518-75058-2
www.suhrkamp.de
Inhalt
Prolog. Die Totenfeier
Erste Glosse. Über die Geschichte als kollektive Fiktion
Erstes Kapitel. Verirrte Kugeln
Zweite Glosse. Über die Wurzeln des spanischen Anarchismus
Zweites Kapitel. Los Solidarios
Dritte Glosse. Über die spanische Zwickmühle (1917–1931)
Drittes Kapitel. Das Exil
Vierte Glosse. Über die spanische Zwickmühle (1931–1936)
Viertes Kapitel. Die Republik
Fünftes Kapitel. Der Sieg
Sechstes Kapitel. Die Doppelherrschaft
Siebtes Kapitel. Der Feldzug
Achtes Kapitel. Die Etappe
Neuntes Kapitel. Die Bauern
Fünfte Glosse. Über den Feind
Zehntes Kapitel. Die Milizen
Sechste Glosse. Über den Niedergang der Anarchisten
Elftes Kapitel. Die Verteidigung von Madrid
Siebte Glosse. Über den Helden
Zwölftes Kapitel. Der Tod
Achte Glosse. Über das Altern der Revolution
Epilog. Die Nachwelt
Quellen
Bildteil
Die Totenfeier
Spät in der Nacht traf der Leichnam in Barcelona ein. Es hatte den ganzen Tag geregnet, und die Autos, die den Sarg begleiteten, waren mit Lehm überkrustet. Die schwarz-rote Fahne, die den Leichenwagen bedeckte, war schmutzig.
Im Haus der Anarchisten, das bis zur Revolution der Sitz der Industrie- und Handelskammer von Barcelona gewesen war, hatten die Vorbereitungen schon am Tag zuvor begonnen. Die Eingangshalle war hergerichtet worden, um den Katafalk aufzunehmen. Wunderbarerweise wurde alles rechtzeitig fertig. Der Schmuck war einfach, er zeigte keine Spur von Kunst oder Pomp. Die Wände waren mit schwarz-rotem Tuch verhangen; ein Baldachin in denselben Farben, einige Kandelaber, dazu Blumen und Kränze: das war alles. An den beiden seitlichen Türen, durch welche die trauernde Menge passieren sollte, waren nach spanischer Sitte große Tafeln angebracht, auf denen zu lesen war: »Durruti heißt euch eintreten« und »Durruti heißt euch fortgehen«.
Milizsoldaten bewachten den Katafalk, Gewehr bei Fuß. Dann trugen ihn die Männer, die mit dem Sarg aus Madrid gekommen waren, ins Haus. Niemand hatte daran gedacht, die großen Flügeltüren des Portals vor ihnen zu öffnen. Die Sargträger mußten sich also durch eine kleine Seitentür schieben. Sie hatten Mühe, sich durch die Menge, die vor dem Haus zusammengeströmt war, einen Weg zu bahnen. Von den Emporen der Eingangshalle, die ohne Schmuck geblieben waren, sahen Neugierige zu. Die Stimmung war erwartungsvoll, wie in einem Theater. Es wurde geraucht. Manche nahmen ihre Mützen ab, andere dachten nicht daran. Es war laut. Milizsoldaten, die von der Front kamen, wurden von ihren Freunden begrüßt. Die Wachen versuchten, die Anwesenden zurückzudrängen. Auch dabei ging es nicht ohne Lärm ab. Der Mann, der für das Zeremoniell verantwortlich war, gab seine Anordnungen. Jemand stolperte und fiel über einen Kranz. Einer der Sargträger zündete sich sorgfältig eine Pfeife an, während der Deckel des Sarges abgehoben wurde. Durrutis Gesicht lag unter einer Glasscheibe, auf weißer Seide, eingehüllt in einen weißen Schal, der ihm das Aussehen eines Arabers gab.
Die Szenerie war tragisch und grotesk zugleich. Sie glich einer Radierung von Goya. Ich beschreibe sie so, wie ich sie erlebt habe, weil sie Einblick in das gibt, was die Spanier bewegt. Der Tod in Spanien ist wie ein Freund, ein Genosse, ein Arbeiter, den man vom Feld oder von der Werkstatt her kennt. Wenn er kommt, macht man seinetwegen keine großen Geschichten. Man liebt seine Freunde, aber man drängt sich ihnen nicht auf. Sie können kommen und gehen, wie es ihnen paßt. Vielleicht ist es der alte Fatalismus der Mauren, der hier wieder zum Vorschein kommt, nachdem er jahrhundertelang verdeckt war durch die Rituale der katholischen Kirche.
Durruti war ein Freund. Er hatte viele Freunde. Er war zum Idol eines ganzen Volkes geworden. Er ist viel und aufrichtig geliebt worden, und alle, die in dieser Stunde gekommen waren, beklagten seinen Verlust und brachten ihm ihre Zuneigung. Und doch sah ich, abgesehen von seiner Frau, einer Französin, nur einen Menschen, der weinte: eine alte Putzfrau, die in diesem Haus gearbeitet hatte, als hier noch die Industriellen aus- und eingingen, und die ihm wahrscheinlich nie im Leben begegnet war. Die andern empfanden seinen Tod als einen schrecklichen, unersetzlichen Verlust, aber sie äußerten ihre Gefühle ohne jede Feierlichkeit. Schweigen, die Mützen abnehmen, die Zigaretten ausdrücken – das wäre ihnen ebenso überspannt erschienen wie Kreuze schlagen oder Weihwasser vergießen.
Im Laufe der Nacht schritten Tausende von Menschen an Durrutis Sarg vorbei. Sie warteten im Regen, in langen Reihen. Ihr Freund und ihr Anführer war tot. Ich wage nicht zu entscheiden, welchen Teil an ihrem Gefühl der Schmerz, welchen Teil die Neugier hatte. Aber ich bin sicher, daß ihnen eine Regung gänzlich fremd war: die Ehrfurcht vor dem Tode.
Die Beerdigung fand am nächsten Vormittag statt. Eines war von Anfang an klar: die Kugel, an der Durruti gestorben war, hatte Barcelona bis ins Herz getroffen. Man hat errechnet, daß jeder vierte Einwohner der Stadt seinem Sarg folgte. Die Massen, die die Straßen säumten, aus den Fenstern sahen, die Dachterrassen und sogar die Bäume der Ramblas besetzt hielten, sind in dieser Zahl nicht einbegriffen. Alle Parteien und Gewerkschaftsorganisationen ohne Ansehen der Richtung hatten ihre Mitglieder aufgerufen. Neben den Fahnen der Anarchisten wehten über der Menge die Farben aller antifaschistischen Gruppen Spaniens. Es war ein großartiger, erhabener und bizarrer Anblick; denn niemand hatte diese Massen gelenkt, organisiert oder geordnet. Nichts klappte wie am Schnürchen. Es herrschte ein unerhörtes Durcheinander.
Der Beginn des Leichenzuges war auf zehn Uhr festgesetzt. Eine Stunde zuvor war es bereits unmöglich, an das Haus des Anarchistischen Regional-Komitees heranzukommen. Niemand hatte daran gedacht, den Weg, den der Zug nehmen sollte, abzusperren. Die Belegschaften aller Betriebe von Barcelona zogen herbei, gerieten durcheinander und versperrten sich gegenseitig den Weg von allen Seiten. Eine Kavallerie-Schwadron und eine Motorradeskorte, die den Leichenzug anführen sollten, fanden sich völlig blockiert und von Arbeitermassen eingekeilt. Überall sah man mit Kränzen bedeckte Wagen, die steckengeblieben waren und weder vorwärts noch zurück konnten. Mit Mühe und Not gelang es, den Ministern einen Weg zur Bahre zu bahnen.
Um halb elf Uhr verließ Durrutis Sarg, bedeckt von einer schwarz-roten Fahne, auf den Schultern von Milizsoldaten seiner Kolonne, das Haus der Anarchisten. Die Massen erhoben die Faust zum letzten Gruß. Sie stimmten die anarchistische Hymne an: Hijos del pueblo, Söhne des Volkes. Es war ein Augenblick großer Bewegung. Doch aus irgendeinem Grunde oder auch aus Versehen hatte man zwei Orchester kommen lassen. Das eine spielte sehr leise, das andere sehr laut. Es gelang ihnen nicht, den gleichen Takt zu halten. Die Motorräder heulten auf, die Autos begannen zu hupen, die Offiziere der Milizen gaben Pfeifsignale, und die Sargträger kamen keinen Schritt voran. Es war ein Ding der Unmöglichkeit, in diesem Tumult einen Zug zu formieren. Die beiden Orchester spielten dasselbe Lied noch einmal, noch mehrere Male. Sie hatten alle Versuche, sich aufeinander abzustimmen, aufgegeben. Man hörte die Töne, aber es war keine Melodie mehr zu erkennen. Immer noch sah man auf allen Seiten erhobene Fäuste. Endlich verstummte die Musik, die Fäuste sanken, und nur noch das Brausen der Menge, in deren Mitte Durruti auf den Schultern seiner Genossen ruhte, war zu hören.
Es verging wenigstens eine halbe Stunde, bis die Straße so weit frei war, daß der Zug sich in Bewegung setzen konnte. Es dauerte mehrere Stunden, bis er die Plaza de Cataluña erreichte, die nur ein paar hundert Meter entfernt liegt. Die Berittenen suchten sich ihren Weg, jeder auf eigene Faust. Die Musiker, in der Menge versprengt, versuchten, sich wieder zu vereinigen. Die Autos, die sich verfahren hatten, trachteten im Rückwärtsgang einen Ausweg zu finden. Die Wagen mit den Kränzen bahnten sich Umwege durch die Seitenstraßen, um an irgendeiner Stelle im Trauerzug unterzukommen. Jedermann schrie, so laut er konnte.
Nein, das war nicht die Beisetzung eines Königs, es war ein Begräbnis, das das Volk in die Hand genommen hatte. Es gab keine Anordnungen, alles geschah spontan. Das nicht Vorhersehbare beherrschte den Tag. Es war einfach ein anarchistisches Begräbnis, und darin lag seine Majestät. Es hatte seine sonderbaren Seiten, aber seine Größe, eine eigenartige, düstere Größe, verlor es nie.
Zu Füßen der Columbus-Säule, nicht weit entfernt von der Stelle, wo einst Durrutis bester Freund gekämpft hatte und an seiner Seite gefallen war, wurden die Trauerreden gehalten.
García Oliver, der einzig Überlebende der drei Genossen, sprach als Freund, als Anarchist und als Justizminister der Spanischen Republik.
Dann nahm der russische Konsul das Wort. Er beschloß seine Rede, die er in katalanischer Sprache hielt, mit dem Ruf: »Tod dem Faschismus!« Der Präsident der Generalidad, Companys, sprach als letzter. »Genossen!« begann er, und endete mit der Losung: »Voran!«
Es war vorgesehen, daß der Trauerzug sich nach den Reden auflösen sollte. Nur einige Freunde Durrutis sollten dem Leichenwagen bis auf den Friedhof folgen. Aber es erwies sich als unmöglich, an diesem Programm festzuhalten. Die Massen wichen nicht von der Stelle, sie hatten bereits den ganzen Friedhof besetzt und den Weg zum Grab blockiert. Es war schwierig durchzukommen; denn zu allem Überfluß waren alle Alleen des Friedhofs durch Tausende von Kränzen unbegehbar geworden. Die Nacht brach herein. Es fing von neuem an zu regnen. Bald goß es in Strömen, und der Friedhof verwandelte sich in einen Morast, in dem die Kränze ertranken. In letzter Minute wurde beschlossen, die Bestattung zu verschieben. Die Sargträger kehrten vor dem Grab um und brachten ihre Last in die Leichenhalle.
Durruti ist erst am folgenden Tag begraben worden.
H. E. Kaminski
Erste Glosse Über die Geschichte als kollektive Fiktion
»Kein Schriftsteller hätte sich entschlossen, die Geschichte seines Lebens zu schreiben; sie glich allzusehr einem Abenteuerroman.« Zu diesem Schluß ist Il’ja Erenburg schon im Jahre 1931 gekommen, als er Buenaventura Durruti kennenlernte; und sogleich machte er sich an die Arbeit. In ein paar Sätzen schrieb er auf, was er von Durruti zu wissen glaubte: »Dieser Metallarbeiter hatte von früher Jugend an für die Revolution gekämpft. Er war auf Barrikaden gestiegen, hatte Banken überfallen, Bomben geworfen, Richter entführt. Er war dreimal zum Tod verurteilt worden: in Spanien, in Chile und in Argentinien. Er war durch unzählige Gefängnisse gewandert und aus acht Ländern ausgewiesen worden.« Und so fort. Die Absage an den »Abenteuerroman« verrät die alte Furcht des Erzählers, man möchte ihn für einen Lügner halten, und zwar gerade dann, wenn er aufhört, etwas zu erfinden, und stattdessen von der »Wirklichkeit« spricht. Wenigstens diesmal möchte er, daß man ihm glaubt. Dabei kommt ihm der Verdacht in die Quere, den er durch seine eigene Arbeit auf sich gezogen hat: »Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, und wenn er auch die Wahrheit spricht.« Damit er Durrutis Geschichte erzählen kann, muß er sich als Erzähler verleugnen. Schließlich verbirgt seine Absage an die Fiktion auch noch das Bedauern darüber, daß er nicht mehr über Durruti zu erzählen wußte, daß von dem verbotenen Roman nichts weiter übrigblieb als ein vages Echo von Unterhaltungen in einem spanischen Café.
Doch bringt er es nicht fertig, ganz zu schweigen, unter den Tisch fallen zu lassen, was ihm zugetragen worden ist. Die Geschichten, die er gehört hat, ergreifen Besitz von ihm und machen ihn zum Nacherzähler. Aber wer hat sie ihm vorerzählt? Erenburg gibt keine Quelle an. Seine wenigen Zeilen fangen ein Stimmengewirr auf, ein gesellschaftliches Produkt. Unbekannte, Namenlose sprechen hier: ein kollektiver Mund. Das Ensembledieser anonymen, widersprüchlichen Äußerungen aber schießt zusammen und gewinnt eine neue Qualität: aus den Geschichten wird Geschichte. So ist seit den ältesten Zeiten Historie überliefert worden: als Sage, als Epos, als kollektiver Roman.
Geschichte als Wissenschaft gibt es erst, seitdem wir auf die mündliche Tradition nicht mehr angewiesen sind, seitdem es »Dokumente« gibt: Notenwechsel, Vertragstexte, Protokolle, Aktenpublikationen. Aber niemand hat die Historie der Historiker im Kopf. Der Widerwille gegen sie ist elementar; er scheint unüberwindlich. Jeder kennt ihn aus der Schulstunde. Für die Völker ist und bleibt die Geschichte ein Bündel von Geschichten. Sie ist das, was man sich merken kann und was dazu taugt, weiter und immer weiter erzählt zu werden: eine Nacherzählung. Dabei schreckt die Überlieferung vor keiner Legende, keiner Trivialität und keinem Irrtum zurück, vorausgesetzt, es heftet sich daran eine Vorstellung von den Kämpfen der Vergangenheit. Daher die notorische Ohnmacht der Wissenschaft vor dem Bilderbogen, der Kolportage. »Hier stehe ich, ich kann nicht anders.« – »Und sie bewegt sich doch.« Keine Forschung, die solche Sätze löschen könnte; der Beweis dafür, daß sie nie gefallen sind, käme nicht gegen sie auf. Die Pariser Kommune und der Sturm auf das Winterpalais, Danton auf der Guillotine und Trockij in Mexico: an diesen Bildern hat die kollektive Imagination mehr Anteil als jede Wissenschaft. Der Lange Marsch ist letzten Endes für uns das, was vom Langen Marsch erzählt werden wird. Die Geschichte ist eine Erfindung, zu der die Wirklichkeit ihre Materialien liefert. Aber sie ist keine beliebige Erfindung. Das Interesse, das sie erweckt, gründet auf den Interessen derer, die sie erzählen; und sie erlaubt es denen, die ihr zuhören, ihre eigenen Interessen, ebenso wie die ihrer Feinde, wiederzuerkennen und genauer zu bestimmen. Der wissenschaftlichen Recherche, die sich interesselos dünkt, verdanken wir vieles; doch sie bleibt Schlemihl, eine Kunstfigur. Einen Schatten wirft erst das wahre Subjekt der Geschichte. Es wirft ihn voraus als kollektive Fiktion.
So versteht sich Durrutis Roman: nicht als faktensammelnde Biographie, geschweige denn als wissenschaftlicher Diskurs. Sein Erzählfeld reicht über das Gesicht einer Person hinaus. Es bezieht die Umgebung ein, den Austausch mit konkreten Situationen, ohne den diese Person unvorstellbar ist. Sie definiert sich durch ihren Kampf. Das macht ihre gesellschaftliche Aura aus, die sich umgekehrt all ihren Handlungen, Äußerungen und Eingriffen mitteilt. Alles, was von Durruti berichtet wird, ist in ihr eigentümliches Licht getaucht; was an seiner Aura ihm selber zuzuschreiben ist, was den Erinnerungen derer, die von ihm sprechen, seine Feinde nicht ausgeschlossen, – das läßt sich nicht mehr entscheiden. Angeben läßt sich dagegen die Methode der Nacherzählung. Sie geht von der Person aus, und ihre Schwierigkeit läßt sich folgendermaßen darstellen. Zu rekonstruieren ist die Existenz eines Mannes, der seit fünfunddreißig Jahren tot ist und dessen Hinterlassenschaft sich beschränkt auf »Unterwäsche für einen Wechsel, zwei Pistolen, ein Fernglas und eine Sonnenbrille. Das war das ganze Inventar.« Gesammelte Werke liegen nicht vor, die schriftlichen Äußerungen des Toten sind äußerst spärlich. Sein Leben ist in seinen Handlungen aufgegangen. Diese Aktion war politisch und zu großen Teilen illegal. Es handelt sich also darum, ihre Spuren aufzufinden, die eine Generation später nicht mehr ohne weiteres zutage liegen; sie sind verwischt, vergilbt, nahe daran, vergessen zu werden. Dennoch sind sie zahlreich, wenn auch verworren. Der schriftliche Strang der Überlieferung liegt in Archiven und Bibliotheken vergraben. Es gibt aber auch eine mündliche Tradition. Viele, die den Toten gekannt haben, sind noch am Leben; sie gilt es ausfindig zu machen und sie zu befragen. Das Material, das sich auf diese Weise zusammentragen läßt, ist von verwirrender Vielfalt: Form und Tonfall, Gestus und Gewicht wechseln von einem Fragment zum andern. Der Roman als Collage nimmt in sich Reportagen und Reden, Interviews und Proklamationen auf; er speist sich aus Briefen, Reisebeschreibungen, Anekdoten, Flugblättern, Polemiken, Zeitungsnotizen, Autobiographien, Plakaten und Propagandabroschüren. Die Widersprüchlichkeit der Formen kündigt aber nur die Risse an, die sich durch das Material selber ziehen. Die Rekonstruktion gleicht einem Puzzle, dessen Stücke nicht nahtlos ineinander sich fügen lassen. Gerade auf den Fugen des Bildes ist zu beharren. Vielleicht steckt in ihnen die Wahrheit, um derentwillen, ohne daß die Erzähler es wüßten, erzählt wird.
Das einfachste wäre es, sich dumm zu stellen und zu behaupten, jede Zeile dieses Buches sei ein Dokument. Aber das ist einleeres Wort. Kaum sehen wir genauer hin, so zerrinnt uns die Autorität unter den Fingern, die das »Dokument« zu leihen scheint. Wer spricht? Zu welchem Zweck? In wessen Interesse? Was will er verbergen? Wovon will er uns überzeugen? Und wieviel weiß er überhaupt? Wieviel Jahre sind vergangen zwischen dem erzählten Augenblick und dem des Erzählens? Was hat der Erzähler vergessen? Und woher weiß er, was er sagt? Erzählt er, was er gesehen hat, oder was er glaubt gesehen zu haben? Erzählt er, was ein anderer ihm erzählt hat? Das sind Fragen, die weit führen, zu weit: denn ihre Beantwortung würde uns dazu zwingen, für jeden Zeugen hundert andere zu befragen; jeder Schritt dieser Überprüfung würde uns von der Rekonstruktion weiter entfernen und der Destruktion der Geschichte näher bringen. Am Ende hätten wir, was zu finden wir aufgebrochen sind, liquidiert. Nein, die Fragwürdigkeit der Quellen ist prinzipieller Art, und ihre Differenzen lassen sich durch Quellenkritik nicht auflösen. Noch die »Lüge« enthält ein Moment von Wahrheit, und die Wahrheit der unbezweifelbaren Tatsachen, gesetzt, sie ließe sich finden, sagt nichts mehr aus. Das Opalisieren der Überlieferung, das kollektive Flimmern rührt von der dialektischen Bewegung der Geschichte selber her. Es ist der ästhetische Ausdruck ihrer Antagonismen.
Wer sich das merkt, kann als Rekonstrukteur nicht viel verderben. Er ist weiter nichts als der letzte (oder vielmehr, wie wir sehen werden, der vorletzte) in einer langen Kette von Nacherzählern dessen, was da vielleicht so oder vielleicht anders vorgefallen und im Verlauf des Erzählens zur Geschichte geworden ist. Wie alle, die ihm vorangegangen sind, will auch er ein Interesse zum Vorschein und zur Geltung bringen. Er ist nicht unparteiisch, er greift in das Erzählte ein. Sein erster Eingriff besteht bereits darin, daß er diese und keine andere Geschichte wählt. Das Interesse, das sich in seiner Suche verrät, zielt nicht auf Vollständigkeit. Der Nacherzähler hat weggelassen, übersetzt, geschnitten und montiert und in das Ensemble der Fiktionen, die er fand, seine eigene Fiktion eingebracht, mit voller Absicht und vielleicht auch wider Willen; nur daß diese eben darin ihr Recht hat, daß sie den andern das ihre läßt. Der Rekonstrukteur verdankt seine Autorität der Unwissenheit. Er hat Durruti nie gekannt, er war nicht dabei, er weiß es nicht besser.Auch behält er nicht das letzte Wort. Denn der nächste, der diese Geschichte verwandeln wird, indem er verwirft oder zustimmt, vergißt oder behält, unter den Tisch fallen läßt oder weitererzählt, dieser nächste und vorläufig letzte ist der Leser. Auch seine Freiheit ist begrenzt; denn was er vorfindet, ist kein bloßes »Material«, absichtslos vor ihn hingekippt, in reiner Objektivität, untouched by human hands. Im Gegenteil. Alles, was hier steht, ist durch viele Hände gegangen, zeigt Spuren des Gebrauchs. Dieser Roman ist öfter als einmal geschrieben worden, von vielen, nicht nur von denen, die am Schluß des Buchs verzeichnet sind. Der Leser ist einer von ihnen, der letzte, der diese Geschichte erzählt. »Kein Schriftsteller hätte sich entschlossen, sie zu schreiben.«
Verirrte Kugeln
Zwei Stadtansichten
León, Bischofssitz und Hauptstadt der gleichnamigen spanischen Provinz, liegt 851 m über dem Meeresspiegel auf einem Hügel am Zusammenfluß der beiden Flüsse Torio und Bernesga, die den León-Fluß bilden. Bevölkerung (1900) 15 580. Die Stadt ist an der Schnellzuglinie Madrid-Oviedo gelegen. Die alten Viertel mit der Kathedrale und anderen mittelalterlichen Bauwerken sind von einer Stadtmauer umgeben; sie haben durch die Erneuerung, die ihnen in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts zuteil geworden ist, nichts von ihrer Sehenswürdigkeit verloren. Zur selben Zeit sind außerhalb des Stadtwalles neue Vorstädte entstanden, um die industriell beschäftigte Bevölkerung aufzunehmen, die durch die Gründung einer Eisengießerei, einer Eisenbahnwerkstatt, einer chemischen und einer Lederwarenfabrik angezogen worden ist. León setzt sich somit aus zwei Städten zusammen – einer alten von klerikalem und einer neuen von industriellem Charakter.
Encyclopaedia Britannica
Das Viertel von Santa Ana, in dem Durruti geboren ist, besteht aus alten, kleinen Häusern. Es ist ein proletarisches Viertel. Sein Vater war Eisenbahner, und auch seine Brüder haben fast alle bei der Bahn gearbeitet, ebenso wie Durruti selbst.
Das gesellschaftliche Klima der Stadt war ganz vom Bischofssitz her geprägt. Es erstickte jede Idee und jede Handlung, die dem Klerus mißfiel. León war, mit einem Wort, eine Zitadelle des alten kirchlichen und monarchischen Spanien. Industriebetriebe gab es kaum. Alle Einwohner kannten einander. Eine starke Garnison, mehrere Abteilungen der Guardia Civil, zahlreiche Klöster, eine Kathedrale, ein Bischofspalais, ein Lehrerbildungs-Seminar, eine Veterinärschule, ein starkes Kleinbürgertum, das Ruhe und Ordnung wollte: das war alles, und es war eine Umgebung, die keinen abweichenden Gedanken, kein widersprüchliches Temperament duldete. Auswanderung war die einzige Lösung. Ein Durruti konnte in León nie und nimmer Platz finden, zumindest nicht im León unserer Jugend, das die paar lauwarmen, harmlosen Republikaner, die es damals gab, bereits als subversive Extremisten und skandalöse Elemente ansah.
Diego Abad de Santillán
Auskünfte einer Schwester
1. Buenaventura Durruti ist am 14. Juli 1896 in León geboren.
2. Geschwister: acht, davon sieben Brüder und eine Schwester. Davon sind heute (1969) noch am Leben: zwei Brüder und die Schwester.
3. Beruf: Mechaniker.
4. Lebenslauf. Trat mit fünf Jahren in die Volksschule zu León ein. Immer guter Schüler. Intelligent, etwas mutwillig, aber von gutmütigem Charakter. Besuchte auch die Sonntagsschule der Kapuzinerpatres in León, wo er verschiedene Auszeichnungen und Diplome bekam, die meine Mutter sorgsam aufbewahrt hat.
Von 1910 bis 1911 arbeitete er in der Werkstatt des Herrn Melchor Martínez für einen Tagelohn von 25 Céntimos. Ich erinnere mich, daß er damit unzufrieden war, weil ihm der Lohn zu gering schien. Meine Mutter war nicht dieser Ansicht, sie hielt den Lohn für hinreichend und sagte ihm, er lerne dort einen nützlichen Beruf, der ihn unabhängig machen werde. Er besuchte in dieser Zeit die Abendschule. Seine freie Zeit verbrachte er meistens lesend und studierend. Er ist dann in die Gießerei des Herrn Antonio Miaja eingetreten. Dort hat er bis 1916 gearbeitet. Dann legte er eine Probearbeit bei der Nordspanischen Eisenbahn-Compagnie ab und bekam dort 1916 einen Posten als Mechaniker. Nach dem Streik von 1917 wurde er entlassen. Er verließ Spanien und ging nach Paris, wo er bis 1920 blieb. Dann kehrte er zurück und half bei der Montage der Kohlenwaschanlagen in der Grube von Matallana de Torio, Provinz León. Als er das wehrdienstpflichtige Alter erreicht hatte, befand er sich wieder in Paris. Er kam auf die Liste der flüchtigen Rekruten und wurde bei seiner Rückkehr nach Spanien in San Sebastián festgenommen. Weil er groß und kräftig war, wurde er zur Festungsartillerie eingeteilt, aber wegen eines Leistenbruchs für untauglich erklärt und entlassen.
5. Bemerkungen. Seine Jugend war wie sein späteres Leben voller Schwierigkeiten und Leiden. Sein Verhältnis zur Familie war vortrefflich. Zum Beispiel sagte er zu seinen Brüdern, sie sollten eine ehrliche Arbeit suchen und sich nicht in Streitigkeiten einmischen, damit ihre Mutter ein ruhiges Leben hätte. Er hat immer sehr an seiner Mutter gehangen, mit großem Respekt und einer tiefen Verehrung. Er hat zuhause nie von seiner Ideologie gesprochen. Meine Mutter und ich haben sich immer der Achtung und Sympathie der Bürger von León erfreut, ungeachtet welchen Standes, auch in der Zeit nach dem Bürgerkrieg. Mein Vater war von Beruf Eisenbahner. Er hatte eine Stellung beim Ausbesserungswerk León. Er starb 1931, meine Mutter, einundneunzigjährig, 1968. Auch mein Vater war in der Stadt angesehen. Unter der Diktatur von Primo de Rivera war er Beigeordneter der Hohen Gemeindeversammlung unter dem Bürgermeister Herrn Raimundo del Río.
Rosa Durruti
Der Schulfreund
Durruti und ich, wir sind schon als Kinder Freunde gewesen, wir sind Genossen gewesen, wir sind Brüder gewesen, versteht ihr? Kaum, daß wir die ersten Zähne im Mund hatten, lang bevor wir in die Schule kamen. Wir waren doch Nachbarskinder. Und meine Mutter ist sehr früh gestorben, ich glaube, ich war damals sieben oder acht Jahre alt, und da hat mich Durrutis Mutter aufgenommen; ich war bei ihnen zuhause.
Und da wird sie zu Pepe gesagt haben, denn wir nannten ihn immer Pepe, einfach Pepe, Pepe Durruti, wird sie gesagt haben, der Florentino hat keine Mutter mehr. Vielleicht mochte er mich deshalb so gern, lieber als einen bloßen Spielkameraden, mehr wie einen Bruder; ich war wie ein Bruder für ihn.
In der Schule war Durruti sehr gut, er hat viel gearbeitet. Wir waren damals schon größer, und eines Tages hat der Lehrer die Mutter zu sich bestellt und hat ihr gesagt: »Hier lernt Ihr Sohn nichts Neues mehr, er verliert nur Zeit. Wenn Sie wollen, ich glaube, er hat das Zeug zu ganz anderen Sachen, er ist sehr intelligent.«
Aber studiert hat er nicht, er wollte lieber arbeiten. Außerdem, wißt ihr, was wir als Kinder waren? Wir waren verirrte Kugeln. Die Nachbarn haben gesagt, mit den beiden ist es hoffnungslos, aus denen wird nichts Gescheites, das sind kleine Ungeheuer, ja, Banditen sind das.
Warum sie das gesagt haben? Das war so. Wir haben immer die Obstgärten heimgesucht, besonders Durruti, der wollte immer alles, was da war, austeilen, an die andern. Bis uns einmal ein Gutsbesitzer, der hatte große Obstgärten in León, erwischt hat, und der rief: »Du da drüben«, – denn er duzte uns, – »du da drüben, mach, daß du verschwindest!« Und Durruti sagt zu mir: »Schau dir diesen alten Kerl an.« Und er: »Könnt ihr nicht hören?« Und Durruti ruft zurück: »Doch!« Und er: »Aber dalli!« Da ruft Durruti zurück: »Wir haben keine Eile.« Sagt der Besitzer: »Das ist mein Gutshof.« Und Durruti fragt ihn: »Und mein Gutshof, wo ist der? Warum habe ich keinen Gutshof?« – »Ich jag euch mit Prügeln raus.« – »Probiers doch, dann sehen wir schon, was passiert.« So haben wir uns das Obst geholt, er und ich und ein paar andere. Das meiste haben wir hergeschenkt, das machte uns Spaß. Durruti konnte es nicht lassen, er gab immer alles her.
Er ist nie auf eine höhere Schule gekommen. Was wollte er machen? Damals hieß es mit vierzehn schon arbeiten gehen und der Familie zu Hause aushelfen mit dem bißchen Lohn.
Sein Vater war bei der Nordbahn angestellt, und so kam es, daß er seinen Jungen schon mit sechzehn oder siebzehn bei der Eisenbahn unterbringen konnte. Ein Leckerbissen war das damals! Denn das hieß, einen festen Tageslohn, eine feste Arbeit, sogar als Mechaniker.
Bevor Durruti bei der Eisenbahn anfing, hat er schon in andern Werkstätten gearbeitet, in León, mit vierzehn Jahren, in Miajas Fabrik, und dort lernte er Arbeiter aus Asturien kennen. Die haben auch davon geredet, was in der Gesellschaft los war, und Durruti hat gut zugehört, denn er kannte die Ungerechtigkeit. Diese Arbeiter kamen von weit her, aus Asturien, und sie mußten zu Fuß nachhause und zurücklaufen, am Wochenende, wenn sie einmal am Tisch ihrer Frau und ihrer Familie essen wollten.
Florentino Monroy
Der Generalstreik
Dann kam der große Generalstreik von 1917. Damals war ganz Spanien im Streik, und wir hatten schon ein bißchen etwas kapiert und waren bei der sozialistischen Gewerkschaft in León; eine andere gab es damals noch nicht.
Wir sind auch die ersten gewesen, die ein wenig Wind in die Sache brachten, damit das Syndikat nicht ganz versumpfte. Die sagten immer, nur mit dem Stimmzettel könnte es besser werden. Nichts da, sagten wir, da müßt ihr euch ganz andere Sachen einfallen lassen.
Als der Streik von 1917 kam, da waren wir gerade neunzehn Jahre alt. Gewaltsam? Und ob das ein gewaltsamer Streik war! Wir haben die Gewalt provoziert. Die Regierung schickte uns das Militär auf den Hals. Der Streik wurde eines Nachts ausgerufen, er begann um Mitternacht. Überall stand die Guardia Civil parat, um die Arbeiter einzuschüchtern, als sie die Fabriken verließen. Aber wir hatten uns schon vorher abgesprochen. Wir wollten es nicht zulassen, daß der Streik im Sand verlief. Wir hatten auch ein paar Waffen, nichts Besonderes, aber genug, um den Soldaten einen Schrecken einzujagen. Die hatten schon den Bahnhof besetzt. Der Bahnhof liegt auf der andern Seite des Flusses, wenn Sie von der Stadt her kommen. Es war schon dunkel, wir sahen die Monturen der Soldaten blitzen, und dann ging es los: Bang! Bing-bang, bing-bang. Es war fast wie ein kleiner Krieg. Uns hat es Spaß gemacht.
Bald hatten wir die Guardia Civil am Hals. Mit den kleinen Revolvern war da nichts mehr zu machen. Wir suchten uns ein paar Hochspannungsmasten im Zentrum von León aus, die waren sehr hoch, und sie standen gut, es waren Bäume davor. Wir kletterten hoch und saßen da gut versteckt, und jeder hatte Mütze und Taschen voller Steine, die warfen wir auf die Polizisten.
Die Polizisten stellten sich wie die Verrückten an, weil sie nicht wußten, wo die Steine herkamen. Die Steine schlugen Funken auf dem Pflaster in der Dunkelheit. Überall Steine! Die Polizisten gingen mit Pferden auf die Leute los. Sie haben uns aber nicht erwischt.
Das war nicht viel, aber es war gut, weil die Leute sahen, daß sie mit dem passiven Kampf nichts ausrichten konnten, und allmählich kam eine revolutionäre Stimmung auf, wie sie später durch die CNT in das ganze Land gebracht worden ist.
Natürlich, wer damals schon der Anführer war bei diesen Gefechten, das war Durruti.
Florentino Monroy
Die Gewerkschaften
Auf Grund des Generalstreiks von 1917 schloß die Eisenbahnergewerkschaft, eine Institution, die von den Sozialdemokraten beherrscht und manipuliert wurde, Durruti und einige seiner Genossen aus. Sie hatten den Streik beim Wort genommen, ohne in ihrem jugendlichen Enthusiasmus zu begreifen, daß die ganze Streikbewegung nur eine Finte der Bonzen war. Largo Caballero, Besteiro, Angiano und Saborit, die Führer der Sozialdemokratie, hatten den Streik angezettelt, nur um dann die Arbeiter, deren Aktionen für eine Weile ihrer Kontrolle entglitten waren, an Händen und Füßen gefesselt den Eisenbahngesellschaften auszuliefern.
Dieses gemeine Manöver und die Komödie ihrer Strafverfolgung trugen den Bonzen nicht nur Abgeordnetensitze im Parlament ein; es gelang ihnen auf diese Weise auch, die Eisenbahnergewerkschaft von anarchistischen Mitgliedern zu säubern. Die Anarchisten waren auf ihren Versammlungen der reformistischen Taktik und dem beherrschenden Einfluß der Sozialdemokratischen Partei entgegengetreten und hatten für eine offen revolutionäre Orientierung der Gewerkschaft gekämpft.
Durruti war unter ihnen einer der rebellischsten und militantesten. Zusammen mit seinen Genossen weigerte er sich, vor den Unternehmern zu kapitulieren; stattdessen ging seine Gruppe, wie viele andere auch, zur Sabotage im großen Stil über. Lokomotiven wurden verbrannt, Schienen aufgerissen, Schuppen und Magazine angezündet, und so weiter. Diese Taktik führte zu großartigen Resultaten, und viele Arbeiter machten sie sich zu eigen. Aber sowie die Sabotageaktionen um sich griffen, ordneten die Sozialisten die Beendigung des Streiks an.
Viele Organisatoren des Streiks, unter ihnen Durruti, verloren ihre Arbeitsplätze. Die Gewerkschaft der Anarchisten, die Confederación Nacional del Trabajo, begann damals zu wachsen. Ein großer Teil des spanischen Proletariats sympathisierte mit ihr und schloß sich ihr an. Durruti ging in den Grubendistrikt von Asturien, eine Hochburg der Sozialdemokraten, und er kämpfte dort gegen neutrale und reformistische Gewerkschaftler für die anarchistische Linie der CNT. Er kam auf die schwarze Liste, verlor von neuem seine Arbeit und mußte nach Frankreich emigrieren.
V. de Rol
Ich habe Ascaso und Durruti die Anfangsgründe des Anarchismus beigebracht. Als ich Durruti das erste Mal sah, schien er mir sehr schüchtern. Er hatte noch keine eigenen Ideen. Er kam aus León und meldete sich bei unserm Syndikat in San Sebastián. Er wollte von uns Arbeit als Mechaniker haben, und wir schickten ihn in eine Fabrik. Nach wenigen Tagen kam er wieder und beklagte sich, daß die Gewerkschaft dort nicht den Mut habe, sich gegen den Unternehmer durchzusetzen. Er wolle es nun auf eigene Faust mit ihm aufnehmen, falls das Syndikat damit einverstanden sei. Das Syndikat war nicht einverstanden damit, denn es konnte und wollte wegen seiner Schwäche noch nichts unternehmen und warnte Durruti davor, sich zu opfern. Daraufhin verließ er diesen Arbeitsplatz. In San Sebastián hat er begonnen, sich unsere Ideen, wenn auch mehr gefühlsmäßig, anzueignen. Das waren die Anfänge Durrutis …
Manuel Buenacasa
Das erste Exil
Er ist dann nach Paris gegangen und hat dort als Monteur gearbeitet. Berliet oder Breguet hieß die Fabrik, glaube ich. Er war nicht allein, andere Genossen aus León haben ihn begleitet, einer besonders, den wir Bruder Lustig nannten; den haben später die Faschisten umgebracht. Dort in Frankreich haben sie viel gelernt. Als sie wieder nach Spanien kamen, kannten sie den Klassenkampf in- und auswendig. Das hat Durruti sehr gefallen, das war etwas für sein Temperament und für seine Art, die Zukunft zu sehen. Durruti ist bei den Anarcho-Syndikalisten in Paris in die Schule gegangen, an Ort und Stelle.
Florentino Monroy
In Paris arbeitete er drei Jahre lang als Mechaniker. Seine spanischen Freunde hielten ihn über die Lage in unserm Land auf dem laufenden und berichteten ihm: daß die anarchistische Bewegung sich immer weiter ausbreitete; daß in der CNT bereits über eine Million Arbeiter organisiert waren; daß eine republikanische Erhebung sich vorbereitete; daß viele den Sturz der Monarchie kommen sahen; daß die Regierung und die Bourgeoisie Banden von Revolverhelden, die sogenannten Pistoleros, aufgestellt hatten, um die Anführer der Anarchisten, der CNT und der Republikaner des linken Flügels zu liquidieren …
Den Revolutionär Durruti ließen diese Nachrichten nicht ruhen. Er kehrte heimlich über die französische Grenze nach Spanien zurück. In San Sebastián schloß er sich den anarchistischen Kampfgruppen an, die Aktionen gegen die Monarchie vorbereiteten. Dort traf er auch Francisco Ascaso, Gregorio Jover und García Oliver.
Alejandro Gilabert
Mr. Davis mit der weißen Nelke
Ich bin die Erinnerung an Durruti nie losgeworden, wie er, das wird 1920 gewesen sein, nach Matallana del Torio kam; das liegt im Norden der Provinz León. Er arbeitete dort als Mechaniker bei der Compañía Minera Anglo-Hispana. In diesem Grubendorf, das in den Bergen liegt, gab es damals schon eine organisierte Arbeiterbewegung, die von den Sozialisten beherrscht war. Als er ankam, war gerade ein Arbeitskonflikt ausgebrochen, und er wurde in das Streik-Komitee gewählt.
Ich kam an der Hand meines Vaters in das Dorf, der Anarchist war und die Arbeiter in seinem Sinn agitiert hat. Er stieg auf eine Mauer und redete auf die Menge ein. Die Arbeiter beschlossen, zur Fabrikleitung zu gehen. Als der Zug vor den Büros der Bergwerksgesellschaft eintraf, weigerte sich der Direktor, ein englischer Ingenieur, Davis hieß er, glaube ich, die Abordnung der Streikenden zu empfangen.
Mr. Davis war ein zierlicher Herr, immer sehr elegant gekleidet, eine weiße Nelke im Knopfloch, etwas schwach auf der Brust, ich glaube, er litt an der Schwindsucht. Er hatte von Durruti gehört, vielleicht hatte er Angst, jedenfalls ließ er durch den Amtsdiener, der vor der Tür stand, ausrichten, er wäre nicht zu sprechen.
Durruti ging auf den Amtsdiener zu, der bewaffnet war, und sagte ihm: »Einen schönen Gruß an Mr. Davis, und wenn er nicht zur Tür herauskommen will, dann werde ich ihn holen, und dann fliegt er aus dem Fenster zu uns auf die Straße.«
Ein paar Minuten später erschien Mr. Davis unter der Tür und lud die Streikleitung sehr höflich in sein Büro. Dort gab es eine lange Diskussion. Die Forderungen der Arbeiter wurden erfüllt, der Streik endete mit einem Sieg. Ein paar Tage später kam die Polizei mit einem Haftbefehl für Durruti. Aber da war er schon über alle Berge.
Julio Patán
Dynamit
Sein unruhiges Temperament, seine Neugier und seine Lust an der Konfrontation führten ihn nach La Coruña, Bilbao, Santander und in viele andere Städte des Nordens. Bei der Rückkehr von einer dieser Reisen stellte Durruti vor der billigen Absteige, in der er wohnte, eine ungewöhnliche Bewegung fest. Die Polizei hatte das Haus umstellt, und Durruti hielt sich fern. Seine Vorsicht war berechtigt, denn zu dieser Zeit wurde bereits das berüchtigte »Gesetz gegen Flüchtige« angewandt, das vielen Arbeitern das Leben kosten sollte.
In San Sebastián stand damals die Einweihung eines prächtigen Gebäudes bevor, das Gran Kursaal hieß und als Cabaret und Spielkasino dienen sollte. Das Königspaar und die Crème der spanischen Aristokratie, die im Sommer nach San Sebastián zu kommen pflegte, wollten daran teilnehmen. Die Polizei hatte nun einen Tunnel entdeckt, der in den Fundamenten des Gebäudes endete. Das Unternehmen wurde sogleich den Anarchisten zugeschrieben, die den Kursaal angeblich am Tag der Einweihung, in Anwesenheit des Königs, der Minister und anderer hochgestellter Haifische in die Luft sprengen wollten.
Für die Polizei ist es noch nie ein Problem gewesen, ihren Opfern ein Verbrechen in die Schuhe zu schieben. In diesem Fall hatten sie es auf Durruti und auf zwei seiner Genossen abgesehen, die als Zimmerleute beim Bau des Kasinos beschäftigt waren. Diese drei beschuldigte die Polizei, den Tunnel in nächtlicher Arbeit vorangetrieben zu haben. Durruti als Mechaniker sollte die Höllenmaschine gebaut und eine große Menge Dynamit beschafft haben, die er angeblich aus den Bergwerken von Asturien und Bilbao, wo er viele Freunde besaß, mitgebracht hatte.
Die beiden Zimmerleute, zwei Genossen namens Gregorio Suberviela und Teodoro Arrarte, sind von der Polizei in Barcelona ermordet worden. Durruti konnte nach Frankreich entkommen. Die spanischen Behörden verlangten seine Ausweisung für den Fall, daß er gefunden würde. Von daher rühren die ersten Verleumdungen gegen ihn. Man wollte ihn zum gemeinen Verbrecher stempeln. Diese Kampagne steigerte sich in dem Maß, in dem er, jeder Verfolgung zum Trotz, seine revolutionäre Arbeit fortsetzte.
V. de Rol
Durruti war immer ein Rebell, schon lange, ehe er zum Anarchisten wurde. Buenacasa, der damals die Bewegung in Katalonien anführte, sagte ihm, Barcelona sei der einzige Ort, an dem er leben könne, denn »nur in Barcelona gibt es ein proletarisches Bewußtsein«. Und der verwegene Bursche aus León, der schon in Gijón und in Rentería auf eigene Faust schwere Arbeitskonflikte ausgelöst und seine Kollegen Hammel genannt hatte, weil sie sich mit ihren Arbeitsbedingungen abfanden, folgte Buenacasas Rat und ging nach Barcelona.
Manuel Buenacasa/Crónica
Zweite Glosse Über die Wurzeln des spanischen Anarchismus
An einem Oktobertag des Jahres 1868 traf Giuseppe Fanelli, ein Italiener, in Madrid ein. Er war etwa vierzig Jahre alt, von Beruf Ingenieur, trug einen dichten schwarzen Bart, hatte funkelnde Augen, war groß von Gestalt und legte eine heitere Entschiedenheit an den Tag. Sogleich nach seiner Ankunft suchte er eine Adresse auf, die in seinem Notizbuch verzeichnet war: ein Café, in dem er eine kleine Gruppe von Arbeitern traf. Die meisten von ihnen waren Typographen aus den unscheinbaren Druckereien der spanischen Hauptstadt.
»Seine Stimme hatte einen metallischen Klang, und ihr Ausdruck paßte sich aufs genaueste dem an, was er zu sagen hatte. Er wechselte vom Tonfall des Zorns und der Drohung, wenn er von Tyrannen und Ausbeutern sprach, auf die Klangfarbe der Betrübnis, des Schmerzes und der Ermutigung über, wenn seine Rede sich den Leiden der Unterdrückten zuwandte. Das Merkwürdige an der Sache war, daß er kein Spanisch konnte; er sprach entweder französisch, eine Sprache, von der einige unter uns wenigstens ein paar Brocken verstanden, oder italienisch, wobei wir uns, so gut es ging, an die Ähnlichkeiten halten mußten, die diese Sprache mit unserer eigenen hat. Dennoch leuchteten uns seine Gedanken derart ein, daß wir, als er geendet hatte, von einer grenzenlosen Begeisterung ergriffen waren.« Noch zweiunddreißig Jahre nach dem Besuch des Italieners kann der Berichterstatter Anselmo Lorenzo, einer der ersten spanischen Anarchisten, Fanelli, den »Apostel«, wörtlich zitieren, und er erinnert sich des Schauders, der ihm über den Rücken lief, als dieser ausrief: »Cosa orribile! spaventosa!«
»Drei oder vier Abende lang trug Fanelli uns seine Propaganda vor. Er sprach auf Spaziergängen und in Cafés mit uns. Auch überließ er uns die Statuten der Internationale, das Programm der Allianz demokratischer Sozialisten und ein paar Nummern der Glocke mit Artikeln und Reden von Bakunin. Bevor er vonuns Abschied nahm, bat er uns noch darum, ein Gruppenfoto zu machen, auf dem er in unserer Mitte zu sehen ist.«
Keiner seiner Zuhörer hatte je zuvor von der Organisation gehört, als deren Emissär Fanelli nach Spanien gereist war: der Internationalen Arbeiter-Assoziation. Fanelli war ein Anhänger Bakunins, er gehörte dem »antiautoritären« Flügel der Ersten Internationale an, und die Botschaft, die er nach Spanien brachte, war die des Anarchismus.
Der Erfolg dieser revolutionären Lehre war augenblicklich und sensationell; sie breitete sich unter den Land- und Industriearbeitern des westlichen und südlichen Spanien wie ein Steppenbrand aus. Schon auf ihrem ersten Kongreß, 1870, entschied sich die spanische Arbeiterbewegung für Bakunin und gegen Marx, und zwei Jahre später konnte die Föderation der Anarchisten beim Treffen von Córdoba auf 45 000 aktive Mitglieder zählen. Die Bauernaufstände von 1873, die sich über ganz Andalusien erstreckten, standen bereits eindeutig unter anarchistischer Führung. Spanien ist das einzige Land der Welt, in dem die revolutionären Theorien Bakunins zur materiellen Gewalt geworden sind. Bis 1936 haben die Anarchisten ihre beherrschende Rolle in der spanischen Arbeiterbewegung behauptet; sie waren nicht nur zahlenmäßig in der Mehrheit, sie bildeten auch ihre militanteste Fraktion.
Dieser historisch einzigartige Sachverhalt hat eine ganze Reihe von Erklärungsversuchen auf den Plan gerufen. Keiner von ihnen leistet, für sich genommen, was er verspricht, und eine kohärente Ableitung nach den Spielregeln der politischen Ökonomie ist bisher nicht gelungen. Immerhin lassen sich die Bedingungen angeben, unter denen der spanische Anarchismus gediehen ist; sie mögen eine Entwicklung, die der rein ökonomischen Erklärung bisher getrotzt hat, immerhin verständlich machen.
Von wenigen regionalen Ausnahmen abgesehen, war Spanien bis zum Ersten Weltkrieg ein reines Agrarland. Die Klassengegensätze in dieser Gesellschaft waren so extrem und unverhüllt, daß man von zwei Nationen sprechen kann, die durch einen Abgrund voneinander getrennt waren. Die politische Klasse, die den Staatsapparat beherrschte und mit Armee und Kirche eng verbündet war, bestand in der Hauptsache aus Großgrundbesitzern. Sie war durchaus unproduktiv, korrupt und unfähig, diezeitweilig progressive Rolle zu übernehmen, die in andern Ländern Westeuropas der Bourgeoisie zugefallen war. Ihr parasitenhaftes Dasein erschöpfte sich im Verzehr von Renten; an der Entwicklung der Produktivkräfte durch kapitalistische Expansion war sie nicht interessiert. Entsprechend schwach war das Kleinbürgertum entwickelt. Abgesehen von armen Handwerkern und kleinen Händlern bestand es aus den Lakaien des »Staatsscheißkerls«, wie Marx es genannt hat, einer aufgeschwemmten, schlecht bezahlten Bürokratie, die, soweit sie nicht überhaupt funktionslos war, eher repressiven als administrativen Zwecken diente.
Das wirkliche Spanien, die riesige Mehrzahl des arbeitenden Volkes, lebte auf dem Land, und dort wurden, bis über die Jahrhundertwende hinaus, auch die wesentlichen Klassenkämpfe auf spanischem Boden ausgetragen. Ihr Verlauf hängt eng mit der Agrarstruktur zusammen. Wo sich, wie in den nördlichen Provinzen, mittelalterliche Besitz- und Produktionsverhältnisse behaupten konnten, ganze Dörfer von Klein- und Mittelbauern ihr Gemeindeland an Wald und Weide behielten, der Boden fruchtbar und ausreichend bewässert war, hielten sich in stolzer Isolierung altertümliche Gesellschaftsformen, fast außerhalb der Geldwirtschaft.
In andern Regionen aber, vor allem an der Levanteküste und in Andalusien, brach sich seit 1836 die neureiche Grundbesitzer-Bourgeoisie mit Gewalt Bahn. Nichts anderes bedeutet in Spanien das Wort Liberalismus als die Zerschlagung des alten Gemeindelandes, seinen »freien« Verkauf, das Bauernlegen und die Konstitution der Latifundienwirtschaft. Die Einführung des parlamentarischen Regimes im Jahre 1843 besiegelt die politische Herrschaft der neuen Gutsbesitzer, die selbstverständlich in der Stadt wohnen, ihre Latifundien wie ferne Kolonien betrachten und sie entweder durch Verwalter oder durch Pächter bewirtschaften lassen.
Auf diese Weise ist ein riesiges Landproletariat entstanden. Dreiviertel aller Einwohner Andalusiens sind bis zum Ausbruch des Bürgerkrieges braceros geblieben, Taglöhner, die ihre Arbeitskraft täglich für einen Hungerlohn versteigern. Der Zwölfstundentag ist die Regel während der Erntezeit. Die Hälfte des Jahres herrscht eine fast totale Arbeitslosigkeit. Endemische Armut, Unterernährung und Landflucht sind die Folge.Die Staatsgewalt tritt auf dem Dorf hauptsächlich als Besatzungsmacht in Erscheinung. Ein Jahr, nachdem sie die Regierungsgeschäfte in die Hand genommen hat, schafft die neue politische Klasse der Gutsbesitzer sich eine eigene Okkupationsarmee, die Guardia Civil, eine kasernierte Gendarmerie, angeblich, um die primitivste Form der Notwehr auf dem Lande, das Banditentum, zu liquidieren, in Wahrheit aber, um das Landproletariat in Schach zu halten, das zu neuen Kampfformen greift. Die Guardia besteht aus sorgfältig ausgewählten Leuten, die stets weit entfernt von ihrer Heimat eingesetzt werden. Es ist dieser Truppe verboten, Einheimische zu heiraten oder mit ihnen zu fraternisieren. Die Gendarmen dürfen ihre Unterkunft nie unbewaffnet oder allein verlassen; heute noch nennt man sie auf dem Land la pareja, weil sie immer paarweise patrouillieren. Der offene Klassenhaß in den andalusischen Dörfern äußerte sich bis in die dreißiger Jahre in einem permanenten Kleinkrieg, einer primitiven Landguerilla, die sich immer wieder zu plötzlichen, spontanen Bauernrevolten steigerte. Diese Aufstände entfesselten eine elementare Massengewalt und wurden mit beispielloser Todesverachtung ausgefochten. Sie nahmen immer denselben, stereotypen Verlauf: Die Landarbeiter machten die Guardia Civil nieder, nahmen Pfarrer und Beamte gefangen, zündeten die Kirche an, verbrannten Grundbücher und Pachtverträge, schafften das Geld ab, sagten sich vom Staat los, erklärten sich zu unabhängigen Kommunen und beschlossen, das Land gemeinsam zu bewirtschaften. Es ist verblüffend zu sehen, wie diese meist analphabetischen Bauern, natürlich ohne es zu wissen, genau den Anweisungen Bakunins folgten. Da ihre Revolten rein lokal und ohne Koordination geführt wurden, dauerte es meist nur wenige Tage, bis sie von den Truppen der Regierung blutig niedergeschlagen wurden.
Hier, in den Dörfern Andalusiens, hat der spanische Anarchismus die erste seiner beiden Wurzeln geschlagen. Er gab der spontanen Bewegung des Landproletariats fast mit einem Schlag eine ideologische Basis und eine feste organisatorische Struktur, und er nährte in den Dörfern die naive, aber unerschütterliche Erwartung der baldigen und totalen Revolution.
Um die Jahrhundertwende konnte man überall im Süden Spaniens die »Apostel der Idee« antreffen, die zu Fuß, auf Eselsrücken und Planwagen das Land durchstreiften, ohne einenPfennig in der Tasche. Die Arbeiter nahmen sie auf und gaben ihnen zu essen. (Seit ihren Anfängen, und das gilt bis auf den heutigen Tag, ist die anarchistische Bewegung in Spanien nie von außen unterstützt oder finanziert worden.) Auf diese Weise kam ein massenhafter Lernprozeß in Gang. Überall traf man nun lesende Landarbeiter und Bauern an, und unter den Analphabeten gab es viele, die ganze Artikel aus den Zeitungen und Broschüren der Bewegung auswendig lernten. In jedem Dorf gab es wenigstens einen »Erleuchteten«, einen »bewußten Arbeiter«, der daran zu erkennen war, daß er weder rauchte noch spielte, noch trank, daß er sich zum Atheismus bekannte, daß er mit seiner Frau, der er die Treue hielt, nicht verheiratet war, daß er seine Kinder nicht taufen ließ, daß er viel las und alles, was er wußte, weiterzugeben suchte.
Den ökonomischen Gegenpol zu den verarmten Dürrezonen des südlichen und westlichen Spanien bildet Katalonien, von jeher die reichste und industriell am höchsten entwickelte Region des Landes. Barcelona, die Metropole der Schiffahrt, des Exports, der Banken und der Textilindustrie, war schon um die Jahrhundertwende zum Brückenkopf des Kapitalismus auf der Iberischen Halbinsel geworden. Das Steueraufkommen per capita lag in Katalonien um das Doppelte über dem spanischen Durchschnitt. Abgesehen vom Baskenland ist dies der einzige Teil des Landes, der eine funktionsfähige Unternehmer-Bourgeoisie hervorgebracht hat; die katalanischen Industriellen und Bankiers waren nicht wie die Gutsbesitzer ausschließlich auf Verschwendung, sondern auf Akkumulation bedacht. Zwischen 1870 und 1930 ist in Barcelona und Umgebung ein riesiges, hochkonzentriertes Industrieproletariat entstanden.
Aber im Gegensatz zu vergleichbaren europäischen Regionen haben sich die katalanischen Arbeiter nicht der Sozialdemokratie und den reformistischen Gewerkschaften, sondern dem Anarchismus zugewandt, der hier seine zweite, seine städtische Basis fand. Bereits 1918 waren 80% aller Arbeiter in Katalonien anarchistisch organisiert. Dieser Umstand ist noch schwerer zu erklären als der Erfolg der Bakunisten auf dem Land. Die Soziologie kann einen ersten Hinweis geben. Die Arbeiterschaft des Industriegebiets von Barcelona ist nur zum geringsten Teil einheimisch; sie hat sich zur Hälfte allein aus den Dürreprovinzen Murcia und Almería, also aus dem Süden, rekrutiert, und diese Binnenwanderung hat sich, auf Grund der strukturellen Arbeitslosigkeit auf dem Lande, bis heute fortgesetzt.
Ein zweites Motiv stellen die zentrifugalen Kräfte dar, die in der spanischen Geschichte eine so große Rolle spielen. Ein starker Lokalgeist, ein Drang zur Unabhängigkeit, zur Autonomie, ein beharrlicher Widerstand gegen die Herrschaftsansprüche der Madrider Zentralregierung zeichnet viele spanische Provinzen aus; aber nirgends macht er sich stärker geltend als in Katalonien, das in mancher Beziehung als eine Nation für sich gelten darf und das schon im siebzehnten Jahrhundert einen Unabhängigkeitskrieg gegen die spanische Monarchie geführt hat. Die ökonomische Sonderentwicklung hat diese Tendenzen nur noch verstärkt. Der katalanische Nationalismus hat ein doppeltes Gesicht. Sein rechter Flügel vertrat die Interessen der einheimischen Bourgeoisie; er benutzte die Frage der Autonomie, um den Klassenkampf zu mystifizieren. Aber auf der Seite der Massen wirkte die katalanische Frage als durchaus revolutionäres Moment. Das Verlangen nach Selbstverwaltung, der Haß auf die zentrale Staatsgewalt, das Bestehen auf der radikalen Dezentralisierung der Macht, das alles waren Motive, die sich im Anarchismus wiederfanden.
Nie und nirgends haben die Anarchisten sich als eine politische Partei verstanden; es gehört zu ihren Prinzipien, sich an parlamentarischen Wahlen nicht zu beteiligen und keine Regierungsposten zu übernehmen; sie wollen sich des Staates nicht bemächtigen, sie wollen ihn abschaffen. Auch in ihren eigenen Zusammenschlüssen wehren sie sich gegen die Konzentration der Macht an der Spitze der Organisation, in der Zentrale. Ihre Föderationen werden von der Basis her bestimmt; jede ihrer lokalen Gruppen genießt eine sehr weitgehende Autonomie, und jedenfalls in der Theorie ist die Basis nicht gehalten, sich den Beschlüssen der Führung zu beugen. Selbstverständlich hängt es von den konkreten Bedingungen ab, wie diese Prinzipien in der Praxis verwirklicht werden. In Spanien hat der Anarchismus seine endgültige Organisationsform erst 1910 gefunden, mit der Gründung des anarchistischen Gewerkschaftsbundes CNT (Confederación Nacional del Trabajo).
Die CNT war die einzige revolutionäre Gewerkschaft der Welt.Sie hat sich nie als »Sozialpartner« verstanden, der mit den Unternehmern verhandelt, um die materielle Lage der Arbeiterklasse zu verbessern; ihr Programm und ihre Praxis bestanden darin, den offenen, permanenten Krieg der Lohnarbeiter gegen das Kapital bis zum endgültigen Sieg zu führen. Dieser Strategie entsprach ihr Aufbau und ihr taktisches Verhalten.
Sie war nie ein Zusammenschluß von Beitragszahlern, und sie hat keine finanziellen Reserven akkumuliert. Ihr Mitgliederbeitrag war in der Stadt sehr geringfügig, auf dem Lande war die Mitgliedschaft oft ganz umsonst. Noch 1936 hatte die CNT bei über einer Million von Organisierten nur einen einzigen bezahlten Funktionär! Ein bürokratischer Apparat existierte nicht. Die Führungskader lebten von ihrer eigenen Arbeit im Betrieb oder von der direkten Unterstützung durch die Gruppen an der Basis, für die sie tätig waren. Das ist kein unerhebliches Detail, sondern ein entscheidender Grund dafür, daß die CNT niemals von den Massen isolierte »Arbeiterführer« mit den herkömmlichen und unvermeidlichen Deformationen des Bonzentums hervorgebracht hat. Die ständige Kontrolle von unten wurde nicht formal, durch Statuten garantiert; sie folgte aus den Lebensverhältnissen der Militanten, die auf das Vertrauen ihrer Basis unmittelbar angewiesen blieben.
Die hauptsächlichen Waffen der CNT, auf dem Land wie in der Stadt, waren der Streik und die Guerilla. Von der Arbeitsniederlegung bis zum Aufstand war es für die Anarchisten immer nur ein Schritt. Ihre Arbeitskämpfe wurden immer extrem betriebsnah geführt. Den reinen Lohnkampf zur Ausdehnung und Sicherung des »sozialen Besitzstandes« lehnte diese Gewerkschaftsbewegung ab. Sie wollte keine »Sozialleistungen« und keine Versicherungen haben, und sie schloß grundsätzlich keine Tarifverträge ab. Die zahlreichen Verbesserungen, die sie für die Arbeiter erzielte, erkannte sie immer nur de facto an. Auf Schlichtungsverhandlungen und Friedenspflichten, gleich welcher Art, ließ sich die CNT nicht ein. Sie verfügte nicht einmal über eine Streikkasse. Das hatte zur Folge, daß ihre Streiks nicht lange dauerten. Um so gewaltsamer wurden sie ausgetragen. Ihre Mittel waren revolutionär: sie reichten von der Selbstverteidigung bis zur Sabotage und von der Expropriation bis zum bewaffneten Aufstand.
Damit stellte sich für die anarchistische Bewegung die Fragenach dem Verhältnis von legaler und illegaler Arbeit. Ein moralisches Problem war das unter den Bedingungen, die in Spanien gegeben waren, ganz und gar nicht; denn die herrschende Klasse hat sich auf der Iberischen Halbinsel nie die Mühe gemacht, auch nur die bürgerliche Fassade eines demokratischen Rechtsstaates aufrechtzuerhalten. Die Parlamentswahlen waren jahrzehntelang eine totale Farce; sie beruhten auf Stimmenkauf und Erpressung durch das Kazikensystem auf dem Lande und auf unverschämter Fälschung. Eine Gewaltenteilung im Sinn der liberalen Staatstheorien hat es in Spanien nie gegeben. Bis zum Ende des Ersten Weltkriegs existierte auch keine Sozialgesetzgebung, und die Gesetze, die danach erlassen wurden, blieben ohne Wirkung. Von seiten der Unternehmer wie von seiten des Staates erfuhr die Arbeiterklasse alltäglich offenes Unrecht und unverhüllte Gewalt. Damit war für sie die Gewaltfrage beantwortet, ehe sie sich stellen konnte.
Allerdings war die CNT eine Massenorganisation, die ungeachtet aller Verbote nicht im Unsichtbaren operieren konnte. Ihre illegale Arbeit haben schon sehr früh geheime Kadergruppen wie die Solidarios übernommen: Selbstverteidigung, Waffenversorgung, Geldbeschaffung, Gefangenenbefreiung, Terrorismus und Spionage. 1927 wurde diese Arbeitsteilung mit der Gründung der Federación Anarquista Ibérica, der Iberischen Anarchistischen Föderation (FAI) formalisiert. Diese Organisation arbeitete grundsätzlich konspirativ. Weder über ihre Mitgliederzahl noch über ihre inneren Verhältnisse ist Genaues bekannt, doch war ihr Prestige unter den spanischen Arbeitern ungeheuer. Jeder, der ihr angehörte, war zugleich in der CNT organisiert. Die FAI bildete sozusagen den harten Kern der anarchistischen Gewerkschaften; sie bot zugleich die sichersten Garantien gegen opportunistische Anwandlungen und gegen die Gefahr des Abgleitens in den Reformismus. In dieser organisatorischen Struktur kam Bakunins Modell einer großen, spontanen Massenbewegung wieder zum Vorschein, als deren Kader eine feste und geheime Gruppe von Berufsrevolutionären am Werk ist.
Über die FAI ist immer viel gefabelt worden. Es ist unvermeidlich, daß sich an den Nimbus einer geheimen Organisation allerlei Gerüchte heften. Von der bürgerlichen Schreckenspropaganda kann man dabei schon wegen ihrer offenkundigen Ignoranz absehen. (So behaupteten die Wortführer der Groß