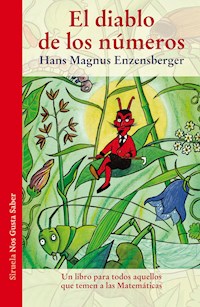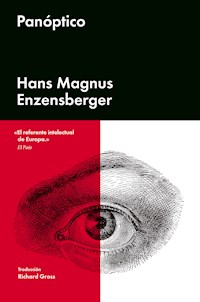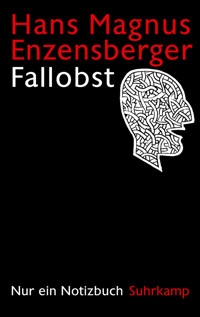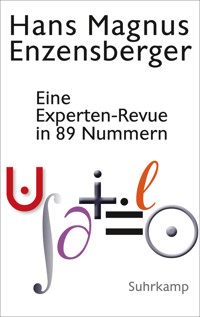22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Unter dem Titel Politik und Verbrechen präsentiert Enzensberger seine eigenen Versuche, die Auffassungen von Recht und Rechtsverletzung, von Staat, Herrschaft, Gehorsam und Verrat zu revidieren. Es sind Versuche, das Verbrecherische an der Politik selber zu entlarven ... Von Mandevilles Bienenfabel bis zu Brechts Dreigroschenoper ist dieser Zusammenhang bemerkt und zu einer literarischen Figur, zur Spiegelung des Ehrenmannes im Ganoven wie des Kriminellen im Spießbürger, also zu der Inversion von Verbrechen und bürgerlich reputierlichem Erfolg ausgebildet worden.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 451
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Hans Magnus Enzensberger
Politik und Verbrechen
Neun Beiträge
Suhrkamp
Inhalt
Reflexionen vor einem Glaskasten (1964)
Rafael Trujillo. Bildnis eines Landesvaters (1963)
Chicago-Ballade. Modell einer terroristischen Gesellschaft (1962)
Pupetta oder das Ende der Neuen Camorra (1960)
Wilma Montesi. Ein Leben nach dem Tode (1959)
Der arglose Deserteur. Rekonstruktion einer Hinrichtung (1958)
Die Träumer des Absoluten (1962/63)
Erster Teil: Traktat und Bombe
Zweiter Teil: Die schönen Seelen des Terrors
Zur Theorie des Verrats (1964)
Nachweise und Anmerkungen
Reflexionen vor einem Glaskasten
I. Definitionen. Was ein Verbrechen ist, wissen wir und wissens nicht. Die Encyclopaedia Britannica macht darüber die folgenden Angaben: »Verbrechen ..., allgemeine Bezeichnung für Verstöße gegen die Strafgesetzgebung (s. d.). Man hat das Verbrechen definiert als ›Mißachtung oder Ablehnung der Verhaltensnormen, welche die Gesamtheit im übrigen als verbindlich betrachtete Sir James Stephen beschreibt es als ›eine Handlung oder Unterlassung, deretwegen die Person, die sich ihrer schuldig macht, gesetzlich bestraft werden kann‹.« [1] Nicht viel anders Thomas Hobbes, der vor dreihundert Jahren schrieb: »Ein Verbrechen ist eine Sünde, die begeht, wer durch Taten oder Worte tut, was das Gesetz verbietet, oder unterläßt, was es befiehlt.« [2] Die tautologische Struktur dieser Sätze liegt auf der Hand, und wie alle Tautologien sind sie umkehrbar: Was bestraft wird, ist ein Verbrechen, was ein Verbrechen ist, wird bestraft; strafwürdig ist alles Strafbare und vice versa. Das sprachliche Vorbild solcher Definitionen ist zu suchen in dem biblischen Satz: Ich bin der ich bin. Sie stellen den Gesetzgeber jenseits aller Vernunft, über jedes Raisonnement. Das kodifizierte Recht macht sich diesen Gestus zu eigen. Im deutschen Strafgesetzbuch heißt es schlicht: »Eine mit Zuchthaus oder mit Einschließung von mehr als fünf Jahren bedrohte Handlung ist ein Verbrechen.«
Die praktischen Vorteile einer Begriffsbestimmung, die jede Diskussion ausschließt, sind nicht gering. Sie enthebt die juristische Praxis ein für allemal der Frage, was ein Verbrechen sei, und schiebt das Problem der theoretischen Arbeit zu, als Spezialität für scharfsinnige Köpfe. Im Seminar ist über den »materiellen Verbrechensbegriff« viel nachgedacht und wenig Schlüssiges ermittelt worden. Kein Wunder, da die Strafgesetzgebung ihrerseits kein schlüssiges System, sondern ein höchst heterogenes, oft bizarres Gemenge ist, in dem sich Bestimmungen zum Schutz der verschiedensten »Rechtsgüter« und Interessen, kodifizierte Tabu- und Moralvorstellungen und bloß pragmatisch-wertfreie Spielregeln historisch abgelagert haben.
Übrigens befinden sich die Rechtsgelehrten in einem ganz gewöhnlichen Fall. Je allgemeiner, je fundamentaler eine Erscheinung, desto undeutlicher pflegt ihr Begriff zu sein. Niemand (oder jeder) weiß anzugeben, was eine Nation ist (doch jeder anders). Alle kennen Geld, manche wissen damit umzugehen, die Nationalökonomen aber können sich nicht über die Frage einigen, was es sei. Was ist Gesundheit? Die Medizin stellt Vermutungen an. Was ist der Tod? Die Biologie antwortet mit Vorschlägen.
In solchen Fällen ist es vielleicht das beste, auf die Straße zu gehen und die ersten zehn Passanten zu fragen, die man trifft. Die häufigste Antwort ist nicht eine Definition, sondern ein Beispiel, und zwar, auffallenderweise, immer dasselbe: »Ein Verbrechen, das ist zum Beispiel ein Mord.« Die Häufigkeit dieser Antwort steht in keinem Verhältnis zur Kriminalstatistik, in der ganz andere Delikte die Hauptrolle spielen. Obwohl er relativ selten ist, spielt der Mord im allgemeinen Bewußtsein eine Schlüsselrolle. Kraft seines Beispiels wird überhaupt erst verstanden, was ein Verbrechen ist.
Kriminalroman und Kriminalfilm, als Spiegelungen dieses allgemeinen Bewußtseins, bestätigen, daß der Mord darin einen zentralen Platz einnimmt, ja mit dem Verbrechen geradezu gleichgesetzt wird.
Daß der Mord das eigentliche und älteste, das kapitale Verbrechen ist, läßt sich übrigens, nach dem Gesetz der Talion, auch aus der Strafe erschließen: Die älteste und höchste, bis tief ins Mittelalter auch die hauptsächliche Strafe, nämlich die Todesstrafe, setzt, was sie vergelten will, den Mord voraus.
2. Naturgeschichte des Verbrechens. Über den stammesgeschichtlichen Ursprung des Verbrechens besitzen wir keinerlei gesicherte Kenntnis. Bei den primitivsten Gesellschaften, die der Beobachtung zugänglich sind, gibt es bereits »Rechtsbrecher«, und zwar selbst dann, wenn es an kodifizierten Vorschriften fehlt. In den ältesten Urkunden des Menschengeschlechts spielt der Mord eine bedeutende Rolle. Da der Urzustand der Gesellschaft nirgends empirisch faßbar ist, muß jede Erforschung seiner Naturgeschichte hypothetisch bleiben. Zur Verfügung stehen ihr folgende Hilfsquellen: die biologische Verhaltensforschung (die allerdings nur bedingte Rückschlüsse auf das menschliche Verhalten erlaubt); die Ethnologie; die Mythenforschung; sowie die Psychoanalyse.
Die klassische Darstellung des »ersten Verbrechens« hat Sigmund Freud gegeben. Sie geht aus von der »Darwinschen Urhorde«: »Ein gewalttätiger, eifersüchtiger Vater, der alle Weibchen für sich behält und die heranwachsenden Söhne vertreibt, nichts weiter.« Das Verbrechen selbst wird folgendermaßen geschildert:
»Eines Tages taten sich die ausgetriebenen Brüder zusammen, erschlugen und verzehrten den Vater und machten so der Vaterhorde ein Ende. Vereint wagten sie und brachten zustande, was dem einzelnen unmöglich geblieben wäre ... Der gewalttätige Urvater war gewiß das beneidete und gefürchtete Vorbild eines jeden aus der Brüderschar gewesen. Nun setzten sie im Akte des Verzehrens die Identifizierung mit ihm durch, eigneten sich jeder ein Stück seiner Stärke an. Die Totemmahlzeit, vielleicht das erste Fest der Menschheit, wäre die Wiederholung und die Gedenkfeier dieser denkwürdigen, verbrecherischen Tat, mit welcher so vieles seinen Anfang nahm, die sozialen Organisationen, die sittlichen Einschränkungen und die Religion.« [3]
Diese Darstellung begegnet dem vordergründigen Einwand, es könne von einem Verbrechen die Rede nicht sein, wo es kein Gesetz gebe. Ein solches Bedenken ist juridisch, nicht philosophisch, und greift zu kurz; die Scheinfrage, auf die es führt, gleicht jener nach der Priorität von Henne oder Ei. Erst am Unrecht, als seiner Grenze, kann Recht sich definieren und für Recht erkannt werden; die »sittlichen Einschränkungen« sind nur als Antwort auf eine Herausforderung zu denken. Insofern ist das ursprüngliche Verbrechen ohne Zweifel ein schöpferischer Akt. (Von seiner rechtsetzenden Kraft hat Walter Benjamin in seiner Schrift Zur Kritik der Gewalt gehandelt.)
Diese Hypothese, die Freud in seinem Aufsatz über Die infantile Wiederkehr des Totemismus aufgestellt hat, ist zugleich berühmt und unbekannt; aus guten Gründen. Über die Widerstände, die sich gegen seinen Versuch regen würden, »den Beginn unseres kulturellen Besitzes, auf den wir mit Recht so stolz sind, auf ein gräßliches, alle unsere Gefühle beleidigendes Verbrechen zurückzuführen«, hat Freud sich wenig Illusionen gemacht. Von gelehrten Spezialisten abgesehen, hat man seinen ›wissenschaftlichen Mythos‹ nicht einmal bestritten, sondern ignoriert. [4] Längst nicht mehr sind es, wie bis in die dreißiger Jahre hinein, in erster Linie die sexuellen Tabus, welche eine Rezeption seiner Thesen blockieren, sondern ihre gesellschaftlichen und politischen Konsequenzen. Je offensichtlicher diese geschichtlich zutage treten, desto gründlicher werden sie verdrängt.
3. Politik und Mord. Der ursprüngliche politische Akt fällt also, wenn wir Freud Gehör schenken wollen, mit dem ursprünglichen Verbrechen zusammen. Zwischen Mord und Politik besteht ein alter, enger und dunkler Zusammenhang. Er ist in der Grundstruktur aller bisherigen Herrschaft aufbewahrt: Sie wird von demjenigen ausgeübt, der die Beherrschten töten lassen kann. Der Machthaber ist »der Überlebende«. Diese Definition stammt von Elias Canetti, der eine ausgezeichnete Phänomenologie der Herrschaft geliefert hat. [5]
Den verbrecherischen Akt, der sie gestiftet hat, bildet die Sprache der Politik bis auf den heutigen Tag ab. Auch im harmlosesten und zivilisiertesten Wahlkampf »schlägt« ein Kandidat den andern (was eigentlich heißt: er schlägt ihn tot); eine Regierung wird »gestürzt« (nämlich zu Tode); Minister werden »abgeschossen«. Was in solchen Ausdrükken symbolisch aufbewahrt ist, entfaltet und verwirklicht sich in extremen gesellschaftlichen Lagen. Keine Revolution kann darauf verzichten, den alten Herrscher zu töten. Sie muß das Tabu brechen, das den Beherrschten verbietet, ihn »anzutasten«; denn nur »wer es zustande gebracht hat, ein solches Verbot zu übertreten, (hat) selbst den Charakter des Verbotenen gewonnen«. [6] Das Mana des getöteten Herrschers geht auf seine Mörder über. Alle bisherigen Revolutionen haben sich am alten, vorrevolutionären Zustand infiziert und die Grundstruktur der Herrschaft geerbt, gegen welche sie angetreten sind.
4. Widerspruch. Auch die »fortschrittlichsten«, »zivilisiertesten« Gesellschaftverfassungen sehen die Tötung von Menschen durch Menschen vor und erlauben sie, aber nur, wo es »zum Äußersten« kommt, zum Beispiel in revolutionären Situationen oder im Krieg. Im übrigen aber liegt die Grundstruktur der Herrschaft nicht zutage, sie ist verdeckt. Der Befehl ist nach wie vor ein »suspendiertes Todesurteil« (Canetti), aber dieses Urteil wird nur als unendlich vermittelte Drohung ausgesprochen, es existiert nur virtuell. [7] Diese Einschränkung erscheint in der Geschichte institutionell verfestigt als das Recht.
Daß das Recht, wie jede gesellschaftliche Ordnung, auf dem anfänglichen Verbrechen ruht; daß es durch Unrecht gestiftet wird – diesen Widerspruch auf seinem Grund hat alle Rechtsphilosophie sich aufzulösen bemüht: bisher vergebens. Denn jede bisherige Rechtsordnung ist Schutz vor der Herrschaft und ihr Instrument zugleich. Vielleicht kann man die ganze Geschichte des Rechtes als die seiner Ablösung von der politischen Sphäre lesen. Dieser ungeheure Prozeß kann nur von Berufenen entfaltet werden; doch scheint es, als habe er die inneren Widersprüche auf seinem Grunde nicht aufzulösen vermocht, sondern mitgeschleppt. Die Trennung von ausübender, gesetzgebender und rechtsprechender Gewalt; die Unabhängigkeit und Unabsetzbarkeit der Richter; die Abtrennung der Staatsanwaltschaft vom Gericht und ihre Instauration als »Partei«; die vielfältigen prozeßrechtlichen Sicherungen: all das sind Vermittlungen von unschätzbarem Wert. Dennoch bleibt der Herrscher immer zugleich der oberste Gerichtsherr, und der Richter, als »unparteiische« Person, steht immer zugleich im Dienste des Staates.
Am deutlichsten ist die zwiespältige Natur der Rechtsordnungen an der Problematik der Strafe abzulesen. Wenn jeder Befehl ein »suspendiertes Todesurteil« ist, so stellt die Strafe dessen, wie auch immer gemilderte, Vollstreckung dar. Der Tod ist die älteste und mächtigste, er ist die eigentliche Strafe. Wird sie abgeschafft, so rückt die Pflicht und das Recht des Staates, zu strafen, aus dem magischen Dunkel religiöser Vorstellungen ins Feld der rationalen Überlegung. Mit der Todesstrafe steht die Strafe schlechthin zur Diskussion; deshalb scheiden an ihr sich Geister und Verfassungen. Dies allein erklärt die Leidenschaft, mit der um sie gestritten wird. Weder die Möglichkeit des Justizirrtums, noch bloßes Mitleid mit den Hingerichteten, geschweige denn die Absicht, die Gesellschaft vor Verbrechern zu schützen, nähren diesen Streit. Gleichgültig, was die Rufer nach der Todesstrafe vorwenden, ein hysterischer Unterton verrät ihr Verlangen nach einer übermächtigen Autorität, mit der sie sich identifizieren können. Was dem Einzelnen verboten ist, andere »unschädlich zu machen«, also zu töten, erlaubt ihm, als Angehörigem des Kollektivs, die Hinrichtung. Daher deren eigentümliche mystique: die eines Rituals. Daß die Todesstrafe früher öffentlich vollstreckt wurde, ist ganz und gar konsequent; die Tötung im Namen aller kann nur öffentlich geschehen, denn alle haben an ihr teil, der Henker ist nur unser Stellvertreter.
Die Abschaffung der Todesstrafe würde, zu Ende gedacht die Natur des Staates verändern. Sie ist ein Vorgriff auf Gesellschaftsordnungen, von denen wir weit entfernt sind. Sie entzieht der staatlichen Herrschaft die Befugnis, über Leben oder Tod des Einzelnen zu entscheiden. Diese Befugnis aber ist der eigentliche Kern der Souveränität.
5. Souveränität. »Die Souveränität im juristischen Sinne«, schrieb der deutsche Historiker Heinrich von Treitschke, »die vollkommene Unabhängigkeit des Staates von jeder anderen Gewalt auf Erden, liegt dergestalt in seinem Wesen, daß man sagen kann, sie ist geradezu das Kriterium für die Natur des Staates.« [8] Die Kraft dieser Mystifikation ist ungebrochen, obgleich auf der Hand liegt, daß es Souveränität in diesem Sinne nie gegeben hat. Aus ihrer Idee folgt, daß der Staat jenseits aller Rechtsordnungen, nämlich über ihnen steht. Wer an ihr festhält, für den kann es ein Völkerrecht nicht geben. Souveränität und Völkerrecht schließen einander aus.
Ein Nachschlagewerk aus dem Jahre 1959 konstatiert dementsprechend: »Es ist sehr zweifelhaft, ob es überhaupt schon ein Völkerrecht gibt... Das bisherige sog. ›Völkerrecht‹ hat sich denn auch im wesentlichen darauf beschränkt, diplomatische Regeln für den Austausch von Erklärungen zu entwickeln und Spielregeln für den Kriegsfall festzulegen... Eine verbindliche Sozialnorm gibt es eben zwischen Staaten noch nicht.« [9]
Der reinste Ausdruck der staatlichen Souveränität, so wie Treitschke sie versteht, ist nach innen, im Umgang mit dem einzelnen Gegner, die Todesstrafe; nach außen, im Umgang mit anderen Staaten, der Krieg. Darf der Staat als Herr über die Rechtsordnung einen, so darf er auch, in seinem und ihrem Namen, viele, notfalls alle töten lassen und die Vollstreckung dieses Souveränitätsaktes seinen Bürgern zur Pflicht machen.
»Der einzelne Volksangehörige kann in diesem Krieg«, schrieb Sigmund Freud und meinte damit den Ersten Weltkrieg, »mit Schrecken feststellen, was sich ihm gelegentlich schon in Friedenszeiten aufdrängen wollte, daß der Staat dem Einzelnen den Gebrauch des Unrechts untersagt hat, nicht weil er es abschaffen, sondern weil er es monopolisieren will wie Salz und Tabak. Der kriegführende Staat gibt sich jedes Unrecht, jede Gewalttätigkeit frei, die den Einzelnen entehren würde... Man wende nicht ein, daß der Staat auf den Gebrauch des Unrechts nicht verzichten kann, weil er sich dadurch in Nachteil setzte. Auch für den Einzelnen ist die Befolgung der sittlichen Normen, der Verzicht auf brutale Machtbetätigung in der Regel sehr unvorteilhaft.« [10]
Mehr als die Gewalttätigkeit, welche die Nationalstaaten im Ersten Weltkrieg bereits bewiesen haben, überrascht uns heute die Überraschung der bürgerlichen Welt angesichts ihres Werkes und ihrer Katastrophe. Die einfachste Überlegung zeigt, daß der private Mord in geschichtlichen Zeiten nie mit dem öffentlichen sich hat messen können. Alle individuellen Gewaltverbrechen von Kain bis Landru wiegen das Unrecht nicht auf, das allein die Erbfolgekriege Europas im achtzehnten Jahrhundert oder die kolonialen Hoheitsakte eines einzigen Jahrzehnts verursacht haben.
Solche Überlegungen gelten freilich als dilettantisch. Maßgebende Staatsmänner, maßgebende Juristen haben sich nie sonderlich weit auf sie eingelassen. Diese Zurückhaltung ist verständlich. Ganz ist der Zusammenhang zwischen Politik und Verbrechen allerdings nie in Vergessenheit geraten. Eine Ahnung davon hat sich auch das neunzehnte Jahrhundert bewahrt. Abgedrängt an den Rand des Bewußtseins, und damit an den Rand der Gesellschaft, ist das Problem zu einer Domäne der Außenseiter geworden. Wer sich, wie Freud, mit ihm beschäftigt hat, der sah sich in gemischter Gesellschaft, unter großen Ketzern und kleinen Querulanten, unter Zukurzgekommenen und Ausgebeuteten, unter sonderbaren Heiligen und Sektierern aller Couleurs. Je sicherer eine Gesellschaft sich ihrer Voraussetzungen fühlt, desto eher läßt sie zu, daß jene Außenseiter sie in Zweifel ziehen. Das bürgerliche neunzehnte Jahrhundert erstickte zwar jeden bewaffneten Angriff auf seine Herrschaftsform, ließ aber die radikalsten Erörterungen ihrer Fundamente als Zeitvertreib für Weltverbesserer zu. Nicht umsonst gilt es bis auf den heutigen Tag als der Gipfel der Lächerlichkeit, die Welt verbessern zu wollen, indessen die konträre Anstrengung auf eine gewisse Hochachtung immer rechnen darf. Mit Lächerlichkeit, die der Verdrängung dienen soll, sieht sich im besondern gestraft, wer die Lehren des Zweiten Weltkrieges ernst nehmen möchte. Lächerlichkeit allein tötet indessen nicht mehr. Gummiknüppel und Dossier, die ihr nachhelfen sollen, beweisen es.
6. Epoche. Wer wissen möchte, in welcher Epoche er lebt, der braucht heutzutage nur die nächstbeste Zeitung aufzuschlagen. Er wird ihr entnehmen können: daß er sich im Zeitalter der synthetischen Faser, des Tourismus, des Leistungssportes oder des absurden Theaters befindet. In solche Umgebung hat die Bewußtseins-Industrie auch den Satz zu rücken verstanden, unsere Epoche sei auf die Namen Auschwitz und Hiroshima getauft. Er hört sich, zwanzig Jahre nach dieser Taufe, bereits wie ein Gemeinplatz aus dem kulturkritischen Feuilleton an. Wahre Sätze werden heute abgeschabt, ehe sie sich entfalten können, und behandelt wie kurzlebige Konsumgüter, die sich beliebig wegwerfen und durch jüngere Modelle ersetzen lassen. Alles Ausgesprochene scheint diesem Verfahren der künstlichen Alterung unterworfen; man glaubt sich eines Satzes enthoben, indem man ihn verschrottet. Es ist aber leichter, sich einer Ware zu entledigen, als einer Wahrheit.
Was in den vierziger Jahren geschehen ist, altert nicht; statt fern zu rücken, rückt es uns auf den Leib und zwingt zu einer Revision aller menschlichen Denkweisen und Verhältnisse: unsere bisherigen Auffassungen davon, was Recht und Unrecht, was ein Verbrechen, was ein Staat ist, können wir nur behaupten um den Preis fortdauernder Lebensgefahr für uns und für alle künftigen Leute.
Daß die modernen Nationalstaaten und ihre Anhänger moralisch zu allem fähig seien, ist zwar keine neue Entdeckung: die Wortführer des Imperialismus haben es schon im vergangenen Jahrhundert mit Stolz verkündet. Inzwischen wissen wir, daß sie auch technisch zu allem fähig sind. Der uralte Zusammenhang von Verbrechen und Politik, die innern Widersprüche des Rechts, die Wahnvorstellung der Souveränität – sie müssen infolgedessen immer gewaltsamer hervortreten und werden im buchstäblichen, explosiven Sinn des Wortes eklatant.
Nichts kann so bleiben, wie es war und ist. Die Revision aber, zu der wir, wie jedermann weiß, bei Strafe des Selbstmords gezwungen sind, hat, wie jedermann weiß, noch kaum begonnen und will schon, im hochspezialisierten Geschwätz der »Bewältigung«, ersticken. Die Wirklichkeit namens Auschwitz soll exorziert werden, als wäre sie Vergangenheit, und zwar nationale: nicht gemeinsame Gegenwart und Zukunft. Dazu dient ein kompliziertes Ritual folgenloser, lokaler Selbstbezichtigung. Mit einem Ereignis, das die Wurzeln aller bisherigen Politik bloßgelegt hat, will dieses Ritual fertig werden (und das heißt letzten Endes: will es vergessen), ohne daraus die Konsequenzen zu ziehen, zu denen es die Beteiligten (Unbeteiligte gibt es nicht) zwingt. Daß eine solche »Bewältigung« steril bleiben muß, daß sie nicht einmal die oberflächlichsten und nächstliegenden Folgen zeitigen kann, liegt auf der Hand; geschweige denn, daß sie die Voraussetzungen zu beseitigen vermöchte, die das Ereignis ermöglicht haben.
Die Zwangsvorstellung der Souveränität ist so gut wie unerschüttert. Nach wie vor besteht »das Wesen des Staates darin, daß er keine höhere Gewalt über sich dulden kann« (Treitschke); nach wie vor gilt Souveränität, so verstanden, als »das Kriterium für die Natur des Staates«; nur daß zum Kriterium für dieses Kriterium, fünfzehn Jahre nach der deutschen Niederlage und nach der Vernichtung von Hiroshima, in den Augen führender deutscher Politiker und Militärs die Verfügungsgewalt über das nukleare Gerät geworden ist.
Dieses Gerät aber ist die Gegenwart und die Zukunft von Auschwitz. Wie will den Genozid von gestern verurteilen oder gar »bewältigen«, wer den Genozid von morgen plant und ihn sorgfältig, mit allen wissenschaftlichen und industriellen Mitteln, die uns zu Gebote stehen, vorbereitet? Alle Gründe, mit denen sie sich, aus dem Arsenal ihrer jeweiligen Ideologien, versehen haben, schlägt das Gerät seinen Herren (seinen Dienern) aus der Hand. Zur Verteidigung von Rechten und von Freiheiten kann es nicht dienen; sondern umgekehrt suspendiert das Gerät, allein durch seine Existenz, alle menschlichen Rechte: das Recht, spazierenzugehen, das Recht, Parteien zu gründen, das Recht, zu arbeiten oder zu essen – sie existieren, wie alle andern, unter seinem Schutz, das heißt, unter seiner Drohung nur noch auf Abruf und werden zum bloßen Gnadenerweis, der jederzeit widerrufen werden kann. Ebenso nimmt das Gerät alle politischen Freiheiten zurück und läßt Demokratie nur noch unter einem Vorbehalt zu, der sie auszehrt. Wie die cubanische Krise dem Blindesten gezeigt hat, entzieht es den Parlamenten ein für allemal die wahren Entscheidungen und legt sie in die Hände von wenigen Individuen, deren jedes mächtiger ist, einsamer und unwiderruflicher entscheiden kann und muß als jeder Despot der bisherigen Geschichte.
Ohnmächtig ist jede Berufung auf den Systemzwang der Abschreckungsstrategie. Auch die Nazis hatten ihren Systemzwang. (Hannah Arendt, unter anderen, hat ihn mit aller denkbaren Präzision beschrieben.) Nicht weniger paranoid als die Wahnidee von der »jüdischen Weltverschwörung« ist das Prinzip eines Rüstungswettlaufs, dessen Ziel zu bekannt ist, als daß noch jemand nach ihm früge. Das Gerät ist keine Waffe im Klassenkampf, es ist weder eine kapitalistische noch eine kommunistische, sondern überhaupt keine Waffe, sowenig wie eine Gaskammer.
Unter solchen, das ist: unter Bedingungen, wie sie seit zwanzig Jahren in unserer Welt herrschen, gerät in eine eigentümliche Lage, wer Gesetze zu verkünden oder Recht zu sprechen hat. Diese Lage ist leicht zu verdeutlichen. An Beispielen fehlt es nicht.
7. Erstes Beispiel: Tierschutz. Verordnung über das Schlachten und Aufbewahren von lebenden Fischen und anderen kaltblütigen Tieren vom 14. Januar 1936.
»§ 2 (1) Krebse, Hummern und andere Krustentiere, deren Fleisch zum Genuß für Menschen bestimmt ist, sind in der Weise zu töten, daß sie möglichst einzeln in stark kochendes Wasser geworfen werden. Es ist verboten, die Tiere in kaltes oder nur angewärmtes Wasser zu legen und alsdann zum Kochen zu bringen.«
Fernschreiben Berlin Nr. 234 404 vom 9. November 1938 an alle Stapo-Stellen und Stapo-Leitstellen.
»1. Es werden in kürzester Frist in ganz Deutschland Aktionen gegen die Juden, insbesondere gegen deren Synagogen, stattfinden. Sie sind nicht zu stören . . .
3. Es ist vorzubereiten die Festnahme von etwa 20000 bis 30000 Juden im Reiche. Es sind auszuwählen vor allem vermögende Juden. Nähere Anordnungen ergehen noch im Laufe dieser Nacht...
Gestapo II. Gezeichnet: Müller.« [11]
Verordnung zum Schutze der wildwachsenden Pflanzen und der nichtjagdbaren Tiere vom 18. März 1936.
»§ 16 (1) Den Grundstückseigentümern, den Nutzungsberechtigten oder deren Beauftragten ist gestattet, fremde, unbeaufsichtigte Katzen, die während der Zeit vom 15. März bis 15. August, und solange der Schnee den Boden bedeckt, in Gärten, Obstgärten, Friedhöfen, Parken und ähnlichen Anlagen betroffen werden, unversehrt zu fangen und in Verwahr zu nehmen. In Verwahr genommene Katzen sind pfleglich zu behandeln ...«
Fernschreiben Warschau Nr. 663/43 vom 24. Mai 1943 an den Höheren SS- und Polizeiführer Ost.
»Zu Ziffer 1. Von den 56065 insgesamt erfaßten Juden sind ca. 7 000 im Zuge der Großaktion im ehem. jüdischen Wohnbezirk selbst vernichtet. Durch Transport nach T.II wurden 6929 Juden vernichtet, so daß insges. 13929 Juden vernichtet wurden. Über die Zahl 56065 hinaus sind schätzungsweise 5-6 000 Juden bei Sprengungen und durch Feuer vernichtet worden... Der SS- und Polizeiführer im Distrikt Warschau. Gezeichnet: Stroop.« [12]
Aus Heinrich Himmlers Gesprächen mit seinem Masseur. »Wie können Sie nur ein Vergnügen daran haben, auf die armen Tiere, die so unschuldig, wehrlos und ahnungslos am Waldrand äsen, aus dem Hinterhalt zu schießen, Herr Kersten. Denn es ist, richtig gesehen, reiner Mord ... Die Natur ist so wunderschön, und jedes Tier hat schließlich auch ein Recht zu leben. Gerade dieser Standpunkt ist es, den ich so sehr bei unseren Vorfahren bewundere... Diese Achtung vor dem Tier finden Sie bei allen indogermanischen Völkern. Es hat mich außerordentlich interessiert, neulich zu hören, daß noch heute die buddhistischen Mönche, wenn sie abends durch den Wald gehen, ein Glöckchen bei sich tragen, um die Tiere des Waldes, die sie zertreten könnten, zum Ausweichen zu veranlassen, damit ihnen kein Schaden zugefügt wird. Bei uns aber wird auf jeder Schnecke herumgetrampelt, jeder Wurm wird zertreten.« [13]
Rede Heinrich Himmlers vor den SS-Gruppenführern in Posen am 4. Oktober 1943.
»... Von Euch werden die meisten wissen, was es heißt, wenn 100 Leichen beisammen liegen, wenn 300 daliegen oder wenn 1000 daliegen. Dies durchgehalten zu haben und dabei – abgesehen von Ausnahmen menschlicher Schwäche – anständig geblieben zu sein, das hat uns hart gemacht. Dies ist ein niemals geschriebenes und niemals zu schreibendes Ruhmesblatt unserer Geschichte.« [14]
Verordnung zum Schutze der wildwachsenden Pflanzen und der nichtjagdbaren Tiere.
»§ 23 (1) Zum Schutze der übrigen nichtjagdbaren wildlebenden Tiere ist verboten
1. sie ohne vernünftigen, berechtigten Zweck in Massen zu fangen oder in Massen zu töten.«
8. Zweites Beispiel. Planspiel. Im April 1961 wurde vor dem Landgericht in Jerusalem der Prozeß gegen den ehemaligen Obersturmbannführer A. Eichmann eröffnet. Die Anklage ging nicht dahin, daß der Beschuldigte die Gasöfen mit eigener Hand bedient hätte. Eichmann hat den Mord an sechs Millionen Menschen gewissenhaft und minutiös geplant.
Ebenfalls im Jahre 1961 ist in Princeton, New Jersey, ein Werk aus der Feder des Mathematikers, Physikers und Militärtheoretikers Herman Kahn Über den thermonuklearen Krieg erschienen. In diesem Werk findet sich die folgende Tabelle:
»Tragische, aber überschaubare Nachkriegs-Bilanzen.
Tote:
Zeitraum für den Wiederaufbau der Wirtschaft:
2 000000
1 Jahr
5 000 000
2 Jahre
10 000 000
5 Jahre
20 000 000
10 Jahre
40000000
20 Jahre
80000 000
50 Jahre
160 000 000
100 Jahre.« [
15
]
»Objektive Untersuchungen zeigen, daß die Summe menschlicher Tragödie (sic) zwar in der Nachkriegswelt erheblich ansteigen würde, daß dieses Ansteigen jedoch ein normales und glückliches Dasein für die Mehrzahl der Überlebenden und ihrer Nachkommen nicht ausschließen würde.« [16]
»Werden die Überlebenden aber in der Lage sein, ein Leben zu führen, wie sie es als Amerikaner gewöhnt sind, also mit Autos, Landhäusern, Kühlschränken, usw. usw.?
Niemand kann das mit Sicherheit sagen, aber ich glaube, selbst wenn wir fast keine Vorbereitungen für unsere Wiederherstellung treffen – abgesehen vom Kauf von Strahlungsmeßgeräten, von der Verteilung von Handbüchern und von der Einübung gewisser Gegenmaßnahmen -, so wird das Land ziemlich rasch wieder auf die Beine kommen.«
Embryonale Todesopfer sind »von begrenzter Bedeutung... Voraussichtlich wird es in der ersten Generation zu fünf Millionen derartiger Fälle kommen, und zu hundert Millionen im Laufe weiterer Generationen. Ich halte die letztgenannte Zahl nicht für allzu schwerwiegend, abgesehen von jener Minderheit der Fälle, in denen es zu deutlichen Aborten oder Totgeburten kommen wird. Wie dem auch sei, die Menschheit ist so fruchtbar, daß eine kleine Verminderung ihrer Fertilität nicht sonderlich ernst genommen zu werden braucht, nicht einmal von dem Einzelnen, der davon betroffen wird.«
Welcher Preis soll »für die Abstrafung der Russen für ihre Aggression« entrichtet werden? »Ich habe diese Frage mit vielen Amerikanern erörtert, und nach einer etwa viertelstündigen Diskussion fällt ihre Einschätzung eines annehmbaren Preises gewöhnlich zwischen zehn und sechzig Millionen. Man einigt sich meist auf eine Zahl, die der größeren der beiden genannten nahekommt ... Die Art und
Weise, wie diese oberste Grenze erreicht zu werden scheint, ist recht interessant. Man nennt nämlich ein Drittel der Gesamtbevölkerung eines Landes, mit anderen Worten, etwas weniger als die Hälfte.«
A. Eichmann ist im Dezember 1961 zum Tode verurteilt und durch den Strang hingerichtet worden.
H. Kahn ist beratendes Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der amerikanischen Luftwaffe, des technischen Ausschusses der Atomenergie-Kommission, Gutachter für das Amt für Zivile Verteidigung und Inhaber des Hudson Institute in White Plains, New York, das Expertisen für die amerikanische Militärplanung liefert. Kahn ist verheiratet, hat zwei Kinder und ist als Feinschmecker bekannt.
Zwischenfragen: Kann man K. und E. vergleichen? Gibt es »objektive Untersuchungen« über »die Summe menschlicher Tragödie«? Welche moralische Beweiskraft kommt einer Sprache zu, die sechzig Millionen Getötete einen »annehmbaren Preis« nennt? Kann der Genozid Gegenstand »voraussetzungsloser«, neutraler Betrachtung und Kalkulation sein? Wo liegen die Unterschiede zwischen Betrachtung und Planung, zwischen Kalkulation und Vorbereitung? Gibt es solche Unterschiede? Kann man den Völkermord verhindern, indem man ihn plant? Lassen sich Verhinderung und Planung an »Fachleute« abtreten? Wem bieten diese Experten ihre Dienste an? Kommt es auf ihre Absichten an? Spielen ihre Vorsätze eine Rolle? Wer hat sie beauftragt, wer spricht ihnen ihr Urteil?
9. Drittes Beispiel. Begreifliche Erregung. Wie viele Menschen sind bereit, bedingungslos und aus freien Stücken zu gehorchen, auch wenn sie wissen, daß die Ausführung eines Befehls einem anderen erhebliche körperliche Schmerzen zufügt?
Versuchsanordnung: Zwei Räume, in denen sich ein Schaltpult und ein elektrischer Stuhl befinden. Der Versuchsperson A wird erklärt, es handle sich um ein Experiment zur Klärung der Frage, inwieweit sich die Gedächtnisleistung eines Erwachsenen durch körperliche Züchtigung verbessern lasse. A wird gebeten, die Rolle des Prüfers oder Lehrers zu übernehmen. Die Rolle des Prüflings oder Schülers übernimmt die Versuchsperson B. Der Versuchsleiter legt B einen Gedächtnistest vor und schnallt ihn vor den Augen A’s auf den elektrischen Stuhl. A nimmt im Nebenraum am Schaltpult Platz. Bei jedem Fehler, den B begeht, legt er einen Schalthebel um. Die Schocks werden nach einer Skala dosiert, die auf dem Strafgerät angebracht ist. Die Züchtigung beginnt mit einem Stromstoß von 15 Volt und steigert sich mit jedem Gedächtnisfehler B’s. Beim zwanzigsten Stromstoß, der 300 Volt beträgt, trommelt B gegen die Trennwand. Bei 375 Volt erscheint ein Warnsignal auf dem Schaltpult: »Gefahr: Schwerste Schocks«. Die letzten Hebel, für 435 und 450 Volt, sind nur noch mit der Chiffre XXX gekennzeichnet.
Die Versuchsanordnung beruht auf einer Fiktion. Zwischen dem Schaltpult und dem elektrischen Stuhl besteht keine Verbindung, die Elektroden bleiben stromlos, der Prüfling B täuscht seine Reaktionen nur vor. Der Prüfer A kann davon nichts wissen. Er befindet sich in der realen Situation eines Folterknechts.
Eine Versuchsreihe nach diesem Muster wurde im Jahre 1963 unter der Leitung des Psychologen Dr. Stanley Milgram von der Yale University durchgeführt. Als Versuchspersonen dienten Freiwillige, sämtlich unbescholtene Bürger. Die Versuchsserie erbrachte folgendes Resultat: 65 % aller Versuchspersonen führten die Befehle des Versuchsleiters aus und bedienten, ihrer Instruktion gemäß, alle vorhandenen Schalthebel. [17]
Anfang 1964 stand in Kempten im Allgäu der ehemalige Oberfeldwebel L. Scherer vor Gericht. Es war angeklagt, während des Zweiten Weltkrieges im Gebiet von Brjansk fünfzehn Männer, Frauen und Kinder, die er bei der Durchkämmung eines Waldstückes angetroffen hatte, in einen Holzschuppen gesperrt, den Schuppen angezündet und mit Handgranaten beworfen zu haben. Professor Maurach von der Universität München legte dem Gericht ein Gutachten vor. Er vertrat darin die Ansicht, es müsse bei der Urteilsfindung die »kochende Erregung der Soldaten« berücksichtigt werden. Die Tötung der fünfzehn Männer, Frauen und Kinder hielt er für »nicht rechtswidrig«. Das Gericht erkannte auf Freispruch. Der Angeklagte, hieß es in der Urteilsbegründung, habe sich in einem Befehlsnotstand befunden.
Nach wie vor wird, den Vorschriften des deutschen Strafgesetzbuches entsprechend, bestraft,
wer in Städten mit Schlitten ohne feste Deichsel oder ohne Geläute oder Schelle fährt (§ 366, Abs. 4);
wer öffentlich angeschlagene Bekanntmachungen, Verordnungen, Befehle oder Anzeigen von Behörden oder Beamten böswillig abreißt (§ 134);
wer vorsätzlich und rechtswidrig Gegenstände, welche zur Verschönerung öffentlicher Wege dienen, beschädigt (§ 304, Abs. 1);
wer in einer Sitte oder Anstand verletzenden Weise Mittel, die zur Verhütung von Geschlechtskrankheiten dienen, öffentlich ankündigt (§ 184, Abs. 3a);
wer ein von einer Behörde öffentlich angebrachtes Zeichen der Hoheit der Bundesrepublik Deutschland unkenntlich macht (§ 96, Abs. 2) und
wer das durch gesetzliche oder polizeiliche Anordnungen gebotene Raupen unterläßt (§ 368, Abs. 2).
10. Kunstfigur. Der Verbrecher im herkömmlichen Verstand des Wortes, wie er in der Praxis der Gerichte immer noch vorkommt, gehört zum mythologischen Grundbestand der Gegenwart. Längst hat er die Züge einer Kunstfigur angenommen. In unserer Phantasie behauptet er einen Platz, der mit seiner realen Bedeutung und mit der seiner Taten nicht mehr vereinbar und durchs Tatsächliche seines Daseins nicht mehr zu erklären ist. Wunderbar und rätselhaft bleibt, mit welcher Leidenschaft wir uns um ihn kümmern und welchen enormen Apparat zu seiner Bekämpfung wir aufbieten. Er genießt eine irrationale Publizität. An den Schlagzeilen unserer Zeitungen ist abzulesen, daß ein simpler Mordfall unsere Gemüter mehr beschäftigt und erregt als ein Krieg, der in genügender Entfernung sich abspielt – und wieviel mehr erst als ein Krieg, der noch nicht ausgebrochen ist, sondern nur vorbereitet wird. Es liegt nahe, den Grund für diesen Eifer zunächst im Beharrungsvermögen unseres Rechtswesens zu suchen. Zweifellos hält die Justiz zäher als irgendeine andere gesellschaftliche Institution – die Kirchen nicht ausgenommen – an alten Gedanken und Formen fest, selbst dann noch, wenn ihnen in der Wirklichkeit nichts mehr entspricht (um so schlimmer für die Wirklichkeit). Auch die neuesten Begründungen zu sogenannten Reformen des Strafrechts spiegeln die kulturelle Verzögerung wider, welche die ganze Sphäre beherrscht; und die Sprache unserer Gesetzbücher ist reich an Wendungen, die so altertümlich sind, daß ihr Leser sich auf die Philologie verwiesen sieht. Landzwang und Unzucht, Rädelsführer und bewaffnete Haufen, Arbeitshaus und Obrigkeit sind sprachliche Fossilien, in denen längstvergangene historische Zustände konserviert werden. In gewisser Weise ist es bewundernswert, mit welcher Kraft sich das Strafrecht in einer fremden Welt unversehrt behauptet hat.
Die Rolle des Verbrechers in unserer Welt ist jedoch institutionell nicht zu erklären. Sieht man genauer zu, so ist es ein ganzes System von Rollen, das ihm anvertraut ist, das ihn unentbehrlich macht und ihn in den Rang einer mythologischen Figur erhebt.
11. Palliativ. Zunächst dient der »gemeine Verbrecher« der Beruhigung. Zwar ruft sein Auftauchen in der Gesellschaft Angst hervor, aber diese Angst ist außerordentlich harmlos. Im Gegensatz zu den weit realeren politischen und militärischen Drohungen, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist, läßt sie sich identifizieren. Ihr Urheber erscheint im Steckbrief auf allen Wanden. Sein Verhalten ist, im Gegensatz zu dem der herrschenden Instanzen, verständlich und übersichtlich. Ohne weiteres läßt sich seine Tat moralisch einordnen. Was von ihr zu halten ist, darüber geben die Gesetzbücher Auskunft. Am Los des Mörders kann man sehen, daß es »noch Richter gibt«, und an seine Figur hält sich die erwünschte Illusion, als sei Töten verboten. Indem sie ihn bestraft, verhilft die Gesellschaft sich zu der Überzeugung, daß ihre Rechtsordnung intakt sei. Das ist beruhigend.
12. Sündenbock. Für den Einzelnen ist jede Verurteilung eines anderen, und der Verbrecher wird stets als der schlechthin Andere betrachtet, ein Freispruch. Wer schuldig ist, der wird bestraft, also ist, wer nicht bestraft werden kann, unschuldig. Die Befriedigung, mit der das Kollektiv die Verfolgung etwa eines ausgebrochenen Sträflings betrachtet, ist lehrreich. Ohne weiteres finden sich Metaphern aus der Jagdsphäre ein. Der Verbrecher ist Freiwild, zum Abschuß freigegeben: auf plebiszitärem Wege käme man jederzeit zu einer Verschärfung der ohnehin unsäglichen polizeilichen Schießpraxis. Auch das Verlangen nach der Todesstrafe ist äußerst populär; besonders nach der Entdeckung sogenannter Sittlichkeitsverbrechen, die stets eine enorme Publizität für sich haben, kommt es in hysterischen Wellen auf. Die Rolle des Verbrechers als eines Sündenbocks der Gesellschaft ist uralt; sie prägt sich aber unter den gegenwärtigen Bedingungen besonders deutlich aus. Je mehr Schuld sich im Ganzen ansammelt, je diffuser ihr Zusammenhang, je anonymer und unsichtbarer ihre Quelle, desto dringlicher wird es, sie an deutlich kenntlichen Einzelpersonen abzureagieren.
13. Stellvertreter. Als Stellvertreter aller empfängt der Verbrecher aber nicht nur seine Strafe, er handelt schon vorher in ihrem Namen, wenn auch ohne ihren Auftrag. Denn er tut nur, wonach es jedermann verlangt; und zwar tut er es auf eigene Faust, also ohne staatliche Konzession. Die Wut darüber, daß er sich herausnimmt, was jedermann sich verbietet, solange es verboten und noch nicht befohlen ist – diese Wut kühlt sich, indem sie Gleiches mit Gleichem vergilt, die Tat des Stellvertreters an ihm wiederholt. Allerdings geschieht auch diese Wiederholung nicht von eigener Hand, sondern von der des Staates, also wiederum durch Stellvertreter. Was er sich real versagt, wird jedermann in symbolischer Gestalt gleich doppelt zuteil, durch Anteilnahme an der Tat des Verbrechers und durch Anteilnahme an seiner Bestrafung. Mörder und Henker nehmen uns ab, was wir zu tun und zugleich zu unterlassen wünschen, und verschaffen uns so nicht nur ein moralisches Alibi, sondern auch das Gefühl moralischer Überlegenheit. Damit mag jene unterschwellige Dankbarkeit zusammenhängen, die sich manchen Verbrechern, besonders den Stars der Branche gegenüber, zuweilen in der Öffentlichkeit regt. Man zollt ihnen eine Hochachtung, wie sie hervorragenden Fachleuten zukommt. Das Böse gilt als ein Spezialgebiet, auf dem der Verbrecher sich kraft seines Berufes bewegt; und somit gedenkt es die arbeitsteilige Gesellschaft an ihn zu delegieren.
14. Konkurrenz. Nicht nur für den Einzelnen aber, sondern auch für die Gesellschaftsordnung im ganzen tritt der Kriminelle ein und tritt ihr gegenüber, und zwar dadurch, daß er für sich deren Vorrechte in Anspruch nimmt: er hält sich, mit den Worten des Holzfällers Paule Ackermann aus Alaska, für einen Mann, der »alles dürfen darf«. Mit diesem Anspruch stellt er sich neben, mithin gegen den Staat. Insofern ist der Verbrecher dessen Konkurrent: er stellt sein Monopol auf die Gewalt in Frage. Auch diese Rolle ist alt. Die Räuber und Briganten vergangener Zeiten haben sie am reinsten ausgespielt, und jedes Rebellentum übernimmt ihre Züge, wo nicht aus freien Stücken, so gezwungenermaßen: sie werden ihm, mit Bewunderung oder Abscheu, von der Welt verliehen. [18]
Obwohl nun die Übermacht des Staates gegen den Verbrecher von vornherein feststeht, obwohl dessen Möglichkeiten, Gewalt zu üben, zu der des staatlichen Apparats in gar keinem Verhältnis stehen, sieht dieser sich von der Tat des Einzelnen oder des »Haufens« unmittelbar bedroht. Mit Vorliebe spricht die Staatsmacht davon, daß ihre »Grundfesten« in Gefahr seien; um an ihnen »zu rütteln«, sie »zu erschüttern«, bedarf es keines Raubmordes, es genügt ein Taschendiebstahl oder die Abfassung eines Artikels. Was die moderne Gesetzgebung aber am meisten zu reizen scheint, ist der »Widerstand gegen die Staatsgewalt«. Wo von ihr die Rede ist, büßen die Texte leicht ihre antiquarische Gelassenheit ein. Schaum bildet sich vor dem Mund ihrer Hüter, der harmlose Trubel wird zur »Zusammenrottung«, der Passant zum Delinquenten. Die Wut, mit der sein Delikt geahndet wird, zeigt die Unsicherheit unserer öffentlichen Ordnungen, die Kehrseite ihrer Übermacht. So stark und so anfällig, so empfindlich und brutal gerieren sich nicht einmal Öl- oder Diamantenmonopole; kaum eines geht mit dem Brustton solcher Überzeugung gegen einen Außenseiter vor.
15. Parodie. Sobald sich das Verbrechertum organisiert, wird es, tendenziell, zum Staat im Staate. Die Struktur solcher Verbrechergesellschaften bildet treulich jene Herrschaftsformen ab, deren Rivalen und Konkurrenten sie sind. Die Räuberbanden des ausgehenden Mittelalters ahmten die feudale Verfassung nach, und eine Art von Lehensverhältnis hat sich bei den gangs bis in heutige Zeiten erhalten. Auch Formen der militärischen Organisation wurden gern und oft kopiert. Bei den Carbonari des neunzehnten Jahrhunderts gab es königstreue Banditen. Andere »geheime Gesellschaften«, wie die Camorra, waren eher republikanisch organisiert; aber noch Salvatore Giuliano hielt sich für den Befreier Siziliens »von Gottes Gnaden«. Die sizilianische Mafia hat die Struktur einer patriarchalischen Regierung bis ins Detail nachgebildet und diese über weite Strecken des Landes geradezu ersetzt: sie verfügte über eine weitverzweigte Administration, erhob Zölle und Steuern und hatte ihre eigene Gerichtsbarkeit.
Ähnliche Symmetrien sind zwischen der Geheimpolizei des zaristischen Rußland, der Ochrana, und den konspirativen Gruppen zu erkennen, die zu bekämpfen sie eingerichtet worden war. Rivalisierende Organisationen neigen stets dazu, einander ähnlich zu werden. Nach Habitus und Physiognomie sind die Leibwächter der Gangster von den Beschützern der Staatsmänner schwer zu unterscheiden.
Auch spezifisch kapitalistische Organisationsformen haben ihr kriminelles Pendant gefunden. Moderne amerikanische Gangsterbanden nennen sich »Crime Syndicate« oder »Murder, Inc.«; sie sind nach dem Muster der großen Corporations gebaut, verfügen über eigene Steuerberater, Buchungsmaschinen und Rechtsabteilungen und gewähren ihren Bediensteten dieselben Sozialleistungen wie ein Großbetrieb seinen »Arbeitnehmern«. Den Faschismus als racket, von Peachums »mittelständischer« Hehlerzentrale bis zum Karfioltrust, hat Brecht beschrieben. So erscheinen die Verbrechergesellschaften als Parodien der allgemeinen sozialen und politischen Verfassung, und umgekehrt. Indessen hinken die Kriminellen meist hinter dem Entwicklungsstand des Ganzen her, was ihnen eine romantische Aura verleiht. So hat der Faschismus sehr bald Brechts Darstellungsweise überholt. Sie trifft wohl den traditionellen Typ des Schädelspalters, etwa Röhm, allenfalls noch Göring, wirkt aber veraltet angesichts von Figuren wie Heydrich, Bormann oder Höß, die einen weit abstrakteren Aufbau der gesellschaftlichen »Ordnung« anzeigen.
Schon hinter dem Faschismus also ist das Verbrechertum weit zurückgeblieben. Heute, da selbst der Faschismus nicht mehr zeitgenössisch ist, da das nukleare Gerät selbst die Möglichkeiten eines Eichmann in den Schatten stellt, wirkt noch die avancierteste Bande von Kriminellen wie ein Andenken aus alten Zeiten, und es ist ungerecht, wenn die Scholastiker der atomaren Strategie, Autoren wie Morgenstern, Brodie, Kahn und ihre sowjetischen Partner, bei ihren Planspielen von einer »Zwei-Gangster-Situation« sprechen, da ihre Kalküle die Vorstellungskraft eines Kriminellen weit übersteigen: Schließlich beschränkt sich der Ehrgeiz der beiden Gangster darauf, einander umzubringen, während die erwähnten Gelehrten ihr Augenmerk vor allem auf die Milliarden richten, die von ihren Planspielen ausgeschlossen bleiben.
16. Phraseologie. Somit wirkt der Delinquent in unserer Welt wie eine vergleichsweise harmlose, fast sympathische, fast humane Gestalt. Seine Motive sind begreiflich. Als einem Opfer und Komplizen der illusionär gewordenen moralischen Arbeitsteilung mißt die Gesellschaft ihm ein mythologisches Kostüm an. Ihrem unaufhaltsamen Fortschritt hat der Gangster nicht folgen können; die technologische Entwicklung hat seine handwerklichen Methoden der Liquidation liquidiert und industrielle Verfahren durchgesetzt. Selbst Figuren wie Trujillo und die vielen »Wohltäter« seinesgleichen, die heute in Dutzenden von Ländern das Heft in der Hand haben, zeugen – so real ihre Herrschaft auch ist, eher von der historischen Verzögerung der Länder, die sie regieren, als von den Zukunftsaussichten ihres Metiers. Der Kriminelle alten Schlages, auch der kriminelle Landesvater, ist ein Nachzügler.
Daher die semantischen Schwierigkeiten, die sich einstellen, sobald man versucht, überkommene Rechtsbegriffe auf die Untaten des mittleren zwanzigsten Jahrhunderts anzuwenden. Anstifter, Täter, Mittäter, Beihelfer, Mitwisser, bei einem Einbruch leicht zu unterscheiden, sind als Rollen undeutlich oder sinnlos geworden. Im Urteil von Jerusalem heißt es:
»Bei einem so ungeheuren und komplizierten Verbrechen wie dem, mit dem wir es zu tun haben, einem Verbrechen, an dem viele Leute auf verschiedener Ebene und durch verschiedene Handlungsweisen teilnahmen – als Planer, als Organisatoren und als Vollzugsorgane, je nach ihrem verschiedenen Rang -, bei einem solchen Verbrechen hat es wenig Sinn, sich der gewöhnlichen Begriffe der Anstiftung und des Komplotts zu bedienen. Denn diese Verbrechen wurden massenhaft verübt, nicht nur im Hinblick auf die Opfer, sondern auch im Hinblick auf die Täter; und die Entfernung eines Täters von dem, der das Opfer faktisch getötet hat, oder seine Nähe zu ihm, hat als Maß für seine Verantwortung keine Bedeutung. Ganz im Gegenteil nimmt diese Verantwortung im allgemeinen zu, je weiter wir uns von demjenigen entfernen, der das tödliche Werkzeug mit seinen eigenen Händen benutzt hat.«
Aber nicht nur die Hilfsbegriffe des Strafrechts und seine Klassifikationen, sondern der Begriff des Verbrechens selber zerschellt an Figuren wie denen, die heute vor unseren Gerichten stehen oder in den Planungsstäben für künftige Untaten sitzen. Wer Hitler einen gemeinen Verbrecher nennt, verharmlost seine Erscheinung und verzaubert sie ins Begreifliche. (Brechts Arturo Ui ist ein einziges under-statement: vergeblich versucht der Stückeschreiber, seine Figur dem Gangster kommensurabel zu machen.) Ebenso läuft die Rede von den »Kriegsverbrechern« auf eine Beschönigung hinaus, sowenig sie es darauf abgesehen haben mag – als ließe sich ein moderner Krieg mit Hehlerei oder Urkundenfälschung über einen Leisten, den des Vorstellbaren, schlagen. Das Verbrechen, total geworden, sprengt seinen Begriff.
Auch das ist nur ein Beispiel, nämlich für die Ohnmacht unseres Sprach- und Denkgebrauchs angesichts der atomaren Situation. Gutgemeint, aber absurd ist die Klage, die ein amerikanischer Bürger vor dem Obersten Gerichtshof in Washington vor einigen Jahren gegen die Fortsetzung der Atomversuche erhoben hat. Das Gericht hat sich für unzuständig erklärt. Unzuständig sind unsere Begriffe geworden. Daß unser militärisches Gerät als Waffe nicht mehr verstanden werden kann, hat am deutlichsten Günter Anders gezeigt. Ebenso verdient eine politische Entscheidung, die alle weiteren politischen Entscheidungen abschaffen würde, diesen Namen nicht mehr. Für einen Akt, der keine Frager mehr übrig ließe, kann es Verantwortung in irgend einem herkömmlichen Sinn nicht mehr geben.
17. Endlösung. »I can build a device – I think I know how to do it today, I doubt that it would take me ten years to do and I doubt that it would cost me 10 billion dollars – and this device which I could bury, say, 2 000 feet Underground and, if detonated, it would destroy everybody in the world – at least all unprotected life. It can be done, I believe. In fact, I know it can be done.«
Herman Kahn, Rede zur Hundertjahrfeier des Massachusetts Institute of Technology 1961. [19]
Die Mathematik hat in der Mengenlehre eine Disziplin hervorgebracht, welche den Wissenschaftler in die Lage setzt, mit den Modifikationen des unendlich Kleinen und des unendlich Großen zu rechnen. Eine moralische Mengenlehre gibt es nicht. Wer versucht, innerhalb des unvorstellbar Bösen Unterscheidungen zu treffen, hat es nicht allein mit semantischen Schwierigkeiten zu tun. Das Versagen der Sprache zeigt nur das Versagen unserer moralischen Fähigkeiten vor unseren eigenen Möglichkeiten an.
Sowenig wie die bisherige politische Praxis ist die juristische Kasuistik dieser Lage gewachsen. Die Nachwelt, mit der Vorbereitung ihrer eigenen beschäftigt, sucht heute die Verantwortlichen für Hitlers »Endlösung« und ihre Handlanger zu richten. Darin liegt eine Inkonsequenz. Diese Inkonsequenz ist unsere einzige Hoffnung, eine winzige. Keine künftige Untat kann die geschehenen aufwiegen: Untaten lassen keine Subtraktion, nur Summierung zu. (Zweifellos gibt es eine moralische Impotenz, die glaubt, Auschwitz lasse sich verringern. Sie ist besonders in Deutschland verbreitet. Es gibt dort Personen, die im Ernst und sogar in amtlichen Schriftstücken das Wort Wiedergutmachung verwenden.) »Endlösungen« können nicht wieder gutgemacht und nicht gewogen werden, auch nicht vor einem Gericht. Das ist ein Grund mehr, weshalb die Welt Gericht über sie halten muß; und ein Grund mehr, weshalb dieses Gericht nicht genügt.
Zwischen der »Endlösung« von gestern und der Endlösung von morgen, also zwischen zwei unvorstellbaren Handlungen, gibt es Unterschiede:
1. Die »Endlösung« von gestern ist vollbracht worden. Die Endlösung von morgen wird erst vorbereitet. Es gehört aber zum Unbegriff dieser Tat, daß über sie nur geurteilt werden kann, solange sie nicht verwirklicht ist, da sie keine Richter, Angeklagten und Zeugen hinterlassen wird.
2. Die »Endlösung« von gestern ist nicht verhindert worden. Die Endlösung von morgen kann verhindert werden. Ihre Vorbereitung und ihre Verhinderung sucht die Gesellschaft zu delegieren, und zwar am ehesten an ein und dieselben Spezialisten. Sowenig wie die Endlösungen selbst läßt sich aber deren Verhinderung delegieren. Eines wie das andere wird nicht ein Werk von Einzelnen sein, sondern das Werk aller; oder es wird nicht sein. Ohne die Ohnmächtigen sind die Mächtigen ohnmächtig.
3. Die »Endlösung« von gestern war das Werk einer einzigen Nation, der deutschen. Das Gerät für die Endlösung von morgen ist im Besitz von vier Nationen. Die Regierungen vieler andrer sind bemüht, sich das Gerät zu verschaffen. Es gibt Gegenbeispiele.
4. Die Planung und Verwirklichung der »Endlösung« von gestern geschah insgeheim. Die Planung der Endlösung von morgen geschieht öffentlich. 1943 gab es Personen, die keine Mitwisser waren. 1964 gibt es nur noch Mitwisser.
5. Die Täter der »Endlösung« von gestern waren kenntlich. Sie trugen eine Uniform, ihre Opfer trugen einen Stern. Die Täter der Endlösung von morgen sind von ihren Opfern nicht mehr zu unterscheiden.
Der israelische Psychiater, der Eichmann untersucht hat, nannte ihn »einen ganz normalen Menschen: er scheint mir normaler als ich selbst mir vorkomme, nachdem ich ihn untersucht habe.« Ein anderer Sachverständiger hielt ihn für einen vorbildlichen Familienvater. Eichmann hat sich hauptsächlich mit Akten, Fahrplänen und Statistik befaßt; dennoch hat er seine Opfer noch mit eigenen Augen gesehen. Den Planern des Letzten Weltkrieges wird dieser Anblick erspart bleiben.
Ist Edward Teller schuldig? Ist der Journalist schuldig, der einen Artikel schreibt, um die Ansprüche deutscher Politiker auf das Gerät zu unterstützen? Ist der unbekannte Mechaniker aus Oklahoma oder Magnitogorsk schuldig? Ist Mao-tse-tung schuldig? Ist schuldig, wer an die Chimäre der »Entspannung« glaubt, solange Kandidaten wie Strauß oder Goldwater sich um die Macht zum Tode bewerben können? Ist der Bauunternehmer schuldig, der einen Befehlsbunker baut? Gibt es in Zukunft noch Schuldige? Gibt es Unschuldige? Oder gibt es nur noch Familienväter, Naturfreunde, normale Menschen?
Der Glaskasten von Jerusalem steht leer.
Rafael Trujillo Bildnis eines Landesvaters
Hintritt
Die erste Meldung, unter dem 1. Juni 1961, kam nicht aus Santo Domingo. Sie kam aus Washington, einer Stadt, die zweieinhalbtausend Kilometer vom Tatort entfernt liegt.
In der Nacht zum 1. Juni war unter den Kokospalmen der George-Washington-Autostrada am Strand des Karibischen Meeres, zehn Kilometer westlich der dominikanischen Hauptstadt in Richtung San Cristobal, eine Ära zu Ende gegangen. So jedenfalls drückten sich die Nachrichtenagenturen aus. Die Industrien, denen wir die Geschichtsschreibung des Tages anvertrauen, geben sich gern römisch, und im Gewimmel der ›historischen Augenblicke‹ sitzt ein Tacitus an jedem Fernschreiber. Wem solcher Ehrgeiz fremd ist, der wird bescheidener sagen, es sei damals ein Kriminalfilm abgelaufen, der einunddreißig Jahre lang gedauert hatte. Am Straßenrand blieben die öden Requisiten zurück, auf welche die Politik des Jahrhunderts offenbar nicht verzichten kann: Requisiten eines Drehbuchs, ›wie es das Leben schriebe‹: das leere Magazin einer Maschinenpistole, eine Blutpfütze, ein Haufen Glasscherben, und eine Uniformmütze mit den Insignien eines Generals. Die Leiche, verstümmelt und kaum mehr kenntlich, wurde erst am andern Morgen gefunden: im Kofferraum eines Wagens, der in der Garage eines leerstehenden Hauses im Villenviertel von Santo Domingo abgestellt worden war.
Der Wohltäter des Vaterlandes, der Ehrenwerte Präsident, der Paladin der Demokratie, der Erste Arzt der Republik, der Träger des Großkreuzes vom Päpstlichen Orden des Heiligen Gregorius, der Tapferste, der Genius des Friedens, der Retter des Vaterlandes, der Beschützer aller Arbeiter, der Ehrenritter des Souveränen Malteserordens, der Erste Lehrer der Republik, der Vater des neuen Vaterlandes, der Erste und Größte aller dominikanischen Staatschefs, der Held der Arbeit, der Wiederhersteller der wirtschaftlichen Unabhängigkeit, der Erste Journalist der Republik, der Oberbefehlshaber der bewaffneten Streitkräfte, der Träger des Halsbandes zum Orden Isabella der Katholischen und siebenundachtzig anderer allerhöchster Auszeichnungen, Seine Exzellenz der Generalissimus Professor Dr. h.c. (Pittsburgh) Dr. h.c. Dr. h. c. Dr. h.c. Dr. h.c. Dr. h.c. Rafael Leónidas Trujillo Molina, war endlich im Straßengraben verreckt.
Die Umstände ließen ein Staatsbegräbnis nicht ratsam scheinen. Erst sieben Monate nach dem Hintritt des Wohltäters ging auf dem Flugplatz Orly, angeflogen von einem Sonderflugzeug der Pan American World Airways, eine große Kiste aus Mahagoni-Holz ein, die seine einbalsamierten Überreste enthielt. Die Beisetzung fand in aller Stille auf dem Pariser Friedhof Père Lachaise statt, wo ein Mausoleum im Werte von 185 000 Mark heute noch das Andenken an den Verblichenen bewahrt.
Nachlaß
Der Wohltäter hinterließ seinem Lande ein sehr komplexes und nicht leicht zu überschauendes Erbe. Weitaus am meisten Interesse hat sein persönliches Vermögen gefunden. Auch die ernsthaftesten Schätzungen dieser Hinterlassenschaft gehen weit auseinander. Die Angaben, die in der Literatur zu finden sind, weichen bis zu einer Zehnerpotenz voneinander ab: sie reichen von 750 Millionen bis zu neun Milliarden Dollar. Diese Meinungsverschiedenheiten sind zunächst in der Sache begründet; die Chronisten unterscheiden kaum zwischen liquiden Mitteln, Forderungen und Sachvermögen; auch ist die Vorstellungskraft eines Publizisten den Größenordnungen, um die es sich handelt, kaum gewachsen. Im übrigen wird man sich fragen dürfen, ob sich ein Vermögen solchen Umfangs überhaupt zahlenmäßig darstellen läßt; schon ein mittlerer Konzern verfügt heute bekanntlich über Möglichkeiten der Bilanztechnik, an denen jede Kontrolle scheitern muß, und das Kapital organisiert sich in internationalen Labyrinthen, die nicht weniger komplex gebaut sind als ein elektronisches Rechenzentrum. [1]
Zu diesen objektiven und gewissermaßen unvermeidlichen Sorgen, die Trujillos Nachlaß mit sich bringt, gesellen sich allerlei subjektive Meinungsverschiedenheiten. Von einem Testament ist nichts bekannt. Die Dominikanische Republik erhebt energische Ansprüche auf die Erbschaft, doch spricht wenig dafür, daß eine solche Erbfolge im Sinne des Wohltäters wäre.
Denn der Wiederhersteller der wirtschaftlichen Unabhängigkeit hat der Nachwelt nicht nur sein Vermögen, sondern auch eine Familie hinterlassen, die so weitverzweigt ist wie ein Konzern. Die Zahl seiner Kinder ist nicht mehr festzustellen; Klarheit besteht darüber, daß sie die Vierzig überschreiten muß. Entsprechend zahlreich sind die Witwen und Bräute des Wohltäters, ganz zu schweigen von seinen Brüdern, Halbbrüdern, Schwestern, Onkeln, Tanten, Schwähern, Neffen, Nichten, Vettern und Basen. Ihren Bemühungen ist es zuzuschreiben, daß wenigstens 250 Millionen Dollar aus dem Portefeuille des Wohltäters den Weg nach Europa gefunden haben; ein Erfolg, der ohne die tatkräftige Hilfe angesehener europäischer Banken nicht möglich gewesen wäre. Besonders die Hausbank des französischen Waffenkonzerns Schneider-Creuzot hat sich um das Wohlergehen der Familie verdient gemacht. Wenigstens einunddreißig Mitglieder des Clans haben in der Alten Welt eine zweite Heimat gefunden: sie leben als Staatsgäste eines anderen Wohltäters in der spanischen Hauptstadt.
In der Dominikanischen Republik hinterließ Rafael Leónidas Trujillo, außer eintausendachthundertsiebenundachtzig Trujillo-Denkmälern, folgende Erbschaft:
40 % Arbeitslose;
55 bis 70 % Analphabeten;
65 % aller Bauern ohne eigenen Grund und Boden; sowie ein durchschnittliches Einkommen pro Kopf und Jahr von rund 200 Dollar.
Laufbahn
Der Wohltäter kam unweit der Stelle, an der er sie siebzig Jahre später verließ, nämlich in San Cristóbal, und im Jahre 1891, als Sohn eines kleinen Postbeamten namens Pepito zur Welt.
1955, im Jahre XXV der ›Ära Trujillo‹, verabschiedete der dominikanische Kongreß ein Gesetz, das alle öffentlichen Äußerungen, die mit der historischen Wahrheit nicht übereinstimmten, als Geschichtsfälschung unter Strafe stellte. Was als historische Wahrheit zu gelten hatte, darüber befand die Historische Akademie in Ciudad Trujillo. Infolgedessen ist über die Jugendjahre des Wohltäters etwas Sicheres nicht auszumachen; es ist anzunehmen, daß sie einer strengen Quellenkritik nicht standhielten.
1901 bezog T. die Volksschule in San Cristóbal.
1905 verließ er dieses Bildungsinstitut, das einzige, das er besucht hat.
Um 1910 fand er eine Anstellung als Telegraphist.
Zwischen 1912 und 1915 erwarb er seine ersten Erfahrungen als Pferdedieb und Zuhälter.
1916 trat er in die Dienste einer großen amerikanischen Zuckerfirma, auf deren Plantagen er als Spitzel und agent provocateur für Arbeitsfrieden sorgte.
1918 wurde T., zusammen mit seinem Bruder Petan, wegen Urkundenfälschung und Betrugs zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt.
Nach seiner Entlassung engagierte ihn Major James McLean, der als sein Entdecker gelten darf, als Spitzel für die amerikanische Besatzungsmacht.
1919 wurde er, nach Bewährung, als Leutnant in die Guardia Civil, eine von den Amerikanern aufgestellte Polizeitruppe von ›Hilfswilligen‹ aufgenommen, wo er ›ausgezeichnete Arbeit‹ leistete und sich im Guerillakrieg gegen seine Landsleute hervortat.
1921 bestand er einen Kurs auf der Kriegsschule von Haina, einer Einrichtung der amerikanischen Militärregierung, mit Auszeichnung.
1922 wurde er zum Polizeihauptmann befördert und mit dem übrigen Personal der Kollaborateurstruppe in dominikanische Dienste übernommen.
Im März 1924 avancierte er, nach einer blutigen Kabale, zum Major, im Dezember desselben Jahres zum Oberstleutnant beim Generalstab.
1925 ernannte ihn der Präsident der Republik zum Chef der Staatspolizei im Rang eines Obersten.
1927, nach der Umwandlung der Polizeitruppe in die Nationale Armee, wurde T. zum Befehlshaber der Streitkräfte und zum Brigadegeneral ernannt.
Im März 1930 kandidierte er bei den Präsidentschaftswahlen, die er im Mai gewann.
Die restlichen einunddreißig Jahre seines Lebens brachte T. als unumschränkter Herrscher und Eigentümer des Landes zu.
Prinzipielles
Rede, gehalten vor dem Altar des Vaterlandes am 16. August 1955, bei der Entgegennahme der Großen Ordenskette des Vaterlandes, die ihm der Kongreß zum 25. Jahrestag des Beginns der Ära Trujillo verlieh:
»Hohes Haus:
In meiner Person ehren Sie heute die ersten 25 Jahre eines vaterländischen Werkes, das dem dominikanischen Volk das höchste Glück, den höchsten Wohlstand und die Gewißheit gebracht hat, daß ihm ein hervorragendes Schicksal beschieden ist...
Es gehört zu meinen Pflichten, das Urteil auf mich zu nehmen, das die Mitwelt über meine Taten und über meine historische Leistung fällt. In diesem Sinn freue ich mich über Ihre Entscheidung und nehme in dieser großen Stunde den Dank der Nation mit Befriedigung entgegen. Ohne Zweifel haben Sie ein prophetisches Urteil ausgesprochen, das vorwegnimmt, was die Nachwelt über mich sagen wird. Sie haben mich am Werk gesehen, Sie kennen das Wesen meines Kampfes, Sie sind meine zuverlässigsten und legitimsten Zeugen.
...
Ich bin sehr menschlich, und es ist nur natürlich, daß mich eine Huldigung von so erhabener Bedeutung innerlich bewegt; doch als ein Staatsmann, der sich verpflichtet fühlt, seinem Lande täglich mehr Glanz und Größe zu verleihen, und der seinen Mitbürgern zutiefst verbunden ist, muß ich in diesem Augenblick von meinen persönlichen Gefühlen und Überzeugungen sprechen. Wir stehen am Altar des Vaterlandes. Immer sind die Altäre die großen Opferstätten gewesen. Für mein Vaterland und für mein Volk möchte ich in Zukunft noch mehr tun als bisher. Deshalb schwöre und gelobe ich vor diesen harten Steinen, welche die Asche der Gründer unseres Staates bergen: Solange mein Herz schlägt, wird es dem Dienst an der Republik geweiht sein... Vor fünfundzwanzig Jahren habe ich meinen Mitbürgern versichert – und dieses Versprechen habe ich gehalten -, daß die Freiheit, solange es noch Reinheit der Seele und klares Pflichtgefühl gibt, eine unbefleckte Jungfrau sein wird, die keine Brutalität vergewaltigen kann...