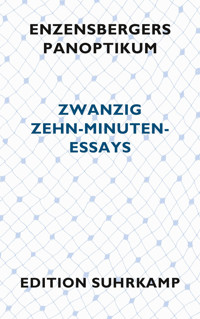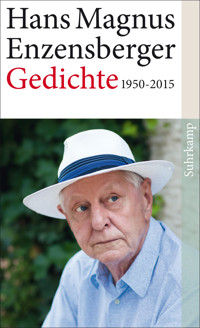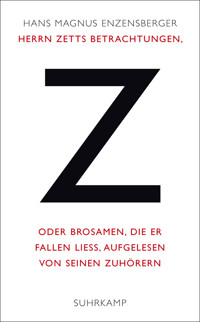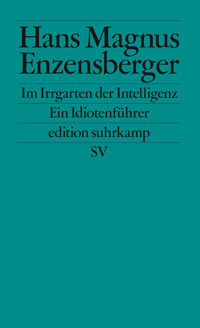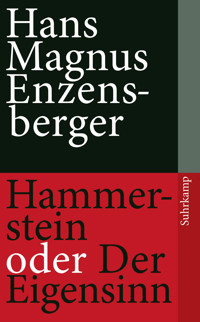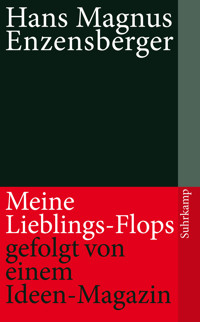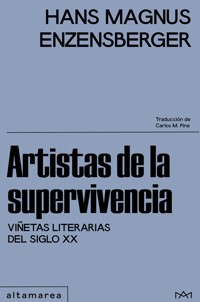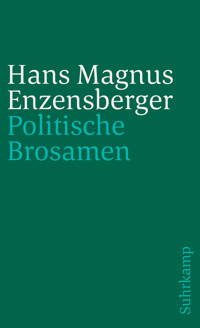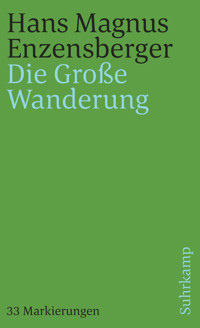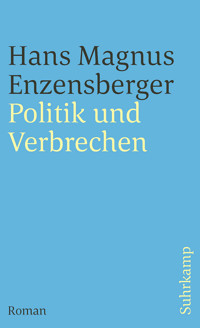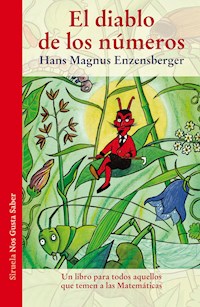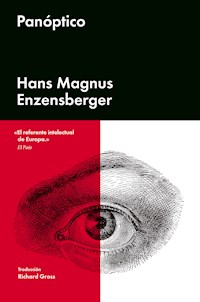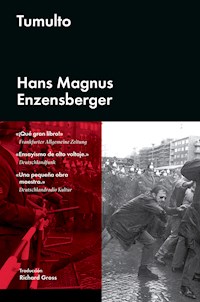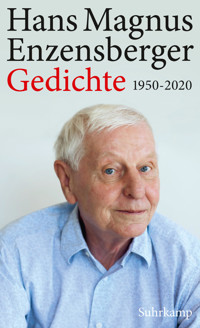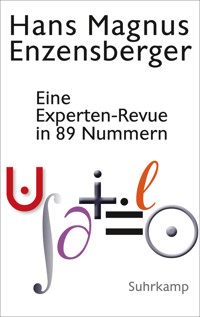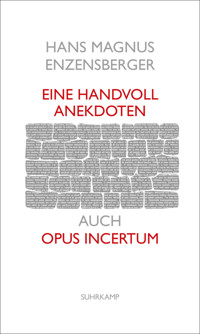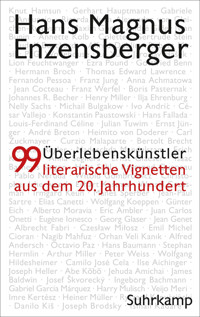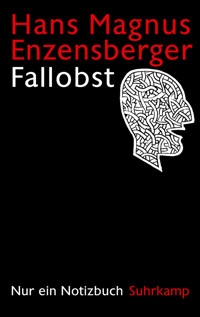
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Fallobst, das in verschiedenen großen und kleinen Körben aufgesammelt wurde«, nennt Hans Magnus Enzensberger seine Beobachtungen, Notate, Kurzessays, Erinnerungen, Dialoge, Gedichte und Glossen. Mit spitzer Zunge, unumwunden und streitbar konfrontiert er uns mit Zeitgeist und mainstream. Doch kommen auch Würdigungen nicht zu kurz: von vertrauten und geliebten Menschen, von Brüdern und Schwestern im Geiste. Die deutsche Sprache, deren Tiefsinn und Abgründen der Autor mit lexikalischen Feinbohrungen auf den Grund geht, erfährt ihr Recht. Und nicht zuletzt die Natur in ihren so wundersamen wie kapriziösen Erscheinungen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 367
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Hans Magnus Enzensberger
Fallobst
Nur ein Notizbuch
Mit Illustrationen von Bernd Bexte
Suhrkamp
Inhalt
Vorwort
Fallobst. Erster und größter Korb
Vorgesprochen
Mitten im Leben –
Fallobst. Der andere Korb
Um einander
Fallobst. Dritter und letzter Korb
Ja aber – Aber ja
Abschließendes Durcheinander
Über Bernd Bexte
Vorwort
Fallobst kann man nicht ernten.
Oft wird es liegengelassen.
Vielleicht taugt es als Dünger.
Mäuse, Würmer, Mikroben
essen es gern.
Keimfrei ist es nicht,
schwer zu verpacken
und kaum zu verkaufen.
Es braucht keine Reklame,
kein Etikett,
keinen Ladenpreis.
Manche sammeln es auf,
wenn sie sonst nichts
zu tun haben, solange
es nicht verfault ist.
Fallobst
Erster und größter Korb
Mitten im Leben –
»Das Leben steckt in den Begriffen wie ein ausgewachsenes Kind in zu kurzen Kleidern. Eine einzige Stunde Leben besteht aus tausend unerklärlichen Regungen der Nerven, der Muskeln, des Gehirns, und ein einziges großes, leeres Wort will sie alle ausdrücken.«
Joseph Roth, Der stumme Prophet II 6, Köln und Amsterdam 1965, geschrieben 1927-1929
Für Alfonso Berardinelli
Es gibt in Italien das, was die Bewohner des Landes il palazzo nennen. Es gibt aber auch die Nachbarin, die uns bei offenen Fenstern an ihrer Musik, an ihrem Krach und ihrem Kummer teilnehmen läßt. Ferner gibt es dort viel Fernsehen, viele Streiks, viele Cafés und viele Demonstrationen. Auch das Kasperltheater ist, ebenso wie die Oper, zweifellos in Italien erfunden worden.
Das alles ist allgemein bekannt, und doch irrt, wer sich mit einer solchen Beschreibung zufriedengibt. Wer genauer hinsieht, dem wird ein interessantes Lebewesen auffallen, das in diesem Teil Europas heimisch ist. Das ist der unsichtbare Italiener. Wie schon sein Name sagt, ist er schwer zu finden. Er lebt weder auf der Piazza noch in einem Büro, sondern in seinem Versteck. Von dort aus beobachtet er seine Landsleute. Er hat kein Geld. Er denkt. Er liest. Er schreibt. Er arbeitet. Hat er sich freiwillig zurückgezogen, oder wurde er vertrieben? Manchmal ist er der Verzweiflung nahe. Manchmal lacht er. Er beklagt sich nicht. Er ist hartnäckig. Ohne Leute wie ihn wäre Italien ein hoffnungsloser Fall. Zum Glück hat es im Lauf der Jahrhunderte stets ein paar Leute wie ihn gegeben.
Nicht waschecht
Was macht das Besondere an Franken aus? Und gibt es eigentlich so etwas wie fränkische Eigenart?
Ach so, Sie wollen etwas über »mein Verhältnis zu Franken« wissen? Ich bin nicht der einzige, der darüber leicht ins Grübeln kommt, denn wo liegt dieses Land überhaupt, und seit wann? Meinen Sie Ober- oder Unter-, Mittel- oder Mainfranken? Wir reden von mindestens drei Bistümern, vier Reichsstädten, zwei Fürstentümern aus Brandenburg, einer Handvoll von Grafschaften, gar nicht zu reden vom Deutschen Orden, den unzähligen Ritterschaften, Abteien und Enklaven. Im fränkischen Kollegium des Reichsfürstenrates saßen, wenn ich nicht irre, sechzehn stimmberechtigte Herrschaften, nämlich sechs Hohenloher, vier Erbacher, zwei Castells, zwei Löwensteiner, ein Schönborn und ein Nostitz.
Alles nur gut zweihundert Jahre her! Ein Patchwork, wie es auf neudeutsch heißt, ein unglaublicher Fleckerlteppich, gar nicht zu vergleichen mit dem fetten Kurbayern, diesem Kriegsgewinnler. Entschuldigung! Ich persönlich finde mich in diesem Durcheinander nur schwer zurecht. Vielleicht, weil ich kein geborener Franke bin.
Meine Voreltern stammen aus dem Allgäu, das ebenso zusammengestückelt und verschachtelt ist. Eigentlich kenne ich mich nur in Nürnberg und Umgebung wirklich aus. Weiter als bis nach Cadolzburg und Erlangen hat es bei mir nicht gereicht. Würden Sie mich nach Wöhrd und Gostenhof, nach Zabo, das auf dem Stadtplan Zerzabelshof heißt, nach Erlenstegen, Groß- oder Kleinreuth hinter der Veste fragen, da könnte ich vielleicht noch mitreden.
Außerdem kenne ich noch allerhand protestantische und katholische Nester, den preußischen Zopfstil und das Markgrafentheater in Erlangen, das jüdische Fürth, die kleine Nadelmetropole Schwabach, den Reichelsdorfer Keller, das längst versunkene gelehrte Altdorf, die kaputtgebombten Slums der Altstadt, die einst den Touristen als das Schatzkästlein des Reiches angepriesen wurden, und natürlich das Parteitagsgelände …
Früher, als Schüler, konnte ich sogar behende zwischen dem proletarischen Dialekt der Insel Schütt und dem Honoratioren-Fränkisch des reichen Prinzregentenufers wechseln, aber inzwischen habe ich die feineren Nuancen aus Mangel an Übung verlernt.
Kurzum, waschecht bin ich nicht, weder als Franke noch als Nürnberger. Aber wer aus dieser Gegend kommt, merkt mir an, daß sie wenigstens eine Spur bei mir hinterlassen hat, die ich durchaus nicht verleugnen will. Jedes A, das mir über die Lippen kommt, verrät, daß auch in mir das berüchtigte goldene Herzerla eines fränkischen Jedermanns schlägt.
Nürnberger Nachrichten, 18. Mai 2013
»Scheint auch die Natur weise dafür vorgesorgt zu haben, daß die menschlichen Dummheiten vorübergehen, verewigen die Bücher sie doch. Ein Dummkopf sollte zufrieden damit sein, diejenigen gelangweilt zu haben, unter denen er weilte; allein, er will auch die zukünftigen Generationen quälen; er will, daß seine Dummheit über das Vergessen triumphiere, dessen er sich doch als eines Grabsteins hätte erfreuen können; er will, daß die Nachwelt darüber unterrichtet sei, daß er gelebt hat, und daß sie auf ewig weiß, daß er ein Dummkopf war.«
Montesquieu, Lettres persanes LXVI
»Nun erfordert aber gewiß in der Welt nichts mehr Anstrengung, als wenn man sich Ehrenhalber zwingen muß, in Entzückung zu gerathen; weswegen man denn auch wohl sagen kann, daß die Betrachtung der Kunstwerke mehr Leiden in der Welt verursacht, als man denken sollte.«
Karl Philipp Moritz, Reisen eines Deutschen in Italien in den Jahren 1786 bis 1788, Zweiter Theil, Berlin 1792
»Ich spreche von der lasterhaften Gewohnheit, andern die eigenen Schriften vorzulesen oder zu rezitieren. Zwar geht sie auf die ältesten Zeiten zurück; doch war dieses Elend in den vergangenen Jahrhunderten noch zu ertragen, weil es seltener vorkam, während heute, da das Schreiben Allgemeingut geworden ist, schwerlich jemand zu finden ist, der nicht irgend etwas verfaßt hätte. So ist eine neue Plage, eine Heimsuchung, eine Geißel der Menschheit daraus geworden.
Das ist kein Scherz, sondern die reine Wahrheit. Denn inzwischen muß man deshalb bereits vor Bekanntschaften auf der Hut sein und der Freundschaft aus dem Weg gehen; denn an keinem Ort und zu keiner Stunde kann ein unschuldiger Mensch sich sicher sein, daß man ihn nicht überfällt und entweder auf der Stelle quält oder dorthin verschleppt, wo er endlose Prosaschriften oder Tausende von Versen über sich ergehen lassen muß. […]
Obwohl jeder Verfasser die unsägliche Belästigung kennt, unter der er selber leidet, wenn er die Sachen anderer anhören muß; obwohl er merkt, wie seine Gäste erbleichen, sich räkeln und gähnen; obwohl er weiß, daß sie alle möglichen Ausreden vorbringen oder gleich die Flucht ergreifen, um sich vor ihm zu verstecken, verfolgt er mit eiserner Stirn und unbegreiflicher Hartnäckigkeit wie ein hungriger Bär seine Opfer, und wenn er sie überrascht, zerrt er sie dorthin, wo er sie haben will. Und während der Lesung sieht er zwar, wie sich die Todesangst des unglücklichen Zuhörers darin äußert, daß er sich windet, daß er gähnt, daß er sich am liebsten gleich hinlegen würde. Aber er gibt keine Ruhe. Im Gegenteil, nur noch wilder und verbissener tönt und schreit er stundenlang weiter, während der Hörer längst der Ohnmacht nahe ist, so lange, bis ihn die Heiserkeit übermannt und seine Kräfte schwinden. Nicht, als gäbe er sich damit zufrieden! Denn eben das, was er seinen Nächsten antut, erfüllt ihn mit einer paradiesischen, quasi übermenschlichen Lust. Siehe, so einer vergißt alle anderen Lüste, verzichtet ganz auf Schlaf und Essen und verliert das Leben und die ganze Welt aus den Augen, nur weil er fest davon überzeugt ist, daß das Publikum an seinen Lippen hängt und ihn bewundert. Sonst nämlich würde er uns verschonen und lieber in der Wüste predigen.«
Giacomo Leopardi, Pensieri XX, übersetzt von H. M. E.
Wallace Stevens believed that »poets, like millionaires, should be neither seen nor heard«. Invited to read for the Museum of Modern Art, he insisted »I am not a troubadour and I think the public reading of poetry is something particularly ghastly«.
Dennis O'Driscoll, »The Outnumbered Poet: Poets and Poetry Readings«, Manuskript 2003
Ein Schriftsteller trug sich gleichzeitig mit einer poetischen Arbeit und einer geschäftlichen Angelegenheit. Man fragte ihn, wie weit er mit seiner Dichtung sei. »Fragt mich lieber«, antwortete er, »wie es mit meinen Geschäften steht. Ich komme mir vor wie jener Edelmann, der sich wegen eines schwebenden Strafverfahrens seinen Bart wachsen ließ. Er wollte sich nicht rasieren, ehe er wußte, ob ihm sein Kopf bleiben würde. So will ich erst wissen, ob mir etwas zum Leben bleibt, bevor ich unsterblich werde.«
Soweit Nicolas Chamfort in seinen Charakteren und Anekdoten.
»Die Kunst aber ist die Kanaille, die mich mit diesem sorgenvollen Ehrgeize behängt hat, und die Trägheit ist es, der ich verdanke, daß ich so edel bin.«
Clemens Brentano an Bettine
»O Faulheit, Mutter der Künste und der edlen Tugenden, sei Du der Balsam für die Schmerzen der Menschheit!«
Paul Lafargue, Das Recht auf Faulheit
Hochgeschätzt bei Dichtern und Künstlern war früher, besonders hierzulande, ein hohes Maß an Weltfremdheit. Spitzwegs armer Poet gehörte zur Innendekoration des bürgerlichen Haushalts; später wußte man die weitgehend fiktive Erfolglosigkeit Van Goghs und die poètes maudits der Bohème zu rühmen.
Ganz anders Goethe, dem seine Fähigkeit, zäh mit Verlegern zu verhandeln, gern vorgeworfen worden ist. An Byron mißfiel, daß er sein Geld zum Fenster hinauswarf, statt es zu vermehren. Die geschäftlichen Abenteuer von Schriftstellern wie Dickens oder Balzac waren ganz besonders dem geschäftstüchtigen Publikum höchst suspekt. Soviel und so früher Kapitalismus war beim gebildeten Bürgertum verpönt.
Das hat sich gründlich geändert; denn in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts ist es zu einer Kehrtwendung um 180 Grad gekommen. Seitdem wird in den Medien über die hohen Vorschüsse angloamerikanischer Romanciers mit derselben Bewunderung berichtet wie über die Summen, die beim Vereinswechsel von Fußballstars fällig werden. Verkannt zu sein gilt nicht mehr als Anzahlung auf den postumen Ruhm.
Nur bei Skribenten, die Gedichte schreiben, wird ein bescheidenes Einkommen nach wie vor geduldet, vielleicht, weil es meist durch die eine oder andere Einladung zu einem Festival, durch eine Stadtschreiberstelle, einen Preis, einen Lehrauftrag oder ein Stipendium ein wenig aufgebessert wird.
Wie Chamforts Edelmann, wenn auch mit ironischem Unterton, auf die Unsterblichkeit zu zählen fällt den Urhebern heute nur noch selten ein, und falls einer an sein Fortleben in der Nachwelt glaubt, tut er gut daran, davon zu schweigen.
»Immature poets imitate, mature poets steal.«
T. S. Eliot
»Bon-sens (Metaphysik). Gesunder Verstand ist jenes Maß von Urteilskraft und Intelligenz, durch dessen Hilfe jeder mit den gewöhnlichen Angelegenheiten der Gesellschaft fertig wird. Nehmen Sie dem Menschen den gesunden Verstand, so reduzieren Sie ihn auf die Qualität eines Automaten oder die eines Kindes. […]
Übrigens gibt es nichts Relativeres als die Ausdrücke Verstand, gesunder Verstand, Geist, Urteilskraft, Durchdringungsvermögen, Scharfsinn, Genie und alle jene anderen Ausdrücke, die sowohl das Ausmaß als auch die Art der Intelligenz eines Menschen bestimmen. Man verleiht jemandem diese Eigenschaften oder erkennt sie ihm zu, je nachdem, ob man sie selbst mehr oder weniger verdient.«
Diderot, Artikel »Bon-sens« in der Encyclopédie
»Mach ma halt a Revoluzion, damit a Ruah is.«
Mündlich überlieferte Parole aus der Münchner Räterepublik von 1919
»Revolution is the opium of the intellectuals.«
David Sherwin, Drehbuchautor des Films »O Lucky Man!« (1973)
Über ein Blatt von Rodolphe Bresdin (1822-1885)
Die Gerberei war sein Brotberuf. Ich habe mich oft gefragt, ob im graphischen Werk Rodolphe Bresdins Spuren dieser Arbeit zu finden sind. Das liegt an den Narben, der minimalen Körnung und an den wuchernden Netzen, die seine Darstellungen überziehen und sie, wie es bei Robert de Montesquiou heißt, »unentwirrbar« machen. Doch sein handwerkliches Vermögen wirft der träumende Künstler hinter sich, sobald er die Nadel oder die Feder in die Hand nimmt.
Nicht an Bewunderern, sondern an Geld hat es dem Künstler gefehlt. Baudelaire, Mallarmé, Gautier, Redon, Hugo, später sogar die Surrealisten waren verblüfft, als sie seine Blätter zu Gesicht bekamen. An seiner Technik kann das nicht gelegen haben. Von Radierung, Lithographie, Gouache verstehe ich ohnehin zuwenig, als daß mir ein Urteil darüber zustünde.
Lieber wundere ich mich darüber, was auf seinen Bildern, die selten mehr als fünfzig mal vierzig Zentimeter groß sind, alles zu finden ist. Wer sich in sie versenkt, gerät in einen Wahrnehmungsstrudel. Alles verästelt sich wie in einem Rebus ohne Ende. Im Dickicht lauern Fratzen und Dämonen. Wenn ein Protagonist im Titel erscheint, muß man ihn mit der Lupe suchen. Selbst der Tod taucht nur als ein Krakel aus dem Unterholz auf. Dafür schwebt über einer weitausladenden Landschaft unversehens ein riesiger Schmetterling.
Wer sich in der Kunstgeschichte auskennt, wird vielleicht an Patinir oder Coninxloo denken, die wie Bresdin auf kleinen Formaten eine ganze Welt versammelt haben: Gebirge, Sturzbäche, Sümpfe und undurchdringliche Wälder, in denen winzig kleine Heilige oder Ziegen und weit hinter ihnen die Türme eines halluzinierten Jerusalem zu finden waren.
Ich bin glücklich darüber, wie an Bildern wie Les grands rochers alle Interpretationen scheitern.
Graf Monaldo Leopardi, der Vater des Dichters, schrieb nach Giacomos Tod im Jahre 1837 ein Memoriale, in dem er berichtet, sein Sohn habe so lange über den Atem nachgedacht, bis er ihm stockte, und so lange über das Wasserlassen nachgegrübelt, bis er keinen Tropfen mehr hervorbrachte.
Ebensowenig gelänge uns der aufrechte Gang, wollten wir bei jedem Schritt die komplizierten Berechnungen anstellen, die nötig wären, um unser gyroskopisches Gleichgewicht bewußt aufrechtzuerhalten.
Vergleiche Heinrich von Kleists Essay Über das Marionettentheater!
Die irreduzible Vielgestaltigkeit der Spezies führt dazu, daß viele ihrer Glaubens- und Herrschaftsformen sich im Singular nicht ausdrücken lassen. Man wird gut daran tun, die einschlägigen Begriffe in den Plural zu setzen. Statt Poly- oder Mono- sollte man von Theismen sprechen. Weitere unentbehrliche Präzisierungen: Juden- und Christentümer, Kapitalismen, Imperialismen, Kommunismen und so fort. Auch den Islam gibt es nur als Plural, wie an den zahlreichen miteinander rivalisierenden Richtungen, den -iten, unschwer abzulesen ist. Jeder dieser Kollektivbegriffe erzeugt aus sich heraus immer weitere Differenzierungen nach dem Modell der russischen Matroschka.
Zu den »Geisterstimmen«. Eine Abendunterhaltung
»Suchen dich Seelen heim? Spürst du sie?« So heißt es in einem Gedicht des spanischen Dichters Pedro Salinas. Na ja, Seelen wäre vielleicht zuviel gesagt. Aber Geisterstimmen sind es auf jeden Fall, was auf einen einredet, wenn man fremde Gedichte liest, Gedichte aus anderen Zeiten und aus anderen Räumen. Da hört man merkwürdige Echos, Ober- und Untertöne im eigenen Kopf. Und wenn sie bleiben, wenn man sie nicht so leicht wieder los wird, dann ist das ein sicheres Zeichen dafür, daß das Gedicht etwas taugt.
Die radikalste Art, mit solchen Heimsuchungen umzugehen, sich einen fremden Text anzueignen, ist die Übersetzung. Von Brotarbeit kann dabei nicht die Rede sein, denn wer Lyrik übersetzt, bekommt kein Geld. Er ist sozusagen selber schuld. Aber das Vergnügen daran, um nicht zu sagen die Lust, belohnt sich selbst. Der Gedichtübersetzer ist kein Märtyrer, sondern ein brüderlicher Egoist. Er handelt ohne Auftrag, folgt seinen Vorlieben und Entdeckungen und nimmt sich das, was er selber brauchen kann.
Schon in der Antike haben viele Dichter von ihren Vorgängern gelernt, indem sie ihre Verse übertrugen. Das war bei den Deutschen nicht anders. Gryphius und Hoffmannswaldau, Goethe und Hölderlin, Mörike und Rückert, Rilke und George, Eich und Celan – die Aufzählung nähme kein Ende. Sie haben eben gewußt, daß alles Dichten ein Fortschreiben am Text der Überlieferung ist und die schiere Originalität nichts weiter als eine Wahnvorstellung der Moderne.
Im übrigen ist die Übersetzung auch die intensivste Form der Kritik. Denn auf die Geisterstunde folgt das kühle Licht des Morgens, an dem das Gedicht wie ein Uhrwerk auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt wird. Wie hat der Autor das gemacht? Das können nur Zerstörung und Rekonstruktion lehren. Was da nicht alles zum Vorschein kommt! Die wunderbaren Erfindungen und die heimlichen Mängel, die Zaubertricks und die Marotten, die Höhenflüge und die blinden Stellen.
Ob man Gedichte überhaupt übersetzen kann, soll, darf – diesen alten Streit lassen wir kalt lachend auf sich beruhen. Hundert Übersetzer haben Shakespeares Sonette ins Deutsche gebracht. Natürlich hat keiner Shakespeare erreicht. Doch mit jedem Versuch ist der Dichter heimischer bei uns geworden. Wir wissen doch, daß jede Migration mit Konflikten und Schwierigkeiten verbunden ist; wir wissen aber auch, daß ohne sie jede menschliche Gesellschaft veröden würde. Unsere Literatur und unsere Sprache wären ohne ihre Aus- und Einwanderer ein trostloses Heimspiel geblieben. Und die Übersetzung belebt, sie hebt den Standard, indem sie den Vergleich ermöglicht und die Latte höher legt.
Ich fürchte, daß es dabei ohne eine Spur von Skrupellosigkeit nicht abgeht. Die Philologie in Ehren, und sogar die Pedanterie ist nicht zu verachten – aber ob das, was beim Übersetzen herauskommt, auch lebt, das steht auf einem anderen Blatt. Jeder wird gern eins zu eins übersetzen, wo das Original es erlaubt. Aber was, wenn das unmöglich ist? Dann ist ein höherer Freiheitsgrad geboten. Das kann so weit gehen, daß die Übersetzung an die Paraphrase, an das Capriccio oder an die Parodie grenzt. Gegengesang, Parodós, nannten die Griechen »ein indirektes Lied voll versteckter Anspielungen« oder »ein ernstes Gedicht, das sich unter der Hand ins Burleske wandelt«. Wenn schon die Alten darin nicht heikel waren, wer wollte uns solchen Schmuggel verbieten? Dem Reinen ist nichts heilig, oder besser: Erst im Sakrileg zeigt sich, was einer ernst nimmt, so wie die Blasphemie nur dem Frommen etwas bedeutet.
Fast alles, was ich über Gedichte weiß, verdanke ich meinen Vorgängern und Mitstreitern.
Ein Lexikonartikel
Gedicht. n. Gefürchtete Textsorte, erkennbar an einem linksbündigen Zeilenfall,
der rechts weite Teile der Druckseite freiläßt.
Für die weitverbreitete Abneigung gegen G.e gibt es verschiedene Erklärungen. Zu kurz greift wahrscheinlich der Hinweis auf eine Plage, der sich Kinder in der Schule ausgesetzt sehen. Man setzt ihnen G.e vor, die sie sich nicht ausgesucht haben, und verlangt von ihnen, daß sie darüber Aufsätze, sog. Interpretationen, verfassen. Dies erzeugt einen Widerstand, der in vielen Fällen jahrzehntelang anhält.
Weit verbreitet ist auch die Vorstellung, G.e seien »schwierig«. An dieser Mystifikation sind ihre Urheber nicht ganz unschuldig. Tatsache ist jedoch, daß Texte dieser Gattung meistens leichter verständlich sind als Parteiprogramme, Allgemeine Geschäftsbedingungen, Mietverträge oder Gebrauchsanleitungen.
Im übrigen irren Menschen, die behaupten, G.e seien ihnen fremd. Personen, die keinerlei solche Texte auswendig können, sind extrem selten. Weithin bekannte G.e sind beispielsweise das Vaterunser, »Hänschen klein«, die Nationalhymne, »I can get no satisfaction«, diverse Abzählverse und, je nach Geburtsdatum, zahllose Schlagertexte, bekannt aus Film, Funk und Fernsehen.
Erwähnung verdienen einige andere Eigentümlichkeiten dieser Textsorte. Zum einen gibt es schlechterdings nichts, von dem ihre Verfasser, die Dichter, nicht sängen und sagten. In diesem Sinn sind G.e, im Gegensatz zu den meisten Prosaformen, Allesfresser. Im allgemeinen zeichnen sie sich ferner durch Kürze aus; G.e in Romanlänge sind eher die Ausnahme. Das mindert den Zeitaufwand, der zu ihrer Lektüre erforderlich ist.
Die Halbwertzeit von G.en ist sehr verschieden. Die meisten verwelken rasch wie ein Veilchenbukett; es sind aber auch Fälle bekannt, wo sie ein paar tausend Jahre überstanden haben.
Auffällig ist die hohe Produktionsrate von G.en, von der jeder Redakteur und jeder Lektor ein Lied (!) zu singen weiß. Es handelt sich, soweit wir wissen, um das einzige Massenmedium, bei dem die Zahl der Produzenten die der Konsumenten übersteigt.
Schließlich ist auf die merkwürdige Tatsache zu verweisen, daß G.e sich mit den allseits gültigen Marktgesetzen als inkompatibel erwiesen haben. Im Gegensatz zu allen anderen sog. Kulturgütern tendiert ihr Handelswert gegen Null. Diese einzigartige Immunität wird von vielen Dichtern beklagt, von andern hingegen als Privileg betrachtet.
Betriebswirtschaftlich ist die Existenz von G.en unerklärlich. An Versuchen, sie wenigstens in ihrer gedruckten Form auszurotten, hat es nicht gefehlt. Großverlage und Fernsehsender haben keinen Zweifel daran gelassen, daß sie in ihren Programmen unerwünscht sind. Noch radikaler mutet das Verhalten gewisser Regierungen an, die gegen die Verbreitung von G.en gewaltsam vorgegangen sind, offenbar weil sie solche Äußerungen für gefährlich hielten – eine Auffassung, die manchem unbefangenen Betrachter übertrieben anmuten wird.
Alles in allem hat sich diese Textsorte jedoch als überraschend zählebig erwiesen. Die Ethnologie ist nach langwierigen Forschungen zu dem Schluß gekommen, daß eine Gesellschaft, in denen G.e unbekannt wären, nie und nirgends existiert hat. Befürchtungen, daß ihr Aussterben bevorstehen könnte, sind schon deshalb wenig plausibel.
Über die Unbelehrbarkeit derer, die Edikte erlassen
Eine Großstadt plant einen neuen Park. Die Einwohner freuen sich. Wer ist zuständig? Der Stadtrat. Das Baureferat. Der Stadtkämmerer. Die Experten für Wasser, Tiefbau und Verkehr. Die Stadtgärtnerei. Alle reden mit. Das kann dauern. Endlich werden die Aufträge an den oder die Landschaftsarchitekten vergeben.
Das Wegenetz wird am Reißbrett entworfen. Die Kriterien sind unklar. Kommunikation, aber für wen? Abwechslungsreich, womöglich pittoresk, naturnah? Für Familien, Touristen, Radfahrer geeignet? Autogerecht, zumindest für irgendeine Buslinie, unbedingt aber für die Polizei, die Feuerwehr und nicht zuletzt für den Fahrzeug- und Maschinenpark der Administration.
Das Ergebnis ist ein Kompromiß, den die beteiligten Behörden unter sich aushandeln. Die Besucher des Parks werden nicht gefragt. Sofort bilden sich Trampelpfade neben den von den Planern ersonnenen Wegen und Abkürzungen, die kreuz und quer zu ihnen verlaufen. Vorhandene Barrieren werden ignoriert oder überwunden.
Aus diesen Erfahrungen lernt keine Behörde. Der stumme Kampf um den Park zieht sich jahrzehntelang hin. Hartnäckig halten die Planer an ihren Vorstellungen fest. Die Besucher stören das Konzept. Aber ihre Selbstorganisation ist renitent. So entsteht neben dem offiziellen Wegenetz ein zweites, das eine spontane Vitalität an den Tag legt und alle Verordnungen und Satzungen Lügen straft.
Dieses Modell ist auf alle Regierungen dieser Welt übertragbar.
An Versuchen, den Leuten ihre Vorliebe für Grund und Boden auszutreiben, hat es nie gefehlt. Sie sind alle gescheitert. Landraub, Bauernlegen, Konfiskation, Verstaatlichung – die Versuche, dieses Streben zu unterdrücken, hat keine Gewalt aus der Welt schaffen können. Notfalls gaben sich die Leute, wo das Eigentum verboten wurde, mit dem bloßen Besitz zufrieden. Die Russen haben sich, wie ihre unterworfenen Vasallen, an ihre Datscha gehalten, für die Skandinavier wurde die Sommerhütte zum idealen Rückzugsort, und bei den Deutschen siegte der Schrebergarten, den sie sich, gleich unter welchem Regime, nie nehmen ließen.
Früher war ein Zentrum noch im Zentrum zu finden. Seitdem es in Center umgetauft wurde, nennt sich jede Bruchbude so. An den entlegensten Orten stößt man nun auf Evangelien-, Feuerzeug-, Eros- oder Surfbedarfszentren. Nach wie vor kann sich jedoch da und dort noch ein Stadtzentrum, eine City oder wenigstens ein Business Center halten. Wenn die Mall dort open ist, wird der Besucher durch einen Sale angelockt, der Prozente verspricht.
»Die Entstehung der Quantenmechanik ist ein wunderbares Beispiel dafür, daß man physikalische Vorgänge verstanden haben kann, ohne daß man imstande wäre, anders über sie zu reden als in Bildern und Gleichnissen. Die Physik handelt nicht von der Natur, sondern von dem, was Menschen über die Natur sagen können.«
Niels Bohr, nach John Canaday, The Nuclear Muse. Literature, Physics and the First Atomic Bombs, Madison 2000
Sozialrassismus – kann es so etwas geben? Immerhin kann sich die Klassen- ebenso wie die Rassendiskriminierung nicht auf die Vernunft berufen. Sie kommt aus der Tiefe, dem sogenannten Bauchgefühl. Und ebenso wie beim gewöhnlichen Rassismus beruht sie auf Gegenseitigkeit, das heißt, die polemische Energie des Ressentiments zielt gleichermaßen nach »oben« wie nach »unten«.
Geboren 1929 – das heißt, ein Relikt aus dem zwanzigsten Jahrhundert. Diese Prägung ist unwiderruflich. Sonderbar daran ist, daß sie nicht als Nachteil oder Defekt empfunden wird, eher so, als hätte man den Jüngeren etwas voraus. Andererseits das Gefühl, als gingen einen manche Erscheinungen der Gegenwart nicht mehr besonders viel an. Man nimmt sie zur Kenntnis, versucht sogar, sie zu verstehen, aber das meiste bleibt einem fremd, so als ginge es um Macken, Moden, Obsessionen, die man nicht teilt.
»To achieve greatness, you need two things: a plan; and not quite enough time.«
Leonard Bernstein
In der Medizin nennt man »Semmelweis-Reflex« die Gewohnheit, als schädlich erwiesene Praktiken zu verteidigen. In der Politik ist dieser Reflex nicht die Ausnahme, sondern die Norm. Siehe die Euro- und Banken-Rettungsmanöver oder die vergeblichen Gesundheits- und Steuerreformen.
»Die medizinische Wissenschaft hat in den letzten Jahren so ungeheure Fortschritte gemacht, daß es praktisch keinen gesunden Menschen mehr gibt.«
Aldous Huxley
Eine liquidierte Firma wird aus dem Handelsregister gestrichen und hört auf zu existieren.
Aus diesem Vokabular hat sich die Kommunistische Partei der Sowjetunion bedient. Russisch likvidirovat', nachweisbar seit 1924, bedeutet seitdem nicht nur »beendigen« oder »abschaffen«, sondern auch und vor allem »auslöschen, ausmerzen, ermorden«. Der Schritt vom Geschäft zum Terror fällt offenbar leichter, als wir denken.
»Dienstleistungsgesellschaft«: ein Gemeinwesen, in dem es keine Diener gibt.
»Keiner kann ein brauchbarer Mensch sein, der sich nicht wohl und übel verhalten kann. Er sollte unredlich sein mit den Unredlichen, sollte ein Räuber sein und mit Dieben stehlen, so gut er kann. Als ein verschlagener Mensch sollte der sich nützlich machen, der Grips dazu hat. Mit Guten sollte er gut sein, mit Schlechten schlecht. Wie immer die Umstände sind, danach sollte er sich richten.«
Plautus, Bacchides, 654–662, deutsch von Anton J. Gail
»Ein Mensch mit einem guten Gedächtnis erinnert sich an nichts, weil er nichts vergißt.«
Samuel Beckett, Proust, 1930
»Es ziemt dem Untertanen, seinem Könige und Landesherrn schuldigen Gehorsam zu leisten und sich bei Befolgung der an ihn ergehenden Befehle mit der Verantwortlichkeit zu beruhigen, welche die von Gott eingesetzte Obrigkeit dafür übernimmt; aber es ziemt ihm nicht, die Handlungen des Staatsoberhauptes an den Maßstab seiner beschränkten Einsicht anzulegen und sich in dünkelhaftem Übermute ein öffentliches Urteil über die Rechtmäßigkeit derselben anzumaßen.«
Gustav von Rochow, preußischer Innenminister und Staatsminister, 1838
Der DDR wird nachgesagt, sie sei eine Nischengesellschaft gewesen. Das ist nichts Besonderes; denn das gilt ebenso für die meisten anderen, nur daß es sich, anders als in der Diktatur, um eine freiwillige Einrichtung handelt. Eine Woche in Tübingen genügt, um das einzusehen. Es ist, wie andere Nester, einzigartig. Eng, zugleich gemütlich und ungemütlich. Die Einheimischen halten sich für etwas Besonderes. Sie sind genial und gewöhnlich, gelehrt und beschränkt. Wie Ghom im Iran ist es die Kapitale einer besonderen religiösen Formation, die von ihren Kritikern Pietkong genannt wird. An ihren säkularen Symptomen ist sie leicht zu entziffern: Hausordnungen und Gebräuche, unter denen die Leidenschaft für die Mülltrennung auffällt. Bis zu sieben verschiedene Tonnen sind zu unterscheiden. Am zentralen Ort, dem berühmten Stift, werden die Insassen von einem eigenen Müll-Tutor betreut, der ihre Abfälle inspiziert und Abweichler zur Rechenschaft zieht.
Gänzlich andere, aber ebenso strikte Regeln gelten für das Rotlichtmilieu von St. Pauli in Hamburg, für die Hausbesitzer von Sylt, für die kosmopolitische Neo-Bohème von Berlin-Kreuzberg und für die Banker-Gemeinden im Taunus.
Bei Georg Simmel heißt es, der Fremde ist einer, »der heute kommt und morgen bleibt«.
Die Säugetiere, was für eine bizarre Laune der Natur. Der Aufwand ist unglaublich hoch: komplizierte Organe, riskante, langwährende Schwangerschaft, die riskante Geburt, die Fütterung, zu der eigene Brüste nötig sind, und die Aufzucht, die kein Ende nehmen will. Daß sie die Konkurrenz mit viel älteren und erprobteren Organismen wie den Bakterien, den Muscheln und den Insekten nicht nur aufgenommen, sondern sogar seit geraumer Zeit bestanden haben, grenzt an ein Wunder. Noch rätselhafter ist es, daß eine Art der Mammalia sich, wenn auch vielleicht nur vorübergehend, zur Herrschaft über alle Tiere aufgeschwungen hat.
Der Refrain der Technophilen: Mensch, werde unwesentlich!
Was sich niemand vorstellen kann
Die Zahl 1036
Eine Revolution in München-Grünwald
Wie eine Katze einen sieht
Den Schmerz eines anderen, den eigenen Schmerz von vorgestern oder übermorgen
Das dritte Jahrhundert nach Christus
Genaugenommen jedes andere Jahrhundert
Einen Nachbarn, der einem alles nachmacht
Sich selber mit zehn Jahren
Sich selber mit hundertzehn Jahren
Leichter als Luft sein
»Natürlich kann man seine eigene Geschichte nur hinterher betrachten. Die Gegenwart ist nie in Kapitel eingeteilt.«
Tanaquil dixit, Brief vom März 1979
Buchstabensalat. Wer wüßte nicht, was das bedeutet: BOBL, VZVB, FTSE, CBRE, EONIA, AIFM, ELSTAM und ISIM? Der ist ein Analphabet und sollte lieber keine Wirtschaftszeitung zur Hand nehmen. Nicht als wären Banker und Spekulanten die einzigen, die dem Abkürzungswahn verfallen sind. Die Konkurrenz der Naturwissenschaftler, der Politiker und der Technokraten ist hart. Doch wie auf den meisten anderen Feldern ist auch hier die Hegemonie der Vereinigten Staaten ungebrochen. Wer nicht auf Anhieb erkennt, was mit LWOP gemeint ist, kommt als Leser des New Yorker oder der NYRB nicht mehr in Frage.
Eine Suchmaschine, die 345 000 Abkürzungen auflistet, kommt dem Trend nicht nach, weil jeden Tag neue Verballhornungen auftauchen.
Der Nutzen dieses Tohuwabohus liegt auf der Hand. Ihr psychologischer Zweck ist der Snobismus der Eingeweihten; ihr sozialer Zweck die Ausgrenzung derer, die nicht dazugehören; ihr politischer Zweck sind Camouflage und Verdunklung.
Selbstbedienung ist ein Oxymoron, das seine eigene Widerlegung zum Inhalt hat. Es bedeutet die Delegierung von Arbeit an den Kunden, der so vom König zum Lakaien gemacht wird.
Die besten Ideen kommen einem
vor dem Einschlafen,
während eines heftigen Sommergewitters,
nach dem ersten Zug aus der ersten Zigarette, wenn man vierzehn Tage lang mit dem Rauchen aufgehört hat,
beim Spazierengehen oder in der Badewanne, wenn kein Stift und kein Papier zur Hand sind,
nach dem Auftauchen aus einer Depression,
wenn man plötzlich um drei Uhr früh aufwacht,
im Konzertsaal, weil der lange Satz der Klaviersonate sich hinzieht,
oder in einer Gefängniszelle.
Die meisten dieser Ideen vergißt man sofort wieder,
und vielleicht ist das besser so.
»Schriftsteller pflegen sich vor dem Tod in ihre Autobiographien zu verwickeln, wenn die dichterische Ader schon so dünn geworden ist, daß sich zwischen den verkalkten Wänden kaum noch eine Metapher herauspumpen läßt.«
Imre Kertész, Letzte Einkehr. Ein Tagebuchroman, S. 325
Beim Essen einer Blutorange denke ich, daß die Welt mir mehr gegeben hat als ich ihr.
»Viele meiner Gedichte hätte ich mir sparen können, ich hätte jetzt ein Kapital, könnte so ungereimt leben, wie ich wollte. Das ewig nachgestammelte Naturgeheimnis. Einmal genügt. Nachtigallen kann auf die Dauer nur ertragen, wer schwerhörig ist.«
Günter Eich, Ein Tibeter in meinem Büro. 49 Maulwürfe, Frankfurt am Main 1970
Das fatale Wort sozial ist ein Schwamm, den auszudrücken in Deutschland den wenigsten gelingt. Keine Partei, die nicht unermüdlich versichert, wie sozial sie ist. Und auf dem Arbeitsmarkt erkundigt man sich neuerdings nach der »sozialen Kompetenz« der Bewerber.
Das hat vermutlich damit zu tun, daß man hierzulande »Gesellschaft« und »Geselligkeit« miteinander verwechselt – sehr zum Nachteil der letzteren. Sie wird selten erwähnt, obwohl die Soziabilität die Grundlage ist, auf der das Zusammenleben beruht.
Johann Gottfried Seume sagt auf seinem Spaziergang nach Syrakus im Jahre 1802 von einem Ritt auf dem Maulesel: »Diese Thiere hören auf nichts als diesen Stachel, der ihnen, statt aller übrigen Treibmittel, am Halse applizirt wird. […] Siehst Du, so kurz und leicht ist die Weisheit der Mauleseltreiber und der Politiker. Das scheint das Schiboletchen aller Minister zu seyn. Wie der Hals des Staats sich bey dem Stachel befindet, was kümmert das die Herren? Wenn es nur geht, oder wenigstens schleicht.«
Kaputt. Ein Erklärungsversuch
So gut wie alle Menschen sind Vandalen. Es ist unfair, für die tief verwurzelte Zerstörungslust des homo sapiens einen germanischen Völkerstamm haftbar zu machen, über den man wenig weiß und der mehr der Sage angehört als der Wirklichkeit.
Es macht mehr Vergnügen, einen Turm zu sprengen, als ihn zu errichten. Der Fünfjährige, der mit Bauklötzen spielt, freut sich schon auf den Moment, wenn er sein Werk mit einem Schlag zum Einsturz bringen kann. Kein böser Nachbar hat das Kind zu dieser Handlung angestiftet. Es kommt ganz von selbst auf die Idee. Die Lust, zu zerstören, ist wenigstens so stark wie die, etwas zu errichten. Homo faber und homo eversor sind nicht nur Brüder; die beiden Seelen wohnen in einer Brust. Menschen sind, wie ihre Geschichte jeden Tag von neuem beweist, Triebtäter.
Ihre reinste Form ist der größenwahnsinnige Gewaltherrscher. Bescheidener ist der gewöhnliche Amokläufer, der Selbstmordattentäter, der sich oft, aber nicht immer, auf einen Willen beruft, der mächtiger ist als er selbst. Wenn er nicht in der Lage ist, zu töten, läßt er seinen Drang an Dingen aus. Ob es sich um ein Möbelstück handelt, das er zertrümmert, ein Kunstwerk oder einen Tempel, ist nebensächlich. Er möchte nur das kaputtmachen, von dem er glaubt, es mache ihn kaputt. Nicht immer ist die Lust an der Zerstörung, wie Bakunin und Schumpeter glaubten, eine schaffende Lust.
Kleiner, als der gesunde Menschenverstand annimmt, ist der Schritt von der Zerstörung zur Selbstzerstörung. Amokläufern und Selbstmordattentätern gelingt er leicht.
Doch gibt es zwischen diesen beiden einen Unterschied, den zu vernachlässigen fahrlässig wäre. Während der eine sich seiner Lust einsam hingibt, kann sich der andere auf ein Kollektiv verlassen, das ihn nicht nur stützt, sondern überhaupt erst hervorbringt. Diese Gemeinde von Anhängern besteht, wie bei der Hochhaussprengung, aus Hintermännern, die selber gar nicht in Erscheinung treten, aus Zwischenträgern und Befehlsempfängern, aus Mittätern und aus freudigen Zuschauern, die sich vielleicht gern beteiligt hätten, wenn sie nicht jedes Sicherheitsrisiko vermeiden wollten.
So wie im kleinen auch im großen. Man braucht kein Psychologe oder gar ein Psychoanalytiker zu sein, um zu verstehen, warum der Krieg bei den meisten Menschen eine Begeisterung hervorruft, die der Vernunft rätselhaft bleibt. Sie kennt am Anfang keine Grenzen; aber auch wenn die Niederlage unabweisbar geworden ist, wird der Kampf so lange fortgesetzt, bis die Zerstörung, als negative Utopie, vollkommen ist. Es gibt offenbar Befriedigungen, von denen wir nichts ahnen, bevor wir sie selbst erfahren. Doch brauchten wir nur einen Spielplatz aufzusuchen, um einzusehen, wie wenig fremd uns solche Anwandlungen sind.
Vorbildlich
»Herr Dr. Meinecke hat ein vorbildliches Examen abgelegt«; »Wir betrauern den Verlust von Herrn Friedrich von Pfannkuchen, Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande, der als Vorstandsmitglied unserer Firma der gesamten Belegschaft ein Vorbild an Weitblick, Einsatzfreude und Schaffenskraft war« – das hört sich ja ganz so an, als wären solche Beispiele nachahmenswert. Her mit irgendeinem Vorbild, und die Positivität wäre gerettet.
Aber wie verhält es sich dann mit dem Mann, der, wie es bei Ulrich von Hutten heißt, »nur an bosheit […] seinem vorbilde gleicht«, der am liebsten »durch sein bösz exempel und vorpilt« wirkt? Auch das Böse ist selten originell; offenbar deshalb kommt es nicht ohne Muster aus. Jeder Ökonom kennt den Trittbrettfahrer, jeder Kriminalist den Nachahmungstäter. Auch die Gemeinheit will gelernt sein. Es hieße, die Kreativität des Menschen überschätzen, wollte man annehmen, daß jedermann imstande wäre, Mord und Totschlag immer von neuem und auf eigene Faust zu erfinden. Dazu braucht es Vorgänger, am besten solche, die ein gewisses Format aufweisen, so daß sie als Lehrmeister dienen können. Vorbildlich war Cäsar für Napoleon, Napoleon für Hitler, Hitler für Saddam Hussein, und selbst Wilhelm II. sah sich veranlaßt, in einem seiner hysterischen Augenblicke an Attila Maß zu nehmen.
Es liegt in der Natur der Sache, daß der Epigone seinem Meister nicht immer gewachsen sein kann. Auch unter den größten Scheusalen herrscht das Gesetz der Konkurrenz, und so gilt im guten wie im bösen, daß sich bei der Wahl von Vorbildern, wenn man sie schon nicht ganz entbehren mag, die größte Umsicht empfiehlt.
»In dem Bestreben, alles Eigenleben in Rußland zu unterdrücken, blieb er siegreich, solange er lebte«, sagt Ricarda Huch über Nikolaus I. (Michael Bakunin und die Anarchie, 1923). Das könnte auch für Lenin und Stalin gelten. Putins Ehrgeiz hat dasselbe Ziel im Auge.
»Da nun Peter der Große die Zivilisation aus dem Westen geholt hatte, mußte der Westen Quell alles Bösen sein, woraus sie [die Slawophilen] folgerten, daß im russischen Volke alles Gute daheim sei.« Auch damit hat die wohlmeinende und unbestechliche Ricarda ins Schwarze getroffen.
Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, von denen die Harvard Business School nichts versteht.
Unsere Nachbarin, die immer nur »die Anni« genannt wurde, war klein, über fünfzig, wohnte in einem kleinen Häuschen am Ufer gegenüber und lebte mit einem pensionierten Organisten zusammen, der im Rollstuhl saß und nie vor die Tür ging. Sie hatte wenig Geld, lebte aber sorglos, weil sie einer Lehre anhing, die sie selber erdacht hatte und die ich »die Ökonomie der Gabe« nennen möchte.
Tagsüber war sie mit ihrem Garten beschäftigt, auf dem sie alle Arten von Gemüse, Salat und Beeren zog.
Wenn es etwas zu ernten gab, kam sie nicht nur bei uns, sondern auch bei anderen Nachbarn mit einem Korb vorbei und brachte ihre Gaben. Wenn man ihr Geld geben wollte, lehnte sie es höflich ab, mit der Begründung: »Das ist alles von selber gewachsen, und je mehr man davon austeilt, desto mehr gibt der Herr einem zurück. Alles wächst besser, wenn man es verteilt; denn dann liegt ein Segen darauf.« Davon war sie nicht abzubringen. Obwohl die Anni nie in die Kirche ging, hatte sie sich so ihre ganz eigene, an Frömmigkeit grenzende Wirtschaftstheorie zurechtgelegt.
Es gibt andere Menschen, die nach einem ähnlichen Prinzip verfahren, auch wenn ihnen religiöse Anwandlungen fernliegen. Meist halten sie sich dabei im Hintergrund. Ihre Gaben bestehen nicht aus Radieschen oder Stachelbeeren. Sie begnügen sich damit, Verbindungen zwischen Dritten zu knüpfen, die ohne ihre Mitwirkung nie zustande gekommen wären. Man kann das eine höhere Form der Kuppelei nennen. Eine Freundin, die dieses Talent hat, nennt es »Stöpseln«. Auch bei diesem Vorgehen gilt, daß ihre Wohltaten gratis sind. Man kann sagen, daß sie auf eigentümliche Weise selbstlos zu Werke geht.
Eine solche Kupplerin handelt nie in ihrem eigenen Interesse. Sie hat gewissermaßen nichts davon. Meist ist sie sogar unfähig, etwas dergleichen auf eigene Rechnung zu unternehmen, vielleicht weil es ihr an Ehrgeiz fehlt oder weil sie es für albern hält, ihren Vorteil zu suchen. Wenn ihre Interventionen von Erfolg gekrönt sind, ohne daß die Beglückten ahnen, wem sie zu verdanken sind – um so besser! Es liegt, wie die Anni sagen würde, ein Segen darauf, sich nicht an die Spielregeln der Welt zu halten.
Großunternehmen, Behörden und andere Dienstleistungseinrichtungen geben sich die größte Mühe, um jeden Kontakt mit den Kunden und Bürgern, die sie bezahlen, mit einem Wort, den gewöhnlichen Leuten, zu unterbinden. Sie legen Wert darauf, unerreichbar zu sein. Zu diesem Zweck werden Eintragungen in Telefonbüchern und Verzeichnissen, auch im Internet, möglichst vermieden; man schaltet sogenannte Call-Center in Indien oder sonstwo ein, die keine Auskünfte geben können, oder Automaten, die nach minutenlangen, mit öder Konservenmusik untermalten Warteschleifen auf ihr Interesse am Datenschutz und an ihren Statistiken verweisen, alles nur, um dem Anrufer mit weitschweifigen Bitten um Geduld oder mit Reklamesprüchen die Zeit zu stehlen. Oft wird dann noch eine Ziffer genannt, die der Anrufer bitte drücken möge, damit er mit der nächsten Automatenstimme verbunden werden kann, und das Spiel beginnt von neuem.
Man wird darin Maßnahmen zur Notwehr sehen, um die Verantwortlichen vor den Leuten zu schützen, die ihnen mit ihren Anfragen, Beschwerden, Wünschen und Einwänden zur Last fallen könnten. Das sind Personen, die Wichtigeres zu tun haben, als sich um die Außenwelt zu kümmern. Selbstisolation und Selbstreferenz gehören zu ihren teuersten Privilegien. »Wo kämen wir hin, wenn wir persönlich Rede und Antwort stehen müßten?« Aber nicht einmal zu dieser Auskunft sind sie bereit. Es ist undenkbar, den Schlaf der Macht zu stören.
Der American Dream ist, wie die meisten Träume, repetitiv und ein wenig kindisch. Ein willkommener Albtraum, der so erfolgreich ist, gerade weil er keine Spur von Originalität aufweist. Reich und berühmt zu werden, ein Milliardär, ein Star, ein Olympionike, ein Alpinist, der einen Neuntausender als erster besteigt – das sind Wünsche, die es schon gab, bevor Columbus sein Indien entdeckte; ein vergessener amerikanischer Dichter namens Longfellow hat 1841 die schönste Formulierung für den Aufsteiger gefunden: »Hinauf! Empor! Dein Wahlspruch sei: Excelsior!«
Leider sind die Lateinkenntnisse seither zurückgegangen. Aber dafür hat die Globalisierung bewirkt, daß der amerikanische Traum zum wichtigsten Exportgut der Vereinigten Staaten geworden ist. Hollywoods soft power ist überall, und die Illusion ist alles. Leider mißlingt es den meisten Tellerwäschern, ins Weiße Haus einzuziehen, so wie es den wenigsten Gänsehirtinnen nie vergönnt war, den Königssohn zu heiraten. Das ist schade, doch ein Ausweg steht auch dem hoffnunglosesten Verlierer offen: Gewisse Talente vorausgesetzt, kann er es bis zum Hedgefonds-Manager, bis zum Spion oder bis zum Hochstapler bringen. Die träumende Nation vertraut der Fortuna, doch eine andere Göttin, die aus der Nacht geboren ist, hat das letzte Wort: die Nemesis.
Was ich Picasso schon immer fragen wollte:
Muy admirado Don Pablo –
wie war Ihnen zumute, als Sie erkannten,
daß Sie ein Monster waren?
Gefiel Ihnen Ihre Einsamkeit?