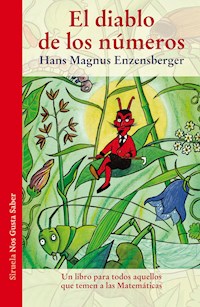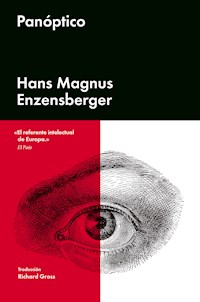11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In Impressionen, Sprüngen und Exkursen folgen wir den Geschichten des M., den Abenteuern eines, der sich den Zumutungen der Geschichte zu entziehen wusste: Familien-Bande und erste Liebe, frühe Lektürelust und Mediensucht, jede Art von Ausweichmanöver vor falscher Autorität, ein missglückter Sprengstoffversuch, Fahnenflucht, Schwarzhandel und dann das Glück akademischer Freiheit im Studium – noch jenseits von Pisa und Bologna: Ob es um jesuitisch geprägte Marx-Exerzitien oder, unter Vortäuschung von Altgriechisch-Kenntnissen, um ein »Mokka-Seminar« im professoralen Salon ging, um ein bisschen Linguistik oder Psychiatrie – hier ließ man ihn in Ruhe.
Aber die Erinnerung ist ein fragmentarischer und unzuverlässiger Ratgeber. Deshalb nimmt sich der Autor die Freiheit der Regie und der Collage, fügt Motive, Bilder und Anekdoten zu einem Opus incertum zusammen. So nannten die alten Römer eine spezielle Art ihres Mauerbaus: ein »ungesichertes Werk«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 196
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
HANS MAGNUS ENZENSBERGER
EINE HANDVOLL ANEKDOTEN,AUCH OPUS INCERTUM
Suhrkamp
Inhalt
Schwarze Wochen im Herbst 1929
Eine jugendbewegte Frau
Geisterhafte Vorfahren
Der Freitisch
Nichts Besonderes aus den ersten dreißig Monaten
Unter Brüdern
Eine erste Liebe
Singer’s Nähmaschine war die beste
Dienstwohnung
Ob man Kinder verwöhnen darf
Eine erste Enttäuschung
Traumabwehr
Ein Häuschen
Nicht aller guten Dinge sind drei
Vom Laster der Lektüre
Ein vielseitiger Mann
Fata eines ramponierten Buches
Bilder aus dem Parteikalender
Unsichtbare Minoritäten
Ein ungeschickter Sozialarbeiter
Wie er mit dem Corynebakterium fertig geworden ist
Kinderkrieger
Ein unfaßbarer Großvater
Der feiste Nachbar
Eine zweite Enttäuschung
Aus dem Schatzkästlein des Deutschen Reiches
Ein doppelter Ladendiebstahl
Ein unheimliches Opfer
Die flüchtigen Annehmlichkeiten eines kurzen Friedens
Ein Klassenbild
Die alljährliche Heimsuchung
Der Heizer
Zuckerbrot
Die Ausstoßung
Das Haus an der Burggasse
Kriegsverdruß und Kriegsbegeisterung
Ein Pariser Sommer
Spätfolgen einer Wanderung
Ein undankbarer Gast
Onkel Fred
Frühe Mediensucht
Eine gedämpfte Unterhaltung
Eine Bunkerphantasie
Blitzmädchen
Kinder im Krieg
Terrorangriff
Die Verbannung aufs Land
Unfreiwillige Naturkunde
Eine Art von Spionage
Was M. und seinen Brüdern zu schwör war
Ein rachsüchtiger Moment
Kartographische Vorlieben
Flegeljahre mit Dynamit
Tiefflieger
Schwierigkeiten bei der Plünderung
Zwölf Jahre im Gewahrsam der Pädagogen
Ein Rekrutierungsversuch
Der Westwall
Von den Leibesübungen
Der Unbefangene
Ein dubioser Fronteinsatz
Die Geschichte einer kleinen Fahnenflucht
Unter den Augen der Militärpolizei
Das letzte Gerücht
Die allererste transatlantische Unterhaltung
Eine luxuriöse Notration
Eigenartige Glücksgefühle
Eine Frage der Interpretation
Ein Fall von Wehrkraftzersetzung
An Stelle eines BWL-Studiums
Schwarzmalerei aus Wut
Noch eine amerikanische Handreichung
In der britischen Enklave
Der Ruf des Kuckucks
Eine Filmvorführung
Kontrafakturen
Intermezzo im Schloß
Nichts wie raus hier!
Auf der Insel der Sieger, die ihr Weltreich verloren hatten
Ein Land, das fast spurlos verschwunden ist
Ein Mißverständnis und seine Folgen
Die Pleite eines Zigarettenmillionärs
Geckenhafte Jünglinge
Die ersten zivilen Feldzüge
Auch eine Rückkehr zur Normalität
Unerwünschte Wohltaten
Unangemeldete Tischgenossen
Nachweis der Gelegenheit zur Eingehung einer Ehe nach § 656 BGB
Aus einer Familienchronik
Abenteuer eines gutmütigen Onkels
Berufsberatung
Exil-Phantasien
Eine friedliche Mobilmachung
Was heißt und zu welchem Ende studiert man Geschichte?
Studium universale en miniature
Umherschweifende Suche nach hörenswerten Verlautbarungen
Ein falscher Famulus
Ein Maulwurf in der Societas Jesu
Es gab damals auch andere Philosophen
Bei den Hanseaten
Magere Reisen
Angst vor Pferden
Ein Ausflug in die Hauptstadt des 19. Jahrhunderts
Eine letzte Prüfung
Noch ein verfrühter Nachruf
Ein Autodafé
Envoi
Illustrationen
Kolophon
Anekdote, die; aus griechisch anékdoton: nicht herausgegeben, eigentlich etwas aus Gründen der Diskretion noch nicht schriftlich Veröffentlichtes, bisher nur mündlich Überliefertes. Kurze Erzählung zur Charakterisierung einer Person, einer merkwürdigen Begebenheit oder einer bestimmten Zeit.
Schwarze Wochen im Herbst 1929
Das eigene Geburtsdatum ist schwer loszuwerden. Auch M. schleppt es mit sich herum. Wenn es nur die Kirchenbücher und die Standesämter wären, die auf diesem Detail herumreiten! Aber nein, es sitzt ihm, wie allen andern, zeitlebens im Nacken.
Am 24. Oktober 1929 brach an der New Yorker Stock Exchange eine Panik aus. Bis zwölf Uhr mittags brachten sich elf Kapitalisten um. Die Besuchergalerie wurde geschlossen. Unter den Gästen befand sich Mr. Churchill, ein Engländer, von dem M. erst viel später erfuhr, als er unter dem Namen Sir Winston mit einem Maschinengewehr in der Hand, einem Zylinder auf dem Kopf und einer Zigarre im Mund in einer deutschen Zeitung abgebildet wurde.
M.s Vater war anno 1929 zu Besuch bei den Verwandten seiner Frau in K., einer kleinen Stadt im bayerischen Schwaben, die von der Brauerei, der Weberei und einer lithographischen »Kunstanstalt« lebte. In einer grün tapezierten Stube, neben einem weißen Kachelofen, erfuhr er aus dem Allgäuer, daß in Amerika soeben ein Schwarzer Donnerstag zu Ende gegangen war. Ein paar Tage später wurde M. geboren und nach katholischem Ritus getauft. Die Notierungen an der New Yorker Börse fielen am selben Tag um durchschnittlich fünfzig Punkte.
Sein Vater hat keine Aktien besessen. Er ist damals Postassessor gewesen, danach wurde er nach Nürnberg versetzt und zum Telegraphendirektor befördert, hat aber trotz dieses wohltönenden Titels nur 450 Reichsmark im Monat verdient. Er trug eine Brille mit vergoldeten Rändern und eine dünne Krawatte. Ob er in diesen Jahren gewählt hat und, wenn ja, wen, das weiß M. nicht.
Eine jugendbewegte Frau
M.s Mutter war der Taufname Eleonore, auf dem ihr Vater bestanden hatte, zu feierlich. Die beiden älteren Brüder nannten sie Lori, und dabei blieb es. Ihre Mutter, die Walburga hieß, hat sich kaum um sie gekümmert. Als Kind mußte sie barfuß gehen. Es gab wenig zu essen, wenig Vitamine und keinen Lebertran. Die Folge waren erste Symptome einer Rachitis, die aber später geheilt wurde. Sie wurde bei den Englischen Fräulein untergebracht, deren Orden mit Großbritannien nichts zu tun hatte, sondern den Schutz der Engel für sich in Anspruch nahm. Wertvoller war das Protektorat des Vaters, der als Patriarch ein lautes Regime führte und dafür sorgte, daß sie ordentlich gefüttert wurde. Sie war sein Liebling; er bevorzugte sie vor den zahlreichen Söhnen, die er gezeugt hatte.
Weil sie eine brave Schülerin war, unterschätzte er, wie sich bald zeigte, ihren stillen Eigensinn. Weil ihr mißfiel, was Walburga ihrer Familie vorsetzte, lernte sie in einem reichen Pfarrhaus die Kunst, etwas Gutes zuzubereiten. Dann wählte sie eine Ausbildung als Kindergärtnerin.
Dort geriet sie in das Milieu der sogenannten Reformbewegung, die danach trachtete, das Korsett abzuwerfen, Ausflüge in Wanderschuhen zu unternehmen und am Lagerfeuer zu singen. Das Wort Jugend nahm eine neue, emphatische Bedeutung an; ein eigener Stil prägte Möbel, Kleider, Fassaden und Ornamente.
Schüchtern war sie nicht. Sie mochte ihren alten Herrn, aber seine Herrscherallüren störten sie. Hinter seinem Rücken traf sie sich mit einem bargeld- und vaterlosen Mann, der in den Augen der Familie außer seinem Ingenieurdiplom nichts zu bieten hatte. Der schrieb ihr so lange zarte und einfallsreiche Liebesbriefe, bis sie sich mit ihm verlobte.
Ihren Vater hat sie nicht nach seiner Meinung gefragt. »Was dem Faß den Boden ausschlug«, schrieb er, »war das unbesonnene und unverantwortliche Verhalten Lores, die sich bisher so tadellos geführt hatte und nun plötzlich wie umgewandelt schien. Jedenfalls wollte sie sich zu Haus nicht mehr das Geringste sagen lassen. Sie brachte es über sich, heimlich bei Nacht und Nebel, unter Mitnahme all ihrer Habe, das elterliche Haus zu verlassen.«
Im August 1928 meldete ein lakonisches Telegramm aus Berlin, daß M.s Eltern geheiratet hatten.
Geisterhafte Vorfahren
Die meisten Menschen haben acht Urgroßeltern, von denen sie wenig wissen. Sie müssen froh sein, wenn auf einem verblaßten Photo, das sich in ein Album verirrt hat, eine dieser Personen zu erkennen ist.
Mit den Großeltern sieht es schon besser aus. M. weiß einiges über den Vater seines Vaters, der Joseph hieß und von einem großen Bauernhof am Auerberg am Rand der Allgäuer Alpen kam. Er war von dreizehn Kindern das drittjüngste und lernte als Feinmechaniker in Nesselwang bei der Firma Riefler, wie man Reißzeuge baut. M. hat von ihm sein Gesellenstück geerbt, das in einem großen Futteral lag. Es enthält, auf blauen Samt gebettet, achtzehn Teile, darunter Stech-, Zieh-, Haar-, Nullen- und Spitzenzirkel, Reißfeder und Kopiernadel.
Sonst weiß M. nicht viel von ihm. Es heißt, daß er sich 1894 bei der Königlich Bayerischen Telegraphen-Werkstatt bewarb, aber nicht angenommen wurde. Später zog er nach Nürnberg, engagierte sich im katholischen Kolpingwerk, erwarb den Meisterbrief und arbeitete als Lichtmonteur bei der städtischen Straßenbahn. Er heiratete die Tochter des Hausmeisters im katholischen Gesellenhospiz, eine schöne, stolze Frau. Auf dem Hochzeitsphoto blickt das Paar ernst und gefaßt in die Kamera, sie bekränzt, weißbehandschuht und mit Brautschleier, er mit einem Zylinderhut, den er auf ein hochbeiniges Tischchen abgelegt hat. Damals war der Gang zum Studio des Photographen noch eine feierliche Zeremonie. Das Portrait hat sich erhalten, es ruht auf schwarzem Karton in einem marmorierten Album. M.s Vater hat die Bildlegende sorgfältig in weißer Tusche ausgeführt.
M.s Großmutter Elisabeth überlebte ihren Mann, der schon 1916 starb. Sie hauste als Witwe fünfzehn Jahre lang in einer winzigen Wohnung hinter der Stadtmauer und entwickelte eine eigensinnige Frömmigkeit, die ihr Sohn nicht teilte, aber ertrug. Um ihn bis zum Abitur zu ernähren, mußte sie an der Garderobe des Volksbads arbeiten, um ihre winzige Rente aufzubessern. Sie war eine stille Frau. 1931 ist sie verstorben.
M. hat nur zwei Großeltern zu Gesicht bekommen, von denen er einiges berichten kann. Die beiden andern lernte er nie kennen. Für ihn leben die Ahnen nur in einigen sepiafarbenen Photos fort, so wie die Geister der Toten bei den Afrikanern.
Der Freitisch
M.s Vater studierte an der Münchner Technischen Hochschule zuerst Maschinenbau, dann Elektro- und Fernmeldetechnik. Er hatte die besten Noten, aber kein Geld. Im Bürgertum fanden sich wohlhabende Familien, die Mahlzeiten für mittellose Waisen anboten. Der angehende Diplomingenieur verdingte sich aber auch, um ein paar Rentenmark zu verdienen, als Komparse beim Stummfilm. Er besaß sogar einen Detektor-Empfänger, den er selbst gebaut hatte. Obwohl der Apparat krächzte und rauschte, bewunderte er das neue Medium. Er bewarb sich als Ansager bei der Münchner »Deutschen Stunde«, einem der ersten regelmäßigen Radioprogramme, was ihm viele Briefe von Hörerinnen einbrachte; er hatte Erfolg bei den Damen, denen seine Stimme gefiel. Trotz seiner Armut war und blieb er großzügig. Auf die Großtuerei und die verschwenderischen Neigungen seiner Kommilitonen reagierte er mit Sarkasmus.
Nichts Besonderes aus den ersten dreißig Monaten
M.s früheste Erinnerungen geben nichts her. Er ist damals zu klein gewesen, um etwas Bemerkenswertes erlebt zu haben. Am Seitengitter seines himmelblau lakkierten Bettchens hat er sich in die Höhe ziehen müssen, um zu sehen, was sich vor dem Fenster des Zimmers abspielte. Dort erschien in der Morgensonne pünktlich eine lange Karawane von großen, gelben Lastwagen, die aus einem Pakethof kam und elektrisch summend auf der Straße vorbeizog. Jedes dieser kastenförmigen Automobile streckte beim Abbiegen einen ellenlangen roten Winker aus, der sich sonderbar langsam auf und ab bewegte, bevor er sich wieder zusammenfaltete.
Das menschliche Gedächtnis ist ein rätselhaftes Organ. Kein Hirnforscher vermag zu erklären, warum M. zu der Frage nach seinen frühesten Erlebnissen nichts Spektakuläreres einfällt als dieses Bild.
Unter Brüdern
M. war der älteste von vieren. Darüber lassen sich umfangreiche Romane schreiben. Manche Erzähler tun das, und oft behandeln sie dieses Thema, als ginge es um einen Krieg. Wer wird benachteiligt, wer wird vorgezogen? Niemand hat es leicht mit der wirren Dynamik, die unter Geschwistern herrscht. M.s Eltern gaben jedem ihrer Kinder zwei Vornamen, wobei sie sich an die Schutzpatrone ihrer Vorfahren hielten. Doch dazu wurde jeder mit einem kindlichen Ruf- oder Spitznamen bedacht, gegen den kein Protest half und der an ihm hängenblieb bis ans Lebensende, ja sogar darüber hinaus.
Das fängt schon damit an, daß der Erstgeborene sich gewöhnlich aufspielt, als hätte er das Sagen. An ein besonders infames Beispiel erinnert sich M. ungern. Er brachte seinen kleinen Bruder Christian, der im Gewirr der Gassen in der Altstadt leicht die Orientierung verlor, dazu, ihm bis zu einem Laden zu folgen, der sich »Stempel-Pensel« nannte und versprach: »Bei uns können Sie alles drucken!« M. verlangte, daß der Kleine das Geschäft betrat und den verblüfften Besitzer aufforderte, sein Versprechen zu halten und den Namen des Bruders zu drucken. »Wenn du das nicht machst, laufe ich dir davon, und du findest nicht wieder nach Hause«, drohte der ihm und sah durch das Schaufenster zu, wie der verzweifelte Bruder seinen Wunsch vorbrachte, freundlich, aber bestimmt abgewiesen wurde und weinend zu seinem Peiniger zurückkehrte, der ihn wieder an die Hand nahm. Daheim versäumte »der Jani« – so lautete sein Spitzname – nicht, sich bei der Mutter über M. und über dieses unerfreuliche Abenteuer zu beschweren.
Alle M. nachfolgenden Brüder wehrten sich nach Kräften ihrer Haut. Mußten sie die Schuhe erben, die M. zu klein wurden? Mußten sie sich mit einem Brummkreisel begnügen, der den Reiz der Neuheit längst eingebüßt hatte, und umgefärbte Pullover tragen? Legte der kleine M. seine Brüder herein, die noch kleiner waren als er? Ließ er sie im Regen stehen? Hat er sie geplagt? War er ein Tyrann? Und wen schätzte der Vater? Den Ältesten? Wer war der Liebling der Mutter? Der Jüngste?
Solche langweiligen Fragen wurden beim Essen hartnäckig beschwiegen, aber sie wurden jedesmal laut, sobald es Streit gab. M. wundert sich nicht über solche Konflikte, sondern über die rätselhaften Kräfte, die, immer, wenn es darauf ankam, den Clan zusammenhielten. Er schreibt sie nicht den Kindern, sondern den Eltern zu. In manchen Familien dauert der Zwist der Brüder an, solange sie am Leben sind. M. erklärt, bei ihnen sei es zum Glück nie so weit gekommen.
Eine erste Liebe
Im Süden der alten Reichsstadt Nürnberg wohnte man, wie es hieß, »hinter dem Bahnhof« in einer sehr bescheidenen Straße. Villen gab es dort nicht, nur enge Mietwohnungen, Hinterhöfe und Lagerhallen. Die größte Attraktion dieser Gegend war für M. ein kleines Lebensmittelgeschäft in der Nachbarschaft. Diesem Tante-Emma-Laden verdankte er seine erste Lektion in der Warenkunde. Neben einer großen Milchkanne mit einem Trichter standen offene Säcke mit Linsen und Kartoffeln. Auf dem Tresen und in den Regalen waren unbekannte, bunt verpackte Bonbons ausgestellt, die nur wenige Pfennige kosteten. Das Glanzstück des Ladens war jedoch eine große, vor dem Eingang aufgestellte Tafel, die den Kunden mit dem Bild einer großen Pralinenschachtel reizte. Unter diesem Gemälde war eine Reihe von Quadraten zu sehen, die statt einer Aufschrift nur stumme Pünktchen trugen. Was das zu bedeuten hatte, verstand M. nicht.
Glücklicherweise war die Tochter des Krämers, ein blondgelocktes gleichaltriges Mädchen, bereit, ihm den Sinn dieses mysteriösen Apparats zu erläutern. »Wenn du einen Fünfer hast, mußt du ihn in den Schlitz einwerfen. Siehst du das kleine spitzige Ding, das an der Kette hängt? Das ist eine Ahle. Mit der stichst du dann in einen dieser Punkte auf der Tafel. Es klingelt, und weiter unten kommt eine Kugel heraus, und du gewinnst etwas. Eine weiße Kugel bedeutet eine Lakritzenstange, die grüne eine Rolle Pfefferminz und so weiter. Wenn du Glück hast, triffst du die beste von den Kugeln, die einzige, die golden ist. Dann kriegst du die große Pralinenschachtel.«
Das Mädchen legte ihm den Arm auf die Schulter, sprach ihm Mut zu und drückte ihm den spitzen Griffel in die Hand. Als er zustach, läutete ein Glöckchen, und eine goldene Kugel fiel heraus.
Erst als er zu Hause mit seinem unverhofften Gewinn ankam und atemlos berichtete, wie er dazu gekommen war, erklärte ihm die Mutter, daß der schlaue Besitzer eine kleine Lotterie eingerichtet hatte. Die kleine Klara aus dem Laden war die erste Frau, in die er sich verliebte.
Singer’s Nähmaschine war die beste
Nie gefehlt hat es M. an Tanten und Onkeln. Die liebste war ihm eine Schwester des Großvaters. Als Kind mußte er zwar in den Sommerferien manchmal auf dem Bauernhof der Allgäuer Vettern so tun, als helfe er ihnen bei der Heuernte. Man gab ihm einen Rechen in die Hand, und auf dem Heimweg durfte er hoch auf dem Heuwagen thronen. Aber viel lieber brachte er ein paar Wochen in dem verwunschenen Häuschen seiner Tante Theres zu. Die lebte ganz allein am Rand der Kleinstadt K. Mit den Männern hatte sie nichts im Sinn. Eigene Kinder hatte sie nie. Ihre Vorliebe galt den Buben der Verwandten und der Nachbarn, die bei ihr immer willkommen waren. Jedem setzte sie im Sommer ein Noppenglas mit selbstgemachtem Holundersaft vor, aus dem lauter kleine Bläschen aufstiegen, weil er moussierte; im Winter dagegen wurden ihre Gäste mit einem Kakao traktiert.
Wie klein sie war! Ihr Teint war dunkel. Ihr ergrautes Haar trug sie zu einer Art Dutt gebunden. Sie versorgte die Waisenkinder der Gemeinde mit Latzhosen und Hemdchen. Gewöhnlich ließ sie sich auf einer kleinen Empore am Fenster nieder, wo es nach Mottenpulver und Nähkreide roch. In verschnörkelten Goldbuchstaben war der Name Singer auf der hölzernen Haube der Nähmaschine zu lesen.
M.s Mutter hat diese Maschine geerbt und sie noch lange gebraucht, obgleich es längst neuere Modelle gab, bei denen der Faden nicht riß und der Transmissionsriemen aus schwarzem Gummi nicht mehr abspringen konnte, weil er im Gehäuse verschwunden war, ebenso wie der brausende Lärm, den das vernickelte Schwungrad hervorrief – ein Geräusch aus dem neunzehnten Jahrhundert, das sich wie ein behagliches Echo auf die Parole vom sausenden Webstuhl der Zeit reimte.
Hinter dem Haus gab es einen Garten, der M. sehr weitläufig erschien. Dort stand in einer Grotte aus Tuffstein eine Gipsmadonna, die mit einem sternenübersäten blauen Mantel angetan war.
M. durfte die Tante Theres manchmal beim Einkaufen begleiten. In der Drogerie schwatzte sie so lange mit dem Besitzer, bis der verschiedene, schön verpackte kleine Seifen herausrückte, die nach Jasmin, Pomeranzen und Moschus dufteten. Doch wenn die Tante unterwegs eine Nachbarin traf, wollten die Geschichten, die sie einander erzählten, kein Ende nehmen. M.s Geduld war diesen Ritualen nicht gewachsen. Er wälzte sich so lange schreiend auf dem Gehsteig, bis die Damen endlich Abschied voneinander nahmen. Zur Strafe verbannte die erzürnte Tante den winzigen Neffen auf den Dachboden, wo es große alte Wäschekörbe, Koffer und Kommoden gab. Der Speicher war eine Fundgrube von Schätzen aus den fernen Friedenszeiten vor dem Ersten Weltkrieg.
Damals, anno 1869, hatte die Tante als erste von fünf Geschwistern das Licht der ersten Gaslaternen in der Kleinstadt erblickt. Nie wollte sie, daß ein Trödler mit den Hinterlassenschaften aufräumte. M. trat seine Buße mit dem größten Vergnügen an. In den verstaubten Koffern und Truhen fand er Schätze wie einen pelzigen Muff und uralte, mit Holzschnitten geschmückte Zeitschriften. Das Beste aber waren die bunten, halbkolorierten Münchner Bilderbogen, auf denen ferne Landschaften, Vulkanausbrüche und biblische Szenen zu sehen waren. Auch mit Max und Moritz machte M. Bekanntschaft, zwei genialen Figuren aus dem Werk von Wilhelm Busch, mit denen sich zu identifizieren ihm nicht schwerfiel.
Die Tante Theres hat M. seine infantilen Wutanfälle immer vergeben.
Das Ende dieser eigensinnigen, frommen, herzensguten Frau war entsetzlich.
Anfang der fünfziger Jahre ließ ihr Augenlicht nach, sie wurde dement, und ihre Brüder verstanden nicht mehr, was sie sagte. Der Arzt sprach von einer Zerebralsklerose und verlangte ihre Einweisung in ein Heim nahe der »Heilanstalt«, einem berüchtigten Ort, der in der ganzen Gegend sprichwörtlich war; denn in den Jahren der Diktatur waren dort die Helfershelfer der Euthanasie am Werk gewesen. Als sie, die immer für die anderen da war, dort mit dreiundachtzig Jahren starb, breitete sich in der Familie das verspätete Gefühl aus, daß sie an der Tante Theres manches versäumt hatte.
Nach ihrem Tod ist ihr Bruder Georg in das Häuschen mit der grünen Veranda eingezogen. Er war der Altphilologe der Familie. M. hütet bis heute einen großen Wandteller aus Phanolith-Porzellan, dessen weißes Relief auf schiefergrauem Grund zeigt, wie Hermes die Aphrodite umwirbt, indem er ihr die Sandale zurückbringt, die Zeus in Gestalt eines Adlers ihr entwendet hatte. Auf der Rückseite ist die Mettacher Türmchenmarke zu erkennen. Dort gibt es auch ein Monogramm des Künstlers. Wahrscheinlich brachte Georg dieses Andenken von einer Italienreise auf Seumes Spuren mit.
Der pensionierte alte Schulmann, ein etwas penibler, absolut integerer Mensch, hat zeit seines Lebens das Land der Griechen mit der Seele gesucht; gesehen hat er es nie. Kinderlos, mit einer strengen, dünnen Frau verheiratet, ging er einmal in der Woche abends in die Rose am Obstmarkt zum Tarocken.
Er war ja immer so besonnen! Politisch war er stumm. Von der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei nahm er keine Notiz und hielt unbeirrt an seiner gebildeten Mission fest.
Dienstwohnung
Jeder Umzug ist ein Abenteuer. M. gefiel schon der olivgrüne Möbelwagen, und er sah zu, wie die Packer Schränke, Kisten und Kommoden durch das Treppenhaus hievten. Daß dabei manches zu Bruch ging und mancher Trödel auf dem Müll landete, kümmerte ihn nicht. Neue Wörter mußten erlernt werden. Was war ein Scheckamt? Was soll das überhaupt sein, ein Scheck? Was verbarg sich unter dieser Bezeichnung? War die Dienstwohnung nur ein Deckname? Aber wofür?
Das Gebäude, in das die Familie zog, kam M. riesig vor. Es war kein Mietshaus, sondern ein weitläufiges Amtsgebäude, in dem tagsüber viele Angestellte, Kunden und Bittsteller aus und ein gingen. Erst abends, nach Büroschluß, leerten sich die Schalterhallen, die Korridore und Treppenhäuser. Nur ein Seitenflügel war bewohnt. Über die Einfahrt vom Hof führte ein privater Eingang in die verheißungsvoll helle, geräumige neue Bleibe. Der größte Raum war ein viel zu großer, leerer Flur. Die Fenster gingen auf einen Park hinaus. Alles schien frisch gestrichen: die Türen, die Küche und das Bad mit der bläulichen Gasflamme. Eine kleine Treppe führte zum »oberen Boden«, einem niedrigen Mezzanin, auf dem sich M.s Vater seine Werkstatt einrichtete, mit einer Drehbank, Dutzenden von Hobeln, Beiteln, Schraubenschlüsseln und Schachteln. Außerdem gab es eine dunkle Besenkammer, wo man sich in einem hohen Wäschekorb verstecken konnte.
M. nahm sich vor, die neue labyrinthische Umgebung, in der er die nächsten zehn Jahre zubringen würde, gründlich zu erforschen.
Ein besonderer Eingang führte, ein paar Treppen höher, zur Wohnung des Herrn Präsidenten, von dem wenig zu sehen war: sein schwarzer, pelzbesetzter Paletot, sein Chauffeur, das schwarze Auto und die schweigsame, magere Hausdame mit der hochgesteckten Frisur, die ihn zu umsorgen hatte, denn eine Frau Präsidentin gab es nicht. Es hieß, daß er für die SS-Uniform, die er an gewissen Tagen anlegte, nichts könne; die sei ihm nur ehrenhalber zuteil geworden.
Auch Herr Kraft, der Hausmeister, hatte hier seine Dienstwohnung, allerdings im Souterrain, wo es nie ganz hell wurde. Seine Frau sah aus, als ob sie es an der Lunge hätte. Er liebte die Musik. Am Wochenende, wenn ein Fenster offenstand, waren die Potpourris aus seinem Grammophon zu hören. Knirschend gab der gemarterte Schellack einen Operetten-Querschnitt, den Egerländer Marsch oder die Meistersinger-Ouvertüre zum besten. Die Sonnenseite seines Lebens glich einem ewigen Wunschkonzert. Aber wenn er mit seinem Schäferhund durch das Haus patrouillierte, griff er scharf gegen jeden Unbefugten durch. M. mußte sich davor hüten, ihm auf seinen Expeditionen zu begegnen. Bei seinen Kontrollgängen trug der Hausmeister eine Art Livree. Nur in seiner Freizeit bevorzugte er die braune Tracht der SA.
Ob man Kinder verwöhnen darf
M.s überlebender Großvater, der als gefürchteter Konrektor eines Gymnasiums in der Pfalz lebte und sich bester Gesundheit erfreute, riet davon ab, die Kinder gewähren zu lassen. M.s Eltern schlugen seine Mahnungen in den Wind. Zwar durften die Geschwister das Haus im Winter nicht verlassen, ohne rote, selbstgestrickte Rotkäppchenmützen, warme Schals und Fausthandschuhe zu tragen; sonst hätte ihnen ja eine gefährliche Halsentzündung drohen können.
Ansonsten aber ließ man sie in Ruhe.
Oft wurden ihnen Wohltaten zuteil, von denen andere nur träumen konnten. Obwohl das Haushaltsgeld nie ganz ausreichte, gab es Spielsachen in Hülle und Fülle. Eine der ersten Gaben, die sein Vater für M. bereithielt, war eine selbstgezimmerte, weißlackierte Schaukelente mit gelbem Schnabel, deren Kufen, weil sich die Nachbarn über das Wummern des Reiters beschwerten, mit einem Belag aus dunklem Gummi versehen werden mußten. Spätere Geschenke waren ein Tretroller, ein Dreirad, ein Kaufladen, ein Chemie- und ein Zauberkasten, ein Werkzeugkistchen, auf dem »Schwing’s Hämmerchen!« geschrieben stand, eine fauchende Dampfmaschine mit einem kupferroten Kessel und einem Ventil, das schrille Pfiffe ausstieß. M. verwahrt bis heute einen hölzernen Eisenbahnzug, den sein Vater selbst erbaute, mit Dampflok, Tender, grünen Personen-, gelbem Gepäck-, rotem Speise- und blauem Schlafwagen, mit beweglichen Radsätzen und genauer technischer Beschriftung in weißer Tusche – ein Wagenpark, der im Lauf der Zeit durch eine komplizierte, elektromechanische Anlage der Spurweite Null Null mit Bahnhof, Stellwerk und Transformator übertroffen wurde.
Zur Adventszeit baute der Vater jedesmal eine winterliche Krippe auf, die mit Schnee aus Gips bestreut war. Eine Platte aus Graupenglas stellte den zugefrorenen Teich dar. Die Kinder holten Moos herbei, das fürs Buschwerk sorgte. Bunte bemalte Figuren und ein kleiner Säugling komplettierten die Heilige Familie im beleuchteten Stall, und ein silberner Mond glänzte über dem nördlichen Bethlehem.