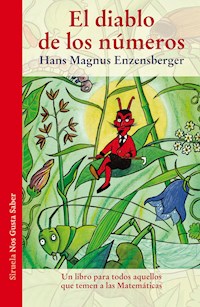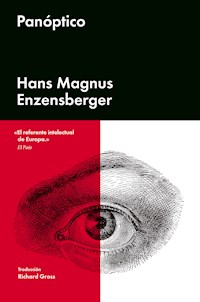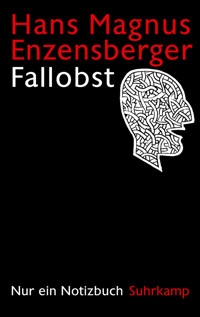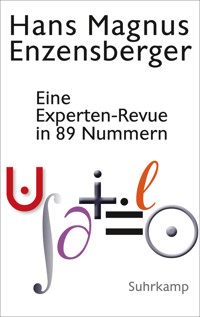14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Wie oft soll ich es euch noch sagen: Es gibt keine Kunst ohne das Vergnügen«, hat Enzensberger in einem seiner Gedichte behauptet. Das ist eine Maxime, an die er sich auch in diesem Buche hält.
Enzensbergers Themen reichen vom Wohnkampf bis zu den Weltuntergangs-Phantasien, vom Schulärger bis zu den verheerenden Zukunftsaussichten für die Dritte Welt, Krisen-Ökonomie, Überwachungsstaat, Eurozentrismus, Unregierbarkeit: das sind große, ernste, schwierige Gegenstände – aber hat man sie deswegen im aufgeregten Prediger- oder im dürren Expertenton abzuhandeln? Heine, den Enzensberger liebt, hat anders darüber gedacht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 287
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Hans Magnus Enzensberger Politische Brosamen
Suhrkamp
Inhalt
Das Ende der Konsequenz
Eurozentrismus wider Willen. Ein politisches Vexierbild
Das höchste Stadium der Unterentwicklung. Eine Hypothese über den Real Existierenden Sozialismus
Unentwegter Versuch, einem New Yorker Publikum die Geheimnisse der deutschen Demokratie zu erklären
Unregierbarkeit. Notizen aus dem Kanzleramt
Blindekuh-Ökonomie
Die Installateure der Macht
Wohnkampf. Eine Talkshow
Plädoyer für den Hauslehrer. Ein Bißchen Bildungspolitik
Armes reiches Deutschland. Vorstudien zu einem Sittenbild
Von der Unaufhaltsamkeit des Kleinbürgertums. Eine soziologische Grille
Zur Verteidigung der Normalität
Zwei Randbemerkungen zum Weltuntergang
Das Ende der Konsequenz
– Püree, sagte der kleine Mann mit dem blonden Schnurrbart und der altmodischen Hornbrille. Er machte eine ausladende Handbewegung, die nicht nur das riesige Studio und die bunten Fachwerk-Attrappen zu umfassen schien, aus denen eigens für diese Sendung eine altdeutsche Kneipe aufgebaut worden war.
– Alles Püree.
Ich war in eine jener Veranstaltungen geraten, für die unser Land berüchtigt ist und die, offenbar in Unkenntnis dessen, was dieses Wort bedeutet, als »Diskussion« bezeichnet werden. Wie die Sendung hieß, habe ich vergessen: Kultur-Klappe? Denk-Disco? Sozio-Flipper? Auch weiß ich nicht mehr, worum es an diesem Abend ging. Sicher bin ich nur, daß es eine jener Bangen Fragen war, die jedem Moderator zwischen Kiel und Konstanz auf der Seele brennen. Sind wir eine verspätete Nation? Stehen wir vor einer neuen Jugendrevolte? Brauchen wir mehr (oder weniger) Staat? Sind unsere Universitäten noch zu retten? Haben die Rebellen resigniert?
Bange Fragen lassen im allgemeinen keine bündige Antwort zu. Das ist ja gerade das Wertvolle an ihnen: sie fördern die Meinungsvielfalt. Das offenbar hartnäckige Problem zum Beispiel, wie viele deutsche Literaturen es gebe, eine oder zwei, ist immer für Überraschungen gut; gelegentlich findet sich ein Experte, der bis neun zählen kann, inklusive Liechtenstein und Siebenbürgen – dann geht ein Raunen durchs Publikum.
Irgendetwas in dieser Art wird es wohl gewesen sein: jedenfalls ein voller Erfolg. Kaum waren die Kameras abgeschaltet, folgte ein kleiner Empfang, zwanglos, wie üblich; man aß im Stehen, wie üblich; und es wurden die üblichen abscheulichen Getränke angeboten.
Der kleine Mann mit der Hornbrille hatte mich in eine Ecke gedrängt. Er kam mir vage bekannt vor, und ich fragte mich vergeblich, ob er etwas mit dem Fernsehen zu tun habe, oder mit der SPD, oder mit der Werbung, oder mit der Stadtverwaltung, oder vielleicht mit dem Theater. Am Ende war er auch nur ein meinungsbildender Kritiker. Ihn einfach danach zu fragen war ausgeschlossen; denn es gehört zu den eisernen Regeln der Podiums-Branche, daß jeder jeden kennt. Obwohl der Mann sich ausführlich zu der bewußten Bangen Frage geäußert hatte, wirkte er keineswegs erschöpft. Während er ein Stück kalter Pizza verzehrte, redete er mit großer Energie auf mich ein.
– Alles Quatsch! sagte er. Ich begreife beim besten Willen nicht, wie Sie sich auf eine solche Sache haben einlassen können – ein Mann wie Sie!
Zu meiner Verteidigung wußte ich wenig vorzubringen.
– Immerhin habe ich kein einziges Mal den Mund aufgetan.
– Das ist es ja eben, rief er. Gerade von Ihnen hätte ich erwartet, daß Sie einen eindeutigen Standpunkt beziehen. Ein klares Wort hätte doch genügt, um diesem lächerlichen Geschwafel ein Ende zu machen. Ich muß sagen, ich bin enttäuscht.
Ich erkundigte mich schüchtern, was ihn, den Herrn mit dem blonden Schnurrbart, dazu veranlaßt habe, an der Veranstaltung teilzunehmen.
– Das will ich Ihnen sagen. Ich fehle nie. Ich bin gewissermaßen Fachmann auf diesem Gebiet, und da zählt für mich nur eines: Überblick. Überblick über das geistige Leben. Ich will Ihnen auch gerne sagen, woraus dieses geistige Leben besteht, nämlich aus Püree.
Ich sah mich außerstande, ihm zu widersprechen.
Seitdem habe ich öfters an diesen harmlosen, wenn auch etwas lästigen Herrn gedacht; ja, er wurde mir, kaum daß ich ihn losgeworden war, beinahe sympathisch. Ich bin sogar so weit gegangen, mich nach ihm zu erkundigen. Es stellte sich heraus, daß er sowohl mit der SPD, als auch mit dem Fernsehen, als auch mit der Werbung zu tun hatte. Er war nämlich »Kommunikationsexperte«, was immer das sein mag; im übrigen besaß er eine Villa in der Nähe von Köln, ein pied-à-terre in Paris und eine tadellos restaurierte Windmühle in Holland. Außerdem hatte er drei Scheidungen und einen Selbstmordversuch hinter sich. Die Leute, die mir diese Auskünfte gaben, schienen ihn kurioserweise zu beneiden.
Seine Tirade ging mir nicht aus dem Kopf. Der Mann hatte ohne Zweifel recht. Das allgemeine Gebrabbel, das bei uns die Stelle einer demokratischen Öffentlichkeit vertritt, ist in der Tat schwer zu ertragen. Schranzen, Parteibuchbesitzer, Mafiosi, dummdreiste Besserwisser geben in diesem Milieu den Ton an. Es herrscht ein militantes Mittelmaß, das beliebige Ansichten über beliebige Gegenstände vervielfältigt. Durch Urteilsvermögen oder qualitative Unterscheidungen wird diese Diskussion im großen und ganzen nicht getrübt.
Bis dahin konnte ich meinem Gewährsmann, Herrn G. (denn so hieß er), mühelos folgen. Merkwürdig war nur, daß er unter diesem Zustand aufrichtig zu leiden schien.
– Manchmal weiß ich selbst nicht mehr, was ich denke, hatte er zum Schluß gesagt, und der ratlose Blick aus seinen braunen, leicht hervorquellenden Augen war der Beweis dafür, daß er nicht übertrieb.
Herr G. hatte wohl verstanden, daß das Märchen vom Schlaraffenland mit einer frommen Lüge beginnt. Der Brei, dessen man ansichtig wird, sobald man sich dieser fabelhaften Region nähert, ist nämlich gar keine Grenzbarriere. Er bedeckt das ganze Territorium, und wer dort Einlaß begehrt, der wiegt sich in einer trügerischen Hoffnung, wenn er glaubt, es genüge, sich durch den Brei hindurchzufressen, um, am andern Ende der Grenzbefestigung, wieder an die frische Luft zu gelangen. Es war also offenbar die Angst des Essers, von seiner Speise verschlungen zu werden, die Herrn G. zum Moralisten gemacht hatte.
Ich verstand seine Sehnsucht nach einer Art Schneepflug, der alles, was ihn störte, sozusagen über Nacht beiseiteräumen sollte: das amorphe Durcheinander, den Opportunismus, die schiere Anpassung an das Püree. Dennoch verblüffte mich der schneidende Ton, in dem er seine Forderungen vortrug. Er verlangte – es war nicht ganz klar, von wem, aber vermutlich wandte er sich an die Intelligenz des Landes – Prinzipienfestigkeit, Radikalität, Unbestechlichkeit, kompromißlose Klarheit, unerbittliche Konsequenz. Ja, die Konsequenz hatte es ihm besonders angetan. Er hatte eine schmerzliche Art, das Wort auszusprechen, als bezeichne es ein heiliges Bedürfnis.
Die niederschmetternde, ihm selber gänzlich unbekannte Komik des Herrn G. lag natürlich darin, daß sein bloßes Dasein jede einzelne der zahlreichen Silben, die er in einem feuchten, aufgebrachten Stakkato hervorstieß, dementierte. Der Inbegriff des Opportunisten hielt eine Predigt gegen den Opportunismus, der perfekte Anpasser wütete gegen die Anpassung, der versierte Quatschkopf verwahrte sich gegen den Quatsch.
An diesem Punkt können wir darauf verzichten, unsere Bekanntschaft mit Herrn G. zu vertiefen; denn seine persönlichen Eigenschaften spielen keine Rolle, und seine Komik ist nicht sein Privatbesitz. Es gibt in unserm Land Hunderttausende, wenn nicht Millionen seinesgleichen. Er gehört zu einem Typus, der für den Zustand dieser eigentümlichen Republik bezeichnend ist. Wer behauptet, er könne zwischen ihm und sich keinerlei Ähnlichkeit erblicken, der tut das auf eigene Gefahr. Auch Herr G. kann nämlich keine Ähnlichkeit zwischen sich und sich erblicken. Das gehört zu seinem inneren Haushalt, zur Struktur seines Bewußtseins oder, wenn man will, seiner Bewußtlosigkeit.
Von Eldridge Cleaver, einem schwarzen Revolutionär aus den USA, der seither als Hosenfabrikant Schiffbruch erlitten hat, stammt ein Satz, der in den sechziger Jahren zum geflügelten Wort wurde: »Baby«, sagte der Schwarze Panther damals, »you’re either part of the problem, or you’re part of the solution.« – Inzwischen hat sich herausgestellt, daß das nicht zutrifft. Je weniger eine »Lösung« in Sicht ist, desto offenkundiger dürfte die Tatsache geworden sein, daß es niemanden gibt, der nicht ein Teil des Problems wäre. Es ist bemerkenswert, mit welcher Vehemenz sich die Intelligenz unseres Landes gegen diese schlichte Einsicht sträubt. So wird die Verdrängung zur Hauptaufgabe der kritischen Kritik.
Jeder, der sich die Mühe macht, den Jahrmarkt des Bewußtseins eine Zeitlang zu beobachten, kann sich ohne weiteres von der Gültigkeit der folgenden Faustregeln überzeugen:
Je mürber die eigne Identität, desto dringender das Verlangen nach Eindeutigkeit. Je serviler die Abhängigkeit von der Mode, desto lauter der Ruf nach grundsätzlichen Überzeugungen. Je frenetischer die Spesenjägerei, desto heroischer das Ringen um Integrität. Je schicker das Ambiente, desto inniger der Hang zum »Subversiven«. Je größer die Bestechlichkeit, desto ärger die Angst davor, »integriert« zu werden. Je weicher der Brei, desto fester die Prinzipien, und je hilfloser das Gezappel, desto inständiger die Liebe zur Konsequenz.
Das Resultat ist eine Verfassung, die ziemlich schwer zu begreifen ist. Man könnte versucht sein, auf den altväterlichen Begriff der Doppelmoral zurückzugreifen; aber das wäre eine Verharmlosung. Überhaupt gleiten die überlieferten Kennzeichnungen, so treffend sie auf den ersten Blick anmuten mögen, an der undurchdringlichen Haut des Phänomens ab: Selbstbetrug, Hypokrisie, Maulhurerei, Pharisäertum – das alles kommt der Sache nahe und verfehlt doch ihren Kern. Solche Diagnosen aus der Überlieferung setzen nämlich beim Subjekt an und zielen auf Charaktere, wo gar keine vorauszusetzen sind. Im Aggregatzustand des Pürees ist die Heuchelei sozusagen objektiv geworden, die Lebenslüge zur baren, unzerbrechlichen Selbstverständlichkeit.
Der Umstürzler, der, ganz in Leder, um seine Planstelle kämpft, als wäre der Menschheitstraum des Kommunismus die Pensionsberechtigung; der Kritiker, der, unerbittlich wie ein zweiter Robespierre, darüber wacht, daß kein Theaterautor sich mit den Mächtigen arrangiert, während er selber, zäh wie Filz, den Traumposten eines Museumsdirektors anstrebt; der Aussteiger, der seine Alternative lückenlos auf Video dokumentiert; der hakenkreuzgeschmückte Punker, der Spesenquittungen sammelt; der Konfliktforscher, der auf den Sekretärinnen seines Instituts herumhackt – das alles sind ja keineswegs Einzelerscheinungen. Jede Kritik, die sich ans scheinbar Individuelle heften wollte, liefe Gefahr, dem anheimzufallen, was sie kritisiert. Der moralische Schizo ist die Norm.
So erklärt sich auch das leise, aber unaufhörliche Pochen, das landauf, landab bei uns zu vernehmen ist, als wären die Heinzelmännchen am Werk. Worauf dabei gepocht wird, ist völlig nebensächlich: auf linke oder rechte Grundsätze, Standpunkte, Prinzipien. Hauptsache, ein anderer, immer ein anderer ist es, den man ertappen, denunzieren, dingfest machen, überführen kann. So ruft einer dem andern zu: Ausverkauf! Renegatentum! Anpasserei! Karrierismus! Jeder ist verdächtig, nur der nicht, der im Moment das Mikrophon ergriffen und sich zum Aufpasser, zum Sheriff der Moral, zum Guru der Konsequenz aufgeschwungen hat.
Freilich, nach dem Gesetz von Angebot und Nachfrage wächst das Rettende auch. Die Sehnsucht nach dem Eindeutigen schafft sich ihre kulturellen Helden. Wer den eigenen Forderungen nicht mehr gewachsen ist, der delegiert sie an eine buntscheckige Schar von Philosophen, Therapeuten, Künstlern, Mystikern, Ideologen, Terroristen, Sektierern und Verbrechern. Ihnen schreibt man zu, was einem selber fehlt: eine Integrität, an der kein Zweifel erlaubt ist. So entsteht eine wunderliche Walhalla der Kompromißlosigkeit, in der man Sid Vicious und Mutter Teresa, Castarieda und Einstein, Samuel Beckett und Josef Stalin, Charles Manson und Erich Fromm, John Cage und Ulrike Meinhof, Chiang Ch’ing und Arno Schmidt, den Reverend Moon und den Professor Beuys bewundern kann.
Die Delegierten, die in diese Ruhmeshalle der Eindeutigkeit abgeordnet werden, hat allerdings kein Mensch gefragt, ob sie sich als Kandidaten zur Verfügung stellen und ob sie Lust haben, die Wahl anzunehmen. Zu beneiden sind sie nicht. Wehe ihnen, wenn sie sich einer Regung überführen lassen, die sie ihren Fans kommensurabel macht; dann nämlich brächen diejenigen, die mit dem Idol ihre T-Shirts schmücken, am liebsten in den Ruf aus: Steinigt ihn! Der Säulenheilige ist einer von uns! Nichts Schlimmeres kann man offenbar einem Menschen nachsagen.
»Er jagte« – dies konnte man schon vor hundertfünfzig Jahren lesen – »mit rasender Schnelligkeit sein Leben durch und dann sagte er: ›konsequent, konsequent‹ –, wenn Jemand was sprach: ›inkonsequent, inkonsequent«; es war die Kluft unrettbaren Wahnsinns.«
Diese berühmte Passage läßt sich schwer in andere Sprachen übersetzen. Die unglückliche Liebe zur Konsequenz scheint eine deutsche Obsession zu sein; wenigstens von unsern Nachbarn wird sie nicht ohne weiteres geteilt. A man of consequence kann allenfalls bedeuten, daß es sich um jemanden handelt, der über Macht oder Einfluß verfügt; un homme de conséquence ist eine wichtige Person; un uomo conseguente ist eine Wendung, die überhaupt keinen Sinn ergibt.
Wo die historischen Wurzeln dieser eigentümlichen Vorliebe liegen, weiß ich nicht. Hat sie etwas mit dem Protestantismus, mit der Reformation zu tun? Handelt es sich um den traurigen Überrest einer längst abgestorbenen philosophischen Tradition? War es nicht der begabteste Politiker der deutschen Geschichte, der stolz verkündet hat: »Deutsch sein heißt, eine Sache um ihrer selbst willen tun«? Das ferne Echo dieses Satzes ist im deutschen Einzelhandel heute noch zu vernehmen, wenn die Verkäuferin, ebenfalls mit einer gewissen Befriedigung, den Kunden wissen läßt: »Wir führen prinzipiell keine Massenware.« Tönt einem hier, im Fachgeschäft, nicht in lächerlicher Verdünnung ein Widerhall jener autoritären Entschlossenheit entgegen, die der Belesene aus den Schriften Carl Schmitts, Ernst Jüngers und Martin Heideggers kennt? Ich frage ja nur. Und ich möchte wahrhaftig nicht behaupten, daß die Deutschen Prinzipienreiterei und Unerbittlichkeits-Rhetorik für sich gepachtet hätten. Die italienischen Utopisten, die spanischen Theologen und die französischen Jakobiner haben sich, auch wenn ihnen das mot juste fehlte, auf die blutige Konsequenz sehr wohl verstanden.
Die nationalen Vorlieben, Traditionen und Talente haben ohnehin an Gewicht verloren, seitdem sich die Freunde der kompromißlosen Entschiedenheit von Korea bis Haiti und von Bissau bis Bukarest massenhaft organisiert haben – auch wenn es vielleicht kein Zufall ist, daß die historischen Vorbilder der jeweiligen Einheitsparteien unstreitig auf deutschem Mist gewachsen sind.
Der Jargon der Eindeutigkeit dröhnt von den Tribünen ganzer Kontinente und verpestet alle Kanäle der öffentlichen Rede: die Gesetze der Geschichte sind »ehern«, die Beschlüsse »unumstößlich«, die Entschlossenheit ist »fanatisch«, »eisern«, »unbeirrbar«, und so weiter und so immer fort. Menschen, die das tiefe Bedürfnis haben, konsequent zu sein, lassen sich mühelos in Vereinen organisieren. Die Konsequenz der Konsequenz heißt meistens: Schule, Gruppe, Kirche, Kaserne oder Partei. Wer das Pathos der Entschlossenheit sucht, der irrt, wenn er damit seine eigene Existenz ins Spiel zu bringen, sich selbst zu »verwirklichen« meint. Nichts ist schematischer als der Amoklauf der Unbeirrbaren. Etwas Vorschriftsmäßiges, ja Bürokratisches haftet jeder Radikalität an, die sich auf nichts weiter beruft als auf Grundsätze. Wer von Prinzipientreue spricht, der hat bereits vergessen, daß man nur Menschen verraten kann, Ideen nicht.
Das Konsequenz-Gebot verwechselt eine logische Kategorie mit einem moralischen Postulat. Weit entfernt davon, Klarheit zu schaffen, richtet es infolgedessen ein krausemauses Durcheinander in den Köpfen an. Zum ersten kann das Pathos der Entschiedenheit nicht darüber hinwegtäuschen, daß die bloße Konsequenz, wie jede logische Bestimmung, leer ist; ich kann ebensogut ein konsequenter Vegetarier sein wie ein konsequenter Faschist, Zechpreller, Atomkraftgegner, Trotzkist, Heiratsschwindler oder Anthroposoph.
Zum andern bleibt meistens undeutlich, welche Art von Deckungsgleichheit es ist, die da eingeklagt werden soll. Geht es um das Denken? Darum, daß es hübsch bei sich selber bleibt und nicht von dem abweicht, was es zuvor gedacht hat? Oder will die Forderung nach Konsequenz darauf hinaus, daß Denken und Handeln miteinander übereinstimmen müssen?
Vielleicht kann uns eine Begegnung mit Herbert Wehner als Beispiel und als Warnung dienen. W. hält keinen Vortrag, er ist kurz angebunden, er wirft dem Publikum ein paar Knochen hin. In der »anschließenden Diskussion«, die, wie gewohnt, an nichts anschließt, steht, bleich vor seiner eignen Entschlossenheit, ein Junglehrer auf. Er heißt Bernhard, zart gebaut ist er, lieb, wir kennen doch unsern Bernhard, eine von diesen olivgrünen Uniformjacken hat er an, obwohl er die Bundeswehr nicht ausstehen kann, mit den Farben des Landes, das er konsequent BRD nennt, am Ärmel, und sein langes braunes Haar ist sorgfältig gekrusselt, wie der Tabak, aus dem er seine Selbstgedrehten herstellt – wie macht er das nur, fragt man sich, diese Tausenden von kleinen Löckchen, das sieht ja zauberhaft aus, ob es wohl eine Dauerwelle ist?
Jedenfalls, Bernhard zieht einen vergilbten Zeitungsausschnitt aus der Tasche und liest ihn vor. Tatsächlich! Es geht daraus hervor, schwarz auf weiß, daß Wehner im Jahre 1926 öffentlich zum Bombenwerfen aufgefordert hat. Und heute ist er gegen den Terrorismus! Jetzt blickt sich Bernhard einen Moment lang beinahe triumphierend um. Er findet Herbert Wehner »unglaubwürdig«. Er hat den Eindruck, als hätte er soeben etwas bewiesen. Aber was eigentlich? Daß der alte Mann besser daran täte, Bomben zu werfen? Daß er nur so tut, als hätte er etwas gegen den Terrorismus, aus Gründen der Opportunität? Oder daß er eine Wetterfahne ist, einer, der nicht weiß, was er will?
Wehner scheint seine Entlarvung mühelos zu überleben. Nicht einmal wütend wird er, sondern er geht einfach zur Tagesordnung über. Bernhard kann das gar nicht fassen. Er macht einen geradezu hilfsbedürftigen Eindruck, und nur zögernd setzt er sich wieder hin. Ja, lieber Bernhard, stell dir vor: Der Mann hat sich die Sache mit dem Bombenwerfen im Laufe eines halben Jahrhunderts einfach anders überlegt. Der Mann lebt nämlich, d. h. er bewegt sich, in seinem Gehirn herrscht ein ständiges Kommen und Gehen, er ist noch lange nicht tot. Ist es das, was Bernhard so unverzeihlich findet? Ist er wirklich ein Liebhaber der Zwangsjacke, oder redet er sich das bloß ein? Das wäre schade, schade um ihn und schade um seine Schüler. Aber auch er bewegt sich immerhin, wenngleich ungelenk; nur Mut, auch für ihn ist noch nicht aller Tage Abend.
Weniger lieb, weniger treuherzig, weniger verzweifelt als die unseres Freundes Bernhard klingt eine andere Stimme, die sich gern in solche Gespräche mischt, nämlich ölig, geübt und hämisch; sie könnte einem Anwalt gehören oder einem aufstrebenden Politiker. Auch er bringt Unbedingtheitsforderungen vor. Und zwar will er Taten sehen. Wem es nicht passe hier, der solle doch mal ausprobieren, wohin es führe, wenn einer mit dem Kopf durch die Wand will. Bitte sehr! Aber einfach aufstehen und bloße Reden halten gegen alles und jedes, ungestraft natürlich – wer sich damit begnüge, der mache sichs zu leicht. Wer etwa zugibt, er habe etwas mit dem Christentum zu tun, von dem werde man doch verlangen dürfen, daß er sein Leben in einem Lepra-Krankenhaus zubringe, statt seinen Mitmenschen auf die Nerven zu gehen. Und dann gar noch Brötchen fordern, jene Brötchen, die man schließlich eben jenem System verdanke, gegen das hier dauernd gestänkert werde. Nein, wer mit dem Kapitalismus nicht einverstanden ist, der soll auch nicht essen, und wer ißt, der hat kein Recht, an etwas anderes auch nur zu denken. Alles andere sei schlicht und einfach – inkonsequent.
Gegen solche bauernfängerischen, heimtückischen Tricks hat Adorno einmal, höflich wie er war, eingewandt, die Trennung von Theorie und Praxis sei ein großer zivilisatorischer Fortschritt. Das hat man ihm ziemlich übelgenommen. Die sadistische Version des Konsequenz-Gebotes hat er am eigenen Leib erfahren. Sie erinnert an den Schrei des Mobs, der dem hoch oben auf dem Dach kauernden Selbstmörder zuruft: Nun spring doch endlich runter!
Liebe Landsleute! In Anbetracht dieser historischen Voraussetzungen und Umstände möchte ich euch mit den Vorzügen, was sage ich, mit den Freuden der Inkonsequenz bekanntmachen. Ich weiß, daß ihr das nicht gerne hört, und ich rechne damit, daß ihr mir diese Wohltat übel vergelten werdet. Ein liebgewordenes Spielzeug gibt man ungern aus der Hand, auch wenn es sich dabei um ein Schlachtermesser handelt, mit dem man Gefahr läuft, sich und andern wehzutun.
Vor allem bitte ich euch zu bedenken, daß ihr euer Leben dem Wankelmut, der Unentschlossenheit, dem Kompromißlertum zu verdanken habt. Überlegt einmal, es kostet ja nichts, ob ihr noch in der Lage wärt, euch über meine bescheidenen Sätze zu ärgern, wenn Nikita Chruschtschov, dieser prinzipienlose Opportunist, nicht seinerzeit den Rückzug angetreten hätte, damals, 1962, mit seinen Raketen – ihr wißt schon, was ich meine. Nichts als Zaudern, langes Hin und Her, feige Bedenklichkeiten! Und im ganzen Kreml fand sich keiner, der im entscheidenden Moment die Sache einmal auf den Punkt gebracht und radikal durchgegriffen hätte, ohne Rücksicht auf Verluste. Stattdessen: Anpassung, Zurückweichen, Sorge um die eigene Haut, ums eigene Wohlergehen.
Dabei wissen wir doch, wie weit man es bringen kann, wenn man nur folgerichtig vorgeht:
Jede beliebige ökonomische Doktrin hat, wenn sie rücksichtslos angewandt wird, den Zusammenbruch des Wirtschaftssystems zur Folge, das mit ihrer Hilfe kuriert werden soll.
Der konsequente Kapitalismus bringt faschistische Diktaturen hervor.
Der konsequente politische Kampf mit allen Mitteln führt zum Terrorismus, ebenso wie die konsequente Verteidigung der Staatssicherheit.
Die reine Lehre der Ökologie, die nicht den Menschen vor der Umwelt, sondern die Umwelt vor dem Menschen schützen will, landet beim Pfahlbauerntum.
Der Aufbau des Kommunismus endet, wenn man ihn ohne Wenn und Aber betreibt, in dem mit Recht so genannten »sozialistischen Lager«.
Das industrielle Wachstum, kompromißlos fortgesetzt, hat die Vernichtung der Biosphäre zur Folge.
Die Konsequenz aus dem Wettrüsten ist der atomare Krieg.
Etc.
Wir befinden uns also, da hilft alles nichts, in einer neuartigen Lage, die mir ziemlich gefährlich vorkommt. Den Risiken, die sie mit sich bringt, wird man mit Mutproben schwerlich beikommen können. Vielleicht sollten wir es einmal mit folgender Maxime versuchen: Die gute Sache, jede gute Sache, wird falsch, sobald wir sie zu Ende denken. »In Gefahr und großer Not / ist die Konsequenz der Tod.« Sie ist nicht so neu, wie sie sich anhört. In den letzten Jahrzehnten haben die meisten Völker, im Lauf eines langwierigen, riesigen, bisher kaum erforschten molekularen Lernprozesses verstanden, daß ihre einzige Überlebenschance im Kuddelmuddel, im Durcheinander, im zähen, unübersichtlichen, immer nur vorläufigen Ausprobieren besteht. Nur deshalb, nicht aus irgendwelchen ideologischen Loyalitäten heraus, finden sich Amerikaner und Westdeutsche, Griechen und Japaner, Briten und Italiener, kurzum, alle, die überhaupt die Wahl haben, mit den Segnungen der (Sozial-) Demokratie ab. Sie ahnen, daß die Alternative zur halben Sache Barbarei und Selbstzerstörung hieße.
Es gibt sogar eine ganze Reihe von Politikern, die das begreifen, und zwar nicht nur im Westen. Schlechte Zeiten für charismatische Heldenväter und echte Führerfiguren. Glücklicherweise lassen sich Ganz Große Männer nirgends blicken. Die Weltpolitik gleicht zunehmend einer Reparaturwerkstatt, wo sich sorgenvolle Mechaniker, über stotternde Motoren gebeugt, am Hinterkopf kratzen und überlegen, wie sie ihre Karren wieder flott machen könnten. (Die Rechnungen fallen entsprechend hoch aus.) Alexander der Große wäre hier ebenso fehl am Platze wie Napoleon oder Stalin.
Dieses Milieu der Mittelmäßigkeit, diese Prothesen-Politik des Sichdurchwurstelns, die ja keineswegs nur in unserer unmittelbaren Umgebung an der Tagesordnung ist – oder gibt es auch nur eine einzige Gesellschaft auf der Welt, die der Zukunft anders als auf Krücken entgegenstolpert? –, hat schon manchen zu der Annahme verleitet, ein gut gezielter Fußtritt wäre genug, um die »Verhältnisse« zum Einsturz zu bringen, so daß der Errichtung einer Schönen Neuen Welt nichts mehr im Wege stünde. Die Erfahrung lehrt, daß dies leider ein Trugschluß ist. Der Zusammenbruch der großen Kolonialreiche – um nur das massivste aller Beispiele zu nennen, ein Ereignis, von dem immerhin zwei Drittel der Menschheit betroffen waren – hat keine der Hoffnungen eingelöst, die sich vor dreißig Jahren daran knüpften, und zwar unabhängig davon, welche Form von »Unabhängigkeit« sich die befreiten Völker eingehandelt haben. Politik in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts ist, wohin man blickt, nichts anderes als Bastelarbeit, Zeitgewinn, Flickwerk, Improvisation, und der größte Ehrgeiz, den sie kennt, ist das Überleben.
Und nun zu euch, liebe Kollegen, oder besser gesagt, zu uns – denn ich möchte mich nicht ausschließen –, zu uns, die wir davon leben, daß uns ab und zu etwas Neues einfällt. (Überlassen wir es lieber anderen, uns »die Intellektuellen« oder gar »die Kulturschaffenden« zu nennen.) Daß es uns schwerer als andere ankommt, das Ende der Konsequenz als Tatsache zu akzeptieren, ist leicht einzusehen. Schließlich verdanken wir einen erheblichen Teil unseres Selbstbewußtseins dem Hang, alles, was wir treiben, auf die Spitze zu treiben. Seitdem es uns, als soziale Kategorie, überhaupt gibt, also wenigstens seit dem achtzehnten Jahrhundert, haben wir mit- und gegeneinander das schöne Spiel gespielt »Ich gehe weiter als du!« Und nie waren dabei die Einsätze höher als in den ersten fünfzig Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts, der heroischen Zeit der Moderne. Wer weiter als alle andern ging, der war das Salz der Erde. Das ganze Pathos der Avantgarde, ihr Prestige und ihr Hochgefühl, hing von dieser Logik ab. Ihr wichtigster theoretischer und ästhetischer Imperativ war die Konsequenz.
Nun muß man uns eines lassen: daß dieser Prozeß der Radikalisierung ziemlich unblutig verlaufen ist. Er führte ja nicht zu Massakern, sondern im schlimmsten Fall zu einer gewissen Öde, Intoleranz und Borniertheit. Man kann also ohne Zorn auf jene heroische Periode zurückblicken; ja, es mag sich mit der Zeit sogar eine gewisse Rührung einstellen angesichts jener schwarzen Quadrate an der Wand, die man einst für den Kulminationspunkt der europäischen Malerei gehalten hat, weil man glaubte, sie hätten die berühmte eherne Logik der Geschichte auf ihrer Seite. Das waren noch Zeiten, als ganze Seiten voller kleiner e’s als der Gipfel der Kühnheit galten und als zukunftsweisende poetische Leistung! Und wenn einer einen 45 Minuten langen Vortrag Über Nichts hielt, verharrte der Saal in ehrfürchtigem Schweigen, weil »der objektive historische Stand des musikalischen Materials« eine solche Konsequenz einfach unausweichlich machte.
Nicht immer freilich ist das intellektuelle Lieblingsspiel der Dichter und Denker, der Bildner und Bauer (»Ich bin radikaler als du«) so glimpflich ausgegangen. Einigermaßen harmlos war es nur, solange es in geschlossenen Räumen ablief. Als zum Beispiel die Pioniere des Neuen Bauens die Idee aufbrachten, die architektonische Phantasie konsequent auf das Stapeln von weißen Würfeln zu reduzieren, hatte das für diejenigen, die in diesen Würfeln arbeiten und wohnen mußten, ziemlich fatale Folgen. Und was die Theorie betrifft, so möchte ich, um es kurz zu machen, mit eurer Erlaubnis eine kleine Geschichte erzählen.
Ende der fünfziger, Anfang der sechziger Jahre lehrte an einer der Hohen Schulen von Paris, ich glaube, es war die Sorbonne, ein jüngerer Dozent Gesellschaftswissenschaften und politische Ökonomie. Sein Spezialgebiet war die Volkswirtschaft der sogenannten Entwicklungsländer. In seinen Vorlesungen und Seminaren sah man deshalb viele Stipendiaten aus dem ehemaligen französischen Kolonialreich: Senegalesen und Madegassen, Algerier und Somalis, Vietnamesen und Marokkaner.
Aufgrund seiner theoretischen und empirischen Analysen war er zu dem Schluß gekommen, daß die Befreiungsbewegungen in den armen Ländern Herr des endemischen Elends nur werden könnten, indem sie die von der Fremdherrschaft deformierten Kolonialgesellschaften sozusagen umpflügten. Die Vertreibung der Imperialisten und die Übernahme der politischen Macht nütze nichts, wenn man die vorhandenen Sozialstrukturen unangetastet lasse. Man müsse sie vielmehr von Grund auf und mit radikalen Maßnahmen umwälzen. Im einzelnen schlug der Dozent drei fundamentale Eingriffe vor:
Als erstes gelte es, das Verhältnis von Stadt und Land umzugestalten. Die Urbanisierung der armen Länder sei verhängnisvoll; sie müsse mit allen Mitteln rückgängig gemacht werden. Industrielle Projekte, die nur neue Abhängigkeiten vom ausländischen Kapital schüfen, seien zurückzustellen. Der Landwirtschaft gebühre der absolute Vorrang.
Zweitens müßten sich die armen Länder vom Weltmarkt abkoppeln, auf dem sich naturwüchsig das kapitalistische Gesetz des Stärkeren durchsetze. Eine lang andauernde Isolation von der Außenwelt sei in Kauf zu nehmen. Erstes ökonomisches Ziel müsse die Selbstversorgung sein. Eine autarke Subsistenzwirtschaft habe zwar Entbehrungen zur Folge, von denen aber in erster Linie die ohnehin privilegierten Schichten betroffen seien.
Drittens sei es nötig, auch den kulturellen Einfluß des Westens zu brechen. Die einheimischen Eliten, vom Händler bis zum Beamten, vom Lehrer bis zum Arzt, seien allesamt von den Wertvorstellungen und Ideologien der Metropolen infiziert. Es handle sich um eine korrupte, parasitäre Schicht, von der eine ständige Ansteckungsgefahr ausgehe und die entschlossen sei, jede wahrhaft selbständige nationale Entwicklung zu vereiteln. Deshalb müsse ihr Einfluß ein für allemal liquidiert, ihre Macht gebrochen werden.
Worauf beruht dieses Programm? Zum einen natürlich auf konkreten Erfahrungen aus verschiedenen Ländern, vor allem Nordafrikas; der junge Wissenschaftler hat ihre gesellschaftliche und wirtschaftliche Dynamik eingehend untersucht. Aber seine Interpretation der Fakten wäre undenkbar ohne Voraussetzungen, die aus der europäischen Tradition stammen. Und zwar hat er nicht auf obskure Heilslehren und irrationale Weltanschauungen zurückgegriffen (schließlich hat das »abendländische Denken« auch den Rassenwahn, den Chauvinismus und den Judenhaß hervorgebracht), sondern auf den besten Teil unserer Überlieferung. Dem Lehrer ging es, ebenso wie den Zuhörern aus allen Kontinenten, die sich seine Thesen eifrig in ihre Kolleghefte schrieben, darum, die krasseste Ungerechtigkeit, die unmenschlichste Unterdrückung und das vermeidbare Leiden der Hungernden abzuschaffen. Sie waren entschlossen, die Maximen der französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, die in ihrem Ursprungsland nur noch Rathäuser und Drucksachen schmücken, beim Wort zu nehmen.
Unter den stillen, fleißigen Studenten in diesen Seminaren waren auch einige Kambodschaner; einer von ihnen hieß Khieu Samphan, ein anderer Jeng Sary, ein dritter Saloth Sar – besser bekannt unter seinem nom de guerre Pol Pot. Fünfzehn Jahre nach ihrem Examen, das sie allesamt mit Auszeichnung bestanden, setzten diese Leute die Anweisungen ihres Lehrers konsequent in die Tat um. Das Resultat ist jedem bekannt, der lesen kann oder einen Fernseher besitzt; nur um die Frage, ob das Experiment der Roten Khmer einer halben oder zweieinhalb Millionen Kambodschanern das Leben gekostet hat, streiten sich die Historiker noch. Was aus dem Dozenten geworden ist, und was er von seinen Schülern hält, weiß ich nicht.
Damit mich meine lieben Freunde nicht mißverstehen: Niemand behauptet, daß es ein Verbrechen wäre, eine Sache zu Ende zu denken. Wir sind allzumal neugierige Leute, die um ihr Leben gern wissen möchten, wohin diese Hypothese oder jener Einfall führt. Das ist schließlich unser Beruf. Auch ist es keine Schande, daß sich die Wege, die wir auskundschaften, früher oder später meist als Sackgassen erweisen. In einer endlichen Welt sollte man sich hierüber nicht allzusehr wundern. Manche ziehen es vor, sich lebenslänglich in ihrem cul-de-sac einzurichten. Und solange es beim Denken bleibt, ist auch dagegen wenig einzuwenden, obwohl mir ein solcher Aufenthalt ziemlich langweilig scheint. Aber wie die Fabel lehrt, halten die Liebhaber der Konsequenz sehr wenig von der Differenz zwischen Theorie und Praxis. Gerade dort, wo kein Weg mehr weiterführt, wollen sie ihre Idee in die Tat umsetzen. Das kann, wie die Fabel lehrt, mörderische Folgen haben. Wo Konsequenz nur um den Preis der Barbarei oder der Selbstverstümmelung zu haben ist, kommt sie mir als ein verabscheuungswürdiger Anachronismus vor.
Dabei liegt die Alternative ziemlich nahe. Wenn euer Denken, liebe Kollegen, diese Grenze erreicht hat, warum kehrt ihr dann nicht einfach um und probiert den nächsten unerforschten Weg aus? Das tut gar nicht so weh, wie ihr denkt. Natürlich müßt ihr mit eurer Sehnsucht nach den heroischen Zeiten fertig werden, in denen es noch so aussah, als könnte einer ein für allemal im Recht sein. Natürlich dürft ihr keine Angst haben vor dieser oder jener Partei, die ihr Biwak in der Sackgasse aufgeschlagen hat, und die begreiflicherweise aufheult, wenn es so aussieht, als könnten ihre geheiligten Prinzipien in die Binsen gehen. Natürlich ist es auch nicht immer angenehm, von der eigenen Unfehlbarkeit Abschied zu nehmen. Doch der geordnete Rückzug aus einer unhaltbaren Position ist das non plus ultra der Kriegskunst; alle guten Strategen haben das gewußt, und alle Kommißstiefel haben es vergessen.
Wenn ihr das Opportunismus nennen wollt oder Anpassung – gebenedeit sei die Anpassung! Ich hielte es, im Zweifelsfall, lieber mit Paul Feyerabend, der behauptet: »Nicht die Ausrottung des Opportunismus macht uns zu guten Menschen – sie macht uns höchstens dumm –, sondern die Ausrottung der Tendenz, unsere selbstischen Träume von einem guten oder ›rationalen‹ oder ›verantwortlichen‹ Leben sofort zu objektivieren und anderen Menschen in der Gestalt objektiver Werte aufzuzwingen.«
Aber, aber, wer wird denn da gleich so verbiesterte Gesichter machen, nur weil Paul Feyerabend sagt, was er denkt! Es besteht kein Grund, darüber gekränkt zu sein. Und ich für meinen Teil lade euch ein, die Vorzüge der Inkonsequenz zu bedenken: das Risiko, das sie gewährt, die Freiheit, sich ungehindert zu bewegen, das Vergnügen an der Phantasie. Nur keine Angst, und vor allem: keine Angst vor der Angst! Sogar zu einem bißchen Sarkasmus könnte es wieder reichen, wenn man sich weigert, jederzeit auf Verlangen grundsätzlich zu werden, zu einer gewissen Heiterkeit im Angesicht der allgemeinen Depression. Hie und da eine Prise Lichtenberg, ein Quentchen Diderot, ein Hauch Heine – und schon röche es nicht mehr so muffig im intellektuellen Psychodrom. Denn »wer ist dieser stille Gentleman, der den Staat nicht grüßen und weder Nebukadnezar noch dem Proletariat dienen will und eher glaubt, daß jeder schon genügend zu tun hat, sein eigenes Kanu durch den Strom des Lebens zu paddeln?« Dreimal dürft ihr raten. Richtig! »Es ist Mr. Dooley, der weiseste Wicht, den unser Land je kannte.«
Unter den verbotenen Hintergedanken, die da, nach Aufhebung der Selbstzensur, zum Vorschein kämen, könnte sich, wer weiß, manches Brauchbare, manches Überraschende finden; und wie angenehm wäre es doch, wenn der ganze Apparat der mühsamen Verdrängung, der politischen Bigotterie und der selbstverliebten Prinzipienreiterei auf dem Sperrmüll verschwände!
Und das Püree? Richtig, fast hätten wir es aus den Augen verloren! Aber es ist immer noch da, eine epochale Tatsaehe, allgegenwärtig wie Hamburger und Kreditkarten, ein weltgeschichtliches Kontinuum. Das Püree bleibt. Es hat objektive Gründe. Deshalb ist ihm mit Sarkasmus nicht beizukommen, geschweige denn mit Konsequenz und moralischen Grundsätzen. Man kann den Brei nicht bis aufs Messer bekämpfen – dazu ist er zu nachgiebig; man kann ihn nicht widerlegen – dazu ist er zu zäh; man kann ihn nicht beseitigen – dazu ist er zu voluminös. Aber am Brei stirbt man nicht. Nur wer sich ihm, wie der arme Herr G., in die Arme wirft, kommt darin um.
Also was sagt die Stimme der Vernunft? Stoisch ertragen und beharrlich ignorieren, sagt sie: den Bericht aus Bonn, zum fünfhundertsten Mal, das Symposion, live übertragen aus dem Verbrauchermarkt, den Kultur-Roller, die Denk-Theke; den Geheimtip runterschlucken; die Förderungsmittel ignorieren, die Lebenshilfe, den Psychoquark, das Sozialgesuddel; den moraltriefenden, staatserhaltenden, revolutionären, kommunikationstheoretisch abgesicherten Verwertungsbrei stillschweigend, gleichmütig, geduldig über sich ergehen lassen.
Leichter gesagt als getan. Ich weiß, das Püree gehört zu den Unkosten der demokratischen, der einzigen Zivilisation, die wir haben, wie die riesigen Dreckhaufen, die sich vor unseren Städten auftürmen; es stinkt zum Himmel, aber gewalttätig ist es nicht. Ich weiß, bei uns soll jeder dürfen, auch der niederträchtige Besserwisser, auch der gemeine Pharisäer, auch der moralische Kretin, und kein Verfassungsgericht kann und will ihm das Maul verbieten. Im Gegenteil, es ist ein Grundrecht, im Püree zu waten. Aufgeschlossen, vorurteilslos, tolerant, so wie ichs gerne wäre, möchte ich am liebsten in den Ruf ausbrechen: Weiter so! Jedem das Seine! Aber ich bringe es nicht fertig. Ich hasse diese machtgeschützte Klebrigkeit. Das ist nicht logisch. Das ist nicht konsequent.
Bei Alfred Döblin heißt es einmal: »Ich habe nie versäumt, wo ich ›ja‹ sagte, gleich hinterher ›nein‹ zu sagen.« Der Aufsatz, in dem dieser Satz zu finden ist, trägt keine gelassene, übermütige, elegante Überschrift. Er heißt »Überfließend vor Ekel«.