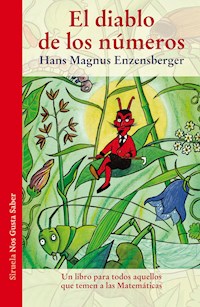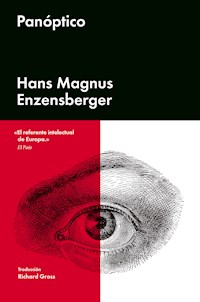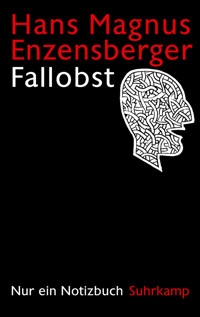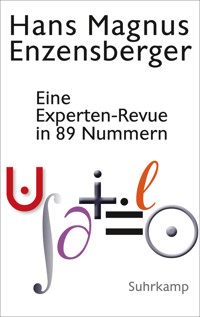11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Hans Magnus Enzensberger nähert sich in 99 pointierten, bewusst subjektiven Darstellungen den Lebensläufen und den speziellen Überlebensstrategien internationaler Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Aber auch den objektiven Gründen dafür, dass ihnen ihr Überleben im 20. Jahrhundert, dem »Zeitalter der Wölfe«, gelungen ist.
Das 20. Jahrhundert war eine Blütezeit von Schriftstellern, die Staatsterror und Säuberungen überlebt haben, mit all den moralischen und politischen Ambivalenzen, die das mit sich brachte. Hatten sie ihr Überleben ihrer Hellsicht, ihrer Intelligenz oder Schlauheit zu verdanken, ihrem Glauben an sich selbst, ihren Beziehungen oder ihrem taktischen Geschick? Waren es Glücksfälle, durch die sie dem Gefängnis, dem Lager und dem Tod entronnen sind, oder waren es Strategien, die von der Anbiederung bis zur Tarnung reichten? Wer das so klar unterscheiden könnte!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 378
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Hans Magnus Enzensberger
Überlebenskünstler
99 literarische Vignetten aus dem 20. Jahrhundert
Suhrkamp
Inhalt
Absicht, Mängelrügen und Haftungausschluß
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV
XXXV
XXXVI
XXXVII
XXXVIII
XXXIX
XL
XLI
XLII
XLIII
XLIV
XLV
XLVI
XLVII
XLVIII
XLIX
L
LI
LII
LIII
LIV
LV
LVI
LVII
LVIII
LIX
LX
LXI
LXII
LXIII
LXIV
LXV
LXVI
LXVII
LXVIII
LXIX
LXX
LXXI
LXXII
LXXIII
LXXIV
LXXV
LXXVI
LXXVII
LXXVIII
LXXIX
LXXX
LXXXI
LXXXII
LXXXIII
LXXXIV
LXXXV
LXXXVI
LXXXVII
LXXXVIII
LXXXIX
XC
XCI
XCII
XCIII
XCIV
XCV
XCVI
XCVII
XCVIII
XCIX
Dank
Kleines Verzeichnis der mehrfach mitwirkenden Künstler
Bildnachweise
Absicht, Mängelrügen und Haftungausschluß
Das 20. Jahrhundert war eine Blütezeit von Schriftstellern, die Staatsterror und Säuberungen überlebt haben, mit all den moralischen und politischen Ambivalenzen, die das mit sich brachte. Wie ist es dabei zugegangen? Waren sie zu standfest, um vor der Macht zu kapitulieren? Hatten sie ihr Überleben ihrer Hellsicht oder ihrer Intelligenz zu verdanken, ihren Beziehungen oder ihrem taktischen Geschick? Waren es Glücksfälle, die an ein Wunder grenzten, durch die sie dem Gefängnis, dem Lager und dem Tod entronnen sind, oder waren es Strategien, die von der Anbiederung bis zur Tarnung reichten?
Wer das so klar unterscheiden könnte! Nur allzuleicht fallen der Nachwelt Schlagworte wie Feigling, Trittbrettfahrer, Etappenhengst oder Opportunist ein. Anderen wird Bewunderung für ihre Unbeirrbarkeit zuteil.
Eine andere Taktik verdient es, erwähnt zu werden. Während die einen durch ihren internationalen Ruhm geschützt waren, wählten andere den Rückzug in die Unauffälligkeit und die Isolation. Vielen gelang die Emigration, doch das Exil wurde manchen zum Verhängnis. Joseph Roth sagte, wenige Tage vor seinem Tod, er sei dem Selbstmord nahe. Aber das wäre eine Sünde gewesen; deshalb zog er es vor, sich totzusaufen.
Egon Friedell war einer der ersten, die sich das Leben nahmen. In den Jahren darauf folgten ihm Kurt Tucholsky, Ernst Toller, Walter Hasenclever, Ernst Weiß, Walter Benjamin, Stefan Zweig und viele andere, deren Namen niemand mehr nennt. Manche ereilten Jahrzehnte später die Spätfolgen der Traumata, von denen sie gezeichnet waren. Klaus Mann, Jean Améry, Arthur Koestler, Primo Levi, Sándor Márai, der Perser Sadeq Hedayat und Paul Celan, das sind einige Namen derer, die nicht weiterleben wollten.
Viel länger fiele ein Register derer aus, die alles überstanden haben. Ihre Haltungen lassen sich auf keinen gemeinsamen Nenner bringen. Was hat der brave Soldat Schwejk mit einem skrupellosen Wendehals gemein? Wie unterscheidet sich der einfache Deserteur von jenem Intellektuellen, der in irgendeiner Schreibstube überwintert hat? Und was zeichnet die Schriftsteller aus, im Vergleich zu anderen Überlebenden? Kann es sein, daß der tiefe Glauben an ihre »Berufung« und an ihr Talent dazu beigetragen hat, daß sie nicht zugrunde gegangen sind? »Aber das ist es ja gerade«, konstatiert Gombrowicz in seinem Tagebuch, »daß die Schriftsteller um keinen Preis aufhören wollen, Schriftsteller zu sein; sie waren zu den heldenhaftesten Opfern bereit, um nur immer weiter zu schreiben.« Oder hatten sie ganz andere, alltägliche, banale Motive?
Zu denken geben am wenigsten die eindeutigen Fälle. Wahrscheinlich haben die meisten Autoren nie einen Schuß abgefeuert. Keiner von ihnen ist an der Front gefallen oder in einem Konzentrationslager ums Leben gebracht worden.
Das ist doch alles lange her, werden Jüngere sagen. Wirklich? Sind Anpassung, glückliche Zufälle, Kompromisse und mehrdeutige Entscheidungen von vorgestern? Kann man nichts von ihnen lernen? »Es kommen härtere Tage«, das kündigte Ingeborg Bachmann 1958 mit ihrem Gedicht »Die gestundete Zeit« an. Für den Fall, daß sie recht behält, könnte ein Training in der Kunst des Überlebens von Nutzen sein.
Frage: Warum keine Komponisten, Schauspieler, bildenden Künstler? Warum nur Schriftsteller?
Antwort: Weil ich mich mit diesem Milieu einigermaßen auskenne.
Frage: Warum gibt es unter Ihren Überlebenden so viele Juden?
Antwort: Weil sie ein Leben führten, das gefährlicher als das der anderen war, und weil sie einem Volk angehören, das sein Überleben in der Zerstreuung dem Buch verdankt. Die Selbstverstümmelung, die sich die deutsche Intelligenz durch ihre Judenfeindschaft zufügte, hat Folgen, die bis heute spürbar sind. Auch daraus erklärt sich die hohe Zahl der jüdischen Schriftsteller, von denen hier die Rede sein wird.
Und warum kein Wort über Figuren wie Hans Schwerte, Hans Robert Jauß oder Paul de Man?
Antwort: Solche Leute wußten zwar zu überleben, aber sie waren weit davon entfernt, Künstler zu sein. Deshalb kommen sie hier nicht vor.
Frage: Die eine Hälfte der Menschheit überwiegt bei Ihnen. Wo bleiben die Frauen? Sie sind in Ihrem Register nur eine Minderheit.
Antwort: Diese Differenz kann ich nicht ausgleichen. Bitte wenden Sie sich an das Patriarchat.
Frage: Und warum sind nicht alle Erdteile, alle Religionen und Hautfarben proportional vertreten?
Antwort: Weil ich mich an solchen Abzählungsroutinen nicht beteiligen möchte. Die Literatur ist keine Olympiade, und einen Medaillenspiegel gibt es nicht.
Im übrigen verlangt mein Vorhaben die Ich-Form. »Ich« ist ja lediglich die erste Person Singular, die sich ungern den Mund verbieten läßt. Wer kein Historiker ist, kann und muß kein Kompendium liefern und keine unanfechtbaren Beweise führen. Er darf sich an einen subjektiven Erzählton und an eine subjektive Auswahl seiner Beispiele halten.
Moralische Urteile stehen einem Nachgeborenen, der die Situationen und Prüfungen nicht bestehen mußte, denen sie ausgesetzt waren, ohnehin nicht zu. Er kann versuchen, fair zu sein. Aber Neutralität kann er nicht in Anspruch nehmen.
Je größer das historische Übel, desto verlockender scheint das kleinere; und je gefährlicher die Umstände, desto mehr wird, wer sie verteidigt, die mildernden Umstände ins Feld führen. Vorliebe und Ekel, Bewunderung und Abneigung – daß solche Gefühle in die Darstellung einfließen, ist unvermeidlich.
Prominenz und Erfolg sind nur als Indizien von Belang. Die Nachwelt kümmert sich nicht um Ehrungen; sie macht, was sie will. Nicht nur die Autoren, auch ihre Werke werden hoch gehandelt oder für immer vergessen, und vielleicht irgendwann wiederentdeckt. Der Nobelpreis für Literatur wird zwar erwähnt, ist aber keine Garantie, sondern bloß eine Anekdote.
Das Wort Vignette stammt aus dem Französischen. Vigne ist die Weinrebe. Daraus leitet sich die Verkleinerung ab. Sie bedeutet zunächst die Kennzeichnung der Rebsorte, später auch das Etikett auf der Weinflasche. Im Lauf der Zeit wurde das Wort auf die Randverzierungen in der Druckerei übertragen. Als Vignette wird auch eine Variante der Porträtmalerei bezeichnet, die besonders im 19. Jahrhundert beliebt war. Es war Mode, geliebte Personen auf ovalen Miniaturgemälden abzubilden, die oft um den Hals getragen wurden und als Souvenir oder Talisman dienten. Bei solchen Vignetten wird das Bild zu den Rändern hin unschärfer und verschwindet allmählich im Hintergrund.
Es gibt auch photographische Vignetten. Das waren Masken vor dem Objektiv der Kamera, um bestimmte Stellen der Aufnahme zu verkleinern, verschwommen erscheinen zu lassen oder ganz zu entfernen. Beim Belichten des Negativs im Labor sind noch weitere Manipulationen möglich.
Die Vignetten wurden gern auf Porträts und Postkarten gedruckt und ließen sich zu Gruppenbildern vereinigen. Ähnliche Bilder finden sich in Kolumbarien, besonders in Italien, wo der heidnische Totenkult auf den Friedhöfen weiterlebt.
I
Ein kleines, banales Geständnis möchte ich gleich zu Anfang ablegen. Vor Jahren habe ich für ein bescheidenes Entgelt einen Fetisch ersteigert. Es ist ein Kärtchen mit dem Absender »Hamsun, Nørholm«, datiert auf den August 1929. Darauf antwortet der Autor mit chinesischer Höflichkeit einem seiner Bewunderer aus Deutschland, der Bernhard Kellermann hieß. Das war ein Erzähler, der vor dem Ersten Weltkrieg den Tunnel geschrieben hat, einen Zukunftsroman, welcher seinerzeit viel Aufsehen erregte. Auf dem vergilbten Karton heißt es: »Genehmigen Sie meinen herzlichen und kollegialen Dank und ergebenen Gruß. Knut Hamsun.«
Wozu das alles? Ich habe dieses Autograph eingelegt in ein buchstabengetreues, durch keine der zahllosen Nachdrucke, Entschärfungen und Rechtschreibreformen verstümmeltes Exemplar von Sult, das mir von den Werken Hamsuns das allerliebste ist. Es mußte 1890 bei einem alten dänischen Verlag erscheinen, weil keiner in Norwegen diesen Roman, der zu deutsch Hunger heißt, drucken wollte. Die Publikation schlug ein wie ein Meteor, allerdings nicht in der Stadt, in der die Geschichte spielt, in Kristiania, dem heutigen Oslo, sondern in ganz Europa.
Schon die ersten paar Seiten sagen viel über den Erzähler: »Ich war stark wie ein Riese und konnte einen Wagen mit meiner Schulter aufhalten. Eine feine, seltsame Stimmung, das Gefühl der hellen Gleichgültigkeit, hatte sich meiner bemächtigt … Ich fand eine Bank für mich allein und begann gierig, von meinem Vorrat abzubeißen. Das tat mir gut; es war lange her, seit ich eine so reichliche Mahlzeit genossen hatte, und ich fühlte nach und nach die gleiche satte Ruhe in mir, wie man sie nach langem Weinen empfindet.«
Sofort hat man den ganzen Hamsun vor sich. Die Passage kehrt seinen heidnischen Stolz, seinen Starrsinn, seine Rachsucht hervor, Züge, die an die »schwierigen Skalden« der isländischen Sagas aus dem 13. Jahrhundert erinnern; zugleich aber zeigt sich hier eine höchst moderne Sensibilität mit all ihren Ticks und Obsessionen. Damals, gegen das Fin de siècle hin, sprach die Psychologie von »Neurasthenie« und »Hysterie«; heute fiele die Diagnose sicher anders, aber genauso hilflos aus.
Nun soll hier kein Romanführer geliefert werden. Es geht darum, wie Hamsun überlebte; wie es beim Aufstieg, beim Fall und bei der Wiederauferstehung dieses Weltumseglers, Landstreichers, Nobelpreisträgers und Landesverräters zugegangen ist. Dazu muß man sich auf die Geschichte des politischen Zerwürfnisses zwischen ihm und seinem Land einlassen. Auf ein paar Seiten ist das nicht auszuschöpfen.
Wer es genau wissen will, wird sich durch ein 600 Seiten dickes Buch wühlen müssen: Processen mod Hamsun von Thorkild Hansen, das natürlich nicht in Oslo, sondern in Kopenhagen erschienen ist. (Es gibt auch eine deutsche Übersetzung.)
Am letzten Tag des Krieges war in Aftenposten, der größten norwegischen Zeitung, auf der ersten Seite ein Nachruf auf Hitler zu lesen: »Wir, seine treuen Anhänger, neigen nun unser Haupt angesichts seines Todes.« Gezeichnet: Knut Hamsun.
Er wußte genau, daß er sich mit dieser Äußerung nicht nur dem Haß seiner Landsleute auslieferte. Er machte sich auch bei seinen ausländischen Bewunderern unmöglich. Das war eine Provokation, die der Selbstsabotage nahekam. Die Ratten, so muß er gedacht haben, mögen das sinkende Schiff verlassen – ich nicht! Das war der schiere Trotz. »Ich werde so angreiferisch, so zerstörerisch sein wie nur irgend möglich«, das soll er schon gesagt haben, als er noch keine dreißig war.
Dabei hat er Hitler nie gemocht. Allerdings lobte er ihn 1943 bei einem Besuch auf einem Journalistenkongreß in Wien als Kreuzfahrer, der »England in die Knie zwingen werde«. Daraufhin lud ihn Hitler zu einem Besuch auf den Obersalzberg ein. Er behauptete sogar, sein Leben gleiche in gewisser Hinsicht dem Hamsuns. Aber nach einer Dreiviertelstunde endete die Unterhaltung mit einem handfesten Krach. Hitler brach sie ab und verließ den Raum. Hamsun hatte sich über das brutale Besatzungsregime und den »Reichskommissar«, einen gewissen Terboven, beschwert und verlangte seine Abberufung. Der wolle kein Norwegen, sondern ein Protektorat. »Und dann die Hinrichtungen! Wir wollen nicht mehr!« Der Führer soll getobt haben.
Und so ging es weiter mit dem Zwiespalt dieses Menschen, der Norwegen mit seiner Liebe und die Selbstgerechtigkeit seiner Bewohner mit Haß verfolgte.
Die Konsequenzen, die der Greis nach dem Krieg auf sich nahm, waren ein paar Wochen Hausarrest, über die er sich lustig machte, zwei Jahre in einem Altersheim und eine quälende psychiatrische Untersuchung, um festzustellen, ob er zurechnungsfähig sei. Eine »starke Triebnatur« und »nachhaltig geschwächte seelische Fähigkeiten« – diese Diagnose erlaubte dem obersten Ankläger, den Strafprozeß gegen Hamsun niederzuschlagen. Im Dezember 1947 wurde er von einem Zivilgericht in Grimstad wegen des Schadens, den er seinem Land durch seine Äußerungen in der Presse zugefügt hatte, zu einer hohen Geldstrafe verurteilt. Sein Nachruf auf Hitler fiel erschwerend ins Gewicht. Daß er der »Nationalen Sammlung« beigetreten war, der norwegischen Partei, die mit Hitler sympathisierte, bestritt er. Später stellte sich heraus, daß im Prozeß ein gefälschtes Photo als Beweis vorgelegt worden war. Seine Feinde hatten auf das Revers seines Anzugs ein Sonnenkreuz montiert, das Abzeichen der Quislinge. Am Ende blieb es bei der Geldstrafe, die Hamsun ruinierte. Als er entlassen wurde, war der 88jährige Dichter verwirrt, abgemagert und so gut wie taub.
Doch mit seinem letzten Buch, den 100 Seiten Auf überwachsenen Pfaden, hat er sich an all denen gerächt, die ihm an den Karren gefahren waren. Der Verlag, den er einst mit seinen Honoraren gerettet hatte, weigerte sich, es zu veröffentlichen. Ein winziger Schweizer Verlag, Ex Libris, durchbrach die Blockade und schloß den ersten Vertrag mit dem Aussätzigen. Daraufhin mußten auch die Norweger die bittere Pille schlucken.
Wutausbrüche fehlen in Hamsuns Abrechnung. Viele Passagen lesen sich fast idyllisch. Junge Leute würden seine Haltung cool nennen. Er stellte den Psychiater, der ihn untersucht hatte, ebenso bloß wie die Justiz, den Verlag, der viel Geld an ihm verdient und ihn hintergangen hatte. So hat der kranke, hilflose Hamsun am Ende in aller Ruhe über seine Widersacher triumphiert.
Die Norweger haben ihn 2009 rehabilitiert, wahrscheinlich auf Betreiben des Königshauses; Straßen wurden nach ihm benannt, Denkmäler errichtet und seine Bücher neu aufgelegt. Der Verlag, der ihn im Stich ließ, als er auf ihn angewiesen war, bemühte sich nun um sein Werk und gab eine historisch-kritische Gesamtedition heraus. Etwas anderes, als auf Hamsun stolz zu sein, ist seinen Landsleuten nicht übriggeblieben.
II
Alle, die mit diesem jungen Mann aus Niederschlesien zu tun hatten, mußten sich auf ein Genie gefaßt machen. In der Schule blieb er sitzen, weil ihm der Drill mißfiel, der dort herrschte. Gerhart Hauptmann dachte sich einen Bund aus, in dem es weder Stehkrägen noch Krawatten gab und in dem die freie Liebe herrschte. Seine Losung hieß: Zurück zur Natur. Er dachte daran, auszuwandern. Seine einzige Zuflucht in Breslau war das Theater. Die Lehre auf einem Gutshof war ihm zu mühsam. Er brach sie ab, weil er es, wie man damals sagte, an der Lunge hatte. Aus der Kunstschule wurde er wegen schlechten Betragens und mangelnden Fleißes ausgeschlossen. Er verlobte sich heimlich mit einer reichen Kaufmannstochter, die ihn durchfütterte. Ein Studium an der Universität hielt er nicht durch. Um sich als Bildhauer zu versuchen, ging er mit ihrer Hilfe nach Rom. Er blieb erfolglos und kehrte enttäuscht nach Deutschland zurück. Von der akademischen Welt verabschiedete er sich, zog ins Riesengebirge, ließ sich scheiden und heiratete wieder.
Seine Vorlieben waren wunderlich. Die »Rassenhygiene« interessierte ihn. Seinen ersten Roman hat er später über einen Wanderprediger geschrieben, der die Nachfolge Christi antreten wollte und einem Kult des Sonnengottes huldigte. Seine Vorlieben waren wunderlich.
Erst als Dramatiker zeigte er seine Klaue. Sein Stück Vor Sonnenaufgang wurde bei der Uraufführung als skandalös empfunden, doch die Zensur konnte ihm trotz gelegentlicher Verbote nichts anhaben. Man hängte ihm das Etikett eines Naturalisten an, einen Ruf, der mit dem Biberpelz und den Webern legendäre Ausmaße erreichte. Das war der Weltruhm, ein Renommee, von dem er sich nie wieder erholt hat. Nach der Jahrhundertwende setzten die Ehrungen ein. Preise, Ehrendoktortitel, 1912 der Nobelpreis. Das Goethe-Syndrom ereilte ihn.
Es ist nämlich so, daß der deutsche Geist immer einen Vize-Goethe zu benötigen scheint, schon, damit er im Ausland über einen würdigen Repräsentanten verfügt. Nicht einmal Thomas Mann konnte diese Planstelle wirklich ausfüllen. Aus Eifersucht hat er sich im Zauberberg über Hauptmann in Gestalt des Mynheer Peeperkorn lustig gemacht. Kann es wahr sein, daß man dem Dichter 1921 das Amt des Reichskanzlers angeboten hat? Es fällt schwer, das zu glauben. Albert Ehrenstein ließ sich so über ihn vernehmen: »Das Ewig-Klassische zog ihn hinab. Aus dem Titanen ward ein Würdepopo.« Sein olympisches Haupt schien alle Niederungen zu überragen.
Doch mit den Jahren gingen seine Auflagen zurück. Das Leben, das er führte, war teuer. Er wandte sich der Neoromantik, dem Film und dem Fortsetzungsroman zu. Im Sommer zog er sich in ein Kloster auf der Insel Hiddensee zurück. Er wollte immer einen Eckermann in der Nähe haben, einen Vertrauten, der ihm als Sekretär diente. Zuerst spielte Elisabeth Jungmann diese Rolle, später übernahm sie Erhart Kästner.
Die deutschen Diktaturen hat Gerhart Hauptmann überstanden, ohne Schrammen davonzutragen. Zu seinem 80. Geburtstag wurde ihm eine 17bändige Gesamtausgabe überreicht. Die Nationalsozialisten ließen ihn in Ruhe, weil Hitler ihn für unentbehrlich hielt. Auch die DDR hatte nichts gegen ihn. Als er starb, gedachten Wilhelm Pieck und Johannes R. Becher seiner und hielten Reden bei der Trauerfeier. Sein Grabstein, der nur seinen Namen trägt, steht auf Hiddensee.
III
In der italienischen Commedia dell’arte hat jede Figur einen Charakterzug, über den man sich lustig macht. In ihrem Maskenspiel gibt es den Harlekin, den Pantalone, den Bajazzo und nicht zuletzt den Capitano, der den Macho und den Kriegshelden verkörpert.
Über diese Tradition war Gabriele D’Annunzio erhaben. Er brachte es fertig, nicht nur einen Typus darzustellen, sondern in seiner Person eine ganze Galerie von Karikaturen hervorzubringen: die Strohpuppe eines typischen Italieners, eines Dichters, eines Weiberhelden, eines Reklamefachmanns, eines Dandys, eines Revoluzzers und eines Faschisten. Das ist eine beachtliche Leistung, bei der einem das Lachen im Hals steckenbleibt. Rätselhaft, wie es diesem kleinwüchsigen, häßlichen Mannequin gelungen ist, sich zu einer europäischen Größe aufzuplustern!
Gabriele D’Annunzio war der Sohn eines Landbesitzers, der ursprünglich Francesco Rapagnetta (»kleine Rübe«) geheißen hatte. Ein reicher Onkel, der D’Annunzio hieß, adoptierte ihn. Dadurch konnte er diesen glorios klingenden Namen seinem eigenen hinzufügen, und Rapagnetta, das Rübchen, wurde gestrichen.
In den 1890er Jahren wandte sich Gabriele D’Annunzio dem Schreiben von Romanen zu. 1910 floh er wegen hoher Schulden, bedingt durch seinen aufwendigen Lebensstil, ins »freiwillige Exil« nach Frankreich, um seinen Gläubigern zu entkommen. Auch später mußte er seine Wohnungen und Villen immer wieder im Stich lassen, weil ihm wegen seiner manischen Sammelleidenschaft das Geld ausging.
In der Not erfand er Reklamen und Slogans für die großen Kaufhäuser, Parfüm- und Kekshersteller. Unter verschiedenen Pseudonymen schrieb er kleine Kolumnen über die römischen Salons. Dort lernte er auch seine Ehefrau kennen, die Herzogin Maria Hardouin di Gallese. Nach der Heirat gingen die beiden, obwohl sie ihm drei Söhne gebar, getrennte Wege, aber eine Scheidung kam nicht in Frage, weil er auf ihren Titel Wert legte.
Vom Weltkrieg war D’Annunzio begeistert. 1918 brach eine Staffel von zehn kleinen Maschinen zu einem Flug nach Wien, der Hauptstadt des Kriegsgegners Österreich auf. Drei Piloten mußten notlanden, bevor sie die Grenze erreichten, ein vierter wurde in Österreich verhaftet. Aber D’Annunzio erreichte sein Ziel. Auch hier bewies er sein Können als Reklamefachmann. Er ließ Tausende von Flugblättern mit den Farben der italienischen Fahne herunterflattern. Der Text endete mit den Worten: »Die unbekümmerte Kühnheit wirft über Sankt Stephan und dem Graben das unwiderstehliche Wort ab Viva l’Italia!«
1919 besetzte der Held mit einem Haufen von Milizionären die Hafenstadt Fiume, das heutige Rijeka, mit dem Ruf: »Fiume o morte – Italia o morte!« Dieser operettenhafte Handstreich brachte nicht nur die Regierung in Schwierigkeiten. Er nahm auch Züge des italienischen Faschismus vorweg: die Mobilisierung der Massen durch Führerkult, durch Aufmärsche, Hetzreden und Paraden.
1922 scheint der Künstler einen Umsturz geplant zu haben. Daraus wurde nichts, weil Mussolini mit seinem Marsch auf Rom schneller war. Dafür entschädigte ihn der Duce. Er veranlaßte, daß der König ihm den Titel eines Fürsten von Montenevoso verlieh. Außerdem befahl er, daß eine 49bändige Gesamtausgabe seiner Schriften auf Staatskosten gedruckt wurde.
Der Dichter zog sich schmollend auf seine Villa zurück, die ebenfalls von der Staatskasse finanziert und zur Nationalen Gedenkstätte erklärt wurde. Dieses Haus nannte er Il Vittoriale degli Italiani.
Dort ist D’Annunzio gestorben und in einem Mausoleum aus weißem Marmor bestattet worden. Er war ein Clown wider Willen und wie alle Clowns ein trauriger Mensch.
Ein Besuch in seinem Haus bei Gardone am Gardasee ist empfehlenswert. Es wurde zu einer Touristenattraktion. Als Monument der unverschämten Chuzpe und des künstlerischen Bluffs ist es unerreicht. Man kann in diesem Museum seine zahllosen handgefertigten Pantöffelchen ebenso bewundern wie die Relikte seiner Heldentaten und Eroberungen: das Flugzeug, mit dem er über Wien flog, und ein in den Berg eingelassenes Kriegsschiff.
Mit allem und bei allen ist D’Annunzio glatt durchgekommen: bei Eleonora Duse, bei Hofmannsthal, bei Mussolini, bei Gräfinnen, Huren und bei seinen Landsleuten; mit seinen Posen, seinem Kitsch und seinen Allüren. Darin bestand seine Kunst.
IV
Niemand kann alles lesen, was sie geschrieben hat: Gedichte, Novellen, Märchen, Werke über die Blütezeit der Romantik, den Dreißigjährigen Krieg, die gescheiterte Revolution von 1948, das italienische Risorgimento und sogar einen Kriminalroman. Ricarda Huch ist »schwer einzuordnen«, lamentieren ihre Kritiker. Auch mir ist zunächst nur ein kleiner Suhrkamp-Band in die Hände gefallen. Ich glaube, er war gelb und hieß Michael Bakunin und die Anarchie. Dieses Buch hat mich sofort für sie eingenommen, ebenso wie ihre Brieferzählung über einen russischen Terroristen aus dem Jahr 1905.
Auf alten Photos wirkt sie imposant, mit kalten, eulenhaften Augen und einem blühenden, sinnlichen Mund. Aber war sie nun links, oder war sie rechts? Kann man ihr antikapitalistische oder gar antimoderne Affekte nachweisen? Darüber haben sich die Nachgeborenen, diese ewigen Besserwisser, den Kopf zerbrochen. Doch sich durch den ideologischen Dschungel der Weimarer Republik zu wühlen, das interessierte sie nicht. Nicht einmal in der feministischen Bewegung wollte sie mitspielen, obschon sie sich als Frau sehr wohl durchzusetzen verstand. Als das in Deutschland noch undenkbar war, wurde sie mit 28 Jahren in Zürich als eine der ersten Frauen promoviert und beschloß, in Zukunft von der Schriftstellerei zu leben.
Im Panoptikum der Überlebenden steht sie als bravouröse Ausnahmeerscheinung da. Sie hat vielen zu schaffen gemacht, sogar den Nationalsozialisten. Die wußten nicht, was sie mit ihr anfangen sollten. Sie war ihnen zwar lästig, aber sie zu beseitigen war nicht ratsam, obwohl sie 1933 sofort gegen »die Zentralisierung, den Zwang, die brutalen Methoden, die Diffamierung Andersdenkender und das prahlerische Selbstlob« der Regierung protestierte und aus der Preußischen Akademie der Künste austrat.
Dennoch wollte sie auf keinen Fall emigrieren, sondern in Deutschland ausharren. Weil sie damals schon eine europäische Berühmtheit war und als Grande Dame der deutschen Literatur galt, ließ der NS-Staat sie nicht nur in Ruhe; er bemühte sich sogar um sie. Ohne absurde Widersprüche konnte es dabei nicht abgehen.
Als sie und ihr Schwiegersohn Franz Böhm 1937 bei einer privaten Einladung die Politik der NSDAP kritisierten, wurden sie denunziert und angeklagt. Eine Amnestie, die das Regime erließ, lehnten beide ab. Böhm, ein Professor an der Universität Freiburg, wurde entlassen; Ricarda Huch blieb verschont. Goebbels und Hitler sandten ihr sogar Glückwunschtelegramme zum 80. Geburtstag.
Der erste Band ihrer Deutschen Geschichte, der 1934 erschienen war, wurde in der Presse heftig angegriffen; der zweite bekam es mit der Zensur zu tun; und der letzte wurde nicht mehr gedruckt und erst nach ihrem Tod in Zürich veröffentlicht. In Ricarda Huchs Jenaer Wohnung trafen sich Leute aus Kreisen des Widerstandes, die später am Attentat vom 20. Juli 1944 beteiligt oder mit den Verschwörern verwandt waren. Franz Böhm entkam nur wegen einer Namensverwechslung der Verhaftung. Ohne solche Glückssträhnen hätten sie beide schwerlich überlebt.
Nach dem Krieg bemühte man sich auf beiden Seiten des geteilten Landes um die Gunst der inzwischen 83jährigen Autorin. In Jena verlieh man ihr einen Ehrendoktor, und auf dem ersten und letzten gesamtdeutschen Schriftstellerkongreß in Berlin wurde sie zur Ehrenpräsidentin gewählt.
In der sowjetischen Zone hat sie es nicht lange ausgehalten. Sie fuhr in einem ungeheizten britischen Militärzug nach Frankfurt am Main, wo Franz Böhm hessischer Kultusminister geworden war. Der Anstrengung dieser Reise waren ihre Lungen nicht gewachsen. Kurz darauf ist sie an einer Pneumonie gestorben.
Für die Liebe war diese starke Frau anfälliger als für die Politik. Mit 16 Jahren verliebte sie sich in ihren viel älteren Schwager Richard. Das führte in ihrer Geburtsstadt Braunschweig zu ihrem ersten, aber durchaus nicht letzten Skandal. Dann heiratete sie einen italienischen Zahnarzt und zog zu ihm nach Triest, nur um 1907 zu ihrem Jugendschwarm zurückzukehren und ihn endlich zu heiraten. Sie ließ sich von beiden Männern scheiden. Sie zog es vor, sich über ihre leidenschaftlichen Turbulenzen auszuschweigen.
V
Das Überleben im 20. Jahrhundert hatte meist tragische Aspekte, aber manchmal geriet es auch zur Farce. Ein Philosoph des Absurden wie Albert Camus hätte daran nicht gezweifelt. Auch ein Abkömmling des Uradels war nicht dagegen gefeit, daß er lächerlich wirkte. Alexander von Gleichen-Rußwurm fand sich eingeklemmt zwischen Grandiosität und Geldmangel wieder.
Geboren war er auf dem hübschen Renaissanceschloß Greifenstein in Unterfranken. Ob er nun Graf oder nur Freiherr war, darüber mögen sich die Kenner des Gotha streiten. Zu allem Überfluß war er auch noch ein Urenkel Friedrich Schillers und durfte ehrenhalber in der weiblichen Nachkommenslinie dessen Familiennamen tragen.
Was blieb ihm also anderes übrig, als selber zum Schriftsteller zu werden? Er war sehr fleißig. Angefangen hat er mit einer Rokoko-Komödie und mit Pfifferlings Reise- und Liebesabenteuern. Es gibt von ihm Dramen, Novellen und Lyrik. Naheliegender war Schiller. Die Geschichte seines Lebens, an der er sich schon 1913 versuchte. Noch erfolgreicher war er jedoch mit einer Geschichte der europäischen Geselligkeit, die es auf sechs Bände brachte, und als Mitarbeiter einer Sittengeschichte des Intimen: Bett – Korsett – Hemd – Hose – Bad – Abtritt. Die Geschichte und Entwicklung der intimen Gebrauchsgegenstände sowie mit einer Ästhetik der Krawatte. Außerdem hat Gleichen unermüdlich aus dem Lateinischen, Griechischen und Französischen übersetzt. Ein bibliographisches Handbuch führt 114 Titel von ihm auf. Zuletzt, als 1937 die Lichter in Europa ausgingen, konnte er noch ein esoterisch angehauchtes Werk Von der Heilsehnsucht der Jahrhunderte vorlegen.
Zuvor hatten seine Schriften viele Auflagen erlebt, doch die Tantiemen haben nie ausgereicht. In den Medien machte er nur ein einziges Mal Schlagzeilen. Als der »Mäusebaron« ist er ihnen in höhnischer Erinnerung geblieben.
Das ging so zu: Nach dem Ersten Weltkrieg hatte er ein Hotel am Bodensee erworben, weil er dachte, mit dem Tourismus ließe sich Geld verdienen. Um eine drohende Pleite abzuwenden, kam er 1925 auf eine eigentümliche Idee.
Einem Juwelier kündigte er eine Kette aus 234 Zuchtperlen an. Die Postsendung versicherte er zum Wert von 65 000 Mark. Als das Paket ankam, fand der Empfänger darin nur eine tote Maus. Gleichen-Rußwurm zeigte den Gewichtsverlust an und verlangte eine Entschädigung. Vier Jahre später wurde er wegen Versicherungsbetrugs vor Gericht gestellt. Hatte er wirklich mit der Maus ein Stück Käse eingepackt, in der Hoffnung, sie möge es verspeisen?
Der Baron wies diesen Vorwurf entschieden zurück. Sein Verteidiger machte zu seinen Gunsten geltend, daß sein Geisteszustand angegriffen war und daß sein Mandant an Halluzinationen leide. Auch seine Selbstmordpläne wurden angeführt. Verschiedene Gutachter attestierten ihm eine psychische Störung, andere glaubten an eine »Flucht in die Krankheit nach der begangenen Tat«. Das Gericht verurteilte den armen Mann zu einer Geldstrafe von 10 000 Mark.
Aber wer dachte, Gleichen-Rußwurm ließe sich von dieser Affäre beirren, der kannte ihn schlecht. Seine literarische Tätigkeit setzte er unvermindert fort. 1938 wurde er aus seinem Schlößchen vertrieben, weil das Gelände, das übrigens heute der Bundeswehr gehört, einem Truppenübungsplatz weichen mußte.
Das Ehepaar zog nach Baden-Baden, wo Gerhart Hauptmann und Otto Flake bei ihnen ein und aus gingen. Auch Thomas Mann hat seines Kollegen im Doktor Faustus gedacht; in diesem Roman taucht er mehrmals unter vollem Namen auf. Mann hat ihn ganz in der Manier von Felix Krull dargestellt und als geistig gestörten Salonlöwen gezeichnet.
Alexander von Gleichen-Rußwurm war der allerletzte Nachfahr Schillers. Obwohl er nie genug Geld in der Tasche hatte, stifteten seine Frau und er alles, was an den Klassiker erinnerte, den Sammlungen und Museen in Weimar, Marbach und Würzburg. Nach dem Krieg lebte er noch zwei Jahre in Baden-Baden. Dort ist der alte Herr nach dem Krieg verarmt und vergessen gestorben.
VI
Der Lebensweg Alexei Maximowitsch Peschkows – so hieß er wirklich – läßt sich am besten mit einer Zickzacklinie nachzeichnen, die sich gegen Ende zerfasert und erlischt.
Als Kind hatte Maxim Gorki es schwer. Der Vater, ein Tischler, schlug ihn. Er starb früh, und die Mutter folgte ihm bald. Mit zehn Jahren war der dickköpfige, gedrungene Junge eine Waise und mußte als Lumpensammler, Vogelhändler und Nachtwächter arbeiten, um sich satt zu essen. Eine Schule und eine Universität konnte er nicht besuchen. Seine Kenntnisse erwarb er als Autodidakt. Nach einem Selbstmordversuch ging er auf Wanderschaft und kam zu Fuß bis nach Tiflis. Über seine ersten Kontakte mit jungen Revolutionären legte die Polizei ein Dossier an, das seine Überwachung bezeugt. Er las und schrieb fieberhaft.
1892 gelang ihm die erste Veröffentlichung in einem Provinzblatt. Diese Erzählung signierte er mit dem Pseudonym Gorki, das heißt auf russisch »der Bittere« und erklärt sich selbst. Er zog nach Samara und wurde Redakteur. Er heiratete, doch die Ehe scheiterte nach sechs Jahren. Sein erster Erfolg kam 1894 mit Tschelkasch, einer Barfüßer-Geschichte, deren Held ein Dieb und Säufer ist.
Seitdem konnte er von der Schriftstellerei leben. Er freundete sich mit Tschechow und Bunin an und begann, Theaterstücke zu schreiben, die nicht totzukriegen sind und nach wie vor durch die Spielpläne geistern. Sie handeln von Kleinbürgern, Sommergästen und Barbaren. Auch Verfilmungen blieben nicht aus. Die Mutter und das Nachtasyl galten in Rußland als Klassiker und Musterstücke des sozialistischen Realismus.
Nach dem Petersburger »Blutsonntag« von 1905 wurde er festgenommen, kam aber nach lautstarken Protesten bald wieder frei. Er lernte Lenin kennen und ging nach Frankreich und in die Vereinigten Staaten ins Exil. Sein nächstes Ziel war Capri, wo er eine Schule für revolutionäre Propaganda gründete. Viele Russen pilgerten dorthin. Nach einer Amnestie kehrte er als berühmter Mann zurück. Er stritt sich mit Lenin, dessen Atheismus er ablehnte. Zu einem neuen Zwist kam es nach der Revolution. Gorki fürchtete die Diktatur des Proletariats und polemisierte gegen die Prawda, das bolschewistische Parteiorgan. Lenin witterte eine Verschwörung, wollte ihn loswerden und schob ihn in ein deutsches Sanatorium ab. Gorki zog nach Berlin, nach Usedom, wo er Meine Universitäten verfaßte, nach Marienbad und nach Sorrent in das Italien Mussolinis. Finanziert hat ihn offenbar die sowjetische Handelsmission in Berlin. Dort hatte sich auch die Tscheka eingenistet. Nach Lenins Tod blieb Gorki in Italien und schrieb Erinnerungen an diesen »geliebten Menschen« auf.
1927 wurde er in der Sowjetunion wie der verlorene Sohn empfangen: Lenin-Orden, Mitgliedschaft im Zentralkomitee, Feiern zu seinem 60. Geburtstag. Nicht nur ein Theater und ein Institut wurden nach ihm benannt, sondern auch die Twerskaja, eine zentrale Straße in Moskau, und seine Geburtsstadt Nischni Nowgorod. (Beide Umtaufen wurden 1990 rückgängig gemacht.)
Er bereute seine Skepsis von 1917 und pries die Umerziehung der Häftlinge. Die Zwangsarbeit hielt er für eine Errungenschaft. Sicherheitshalber überwachte ihn die Geheimpolizei. Klaus Mann, der ihn 1934 besuchen konnte, wunderte sich: »Der Dichter, der die extreme Armut, das düsterste Elend gekannt und geschildert hatte, residierte in fürstlichem Luxus; die Damen seiner Familie empfingen uns in Pariser Toiletten; das Mahl an seinem Tisch war von asiatischer Üppigkeit … Dann gab es sehr viel Wodka und Kaviar.«
Ein Jahr vor seinem Tod stürzte das größte Zivilflugzeug der Sowjetunion ab. Darin kann man ein fatales Omen sehen, denn die Maschine trug seinen Namen. Es ist schwer zu sagen, wie Gorki gestorben ist. Seine Gesundheit war angegriffen. Zwei Jahre nach seinem Tod wurde der ehemalige NKWD-Chef und Henker Jagoda in einem Schauprozeß beschuldigt, er habe Gorkis Ableben durch einen medizinischen Kunstfehler verursacht. Auch der Sekretär des Schriftstellers und zwei seiner Ärzte wurden mit dieser Begründung verurteilt und erschossen. Wahrscheinlich waren all diese Anklagen, so wie es in Moskau üblich war, schlicht und einfach erfunden. Fest steht nur, daß Gorkis Urne bis heute an der Kreml-Mauer ruht.
VII
Damals, zwei Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, war er schon eine sagenhafte Figur. Im Sommer 1947 trat André Gide in München, einer zertrümmerten Stadt, neben Carl Zuckmayer und Erich Kästner auf die Bühne. Mit 78 Jahren wirkte er sonderbarerweise ganz und gar nicht wie ein Greis. Ein paar hundert verblüfften Deutschen in abgerissenen Kleidern sprach er Mut zu. Wir jungen Leute sollten uns nicht von der Geschichte einschüchtern lassen, sagte er; es hinge ganz von uns ab, ob Europa sich von den Verwüstungen erhole, die es sich selbst zugefügt hatte. »Ich glaube an den Wert der kleinen Zahl«, rief er uns zu, und: »Inmitten der Ruinen ist die Freude das Wichtigste.«
Ich weiß nicht mehr, wie ich zu der Einladung zu diesem Jugendtreffen gekommen bin. Aber Gide war der erste ausländische Schriftsteller, der die Hand zu den boches ausstreckte, und seine Haltung hat mich damals sehr beeindruckt. Ich merkte, daß er nicht nur ein berühmter Mann, sondern auch ein Verführer war, der behauptete, daß unser Leben durchaus kein bloßes Jammertal sei.
Später, als ich seine Bücher las, begriff ich, was er meinte. Als er tief im 19. Jahrhundert in der Kleinstadt Uzès unweit von Nîmes geboren wurde, gab es zwar Geld genug in der Familie, aber als sein Vater starb, war er ganz seiner strengen Mutter ausgeliefert, einer Calvinistin, die ihn mit ihrem Puritanismus plagte und ihm alle möglichen Sünden auszutreiben suchte. Er hat der Mama sogar den Tort angetan, zu heiraten.
Nicht im Traum dachte er daran, sich auf ein seriöses Studium oder gar auf einen Brotberuf einzulassen. In Paris geriet er in das Milieu der sogenannten Symbolisten, traf Leute wie Oscar Wilde und Stéphane Mallarmé, schrieb Gedichte und Erzählungen und konnte endlich seinen bisexuellen Neigungen freien Lauf lassen.
Alle seine Veröffentlichungen bis 1909 mußte er selbst finanzieren. Erst mit der Erzählung Der Immoralist und mit der Gründung der Nouvelle Revue Française, die in Paris jahrzehntelang den Ton angab, stellten sich erste Erfolge ein. Die Kirche hat ihm dadurch geschmeichelt, daß sie nicht nur Gides berühmtesten Roman, Die Verliese des Vatikans, sondern 1952 alle seine Werke auf den Index setzte.
In den beiden Weltkriegen vermied er es, zu schießen oder erschossen zu werden. Aber ansonsten hat er sich kräftig eingemischt, und das nicht nur, indem er Flüchtlingen und Verfolgten beistand, sondern durch seine aufsehenerregenden Angriffe auf die koloniale Ausbeutung Afrikas. Ein oder zwei Jahre lang hat er sogar mit dem Kommunismus geflirtet; aber sobald er die Sowjetunion selbst in Augenschein nahm, verlor er die Lust an ihren Verheißungen und galt fortan bei der Linken als Ketzer.
1939 zog er sich sogleich vor der deutschen Okkupation zurück, zuerst nach Südfrankreich und dann nach Tunis, ein Exil, in dem es ihm gefiel. Der Nobelpreis hat ihn, kurz nach seinem charmanten Auftritt in München, im Herbst 1947 eingeholt. Ein paar Jahre später ist er zu Hause im Bett gestorben.
VIII
Gegen diesen Mann hatte niemand etwas, außer der Riege, die sich jedesmal am 9. Mai auf dem Lenin-Mausoleum zur Schau stellte, um eine Siegesparade abzunehmen. Aber Millionen von Lesern verstanden und liebten Iwan Bunin. Selbst unter Schriftstellern gibt es etliche, denen man schwere Sünden kaum vorwerfen kann. So einer war Anton Tschechow, und ich glaube, auch Bunin gehörte zu diesen seltenen Vögeln.
Wie kommt es dann, daß er die Sowjetunion und die Herrschaft der Nationalsozialisten überlebt hat, ohne eingesperrt oder erschossen zu werden? Lag es daran, daß Bunin die Tribüne stets gemieden hat? Dröhnende Reden zu halten und sich an Ideologien zu klammern lag ihm nicht. Die literarischen Moden waren ihm egal, und die Avantgarden seiner Zeit, ob sie nun Futurismus, Dada oder Proletkult hießen, ließ er links liegen. Er wollte lieber an seiner Prosa arbeiten und das Publikum mit seinen Geschichten bezaubern.
Seine frühen Dorferzählungen neigten zur Idylle und boten ein lyrisch geschöntes Bild vom Landleben. Erst nach 1920, als er nach Frankreich emigrieren mußte, fand seine Prosa zu einer federnden, rücksichtslosen Kraft, und seine Geschichten wurden immer abgründiger. Fern von den Illusionen des Symbolismus, sprechen sie von Chaos, Melancholie, Begierde und Wahnsinn.
Als Kosmopolit wider Willen kannte er die Côte d’Azur und das algerische Constantine so gut wie die sommerlichen Boulevards von Moskau und die Absteigen und Gerichtssäle von Sankt Petersburg. Kleinstädte am Ende der Welt, dunkle Alleen, kaukasische Kurorte sind die Schauplätze der plötzlichen Leidenschaften und der unerklärlichen Verbrechen, von denen er erzählt. Und immer wieder findet sich der Leser an Bord eines Schiffes, eines Wolga-Dampfers, der träge dahingleitet, in einer Luxuskabine auf der Fahrt zur Krim oder mitten im Bürgerkrieg auf einer Arche Noah voller verzweifelter Flüchtlinge. Auch nach ein paar Menschenaltern wirken seine Erzählungen sonderbar frisch. Das liegt wahrscheinlich daran, daß sie vom Wichtigsten im Leben, vom Unvorhergesehenen, handeln. Stilistisch war er Dostojewski, dessen »verschrobene« Gestalten und »anspruchslose Schwätzer mit ihren verrückten Ideen« er nicht ausstehen konnte, weit überlegen, und das wußte er ganz genau.
Die Photographien, die es von ihm gibt, verraten wenig. Zu sehen ist darauf ein eleganter, magerer Herr, der ernst in die Kamera blickt. Die adlige Herkunft war ihm gleichgültig. Seinem diskreten Auftritt ist ein Anflug von Schwermut anzumerken. Ein Hang zum Pessimismus ist unverkennbar. Daß er es im Leben nicht leicht hatte, beweisen allein schon die folgenden Einträge im biographischen Lexikon:
Iwan Alexejewitsch Bunin kam 1870 in Woronesch zur Welt und starb 1953 in Paris. Sein Vater war ein verarmter Offizier aus dem Kleinadel, der zuviel trank und verschwenderisch mit dem Geld umging, obwohl er neun Kinder hatte, von denen nur vier überlebten. Die Familie wohnte an einem abgelegenen Ort. Seine Kindheit auf dem Dorf, sagt er, war »von trauriger und eigentümlicher Poesie«.
Er haßte das Gymnasium und wollte lieber auf eigene Faust zu Hause lesen, schreiben und Fremdsprachen lernen. Zu einem Studium an der Universität hat es nicht gereicht. Bunin mußte sich als Bibliothekar, Statistiker und schlechtbezahlter Redakteur durchschlagen. Zwei gescheiterte Ehen, der Verlust eines Sohnes und viele komplizierte Liebesgeschichten haben ihn nie lange vom Schreiben abgehalten. Um die Jahrhundertwende konnte er in Moskau seine ersten Erfolge feiern, verdiente Geld und konnte ausgedehnte Reisen unternehmen. Den Winter verbrachte er auf Capri, wo sich die russischen Urlauber tummelten.
Leider kam der Erste Weltkrieg dazwischen. »Ich war Zeitgenosse von Kretins, deren Namen in die Weltgeschichte eingegangen sind – jener ›großen Genies‹, die ganze Reiche zerstört und Millionen von Menschenleben vernichtet haben.«
Die russische Revolution betrachtete er als Katastrophe. Er beschreibt sie in einem Tagebuch aus den Jahren 1918-1919, das Verfluchte Tage heißt. Als Odessa 1920 im Bürgerkrieg an die Bolschewiki fiel, schiffte er sich auf der ›Dmitry‹, einem der letzten Dampfer, nach Konstantinopel ein. Sein Heimatland hat er nie wieder betreten.
Fortan hauste er als Staatenloser im französischen Exil, zuerst in Paris und dann in der Provence. Ein Besucher berichtet: »Sie hatten nur ihre Kleider, Bettwäsche und ein paar englische Lederkoffer, deren bunte Hotel-Etiketten von komfortableren Aufenthalten erzählten.«
Als ihm 1933 der Nobelpreis verliehen wurde, erschrak er: »Mein Herz preßte sich vor Wehmut zusammen.« Die sowjetische Presse erklärte die Stockholmer Entscheidung mit den Umtrieben des Imperialismus. Daß seine Werke aus den sowjetischen Buchläden verschwunden waren, versteht sich.
Als Hitler den Zweiten Weltkrieg vom Zaun brach, zog sich Bunin ganz in sein Haus hoch über Grasse im Hinterland von Cannes zurück. Das lag bis Ende 1942 in der »freien Zone«, bis dann die Wehrmacht einmarschierte. Mit der Kollaboration wollte er nichts zu tun haben. Im Gegenteil: Er beherbergte in seiner ›Villa Jeanette‹ illegale Flüchtlinge. Einen gewissen Schutz gab ihm ein Nansenpaß, den amerikanische Freunde ihm verschafft hatten.
Es war ein armes und gefährliches Leben. Aber Krieg hin oder her – Bunin schloß sich in sein Arbeitszimmer ein, weil er unbedingt seinen Erzählungszyklus Dunkle Alleen fertigstellen und ein Dutzend anderer Geschichten schreiben wollte, obschon seiner Familie immer wieder das Geld ausging.
Nach der Befreiung kehrte die Familie nach Paris zurück. Bunin lebte noch acht Jahre weiter, krank und ohne Illusionen über die Zukunft Rußlands. Es heißt aber, er sei ruhig und ohne Kampf im Bett gestorben.
Erst 1965-1967 konnte in Moskau eine erste russische Gesamtausgabe seiner Werke erscheinen, nachdem die Partei, vor der er geflohen war, ihn »rehabilitiert« hatte. Heute gilt er neben Nabokov als der bedeutendste Autor der russischen Emigration.
IX
Sie kam 1870, kurz vor dem Deutsch-Französischen Krieg, in München zur Welt. Ihr Vater Max war vielleicht ein Halbbruder des bayerischen Märchenkönigs Ludwig und der illegitime Sohn einer Kammerzofe; aber Genaues weiß man nicht. Annette Kolbs Vater war Chef der Pariser Gärtner und wirkte mit an der Gestaltung des Bois de Boulogne. Dann wurde er Leiter des Botanischen Gartens in München. Auch Annettes Mutter Sophie war nicht ohne; sie wurde als Konzertpianistin und Schülerin von Jacques Offenbach hochgeschätzt.
Annette Kolb wuchs also in München auf. Im Salon der Eltern, wo fast nur französisch gesprochen wurde, verkehrten neben Mitgliedern der Münchener Hofgesellschaft allerhand Diplomaten und Künstler. Die Schuljahre mußte sie in einem Tiroler Kloster zubringen, wo es ihr ganz und gar nicht gefiel. Sie fand es amüsanter, selber etwas zu schreiben. 1899 gab sie ihr erstes Buch, Kurze Aufsätze, zum Druck und bezahlte die Kosten aus eigener Tasche.
Im Ersten Weltkrieg trat sie derart entschieden für den Frieden mit Frankreich ein, daß es bei einer Veranstaltung zu einem Tumult kam. Sie wunderte sich, daß »zehntausend hetzerische Journalisten« sie angriffen und daß das Münchener Kriegsministerium »wegen pazifistischer Umtriebe« eine Brief- und Reisesperre über sie verhängte. Immerhin hat sich Walther Rathenau für sie eingesetzt, so daß sie 1917 in die Schweiz auswandern konnte.
In Bern freundete sie sich mit Romain Rolland und René Schickele an. Deutsche wie französische Geheimdienste hielten sie für eine Spionin. 1919 nahm sie an einem internationalen Arbeiter- und Sozialistenkongreß teil. Nach dem Krieg kehrte sie nach Deutschland zurück und begann, eine Rolle im Literaturbetrieb zu spielen. Schon 1913 war sie mit ihrem ersten Roman, Das Exemplar, erfolgreich gewesen und mit dem Fontane-Preis ausgezeichnet worden. Rilke hat sie sehr bewundert.
Ihre Romane sind verhüllte Autobiographien. Sie schildern eine Welt, die nach dem verheerenden Krieg nicht mehr existierte. Die Titelheldin von Daphnes Herbst zum Beispiel ist die Tochter eines bayerischen Standesherrn und einer Wiener Geigerin, die durch die Intrigen einer mißgünstigen Umgebung früh zugrunde geht. Die Schaukel, ein späteres Werk, in dem sie das Fluidum ihres Elternhauses einfängt, erzählt von einer Familie, die ein Leben zwischen Luxus, Lebenslust und angstvollen Ahnungen führt.
Aber ihre Leidenschaft galt nicht allein der Literatur, sondern auch der Politik, die ihr weit mehr Enttäuschungen bereitete als das Schreiben. Ihre Mission führte sie von ihrem Wohnsitz Badenweiler aus auf Reisen durch ganz Europa. In Zarastro. Westliche Tage (1921) träumte sie von einer dauerhaften Versöhnung zwischen den Erzfeinden Deutschland und Frankreich. 1929 publizierte sie ihren Versuch über Briand, den französischen Staatsmann und Träger des Friedensnobelpreises. In ihrem Beschwerdebuch von 1932 zog sie eine Bilanz ihres politischen Scheiterns.
1933 floh sie über die Schweiz und Luxemburg nach Paris. Das war ihr endgültiger Bruch mit dem nationalsozialistischen Deutschland. Erstaunlich kommt einem vor, daß sie ein Jahr später noch ein letztes Buch in Deutschland veröffentlichen konnte: Die Schaukel. Eine Jugend in München. Doch schon in der dritten Auflage sah sich der S. Fischer Verlag gezwungen, einen Satz zu streichen. »Wir sind heute eine kleine Schar von Christen, die sich ihrer Dankesschuld dem Judentum gegenüber bewußt« bleiben: für die Zensur des Propagandaministers war das eine Provokation.
Bald darauf nahm Annette Kolb die französische Staatsbürgerschaft an. Natürlich war sie auch in Sanary-sur-Mer mit dabei, einem Ort an der Riviera, wo sich mit der Familie Mann, mit Brecht, Joseph Roth, Feuchtwanger, Werfel und vielen anderen eine literarische Exilgemeinde angesiedelt hatte. Diese Idylle dauerte nicht lange. Nach der deutschen Invasion führte ihre nächste Flucht Annette Kolb über die Schweiz und Lissabon nach New York.
Als der Krieg zu Ende war, kehrte sie nach Europa zurück und lebte hochgeehrt in Paris und München. 1960 gab sie mit Memento. Erinnerungen an die Emigration Auskunft über die Jahre des Exils. Die Spaltung ihres Lebens in eine französische und eine deutsche Hälfte hat sie nie als Verhängnis, sondern immer als Vorzug empfunden. Ob da auch eine Spur von Hochmut mitgespielt hat? Wenn das so wäre, dann hätte sie das mit ihrem Charme, ihrer Selbstironie und ihrer tadellosen Haltung mehr als wettgemacht.
Annette Kolb war nie verheiratet. Sie starb 1967 mit 97 Jahren. Ihr Grab kann man auf dem kleinen Bogenhauser Friedhof in München besuchen.
X
Ihr Lebenslauf wirkt fast wie eine Karikatur dessen, was sich viele Amerikaner, Briten und Deutsche unter einer Pariserin vorstellen: Oh là là! Belle Époque! Dutzende von skandalösen Liebesgeschichten! Verlockende Dekadenz! Alles, was anderen verboten war!
Solchen Klischees aus dem Katalog des Puritanismus scheint Sidonie-Gabrielle Claudine Colette zu entsprechen, ein Dorfmädchen aus der burgundischen Provinz, das nie ein Lyzeum von innen gesehen hat, aber viele Bücher las. Eine unglückliche Kindheit hatte sie nicht zu beklagen. Ihre Mutter, genannt Sido, hatte Vorfahren auf den Antillen, war Feministin und hatte mit der Religion nichts im Sinn.
Mit sechzehn fuhr Colette nach Paris. Dort lernte sie einen doppelt so alten Herrn kennen, der sich bereits unter dem Namen Willy als Schürzenjäger und Verfasser von Trivialromanen einen Namen gemacht hatte. Er betrog sie nicht nur, er steckte sie mit der Syphilis an, beutete sie aus und stahl ihr die Urheberrechte an ihrer ersten Romanserie, deren Hauptfigur Claudine heißt. Colette brach mit ihm und nahm ihren Erfolg selbst in die Hand. Von nun an forderte sie ihre Wollust als Frau ein, bekannte sich zu ihrer Bisexualität, trat als Varietétänzerin auf, heiratete wieder, ließ sich betrügen und betrog, wurde Journalistin und schrieb ihr nächstes Buch, das Marcel Proust so beeindruckt hat, daß er vor Rührung weinte.
Die Energie dieser Frau war unbegreiflich. Affären, Scheidungen, Verfilmungen, ein Skandal nach dem anderen. Ihr berühmtestes Buch, Chéri, machte sie reich. Sie bearbeitete es fürs Theater und trat selbst in der Hauptrolle auf. Ihre dritte Ehe, mit einem jüdischen Mann, war die einzig glückliche. Doch seit 1939 litt sie an einer schweren Arthrose, die sie zeitweise ans Bett fesselte. Unter der deutschen Okkupation blieb sie unbehelligt. Es gelang ihr sogar, ihren Mann aus der Haft zu befreien und dafür zu sorgen, daß er untertauchen konnte und überlebte.
Nach dem Krieg erschien eine Gesamtausgabe ihrer Werke, sie wurde zum Grand Officier der Ehrenlegion ernannt, und als sie mit über 80 Jahren starb, gab es ein feierliches Staatsbegräbnis.