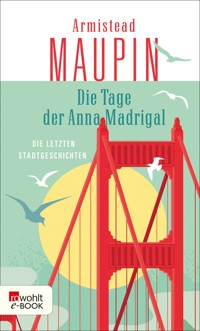8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
«Man verschlingt dieses Buch wie ein nächtliches Mahl in der Küche.» (New York Times) In seiner Mitternachts-Radioshow tröstet Gabriel Noone unzählige Menschen, aber er selbst ist nicht glücklich. Da bekommt er Post von einem 13-jährigen Fan: Pete ist unheilbar krank, verfügt jedoch über Lebenskraft und ein ungewöhnliches Schreibtalent. In langen Telefonaten freunden sich die beiden an, doch als Gabriel auf eine Begegnung drängt, entzieht sich Pete. Lange wehrt sich Gabriel gegen einen schlimmen Verdacht … Ein neuer Roman vom Autor der «Stadtgeschichten» – «Das stärkste Buch, das Armistead Maupin je geschrieben hat.»(Stern)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 435
Ähnliche
Armistead Maupin
Der nächtliche Lauscher
Roman
Über dieses Buch
«Man verschlingt dieses Buch wie ein nächtliches Mahl in der Küche.» (New York Times)
In seiner Mitternachts-Radioshow tröstet Gabriel Noone unzählige Menschen, aber er selbst ist nicht glücklich. Da bekommt er Post von einem 13-jährigen Fan: Pete ist unheilbar krank, verfügt jedoch über Lebenskraft und ein ungewöhnliches Schreibtalent. In langen Telefonaten freunden sich die beiden an, doch als Gabriel auf eine Begegnung drängt, entzieht sich Pete. Lange wehrt sich Gabriel gegen einen schlimmen Verdacht …
Ein neuer Roman vom Autor der «Stadtgeschichten» – «Das stärkste Buch, das Armistead Maupin je geschrieben hat.»(Stern)
Vita
Armistead Maupin, geboren 1944 in Washington, studierte Literatur an der University of North Carolina und arbeitete als Reporter für eine Nachrichtenagentur. Er schrieb für Andy Warhols Zeitschrift Interview, die New York Times und die Los Angeles Times. Seine Geschichten aus San Francisco, die berühmten «Tales of the City», verfasste er über fast zwei Jahrzehnte als täglichen Fortsetzungsroman für den San Francisco Chronicle. Maupin lebt in San Francisco.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2000 unter dem Titel «The Night Listener» bei HarperCollins Publishers, Inc., New York.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Juni 2023
Copyright © 2002 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«The Night Listener» Copyright © 2000 by Literary Bent LLC
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Umschlag-Konzept any.way, Hamburg
Barbara Hanke/Heidi Sorg/Cordula Schmidt
Coverabbildung undefined undefined/iStock
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
ISBN 978-3-644-00476-4
www.rowohlt.de
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Für Terry Anderson und Armistead Maupin, Sr., in beständiger Liebe
Sicher bin ich mir nur der Heiligkeit der Neigungen des Herzens und der Wahrheit der Imagination.
John Keats
Und nahezu ein jeder, von Alter, Krankheit oder Leid geschlagen, glaubt gern, es gebe einen Gott oder etwas, das ihm gleichkommt.
Arthur Hugh Clough
1Der Juwelengeschmückte Elefant
Ich weiß, wie es klingt, wenn ich ihn meinen Sohn nenne. Es wirkt ein bisschen aufgesetzt, ein bisschen zu begehrlich, als dass man es ernst nehmen könnte. Die Blicke meiner Mitmenschen sind mir nicht entgangen, dieses matte, nachsichtige Lächeln, das sich gleich wieder verflüchtigt. Es ist schon klar, wofür sie mich halten: für einen frustrierten Mann jenseits der fünfzig, der schnell nochmal eben die Vaterschaft beansprucht – bei einem fremden Kind.
Aber so ist es nicht. Ehrlich gesagt habe ich nie ein Kind gewollt. Ich bin nie der Ansicht gewesen, dass eine Laune der Natur mich meiner männlichen Bestimmung beraubt habe. Das mit Pete und mir war schlicht und ergreifend Zufall, ein Zusammentreffen verwandter Seelen, das nichts mit verborgenen oder sonstwie gearteten Vatergelüsten zu tun hatte. Das jedenfalls kann ich Ihnen versichern.
Sohn ist natürlich nicht das richtige Wort.
Aber das einzige, das den Geschehnissen gerecht werden kann.
Fabulieren ist mein Handwerk, darum möchte ich Sie vorwarnen: Ich habe Jahre damit zugebracht, mein Leben für die Literatur auszuschlachten. Wie eine Elster hebe ich das Glitzerzeug auf und stoße alles andere ab; wenn es der Geometrie der Geschichte nicht dient, kann ich es nicht gebrauchen. Das macht mich nicht unbedingt zu einem zuverlässigen Erzähler. Fragen Sie Jess Carmody, der zehn Jahre mit mir zusammengelebt hat und diese Schwäche aus nächster Nähe kennt. Er hat sie sogar benannt – das Syndrom des juwelengeschmückten Elefanten –, nach einer Geschichte über einen alten College-Freund, die ich ihm des Öfteren erzählt hatte.
Boyd, so hieß der Freund, war in den sechziger Jahren dem Friedenskorps beigetreten. Er wurde in ein indisches Dorf versetzt, verliebte sich dort in eine Einheimische und hielt schließlich um ihre Hand an. Boyds hochwohlgeborene Eltern in South Carolina waren von der Vorstellung brauner Enkel gleichwohl derart entsetzt, dass sie sich weigerten, zur Hochzeit in Neu-Delhi zu erscheinen.
Also schickte ihnen Boyd Fotos. Die Braut entpuppte sich als Aristokratin der höchsten Kaste, vornehmer als irgendein Mitglied von Boyds Familie. Das Paar war in königlicher Pracht getraut worden, auf dem Rücken zweier juwelengeschmückter Elefanten.Gefangen in ihrem bürgerlichen Snobismus, hatten Boyds Eltern es fertig gebracht, das gesellschaftliche Ereignis ihres Lebens zu verpassen.
Ich hatte Jess diese Geschichte so oft erzählt, dass er sie auswendig kannte. Als Boyd auf Geschäftsreise bei uns vorbeikam und Jess kennen lernte, meinte dieser, den idealen Anknüpfungspunkt zu haben: «Also», sagte er vergnügt, «Gabriel hat mir erzählt, dass du auf einem Elefanten geheiratet hast.»
Boyd blinzelte ihn verwirrt an.
Ich spürte, wie ich rot anlief. «Stimmt das nicht?»
«Nein», lachte Boyd verlegen, «wir haben in einer Presbyterianerkirche geheiratet.»
Jess sagte nichts und bedachte mich stattdessen mit einem lidschweren Blick, den ich schon lange zu deuten wusste: Dir kann man aber auch gar nichts glauben.
Zu meiner Verteidigung sei gesagt, dass der Kern der Geschichte wahr ist. Boyd hatte tatsächlich eine indische Frau geheiratet, die er im Friedenskorps kennen gelernt und die sich als recht wohlhabend erwiesen hatte. Und Boyds Eltern – die in der Tat besonders spießig waren – bereuten dauerhaft, dass sie die Hochzeit nicht miterlebt hatten.
Ich weiß nicht, was ich zu den Elefanten sagen soll, außer, dass ich fest an sie glaubte. Auf jeden Fall habe ich sie nie als Lüge empfunden, eher als eine Art Sinnbild für eine tiefere, kargere Wahrheit. Die meisten Geschichten haben Löcher, die geradezu nach juwelengeschmückten Elefanten verlangen, und mein Impuls ist nun mal, sie beizusteuern.
Das soll nicht passieren, wenn ich von Pete erzähle. Ich will mich bemühen, die Ereignisse so zu schildern, wie ich sie in Erinnerung habe, Schritt für Schritt, so schmucklos wie möglich. Das schulde ich meinem Sohn – uns beiden, besser gesagt – und den unverhofften Verwicklungen des täglichen Lebens.
Doch vor allem möchte ich, dass Sie mir diese Geschichte abnehmen.
Und das wird ohnehin schwer genug.
An dem Nachmittag, als Pete in mein Leben trat, war ich nicht ganz ich selbst. Oder vielleicht war ich noch nie so sehr ich selbst gewesen. Jess hatte mich zwei Wochen zuvor verlassen, und diese Erkenntnis war frisch wie eine offene Wunde. Noch nie hatte ich Kummer als etwas so Körperliches empfunden, etwas Greifbares, das wie eine feuchte Faser an den Gliedern klebte. Ich konnte nicht schreiben – jedenfalls tat ich es nicht –, unfähig zu der zermürbenden Selbstbespiegelung, die Geschichten einem abverlangen. Ich fütterte den Hund, führte ihn aus, sah die Post durch, aß, spülte das Geschirr, lag stundenlang auf der Couch und sah fern.
Alles schien meinen Schmerz zu betreffen. Die albernste Kaffeewerbung konnte mich in tiefe tschechowsche Melancholie stürzen. Die Selbstzweifel, die Panik und Wut waren einfach nicht zu umgehen. Meine Ehe war mitten in der Luft explodiert und quer über die Landschaft verstreut worden, und mir blieb nur noch, die Trümmer nach einem Hinweis auf mögliche Ursachen zu durchstöbern, auf der Suche nach einer aussagekräftigen Black Box.
Die unumstößlichen Tatsachen waren zu einer Litanei geworden, die ich Freunden am Telefon herbetete: Jess hatte sich eine Wohnung in Buena Vista Park genommen. Er brauchte Freiraum, hatte er gesagt, einen Ort, an dem er allein sein konnte. Zehn Jahre lang hatte er in Erwartung des Todes gelebt, jetzt hatte er vor, mal ans Leben zu denken. (Ihm war klar geworden, dass er das tun konnte, ohne von Verdrängung sprechen zu müssen.) Er wollte meditieren, lesen und sich endlich mal auf sich selbst konzentrieren. Er konnte nicht genau sagen, wann er zurückkäme oder ob er zurückkäme oder ob ich ihn danach überhaupt noch haben wolle. Ich solle das nicht persönlich nehmen, sagte er; es habe nichts mit mir zu tun.
Als er seine Satteltaschen mit Proteasehemmern voll gestopft hatte, hauchte er mir einen ernsten Kuss auf den Mund und bestieg sein rotes Motorrad. Vor sechs Monaten hatte er sich selbst beigebracht, damit zu fahren. Ich hatte der Maschine immer misstraut, und als ich sie nun den Hügel hinunterdröhnen hörte, begriff ich es: Sie war von Anfang an wie für diesen Augenblick bestimmt gewesen.
Die Einsamkeit, die nun eintrat, trieb mich zur Verzweiflung. Oder zumindest ins Castro-Viertel, das ich nach Pork Chops und Pornovideos durchstreifte, nur um mich unter die Lebenden zu mischen. Es war merkwürdig, nach zehn Jahren des Einigelns mit Jess die Gewohnheit wieder aufzunehmen. All diese glatzköpfigen Jungs mit ihren Goaties und Tattoos. All diese alten Knacker wie ich mit ihren gefärbten Schnauzern und feinen Jeans, maßlos erstaunt, noch immer da zu sein, noch immer auf der Jagd nach Liebe.
Und dazu die schleichende Vermarktung, die Body Shops und Sunglass Huts, die in jeder amerikanischen Mall zu finden sind. Dieses Viertel war zu einem Themenpark für Homos geworden, wo die Namen der Ikonen groß an der Wand der schicken neuen Saftbar standen. Natürlich konnte ich mir einen Blick nicht verkneifen, und tatsächlich, da stand GABRIEL NOONE – gleich links neben der Queckensaftmaschine – zwischen OSCAR WILDE und MARTINA NAVRATILOVA.
In meiner ganzen Niedergeschlagenheit gab mir das doch einen Kick; das und die Art, wie mein Name hinter mir leise die Runde machte, während ich die Straße hinunterging. Einmal hielt mich eine Fremdenführerin an, die eine Tour namens «Cruisin’ the Castro» veranstaltete. Unaufdringlich präsentierte sie mich einem Dutzend Besuchern aus Deutschland und den Niederlanden wie ein einheimisches Artefakt. Sie applaudierten höflich, mitten auf dem gedrängt vollen Bürgersteig. Und einer erkundigte sich nach Jess’ Wohlbefinden. Ich antwortete, es ginge ihm gut, der neue Cocktail wirke Wunder, sein Energieniveau wäre so hoch wie nie, und er hätte eine echte Chance zu überleben, Gott sei Dank. Das hörten sie wirklich gern.
Ich entfernte mich, bevor mich jemand als Schwindler entlarven konnte. Oder entdeckte, dass das Video unter meinem Arm den Titel Dr. Jerkoff and Mr. Hard trug.
Eines Nachmittags kam meine Buchhalterin Anna vorbei, um einige Schecks unterschreiben zu lassen. Ich hatte sie telefonisch eingeweiht, da Jess immer unsere Finanzen verwaltet hatte. Sie nahm es gelassen, aber ich bemerkte einen Anflug mütterlicher Fürsorge, ein seltsames Gefühl bei einer Einundzwanzigjährigen, doch ich ließ es dankbar über mich ergehen.
Anna war es, die die ganze Geschichte mit Pete ins Rollen brachte. Ohne sie wäre er nie in meine rapide schwindende Umlaufbahn gelangt. Wir hockten im Büro – Jess’ Büro –, sortierten Quittungen und fischten die Rechnungen aus dem Postberg. Das hätte ich auch allein geschafft, aber Anna hatte offenbar meine geröteten Augen gesehen und wollte mir Gesellschaft leisten. Ihre Augen – schwarz glänzend in einem herzförmigen Gesicht – betrachteten mich ernst, wann immer sie sich unbeobachtet fühlte. Ich weiß noch, dass ich eine gewisse Ähnlichkeit mit Olivia Hussey aus Insel der Verdammten feststellte, eine derart verstaubte Assoziation, dass ich sie gar nicht erst laut aussprach.
«Das sieht interessant aus», sagte sie und schob mir ein Päckchen herüber, einen gefütterten, ungefähr zwanzig mal dreißig Zentimeter großen Umschlag.
«Da wär ich mir mal nicht so sicher», entgegnete ich. «Das sind bloß Fahnen.»
«Fotos?»
«Nein, Druckfahnen für ein Buch. Irgendein Lektor will nette Worte für einen Klappentext.»
«Das erkennst du schon am Paket?»
«Im Dunkeln», sagte ich, «und mit verbundenen Augen.» Ich deutete auf das Verlagssignet auf dem Umschlag. «Siehst du, Argus Press.»
Ich hätte ihr auch noch erzählen können, was im Begleitbrief stand. Dass man sich darüber im Klaren sei, wie viele Menschen meine Zeit beanspruchten und welche Menge von Manuskripten sicherlich jede Woche bei mir landeten. Wie entscheidend jedoch wenige wohlwollende Worte eines Schriftstellers meines Ranges diesem verstörenden Lebensbericht, diesem gefühlvollen Coming-out-Roman, diesem phantastischen Aids-Kochbuch mit Rezepten berühmter Persönlichkeiten helfen würden, «das Publikum zu erreichen, das es so überaus verdient». Soll natürlich heißen, Schwuchteln.
Aber ich sagte nichts. Anna sollte nicht sehen, wie giftig ein gebrochenes Herz sein kann. Sie sollte auf meiner Seite sein. Also lächelte ich schief und versenkte das Päckchen im Papierkorb.
«He», sagte sie mit leicht beleidigtem Blick. «Bist du gar nicht neugierig?»
«Nein.»
«Warum denn nicht?»
«Weil ich es momentan nicht ertrage, wenn jemand anders gut ist.»
Sie dachte darüber nach. «Vielleicht ist es ja richtig schlecht.»
«Warum sollte ich es dann lesen?»
«Weiß nicht. Zur Aufheiterung?»
«So funktioniert das nicht. Ich identifiziere mich mit dem schlechten Zeug.»
«Ehrlich?» Sie sah vollkommen konsterniert aus.
«Das ist schwer zu erklären», sagte ich. «Schriftsteller sind so.»
«Aha», murmelte sie, gab es auf und wandte sich wieder ihrer Arbeit zu.
Ich war versucht, diesen Unsinn meiner augenblicklichen Krise zuzuschreiben, doch in Wahrheit bin ich mir meiner schriftstellerischen Fähigkeiten immer unsicher gewesen. Schließlich waren meine Arbeiten ursprünglich fürs Radio gedacht: kleine packende Kamingeschichten, die ich einmal pro Woche eine halbe Stunde lang im National Public Radio in einer Sendung namens Nachts mit Noone vorlas. Meine Protagonisten waren ein bunter, liebenswerter Haufen, Menschen, die, in der Ironie unserer modernen Zeit gefangen, überlebten, indem sie ihre Freunde zur Familie machten. Die Sendung entwickelte sich zum Kulthit; die Hörer scharten sich massenweise um die Radios, wie es seit den Serien der vierziger Jahre nicht mehr geschehen war. Während mich das als Geschichtenerzähler tief beglückte, kam ich mir als Schriftsteller unbefugt vor, als sei ich durch ein unverschlossenes Kellerfenster in den Tempel der Literatur eingebrochen.
Zwar verkaufen sich die Bücher, die nach diesen Sendungen entstanden, bis zum heutigen Tag; Barnes & Noble und Amazon.com machen Werbung mit meinem Namen. Doch in meinem Herzen bleibe ich ein gewiefter Hochstapler, ein Taschenspieler, der der Menge draußen vor der Oper kleine Kunststückchen zeigt. Ein richtiger Schriftsteller ist Stargast bei Kongressen und Sommeraufenthalten in Yaddo und wird von der New York Times Book Review für erwähnenswert befunden. Ein richtiger Schriftsteller würde nie mit dem Schreiben aufhören, wenn sein Leben um ihn herum zerbricht. Er würde jede Kleinigkeit verwerten. Er würde sein Herz aufs Papier bannen, damit die Leser an allem teilhaben können.
Doch der Kampfgeist verließ mich, als meine Ehe sich aufzulösen begann. Ich verlor einen lebenswichtigen Motor, von dessen Existenz ich nicht mal etwas gewusst hatte. Diese elegant gewundenen Plots, die meine Hörer so mochten, waren von einem unerschütterlichen Optimismus vorangetrieben worden, der über Nacht verschwunden war. Und danach ließ mich meine Stimme im allerwörtlichsten Sinn im Stich – nämlich mitten in einer Aufnahme.
Wie üblich nahmen wir an dem Tag im hiesigen NPR-Studio auf, das die Sendung per Satellit ins restliche Sendegebiet übertrug. (Als weltraumbegeisterter Junge hatte ich ein Sammelalbum für den Sputnik gehabt. Daher fand ich die Vorstellung, dass eines seiner Enkelkinder meine Geschichten der ganzen Nation ins Haus beamte, wunderbar.) Ich hatte zwar seit Wochen nichts mehr geschrieben, aber ich hatte noch fünf oder sechs Folgen auf Halde, die mir etwas Luft verschaffen würden, bis ich mich wieder sortiert hatte.
Doch nach zehn Minuten, als mir der Aufnahmeleiter eine problematische Passage vorspielte, machte ich eine beunruhigende Entdeckung.
«Was ist?», fragte er mich, als er meine Verwirrung bemerkte.
«Das klingt nicht nach mir», antwortete ich.
Er zuckte mit den Schultern. «Alles gleicher Pegel.»
«Nein … Ich klinge nicht nach mir.»
Diesmal sperrte er die Augen weit auf und summte die Titelmelodie zu Twilight Zone.
«Ernsthaft, Kevin.»
«Willst du eine Pause machen?»
«Nein. Lass uns einfach nochmal mit der Seite anfangen.»
Also setzte ich erneut an, doch meine Stimme klang noch verstellter und geisterhafter. Ich stolperte plötzlich über die einfachsten Wörter, als ich mich an einer heiteren häuslichen Kabbelei versuchte (das Paar, das Jess und mir am ähnlichsten war, stritt sich um die Fernbedienung). Nach einem halben Dutzend Takes hatte ich so überzogen, dass die Sprecher der nachfolgenden Sendung – drei Meister aus dem Silicon Valley – sichtlich genervt im Kontrollraum ihre Kreise zogen. Da ich keine Zeugen für meine Selbstvernichtung brauchte, entschuldigte ich mich beim Aufnahmeleiter, nahm die Kopfhörer ab und verließ das Studio für immer.
In der darauf folgenden Woche kredenzte NPR seinen Hörern ohne weitere Erklärung die Highlights von Nachts mit Noone.
Ich saß also müßig herum, während Anna arbeitete und eine Schar geflügelter Toaster über den Bildschirm von Jess’ Mac flatterte. Das war sein liebster Bildschirmschoner, es gab also keinen Anlass zu der Vermutung, dass er ihn als Abschiedsgruß eingestellt hatte. Trotzdem war die Ironie unverkennbar. Diese verspielten Accessoires waren wie ein Symbol unserer verlorenen Häuslichkeit, jener verlässlichen Nestwärme, die es einmal gegeben hatte. Ich war sehr erleichtert, als Anna sie mit einem Tastendruck verscheuchte.
«Sind die Quicken-Dateien auf dem neuesten Stand?», fragte sie.
«Nein. Ich weiß nicht, wie man da reinkommt.»
Sie blinzelte mich skeptisch an.
«Ich bin ein IBM-Mensch», erklärte ich. «Jess hat das immer gemacht.»
Sie fing an, mit der Maus zu klicken. «Dann sammelst du jetzt deine Quittungen zusammen, ich kümmere mich um den Rest.»
«Schön», sagte ich kleinlaut.
«Willst du dich nicht aufs Ohr hauen?», fragte sie.
«Du meinst, ich soll gehen?»
«Hm, ja.»
Das schwierige Kind wurde auf sein Zimmer geschickt.
Also machten der Hund und ich unseren Spaziergang. Die Straße, die wir entlanggingen – die wir immer entlanggingen –, heißt seit Anfang des Jahrhunderts Avenue, obwohl sie den Namen nicht unbedingt verdient. Sie ist zwar mit roten Klinkersteinen gepflastert und von recht majestätischen rotblättrigen Zwetschgenbäumen gesäumt, erstreckt sich aber nur über einen Häuserblock und mündet in einer Sackgasse am Rande des Sutro Forest. Die Häuser in der Straße sind alt, haben Dachschindeln und kupferne Regenrinnen, an denen es grün herabläuft, doch ihr narrensicherer Charme nahm mich an diesem Nachmittag nicht gefangen.
Ich erreichte den Wald lange vor Hugo. Zu meinen Füßen lag eine nebelschwere Schlucht, in der Eukalyptusbäume knarrten wie die Masten einer Galeone. Einen Augenblick lang verlor ich mich in ihrer theatralischen Schwermut, dann drehte ich mich nach dem Hund um. Er war weit hinter mir, zu blind und wacklig, um sich orientieren zu können. Als ich pfiff, stellten sich die Schlappohren auf halbmast, und dann trottete er geradewegs in die falsche Richtung. Armer alter Knochen, dachte ich. Seit Jess weg war, wirkte er noch schusseliger.
«He, Raubtier! Hier geht’s lang.»
Plötzlich klang meine Stimme wieder fremd. Auf halbem Weg nach Hause wurde mir klar, warum: Ich hatte mich angehört wie Jess. Genau diesen rauen, aber kumpelhaften Ton hatte er immer mit Hugo angeschlagen. Und niemand außer ihm, das kann ich Ihnen versichern, hat den Hund je «Raubtier» genannt. Das war nichts Mystisches, bloß ein billiger Streich meines Unterbewusstseins, meine einzige Möglichkeit, Jess’ habhaft zu werden. Wie jämmerlich, dachte ich. Und wie typisch von mir, mich mit meiner mäßigen Bauchrednerei derart auszutricksen.
Auf dem Nachhauseweg war der Nebel viel dichter. Aus alter Gewohnheit ging ich auf der anderen Straßenseite zurück, von wo ich das Haus im Ganzen sehen konnte: drei schmale Stockwerke, die sich in den bewaldeten Abhang quetschten. Die neuen Zedernschindeln waren noch zu blass für den dunkelgrünen Putz, doch nach ein oder zwei Regenperioden würden sie silbermatt anlaufen. Darauf hatte ich gewartet. Ich wollte, dass das Haus alt aussah, als hätten wir schon immer darin gewohnt.
Als wir vor drei Jahren eingezogen waren, hatten wir uns Hals über Kopf in die Renovierung gestürzt. Zäune und Simse entstanden über Nacht, und der Garten stand bereits in voller Blüte, ein Fertigparadies aus Azaleen, schwarzem Bambus und Schwertfarnen, die so groß waren wie Strandschirme. Wir lebten bereits seit sieben Jahren mit Jess’ schwindenden T-Zellen und hatten nicht vor, darauf zu warten, dass uns die Natur einholte.
Jess hatte sich immer darüber lustig gemacht. Manchmal nannte er mich Mrs. Winchester nach der verrückten alten Lady von der Monterey Peninsula, die glaubte, dass beständige Heimverschönerungen die bösen Geister verjage. Und damit lag er nicht so falsch. Meine rastlose Planung war mein einziger Schutz gegen das Unvermeidliche. Jess würde irgendwann krank werden, früher oder später, aber nicht, bevor die Schindeln gereift, der neue Brunnen gebaut und die Glyzinie am Gartentor emporgerankt war. So war es gedacht: Jess konnte gehen, aber erst, wenn der Traum vollendet war, wenn wir uns in der eigens errichteten Festung eingenistet und gegen den kommenden Sturm verbarrikadiert hatten.
Es war mir gar nicht in den Sinn gekommen, dass es auch andere Wege gibt, auf denen man weggehen kann.
Aber zurück zum Päckchen:
Bei meiner Rückkehr empfing es mich, wie Phönix aus dem Ascheimer, gut sichtbar neben dem Faxgerät. Anna war bereits zu einem anderen Kunden gegangen, doch ihr trockenes Lächeln verharrte noch im Raum. Ich setzte mich an den Schreibtisch, nahm den gefütterten Umschlag in die Hand und drehte ihn langsam herum. Irgendwie war es wie Weihnachten, so komisch es klingt, die braunpapierene Verheißung künftiger Ereignisse. Anna hatte Recht gehabt, befand ich; es brachte nichts, der Neugier abzuschwören. Jetzt erst recht nicht.
Ich zog die Lasche auf, und heraus fiel ein gebundener Fahnensatz mit hellblauem Umschlag. Das Buch trug den Titel Die Kinderfabrik. Der Autor hieß Peter Lomax – ein mir unbekannter Name. Laut Begleitbrief von Ashe Findlay (einem blasierten, aber freundlichen New Yorker Lektor, dem ich öfter auf Buchmessen begegnet war) handelte es sich in der Tat wieder einmal um einen Erfahrungsbericht. Der sich jedoch durch einen Aspekt wesentlich von anderen abhob: Der Autor, ein Opfer langjährigen sexuellen Missbrauchs, war dreizehn Jahre alt.
Ich blätterte in den Fahnen, wie ich es meistens tue, und las den einen oder anderen Absatz. Als ich genug gesehen hatte, kochte ich mir eine Kanne Kaffee und stieg zu meinem Dachbüro hinauf. Hugo folgte mir auf den Fersen, ängstlich wimmernd, als sei der einzige ihm noch verbliebene Mensch auch noch dabei zu verschwinden. Auf dem Sofa bereitete ich ihm ein Nest mit einem von Jess’ ungewaschenen T-Shirts. Der Geruch beruhigte den Hund auf der Stelle, und bald war er zu meinen Füßen eingeschlafen und schnarchte herzhaft, als ich die Fahnen öffnete. Es war sechs, noch nicht dunkel. Nach Mitternacht sollte ich das nächste Mal aufsehen.
Es ist nicht leicht, Petes Geschichte auf das Wesentliche zu beschränken, das Grauen ohne Petes Klugheit, seinen Mut und entwaffnenden Humor darzulegen. Doch nur so kann man nachvollziehen, wie heftig mich diese Fahnen packten, warum ich in der Nacht so unruhig schlief und vor allem, warum ich am nächsten Morgen sofort zum Telefonhörer griff.
Pete wurde 1985 geboren. Sein Vater war Vorarbeiter in einer Strumpffabrik, seine Mutter Hausfrau. Für ihre Nachbarn in Milwaukee waren Petes Eltern nichts Außergewöhnliches, normale Bürger, die in Schnellrestaurants aßen, im Price Club einkauften und mit ihrem reizenden Jungen im Schlepptau zum Gottesdienst erschienen. Offenbar waren sie ein nettes Paar, viel zu musterhaft und durchschnittsamerikanisch, um irgendeinen scheußlichen Verdacht aufkommen zu lassen.
Zu Hause lag die Wahrheit. Hinterm Haus stand ein schallisolierter Schuppen, in den Pete regelmäßig zur «Disziplinierung» gesteckt wurde. Mit zwei Jahren begann ihn sein Vater zu schlagen, mit vier, ihn zu vergewaltigen. Seine Mutter wusste davon; genauer gesagt, sie nahm die Übergriffe auf Video auf und bot sie anderen Erwachsenen feil, die auf so etwas standen. Und wenn das Geld knapp wurde, wurde Pete persönlich feilgeboten. Manche Leute durchquerten drei Staaten, bloß um einen Achtjährigen in ihre Spiele zu integrieren. Pete erinnert sich daran, wie er auf matschigen Parkplätzen von Holiday Inns auf sie wartete. Er erinnert sich an ihre Spielzeuge, an ihr gruseliges Lustgrunzen und den fauligen Obstgestank von Amylnitrit. Und daran, wie er von seiner Mutter hinterher als Trostpflästerchen für seine Wunden Plastikdinosaurier bekam.
Damit war es vorbei, als er elf war. Zwei Tage nach Weihnachten, in einem Schneesturm, verließ er das Haus und rannte mit einem Rucksack voller Videobänder acht Blocks zu einer öffentlichen Bücherei. Von dort aus rief er eine Hotline für missbrauchte Kinder an und wartete zwischen den Regalen, bis eine Ärztin ihn dort abholte. Sie hieß Donna Lomax. Sie trug Jeans und Blazer, erinnert er sich, hatte braune Augen und hörte ruhig zu, während er seine Geschichte erzählte. Sie nahm ihn in ihr Büro mit, wo er einen Star Wars-Comic las und sie sich mit einem Kollegen zusammen in einem anderen Raum die Bänder ansah. Das war das Ende. Bei Donna zu Hause bekam er Abendessen und dort schlief er auch, in einem Zimmer mit sauberen Laken und einer Tür, die er von innen abschließen konnte.
Petes Eltern wurden verhaftet und eingesperrt. Sie sahen ihren Sohn nie wieder, wenn man von dem Video absieht, auf dem er gegen sie aussagte. Obwohl Donna geschieden war und eigentlich nie Kinder hatte haben wollen, sah sie etwas Besonderes in dem Jungen, etwas, das sie in bislang ungekannter Weise berührte. Als sie sich erbot, Pete zu adoptieren, nahm er schnell, aber völlig emotionslos an. Mitgefühl war ihm noch fremd; er hatte nicht gelernt, jemandem zu vertrauen, auch nicht diesem schlanken Engel, der ihm Sicherheit versprach und im Gegenzug nichts verlangte.
Also wurde Pete ein Lomax, doch nur dem Namen nach. Wochenlang schloss er sich in seinem Zimmer ein, das er nur zu den Mahlzeiten verließ, und selbst dann beäugte er seine neue Mutter über den Tisch hinweg wie ein gefährliches wildes Wesen. Donna bedrängte ihn nicht; sie ließ ihn aus freien Stücken aus dem Wald heraustreten, in seinem eigenen Tempo, und als er kam, war sie für ihn da, mit zärtlichster Gewissheit, und wiegte ihn in den Armen, während er weinte.
Dort hätte es enden sollen, doch dem war nicht so. Als Petes körperliche Wunden geheilt waren, als er gelernt hatte, mit Donna zu lachen, als er das Tagebuch angefangen hatte, aus dem irgendwann dieses Buch entstehen sollte, bekam er einen beunruhigenden Husten. Donna musste ihm sagen, was sie bereits wusste: dass er Aids hatte.
Im Krankenhaus wurde Petes Lungenentzündung behandelt und eine Lungendrainage gelegt. Sobald er wieder aufrecht sitzen konnte, bat er Donna, ihm sein Tagebuch mitzubringen. Sie brachte ihm noch mehr mit: einen Laptop. Das Schreiben wurde seine Obsession und schließlich seine Erlösung. Er schrieb Stunden ohne Unterbrechung, vergaß alles um sich herum, trunken von der Erkenntnis, dass Worte sein Leid fassen konnten.
Und manchmal, wenn die Station dunkel war, hörte er Radio. Über dem Bett gab es einen Fernseher, doch den machte er nie an. Er hatte seine Qualen auf so einem Bildschirm gesehen, und so konnte er diese gnadenlose Anschaulichkeit nicht als Flucht begreifen. Das Radio aber entführte ihn an einen geheimen Ort, wo kein Gesicht dem eines Bekannten glich. Seine Lieblingssendung kam von einem Mann, der nachts Geschichten erzählte, Geschichten über Menschen, die, in der Ironie unserer modernen Zeit gefangen, überlebten, indem sie ihre Freunde zur Familie machten. Die Stimme des Mannes war tief und besänftigend, die Stimme eines verständnisvollen Vaters.
Und häufig, obwohl Pete es besser wusste, schien sie nur zu ihm zu sprechen.
2Die Noones
«Na», sagte Ashe Findlay am nächsten Morgen am Telefon, «dachte ich’s mir doch, dass ich von Ihnen hören würde.»
Die Stimme des Lektors war so, wie ich sie in Erinnerung hatte: das penetrante Näseln eines Yankee-Aristokraten. Allzu mühelos konnte ich mir den Rest vorstellen: das abgetragene rosa Oxfordhemd, die schiefe Fliege und die zusammengewachsenen Augenbrauen, diese ganze schale John-Cheever-Nummer.
«Der Junge ist unglaublich», sagte ich.
«In der Tat.»
«Ich schreibe gern was für den Klappentext.»
«Wunderbar.» Er machte eine bedeutsame Pause, bevor er fortfuhr. «Ich nehme doch an, dass Sie es ganz durchgelesen haben?»
«Bis zum Ende, ja.»
«Dann wissen Sie auch, was für einen ergebenen Fan Sie haben.»
«Ja», antwortete ich gelassen. «Es hat mich sehr gerührt.»
«Pete hat ausdrücklich darum gebeten, Ihnen die Fahnen zukommen zu lassen. Er lässt sich keine Ihrer Sendungen entgehen.»
Ich widerstand dem Drang, mich in dieser Schmeichelei zu aalen. Ich wollte Findlay deutlich machen, dass allein das Talent dieses Jungen meine Aufmerksamkeit beanspruchte. «Geht es ihm gut?», fragte ich. «Gesundheitlich?»
«Im Augenblick schon. Er ist ein zäher kleiner Bursche. Ein Überlebenskünstler par excellence.»
Ich sagte ihm, genau das habe mir an dem Buch gefallen: dass Pete sich nie, nicht mal in den düstersten Augenblicken, dem Selbstmitleid hingab. Und manchmal war er ausgesprochen witzig, erzählte schonungslos nüchtern von schrecklichsten Qualen. Wer hätte gedacht, dass es als Happy End ausgelegt werden könnte, wenn ein Junge im Angesicht des Todes doch noch Liebe findet?
«Wo haben Sie dieses Manuskript bloß aufgetan?», fragte ich.
Der Lektor gönnte sich ein kleines Glucksen auf seine Kosten. «Purer Zufall. Sein Aids-Berater kennt eine unserer Sekretärinnen im Vertrieb. So ist es auf meinem Tisch gelandet.»
«Haben Sie viel daran arbeiten müssen?»
Noch ein Glucksen. «Ich sage es nur ungern, aber es war eines der druckreifsten Manuskripte des ganzen Jahres.»
«Du lieber Himmel.»
«Hier und da musste ich ihn zurückpfeifen. Er benutzt gern große Worte, wo kleine genügen, aber Kinder tun das nun mal, nicht wahr?»
«Ich kann es gar nicht fassen», sagte ich. «Ehrlich gesagt …» Es verschlug mir die Sprache, aus Gründen, die ich selbst nicht kannte. Bescheidenheit? Scham? Irgendeine uralte, tief verwurzelte Angst vor Zurückweisung?
«Ja?», hakte der Lektor nach.
«Also, ich habe mich gerade gefragt, ob es sinnvoll wäre, ihm das persönlich zu sagen?»
«Sie meinen, ihn anzurufen?»
«Genau.»
«Ich stelle mir vor, dass er begeistert wäre. Gewiss. Lassen Sie mich erst mit Donna sprechen. Ich bin sicher, das geht in Ordnung, zumal wenn man bedenkt … nun, wie sehr er Sie verehrt.»
«Wenn es gerade ungüngstig ist …»
«Nein, sie würden sich freuen. Ich rufe Sie in ein, zwei Tagen zurück.»
«Prima.»
«Er ist ein reizender Junge. Und Donna werden Sie auch mögen.»
Ich sagte ihm, das könne ich mir gar nicht anders vorstellen.
«Wie läuft es mit Ihrer Arbeit?»
Diese Nachfrage war der Höflichkeit geschuldet, nicht wirklichem Interesse. Findlays literarischer Geschmack bewegte sich zwischen John Updike und Doris Lessing, dem (alten) New Yorker und der Paris Review. Meine sentimentalen Schmonzetten waren ihm völlig gleichgültig. Uns verband lediglich eine Zweckehe. Wenn er sich mit mir abgab, dann nur, weil irgendein gewiefter Kopf in der Chefetage beschlossen hatte, Petes Buch auf dem «Aids-Markt» zu lancieren.
Da Findlays Neugier nicht echt war, fiel es mir leichter, ihm ungeschminkt zu antworten. Ich vertraute ihm sogar an, was ich bisher nicht mal meinem eigenen Lektor offenbart hatte: dass es mich immer weniger beglückte, Wörter auf dem Papier hin und her zu schieben. Und dass das womöglich ein chronischer Zustand sei.
«Sie meinen, Sie haben eine Blockade?»
«Wohlwollend ausgedrückt», erwiderte ich. «Das setzt voraus, dass es überhaupt etwas zu blockieren gibt.»
«Ach, kommen Sie, Gabriel.»
«So ist es nun mal.» Es berührte mich seltsam, dass er mich beim Vornamen genannt hatte. Für seine Verhältnisse war das sehr vertraulich.
«Sie brauchen bloß mal eine Pause», beharrte er.
Ich antwortete, die hätte ich seit fast vier Monaten.
«Dann fahren Sie doch die Küste herunter, mit … Jamie?»
«Jess.»
«Richtig. Düsen Sie einfach ins Blaue hinein und denken Sie nicht ans Schreiben. Ich glaube, Sie werden staunen, wie schnell der Drang zurückkehrt.»
«Vielleicht tun wir das, ja», sagte ich.
«Wie geht es ihm denn eigentlich?»
«Gut geht es ihm, er fühlt sich besser denn je. Er muss natürlich aufpassen, man weiß ja nie … aber … es geht ihm gut …»
Während ich mein Sprüchlein herunterleierte, wanderte mein Blick über die Stadtsilhouette. Jess’ neue Bleibe hob sich wie ein Zuckerwürfel gegen das urtümliche Grün des Buena Vista Park ab. Ordentlich eingerahmt vom Schlafzimmerfenster, war es vom Bett aus – von unserem Bett aus – sichtbar. Es war das Erste, was ich morgens erblickte, und das Letzte, was ich abends mitnahm. Was für ein feiner melodramatischer Tupfer, dachte ich; der hätte von mir stammen können.
«Da bin ich aber froh», hörte ich Ashe Findlay sagen.
Ich hatte den Faden verloren. «Entschuldigung, Ashe … worüber?»
«Dass es Jamie gut geht. Ich meine Jess. Verdammt, warum beharre ich darauf, ihn Jamie zu nennen?»
Ich erklärte ihm, so hieße eine meiner Figuren.
«Ah.»
«Er ist nicht wirklich Jess, aber ich habe heftig abgekupfert.»
Milde ausgedrückt. Als Jess und ich uns kennen lernten, trafen sich auch Jamie und Will, das glückliche Schwulenpärchen in Nachts mit Noone. Und als Jess positiv getestet wurde, erging es Jamie ebenso – und er benutzte dasselbe piepende Pillendöschen für sein AZT. Obwohl Jamie Kupferschmied und äußerlich das Gegenteil von Jess ist, werden die beiden oft verwechselt. Sogar Ashe Findlay, der nicht gerade zu meiner Fangemeinde zählte, unterlief dieser leidige Lapsus. Auch er verwechselte die Realität mit der Literatur.
«Das liegt nahe», versicherte ich ihm.
Worauf er zu einem Vortrag über das Wesen der Literatur anhob. Ich erinnere mich an kaum mehr als seine erhebenden Schlussworte, mit denen er mich aufforderte, am Augenblick festzuhalten, da dieser die Quelle meiner Inspiration sei.
«Und sie wird wieder sprudeln, Gabriel, das versichere ich Ihnen.»
Natürlich, dachte ich und starrte wieder aus dem Fenster.
«Und grüßen Sie bitte Jess von mir, ja?»
An dem Nachmittag vertiefte sich meine Depression, also ging ich mit Hugo in den Golden Gate Park. Auf der Wiese hinter den Tennisplätzen fand gerade ein Hare-Krishna-Festival statt. Die Anhänger waren größtenteils Jugendliche, bleich und verpickelt in ihren Safranroben, aber ich beneidete sie um ihre dumpfe Entrückung. Ich saß im Schneidersitz im Gras, beobachtete sie eine Weile und fühlte mich wie ein Eindringling. Ich wollte einer von ihnen sein, im Wirbel ihrer Flitterfarben verschwinden und meinen Kummer von der Sonne herausbrennen lassen, doch für so etwas kannte ich mich viel zu gut.
Als ich nach Hause kam, saß Anna im Büro. «Ich musste ein paar Sachen nachgucken», sagte sie und sah vom Computer auf, als sei sie auf frischer Tat mit einem Sack voller Silberbesteck ertappt worden.
«Guck nach, soviel du willst», ermunterte ich sie, «du brauchst auch nicht vorher anzurufen.» Es wäre mir irgendwie peinlich gewesen, die ganze Wahrheit zu sagen: dass ich es herrlich fand, jemanden zu Hause vorzufinden, der mein wackliges Leben auf Kurs hielt, wie Jess es früher getan hatte.
«Dein Vater hat übrigens angerufen.»
Das war das Letzte, was ich erwartet hatte. «Ehrlich? Wann?»
«Vor kurzem.»
«Hast du abgenommen?»
Sie kicherte. «Blieb mir nichts anderes übrig. Es ging ständig: ‹Bist du daaaa, bist du daaaa? Heb ab, verdammte Kiste, ich weiß, dass du daaaaa bist!›»
«Ja, so ist er», sagte ich.
«Netter alter Kauz.»
Ich sagte ihr, dass die meisten Fremden ihn mochten.
«Warum sollte man ihn nicht mögen?», fragte sie.
«Würde er dich kennen, würde er dich hinter deinem Rücken als süßes kleines Chinuckenmädel bezeichnen.»
Sie lächelte und wandte sich wieder dem Computer zu. «Ich bin ein süßes kleines Chinuckenmädel.»
Dabei ließ ich es bewenden. Mein Vater war schon immer ein windiger Charmeur gewesen, darum kapierten es die meisten nicht. Man musste ihn schon ein halbes Jahrhundert kennen, um zu merken, wie wenig er einem wirklich gab. «Wieso hat er überhaupt angerufen?»
«Er hat dich bei Jeopardy gesehen.»
Einen Augenblick lang fragte ich mich, ob Pap nun auch den Halluzinationen anheim gefallen war, die in den Sechzigern meine Großmutter aufgezehrt hatten. Dodie hatte damals die gesamte Familie im Fernsehen gesehen. Im Großen und Ganzen war es meine Schuld, denn ich arbeitete damals als Reporter für einen Sender in Charleston und war manchmal bei Interviews im Profil zu sehen. Dodie war darauf hingewiesen worden, dass sie nach mir Ausschau halten sollte, und in Windeseile hatte sie diese Aufgabe perfektioniert. In ihrem Zimmer im Live-Oaks-Altersheim sah sie meine Schwester Josie in Verliebt in eine Hexe, meinen Großonkel Gus in The Defenders und meine Mutter in Connie’s Country Kitchen.
Einmal erzählte sie mir mit tränenerstickter Stimme, dass mein Vater – ihr Sohn – von einer «Bande radikaler Neger» ermordet worden sei. Sie habe es im Fernsehen gesehen, sagte sie, und davon war sie nicht abzubringen. Nicht einmal, als ich ihren geschändeten Sohn ins Altersheim mitnahm, wo er sie anschrie, als hätte man ihn eines Vergehens beschuldigt: «Verdammt nochmal, Mama, ich bin nicht tot! Sieh mich an. Ich bin hier, verdammt nochmal!» Doch Dodie hörte nicht auf zu weinen, also schnappte sich Pap eine Plastiklilie von ihrer Kommode und legte sich auf ihr Bett. «Okay», bellte er und hielt die Lilie hoch über die Brust, «ich bin tot! Bist du nun zufrieden, Mama?» Nach ein, zwei Sekunden kicherte Dodie wie ein junges Mädchen, ihre Dämonen waren durch ihren beharrlichen Sinn für das Absurde ausgetrieben worden. Dodie war zwar nicht mehr ganz richtig im Kopf, aber für einen Scherz war sie immer noch zu haben.
«Jeopardy?», fragte ich und blinzelte meine Buchhalterin an. «Ich bin nie bei Jeopardy gewesen.»
«Jetzt schon», erwiderte sie. «Vor zwei Tagen.»
«Was soll das heißen?»
«Du warst eine Frage. Beziehungsweise eine Antwort. Wie auch immer das läuft, so was wie: ‹Diese Stadt ist der Schauplatz von Gabriel Noones Geschichten in Nachts mit Noone.› Dein Dad hat das gesehen. Er und deine Stiefmutter.»
«So was!»
Anna hob die Augenbrauen. «Total cool, oder?»
Ich konnte es nicht leugnen. Ich sah Pap vor dieser Quizshow lümmeln, mit aufgeknöpfter Hose, Cracker aus der Dose knabbernd. Ich stellte mir vor, wie er vor Verblüffung grunzte, als er meinen Namen – seinen Namen, immerhin – aus Alex Trebeks Mund hörte und ihn in leuchtend blauweißen Lettern auf dem Schirm sah. Mein Peabody Award hatte ihn ziemlich kalt gelassen, aber Jeopardy war etwas anderes. Jeopardy dümpelte munter an Dads Horizont, neben Patton – Panzer nach vorn, Roy Blount Jr. und Meine Lieder, meine Träume.
«Und», fügte Anna beiläufig hinzu, «er kommt hier vorbei.»
«Das hat er gesagt?»
Sie nickte. «Auf dem Weg nach Tahiti.»
«Wann?»
«Ich glaube, in zwei Wochen. Du sollst ihn anrufen.»
«Scheißekackemist.»
«He», sagte Anna und drehte sich zum Computer um. «Nicht den Überbringer erschießen.»
Es war Jess, den ich erschießen wollte. Wie konnte er es wagen, zu diesem Anlass nicht da zu sein – mein Meister, mein Mitverschwörer, mein Happy End, mein lebender Beweis dafür, dass Männer einander innig lieben können? Mein Vater würde dieses Haus endlich zu Gesicht bekommen, und etwas Entscheidendes würde fehlen: das, was diesen Ort mit Leidenschaft und Engagement erfüllte. Ich wusste, wie mein Vater auf die Trennung reagieren würde, ich hörte bereits, wie er mir versicherte, dass ich ohne diesen Mistkerl besser dran sei, er würde die Fehler dieses Mannes aufzählen, den wirklich kennen zu lernen er nie für nötig befunden hatte. Seine so lange gezügelte Missbilligung meiner «Lebensweise» würde unter dem Deckmantel der Solidarität wieder hervorbrechen.
«Das sind keine guten Nachrichten», sagte ich zu Anna.
«Wie alt ist er?», fragte sie. «Uralt wahrscheinlich.»
Ich warf ihr einen Blick zu. «Du meinst, weil ich uralt bin?»
«Na ja … ja.»
«Es gibt noch andere Buchhalter, klar?»
Sie blieb vollkommen unbeeindruckt. «Ich meine ja nur, wenn ich so alt bin wie du, bin ich hoffentlich über meine Eltern weg.»
«Viel Glück.»
Annas Eltern, erinnerte ich mich, waren zwei Frauen. Sie hatte einen leiblichen Vater, der in der East Bay eine Kiosk-Kette besaß, doch mit dem hatte sie sich bloß einmal aus reiner Neugier getroffen. Ihr Zwillingsbruder, der so hetero zu sein schien wie sie, arbeitete an den Wochenenden in einem Zentrum für Schwule, Lesben, Bisexuelle und Transsexuelle. Für sie war das alles ganz normal. Anna war eine moderne Erfindung, freischwebend, unverstrickt. Im Gegensatz zu mir hatte sie nie den düsteren Sog der Vergangenheit verspürt.
Als ich klein war, wusste ich praktisch nichts über meinen Großvater, der vor meiner Geburt gestorben war. In anderen Familien wäre das nicht weiter aufgefallen, aber unsere war besessen vom weiten Feld der Verwandtschaft. Täglich klärte uns mein Vater über unsere Ahnen auf. Wir wussten, dass ein Noone in Fort Moultrie an der Ruhr gestorben, dass ein anderer ein schneidiger unverheirateter Gouverneur gewesen war und dass Großmutter Prioleau während Shermans Marsch Yankees hatte beherbergen müssen. Einige dieser Gestalten hätten wir, so Gott will, bei einer Gegenüberstellung identifizieren können, nicht so den Vater meines Vaters. Soweit ich mich erinnere, habe ich nie auch nur ein Foto von ihm gesehen. Er war ein bloßer Nebel, ein Abstraktum ohne Geschichte.
Erst als ich zwölf war und mein Freund Jim Huger mich auf einem Klassenausflug drangsalierte, erfuhr ich, was ganz Charleston seit Jahrzehnten wusste. Gabriel Noone der Erste hatte sich den Schädel mit einer Schrotflinte weggepustet. Über den Vorfall seien mehrere Versionen im Umlauf, sagte Jim. Eine lautete, dass mein Großvater die Tat im Zimmer meines Vaters vollzogen habe. Als Pap, gerade mal zwanzig Jahre alt, vom Zelten auf Kiawah Island zurückkam, sei ein schwarzes Faktotum – Dah, wie die Frau genannt wurde – gerade dabei gewesen, Blut von der Tapete zu waschen.
Einer anderen Version zufolge habe der Selbstmord nach dem Abendessen im Garten stattgefunden, als die Kinder draußen spielten und alle in der Meeting Street den Knall hörten. Jims Tante Claire sei gerade dabei gewesen, Glühwürmer zu zerquetschen, und habe Dahs fürchterliches Wehklagen gehört. Welche Überlieferung – wenn überhaupt – auch immer zutraf, mein Vater hatte den Vorfall nachweislich nur ein einziges Mal ganz kurz erwähnt: meiner Mutter gegenüber, am Vorabend ihrer Hochzeit an Ostern in der St. Michael’s Church.
Als ich meine Mutter fragte, warum sich Grandpa Noone umgebracht habe, antwortete sie mir, er habe während der Depression Geld verloren. «Und», hatte sie dunkel hinzugefügt, «es gab zu viele Frauen.» (Eine Schwiegermutter und eine unverheiratete Tante hatten mit Dodie und Großvater unter einem Dach gelebt.) Dies, so befand meine Mutter mit heiterem Chauvinismus, sei für jeden Mann Grund genug, das Interesse am Leben zu verlieren. Aber das sei alles nicht wichtig, sagte sie. Wichtig sei nur, dass Pap nie wieder an diese schreckliche Geschichte zu denken brauche. Also trat ich ihrer Konföderation des Schweigens bei und bewachte ein Geheimnis, das gar keines war.
Ich kann mich an einen Abend kurze Zeit danach erinnern, an dem mein Vater und ich uns zusammen die Reihe Playhouse 90 ansahen. Die Sendung, merkte ich zu meinem Entsetzen, handelte von einem Mann, der sich mit dem Selbstmord seines Vaters auseinandersetzt. (Vierzig Jahre danach kann ich den Titel noch immer abrufen: Die Rückkehr von Ansel Gibbs.) Zu erstarrt, um aus dem Zimmer zu gehen, umzuschalten oder auch nur meinen Vater anzusehen, hielt ich anderthalb Stunden die Luft an. Als ich schließlich einen Blick riskierte, konnte ich rein gar nichts von seinem Gesicht ablesen. Der Mann, der bei Gunsmoke immer die Schurken anpöbelte, saß so stumm und reglos da wie eine Leiche.
Ich begann mich zu fragen, ob Selbstmord, wie alles in der Familie, erblich sei. Pap bewahrte in seinem Schreibtisch eine Pistole auf, die er den Japanern abgenommen hatte und die mir zunehmend Furcht einflößte. Er habe sie, sagte er, für den Fall, dass er «verrückte Nigger am Einbrechen hindern» müsse, aber es war seine Verrücktheit, die mich beunruhigte. Wenn er nach einem seiner Anfälle in sein Arbeitszimmer stürmte, machte ich mich auf Schüsse gefasst. Ich glaube, das wusste er. «Keine Sorge», sagte er gern, «ich bin eh nicht mehr lange da.» Das mochte eine Anspielung auf seinen berüchtigt hohen Cholesterinspiegel sein oder schlicht der Eintritt in die mittlere Lebensphase, doch ich verstand es so, dass er eines Tages der Sohn seines Vaters werden würde.
Ich glaube, er fühlte sich in der Minderheit. Wir vier – meine Mutter, mein Bruder, meine Schwester und ich – hatten uns im Angesicht seines hilflosen Zorns verbündet. Und das, was wir niemals erwähnen durften, hatte eine so breite Kluft zwischen uns geschaffen, dass keiner von uns sie je überbrücken konnte. Pap versuchte es auf seine Weise. An Weihnachten überraschte er uns mit kleinen Entlein. Er fuhr mit uns im Country Squire nach Quebec und schmetterte auf dem gesamten Weg dieselben beiden Shantys. Doch er blieb der Außenseiter, der Unhold, vor dem wir flohen, wenn die Situation beängstigend wurde. Bei meiner Mutter fanden wir Unterschlupf. Sie brauchten wir, um die düsteren Seiten meines Vaters zu erahnen – und zu verzeihen. Natürlich liebte er uns, aber auf eine brummige, ironische, ritualisierte Art und Weise, da echte Gefühle sich als zu schmerzhaft erwiesen hatten. Und das wurde mit der Zeit immer schlimmer. Mit ungefähr sechs Jahren hat er mich wohl noch in den Arm genommen, aber später nicht mehr. Als er und meine Mutter mich nach meinem ersten Semester in Sewanee am Flughafen abholten, wollte ich ihn umarmen, doch stattdessen schnellte sein Arm zu einem burschikosen Handschlag vor, als wolle er sagen: Bitte, mein Sohn, bis hierher und nicht weiter.
Danach gab ich es auf.
«Dies ist der Anschluss der Noones. Nach dem Signalton haben Sie eine Minute Zeit, eine Nachricht zu hinterlassen.»
Paps neuer Anrufbeantworter brachte mich aus dem Konzept. Es war merkwürdig, sein archaisches Organ in einem solch postmodernen Kontext zu hören. Noch merkwürdiger war es, dass mit den «Noones» er und Darlie Giesen gemeint waren, eine Klassenkameradin von mir aus der High School, damals, um das Jahr 1962. Der Senior hatte die junge Dame einige Jahre nachdem meine Mutter 1979 an Brustkrebs gestorben war, kennen gelernt und um ihre Hand angehalten. Jetzt besaßen sie eine Eigentumswohnung in der Battery in Charleston, an der Stelle, an der die ersten Schüsse des Bürgerkriegs gefallen waren. An der Stelle, möchte ich mit gemessenem Sinn für die Ironie der Geschichte hinzufügen, an der Gabriel Noone der Dritte erstmals die Freuden des Schwanzlutschens entdeckt hatte.
«Hallo», begrüßte ich den Anrufbeantworter, «hier ist Gabriel. Anna sagte, ihr kommt hier vorbei. Wie schön. Ich bin zwar momentan sehr beschäftigt, aber vielleicht können wir zusammen essen gehen oder so. Ich bin die meiste Zeit hier und schreibe, also … ruft mich an.»
Als ich den Hörer aufgelegt hatte, grinste Anna mich an.
«Du bist still», sagte ich.
«Sie wissen nichts von dir und Jess, oder?»
«Nein.»
«Wirst du’s ihnen erzählen?»
Ich zuckte mit den Schultern. «Was gibt’s da zu erzählen? Es ist mir doch selbst noch nicht klar.»
«Werden sie sich nicht wundern, wenn er nicht hier ist?»
Ich sagte ihr, dass sie möglicherweise gar nicht hierher kämen, dass wir uns vielleicht irgendwo zum Essen träfen. Aber mein eigentlicher Gedanke war: Jess könnte in zwei Wochen schon wieder zu Hause sein, alles könnte wieder im Lot sein.
Damals, als die Wunde frisch war, redete ich mir das ein.
3Radio ist Nicht das Leben
Zwei Tage nach seinem zwölften Geburtstag, vierzehn Tage bevor sein Vater wegen Spielschulden im Gefängnis landete, wurde Charles Dickens zum Arbeiten in eine Schuhwichsefabrik gesteckt. Dort saß er zwölf Stunden täglich in einem rattenverseuchten Raum bei den Docks, klebte Etiketten auf Schuhcremedosen und lernte den Schmerz des Ausgesetzten kennen. Zwar sprach er nie öffentlich über sein Schicksal, doch es manifestierte sich überall: in seinem sozialen Gewissen, dem flammenden Ehrgeiz und in den Horden unschuldiger Kinder, die in seinen Büchern darbten und starben.
Pete meint, es gebe für uns alle eine solche Fabrik: einen schrecklichen Augenblick, in dem wir unser Kinderherz hingeben, der so unvermeidlich sei wie der Verlust der Milchzähne. Und die Folgen seien unabsehbar. Einige von uns würden wie Dickens, andere wie Jeffrey Dahmer, der Kannibale von Milwaukee. Das sei keine Frage von Gut und Böse, glaubt Pete. Vielmehr der willkürlichen Grausamkeit der Welt und unserer angeborenen Fähigkeit, ihr zu widerstehen.
Stimmt das? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich sofort an Dickens dachte, als ich zum ersten Mal Petes Stimme am Telefonhörte. Sie war kindlicher, als ich sie mir vorgestellt hatte, aber kiebig wie nur was, wie ein rotznasiger Taschendieb unserer Zeit. Artful Dodger in Bart Simpsons Kleidern.
«Hier ist Pete Lomax. Der das Buch geschrieben hat. Meine Mom hat gesagt, ich soll Sie anrufen.»
Vollkommen verwirrt von seiner Stimme, unsicher, welchen Ton ich anschlagen sollte, überschüttete ich ihn mit Lob für Die Kinderfabrik. Ich war wahrscheinlich förmlicher als sonst – das heißt, ich weiß, dass es so war –, aber ich gab mir Mühe, präzise zu sein, Themen und Textstellen hervorzuheben, den Rhythmus seiner Sprache: die Dinge, die ich immer gern höre. Ich wollte ihm ein Gefühl dafür vermitteln, was er geschaffen hatte, wie ungeheuerlich das war.
Doch es kam keine Reaktion.
«Pete?»
«Ja?»
«Bist du noch da?»
Noch mehr leere Luft, und schließlich: «Schwören Sie, dass Sie es sind?»
Ich lachte leise. «Jedenfalls bin ich nicht Tallulah Bankhead.»
«Wer?»
«Egal … jemand anders. Warum sollte ich es nicht sein?»
«Keine Ahnung. Sie klingen nicht wie Sie selbst.»
Welch seltsamer Gedanke, dass das Radio Pete bereits eine Vorstellung davon mitgegeben hatte, wie ich zu klingen hatte, ein Gefühl dafür, wer ich «selbst» zu sein hatte. Und noch seltsamer, dass er möglicherweise genau den hohlen Beiklang heraushörte, der meine letzte Aufnahme sabotiert hatte. Auf derartige Taxierung war ich nicht vorbereitet.
«Radio ist nicht das Leben», sagte ich, schamlos herablassend und gleichzeitig ausweichend. «In Wirklichkeit bin ich nicht ganz so dramatisch.»
«Aha.»
«Ich klinge … anders?»
«Ja.»
«Und … wie?»
«Wie gequetschte Scheiße.»
Ich lachte gequält. «Das bringt es so ziemlich auf den Punkt.»
«War nicht böse gemeint.»
«Natürlich nicht.»
«Ich fänd’s bloß so kackscharf, wenn Sie’s wirklich sind.»
«Na ja», sagte ich nach einer kurzen Pause, «das musst du mir Kackarsch schon glauben.»
Pete brach in kindliches Gekicher aus, das seine halbstarke Sprache Lügen strafte. «’tschuldigung», sagte er schließlich. «Meine Mum sagt, ich hab ein dreckiges Mundwerk.»
«Kackrichtig.»
Er kicherte noch heftiger und flehte mich dann an, aufzuhören.
«Warum?», fragte ich. «Nenn mir einen bekackten Grund.» Ich amüsierte mich prächtig.
Dann hörte ich einen dumpfen Knall und dachte, das Telefon sei heruntergefallen. Ich hörte ein Rumoren. Und mühsames Atmen.
«Pete?»
Nichts.
«Pete?»
«Alles okay», sagte er. «Blöde Schläuche.»
Umgehend entstand ein Bild vor meinem inneren Auge: ein zerrütteter Körper, der wie eine Marionette an Fäden hing und verzweifelt nach Luft rang, während ich meine geistreichen Spielchen trieb. «Mein Gott, Pete, das tut mir Leid.»
«Nein. Ist alles cool.»
«Sicher?»
«Ja.»
Ich lauschte auf seinen Atem. Er klang wieder gleichmäßig.
«Was ist passiert?»
«Ich hab bloß dieses blöde Teil umgestoßen, das ist alles. Sie saugen gerade meine Lunge ab.»
«Verstehe.»
«Klingt schlimmer, als es ist.»
«Was ist es denn? Pneumocystis?»
«Ja, genau, das Übliche.»
«Gibt es keine Prophylaxe? Septra oder so?»
«Nicht in meinem Alter.»
«Ach.»
«Das Zeug ist doch sowieso viel zu langweilig. Wechseln wir das Thema. Haben Sie eine E-Mail-Adresse?»
«Ehrlich gesagt, nein.»
«Aber Sie haben doch eine eigene Website?»
«Schon, aber die betreut Jess. Ich weiß nicht mal, wie man die aufruft. Ich benutze meinen Computer nur zum Schreiben.»
«Aber, Mann, E-Mail ist so einfach.»
«Ich weiß, und ich habe auch vor, es bald zu lernen. Nur nicht jetzt, ich habe gerade den Kopf zu voll.»
«Ich könnte es Ihnen beibringen», bot Pete eifrig an. «Ich hab’s Warren beigebracht, und der hatte auch keine Peilung.»
«Vielen Dank», erwiderte ich trocken. «Wer ist Warren?»
«Mein Aids-Berater.»
«Ach, natürlich.» Pete hatte ausführlich über diesen Mann geschrieben, einen Sozialarbeiter in den Vierzigern – schwul und HIV-positiv –, der mitgeholfen hatte, ihn ins Land der Lebenden zurückzuholen.
«Warren ist auch ein großer Fan von Ihnen. Wir haben uns immer zusammen Nachts mit Noone angehört.»
«Du meinst, im Krankenhaus?»
«Nein, später. Als ich wieder zu Hause war. Das erste Mal, als ich Sie gehört hab, war ich … allein.» Seine Stimme zitterte beim letzten Wort. Die nachfolgende Stille sprach Bände.
«Alles in Ordnung?», fragte ich.
«Ich kann’s einfach noch nicht glauben, das ist alles.»
«Was?»
«Mann, dass ich mit Ihnen rede!»
Sein ergebener Tonfall verunsicherte mich. Ich versuchte, von mir abzulenken. «Das passiert nun mal mit Büchern. Plötzlich steht man im Rampenlicht, und man weiß nie, wen man alles erreicht. Du wirst sehen, wenn dein Buch veröffentlicht wird – alle Welt wird sich bei dir melden.»
«Jaja.»
«Ich meine es ernst. Von wem würdest du gern hören?»
«Keine Ahnung.»
«Na komm. Es gibt doch bestimmt jemanden, den du schon immer kennen lernen wolltest.» Ich merkte, dass ich ihn von oben herab behandelte, aber ich konnte nicht anders. Es war irgendwie unverfänglicher, mit einem Kind zu sprechen als mit jener geschundenen alten Seele, die ich aus der Kinderfabrik kannte.
«Cal Ripken wär ganz nett», sagte er.
«Aha, ja.»
«Den kennen Sie doch, oder?»
«Aber ja. Natürlich. Vage.»
«Und, wer ist das?»
«Ein … Sportler.»
Pete schnaubte. «Sie alter Homo.»
«Bitte?»
Der Schuljunge kicherte wieder. «Welche Sportart?»
«Meine Güte», sagte ich, «jetzt werd nicht kleinlich.»
«Gucken Sie sich den Sportteil überhaupt an?»
«Nein», antwortete ich. «Den schmeiß ich immer als Erstes weg, zusammen mit dem Wirtschaftsteil.»
«Oh, Mann.»
«Und noch was: Ich würde eine Zeitung ohne Sportteil kaufen, wenn es die gäbe.»
«Na, supergeil!»
Jetzt musste ich lachen.
«Warren ist genauso», sagte er.
«Tatsächlich?»
«Ich hab ihm gesagt: ‹Auch wenn du ein Stängelraucher bist, kannst du dir doch mal ein Spiel angucken.›»
«Ein was?», fragte ich.
«Ein Spiel.»
«Nein, das davor.»
«Was? Stängelraucher? Noch nie gehört?»
«Nein», lachte ich.
«Scheiße, Mann. Was machen Sie denn die ganze Zeit?»
«Keine Ahnung – Stängelrauchen, wahrscheinlich.»
Er kicherte wieder. «Ich kenn viel so Zeugs. Echt cooles Zeug. Ausdrücke und so.»
«Das kann ich mir vorstellen.»