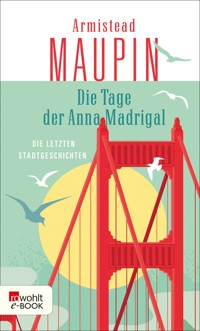7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Stadtgeschichten
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Wie alles begann - die legendären Vorgeschichten zur "Serie der Stunde" (Spiegel online) auf Netflix. Wiedersehen in der Barbary Lane Michael Tolliver, der heimliche Held der «Stadtgeschichten», ist mittlerweile 55 Jahre alt. Er betreibt ein erfolgreiches Gärtnerunternehmen und ist verheiratet mit dem 25 Jahre jüngeren Ben. Sicher, die Haare sind grau geworden, er hat einen Bauch bekommen, und der Rücken macht auch nicht mehr alles mit. Aber eigentlich geht es Michael gut. Bis ihn die Nachricht ereilt, dass Anna Madrigal einen Herzanfall erlitten hat. Nun liegt sie im Koma. Und so versammelt sich – wie es scheint zum letzten Mal – die alte Truppe aus der Barbary Lane um ihre ehemalige Vermieterin und transsexuelle Übermutter ... «Das Warten hat sich gelohnt.» NEON
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 336
Ähnliche
Armistead Maupin
Michael Tolliver lebt
Die neuesten Stadtgeschichten
Aus dem Englischen von Michael Kellner
Über dieses Buch
Wiedersehen in der Barbary Lane
Michael Tolliver, der heimliche Held der «Stadtgeschichten», ist mittlerweile 55 Jahre alt. Er betreibt ein erfolgreiches Gärtnerunternehmen und ist verheiratet mit dem 25 Jahre jüngeren Ben. Sicher, die Haare sind grau geworden, er hat einen Bauch bekommen, und der Rücken macht auch nicht mehr alles mit. Aber eigentlich geht es Michael gut. Bis ihn die Nachricht ereilt, dass Anna Madrigal einen Herzanfall erlitten hat. Nun liegt sie im Koma. Und so versammelt sich – wie es scheint zum letzten Mal – die alte Truppe aus der Barbary Lane um ihre ehemalige Vermieterin und transsexuelle Übermutter ...
«Das Warten hat sich gelohnt.» NEON
Vita
Armistead Maupin, geboren 1944 in Washington, studierte Literatur an der University of North Carolina und arbeitete als Reporter für eine Nachrichtenagentur. Er schrieb für Andy Warhols Zeitschrift Interview, die New York Times und die Los Angeles Times. Seine Geschichten aus San Francisco, die berühmten «Tales of the City», verfasste er über fast zwei Jahrzehnte als täglichen Fortsetzungsroman für den San Francisco Chronicle. Maupin lebt in San Francisco.
Für meinen geliebten Gatten Christopher Turner
«Ihr seid alt, Vater Franz», sagte Fränzchen, der Tropf, «Und Ihr habt schon schneeweiße Haare; Und nichtsdestotrotz steht ihr pausenlos kopf – Bedenkt Ihr denn nicht Eure Jahre?»
Lewis Carroll
«Leute wie du und ich … , irgendwann werden wir fünfzigjährige Libertins in einer Welt von zwanzigjährigen Calvinisten sein.»
Brian Hawkins zu Michael Tolliver, 1976
1Bündnis der Überlebenden
Vor nicht allzu langer Zeit warf mir auf der Castro Street ein Fremder in einem Giants-Parka einen vielsagenden Blick zu, während wir vor Cliff’s Eisenwarenladen aneinander vorbeigingen. Er war ungefähr in meinem Alter – also nicht so weit jenseits der fünfzig – und sah auf diese kaputte Bruce-Willis-Art gar nicht mal so schlecht aus. Ich wartete einen Moment, bevor ich mich umdrehte, um zu sehen, ob er einen zweiten Blick riskieren würde. Offenbar kannte er das Spielchen genauso gut wie ich, denn sein Einsatz kam auf den Punkt.
«Hey», rief er, «bist du nicht eigentlich tot?»
Ich schenkte ihm ein schiefes Lächeln. «Diese Nachricht muss ich glatt verpasst haben.»
Er kam näher und wurde dabei rot. «Tut mir leid, ich dachte nur … , das ist alles schon so lange her, und … manchmal glaubt man einfach … , weißt du … »
Ich wusste. In unserem heißgeliebten Gayberry kann man sich kaum umdrehen, ohne jemandem ins Gesicht zu starren, dessen Züge einem vage bekannt vorkommen und von dem man schon seit geraumer Zeit annimmt, er sei tot. Während der düsteren Tage hat man ihn aus den Augen verloren, schon fast einen Nachruf geschrieben und seine Asche im Meer verstreut, da steht er plötzlich im Gang der Haushaltswarenabteilung von Cala Foods vor einem und erzählt, dass er in den letzten zehn Jahren in Petaluma Rosen gezüchtet hat. Diese merkwürdigen kleinen Auferstehungen im Supermarkt kommen bei mir immer wieder vor, warum also nicht auch bei anderen?
Aber wer um Himmels willen war das bloß?
«Gut siehst du aus», sagte er freundlich.
«Danke. Du auch.» Er hatte die gleichen tiefen Furchen im Gesicht wie ich – die gängigen Verwüstungen durch die Medikamente. Noch so ein Zigarrenladen-Indianer.
«Du bist doch Mike Tolliver, oder?»
«Michael. Ja. Aber ich kann mich wirklich nicht … »
«Oh … , entschuldige.» Er streckte mir die Hand entgegen. «Ed Lyons. Wir sind uns mal bei Joe Dimitris begegnet, nach den zweiten Gay Games.»
Er sah mir wohl an, dass mir das gar nichts sagte.
«Du weißt doch», legte er nach, «das große Haus oben in Collingwood.»
Immer noch nichts.
«Die Wichsrunde.»
«Ahh.»
«Danach sind wir in meine Wohnung gegangen.»
«Am Potrero Hill!»
«Du erinnerst dich!»
Woran ich mich erinnerte – das Einzige, woran ich mich nach neunzehn Jahren erinnerte –, war sein Schwanz. Ich erinnerte mich, dass die unterdurchschnittliche Länge durch den Umfang mehr als wettgemacht wurde. Er war einer der dicksten, die ich je gesehen habe, und die Spitze wölbte sich wie die Keule eines Höhlenmenschen. Sich an ihn zu erinnern war viel schwieriger. Neunzehn Jahre sind einfach zu lang, um sich ein Gesicht zu merken.
«Wir hatten Spaß», sagte ich in der Hoffnung, diese nette Anzüglichkeit könnte als Entschuldigung für mein phallokratisches Gedächtnis dienen.
«Du hast irgendwas mit Pflanzen gemacht, nicht?»
«Immer noch.» Ich zeigte ihm meine schmutzigen Fingernägel. «Damals hatte ich eine Baumschule, aber jetzt gärtnere ich von morgens bis abends.»
Das schien ihn anzumachen, denn mit einem gutturalen «Woa» zupfte er am Träger meiner Latzhose. Falls er auf eine schnelle Nummer am Mittag aus war – ich war es nicht. Mein «grüner» Job, der ihn so in Wallung brachte, hatte mir diverse üble Wehwehchen in den Schultergelenken eingebrockt, und ich musste noch raus nach Glen Park, um ein paar Steineiben zu beschneiden. Ich wollte nichts anderes als einen gemütlichen Abend mit Ben und in den Whirlpool und einen der gelegentlichen Bacon-Cheeseburger von Burgermeister.
Irgendwie schien er das zu merken. «Bist du inzwischen verheiratet?»
«Ja … , so ziemlich.»
«Verheiratet verheiratet oder nur … normal?»
«Du meinst, ob wir beim Standesamt waren?»
«Ja.»
Waren wir, und das sagte ich ihm.
«War bestimmt toll.»
«Na ja, es war eine Massenveranstaltung, aber … , weißt du … , ziemlich cool.» Das klang nicht besonders mitteilsam, aber ich hatte die Geschichte schon viel zu oft erzählt und es meistens nicht geschafft, die schräge Magie dieses Tages rüberzubringen: So viele unterschiedliche Träume wurden unter der hohen güldenen Kuppel eines Palastes wahr, der direkt aus «Die Schöne und das Biest» zu stammen schien. Ihr hättet mal die lange Schlange von Leuten in den besten Jahren sehen sollen, die da im Regen standen, ein paar mit Kindern im Schlepptau, um etwas zu besiegeln, was sie sowieso längst wussten. Und der Bürgermeister selbst – so jung und gutaussehend und … adrett … Er sah wirklich so aus wie der Mann auf der Hochzeitstorte.
«Na gut», sagte Ed Lyons, jetzt kein Fremder mehr, da ich seinen Schwanz mit einem Namen in Verbindung brachte. «Ich bin auf dem Weg zum Bagelshop.Wie steht’s mit dir?»
Ich sagte, ich sei auf dem Weg zu meinem Pick-up.
«Woa!» Allein die Erwähnung des Fahrzeugs brachte ihn schon wieder auf Touren.
Ich muss wohl ein bisschen die Augen verdreht haben.
«Was ist?», fragte er.
«Ist nicht so ein dickes Gerät», ließ ich ihn wissen.
Er lachte und zog ab. Während sich seine breiten Schultern einen Weg durch den Fußgängerstrom bahnten, fragte ich mich, ob ich Eds Job – was immer er tun mochte – wohl ebenso sexy finden würde wie er meinen. O ja, Kumpel, so ist’s gut, mach mich heiß, mach, dass ich diese Zweizimmer-Eigentumswohnung kaufe! Dieser Century-21-Blazer ist so verdammt scharf!
Ich nahm Kurs auf meinen Pick-up (einen hellblauen Tacoma, wenn ihr’s unbedingt wissen wollt) und schwamm auf einer Welle von hausgemachter Euphorie, die mich ab und zu überkommt. Nach dreißig Jahren in dieser Stadt tut es mir gut, daran erinnert zu werden, dass ich immer noch gern hier bin, immer noch gern diesem süßen Bund der Überlebenden angehöre, wo sich Männer vor einem Eisenwarenladen treffen und über die Liebe, den Tod und Wichsrunden reden, als sprächen sie über das Wetter.
Ben zu haben hilft mir dabei sehr, das ist mir klar. Vor einigen Jahren, als ich noch nicht verheiratet war, begann sich der Charme der Stadt doch ziemlich zu verflüchtigen. All die Dotcommer, die in ihren SUVs und Hummers wie Gottkönige auf dem Mittelstreifen durch die Noe Street rasten, als ritten sie eine Attacke gegen ein Dritteweltland. All die frischgebackenen Tunten im Badlands, umnebelt von Zigarettenqualm und Arroganz, die offenbar glaubten, schon politisch aktiv zu sein, wenn sie nur das Out-Magazin abonnierten und regelmäßig bei der «Queer as Folk»-Nacht aufkreuzten. Von den Verkehrschaoten und Leck-mich-doch-Oberkellnern ganz zu schweigen und auch von den Kleinstadttucken, die ihre Kleinstadtmacken mit ins Castro-Viertel schleppten und dann die «anderen» auszugrenzen versuchten. Ich erinnere mich ganz besonders an einen, der mich, die Unterschriftenlisten in der Hand, auf dem Bürgersteig beackerte, um mir die Gefahren der geplanten neuen Straßenbahnhaltestelle der Linie F nahezubringen (die die Hetero-Touristen von Fisherman’s Wharf ins Castro karrt). «Das können sie doch nicht machen», quäkte er, «hier ist das Zentrum unserer Spiritualität!» Dabei standen wir vor einem Laden, in dessen Schaufenster Dildos zum Selbstgießen und Schwanz-an-der-Schnur-Seife zu bewundern waren. Meine Spiritualität, teilte ich ihm mit, würde das schon überleben.
Die Dotcommer müssen sich inzwischen wieder in Bescheidenheit üben, aber die Immobilienpreise steigen weiter wie verrückt, und ein Ende ist nicht in Sicht. Ich bin froh, dass ich mich vor siebzehn Jahren hier einnisten konnte, als es einem Baumschulenbesitzer und Freizeit-Denkmalschützer noch möglich war, ein Haus im Herzen der Stadt zu erwerben. Es schien damals nichts Besonderes zu sein, ein Haus für den Anfang, das stark renovierungsbedürftig war. Aber als mein Partner Thack und ich die hässlichen rosaroten Asbestschindeln abgeschlagen hatten, kam darunter das historische Gerüst zum Vorschein. Unsere kleine Baustelle bestand nämlich aus drei Erdbeben-Baracken, die nach der Katastrophe von 1906 als Notunterkünfte in den Parks errichtet und später auf Rollwagen zu anderen Standorten gekarrt worden waren, um als reguläre Wohnungen zu dienen. Es waren einfache, grobe Kästen, plump und in schrägen Winkeln zusammengeschustert, aber wir ließen im Hausinnern ein paar der Balken sichtbar stehen und fanden es großartig, unseren Besuchern von der schillernd-katastrophalen Herkunft unserer Behausung zu erzählen. Was wäre angemessener gewesen? Wir selbst steckten mitten in einer Katastrophe – der letzten großen des Jahrhunderts – und waren auf das Schlimmste gefasst.
Aber dann bin ich doch nicht gestorben. Neue Medikamentencocktails wurden entwickelt, mir ging es besser, und Thack brachte es endlich über sich, mir zu sagen, dass er wegwollte. Mitte der Neunziger fand er einen neuen Job in Chicago, und das Haus gehörte mir allein. Zunächst war es eine Gruft, aber ich schaffte es, die allzu zahlreichen Geister mit Farbe, Vorhängen und neuem Mobiliar auszutreiben. In den folgenden acht Jahren dämmerte mir heimlich, still und leise: Es war möglich, sich alleine einzurichten. Es war möglich, dieses Haus mit Freunden und freundlichen Unbekannten zu füllen, ohne dass jemand neben einem schlief. Man konnte seinen Garten pflegen und Mahlzeiten kochen und an dieser Autonomie ein gewisses Vergnügen finden.
Mit anderen Worten: Ich war reif für Ben.
Ben habe ich im Internet getroffen. Na ja, nicht ganz; ich habe ihn im Internet gesehen und in North Beach auf der Straße getroffen. Aber ich hätte nie von ihm erfahren geschweige denn gewusst, wonach er suchte, wenn mein Freund Barney nicht auf einer Website für ältere Schwule gemodelt hätte. Barney ist achtundvierzig, ein erfolgreichen Hypothekenbroker und eine Art Muskeldaddy. Er ist auch ein kleines bisschen eitel. Als ich ihn eines Tages auf der Market Street traf, musste er mir sofort berichten, dass sein großer weißer Marmorarsch jetzt allen Welt-Weiten-Wichsern für nur 21,95 Dollar im Monat zur Verfügung steht, Kreditkarte oder Onlineüberweisung.
In früheren Zeiten wäre mir das wahrscheinlich ziemlich schmierig vorgekommen, aber das Internet hat irgendwie die eine Hälfte der Welt dazu gebracht, sich zum Vergnügen der anderen auszuziehen. Barney ist durchaus sexy. Trotzdem musste ich beim Betrachten seiner Fotos schlucken. Vielleicht kenne ich ihn einfach zu lange, aber das Ganze wirkte irgendwie schräg und inzestuös, so als würde eure Tante Gladys vor der kämpfenden Truppe die Bluse aufmachen und mit den Titten wackeln.
Jedenfalls gab es auf dieser Website auch noch Kontaktanzeigen. Ich verabschiedete mich also von Barneys zwinkerndem Schließmuskel und sah mich etwas genauer bei anderen Kerlen um, denen es um Sex, Freundschaft oder eine feste Beziehung ging. Da gab es natürlich jede Menge alte Knacker – und damit meine ich jeden meines Alters oder jenseits davon –, Normalos aus Lodi oder Tulsa, die tapfer lächelnd neben ihren Oldtimern standen oder sich in ihren Sonntagsstaat geworfen hatten. Bei den meisten waren zusätzlich Nahaufnahmen ihrer Erektionen zu bewundern, kunstsinnig von schräg unten geschossen, damit skeptische Besucher dieser Galerie sich davon überzeugen konnten, dass trotz des Schnees auf dem Dach noch immer Feuer im Ofen brannte.
Allerdings war ich überrascht, wie viele junge Burschen es hier gab, Zwanzig- oder Dreißigjährige, die nach Partnern über fünfundvierzig Ausschau hielten. Einer hatte es mir besonders angetan, ein Rotblonder mit Bürstenhaarschnitt und glänzenden braunen Augen – CLEANCUT-LAD4U. Der eigentliche Name wurde nicht genannt, aber seinem persönlichen Profil nach wohnte er in der Bay Area, war dreiunddreißig und «flexibel». Er lag gegen das Kopfende eines Bettes gelehnt, grinste schläfrig und hatte ein weißes Betttuch gerade so weit heruntergezogen, dass man das Schamhaar erahnen konnte. Ich kann immer noch nicht genau sagen, warum er mir wie jemand aus einem anderen Jahrhundert vorkam, ein handfester Kerl wie auf einer Daguerreotypie, lässig männlich und von zartem Gemüt.
Aber wie funktionierte das hier? Musste ich selbst ein Profil anlegen, oder konnte ich ihm direkt eine Mail schicken? Bestimmt würde er ein Foto sehen wollen. Sollte ich mich ausziehen? Mir scheint, dass die Jungen sich ein wenig Geheimniskrämerei leisten können, aber die Alten müssen schon zeigen, was sie haben. Was ja leichter gesagt als getan ist. Natürlich kann ein richtig guter Schwanz einen Senkarsch vergessen lassen, und manch einer steht auf einen netten rundlichen Bauch, aber wer kann schon was mit dem Niemandsland dazwischen anfangen, diesen schlappen Unterbauchfalten?
Vielleicht könnte ich in meinen schmutzigen Arbeitsklamotten mit heraushängendem Schwanz posieren (und mich NICENDIRTY4U nennen). Doch wer sollte so ein Foto machen? Logischerweise Barney, aber dass ausgerechnet er meinen ersten Internet-Auftritt inszenieren sollte, kam mir ziemlich gruselig vor, da musste doch eine andere Idee her. Und wen konnte ich schon täuschen? CleanCutLad bekam wahrscheinlich Hunderte von Angeboten pro Woche. Ich tat bestimmt besser daran, bei meiner monatlichen Nacht im Steamworks zu bleiben; da wurden die nackten Tatsachen hübsch ausgestellt, und wenn man eine Abfuhr kassierte, war sie kurz und schmerzlos.
Also beließ ich es dabei, druckte aber die Kontaktseite des Burschen noch aus und heftete sie über meinen Pflanztisch. Dort hing sie so lange, bis sich das Papier an den Ecken kräuselte – ein Pin-up-Boy für eine Schlacht, die nie geschlagen werden würde. Ohne die Einladung meiner Freundin Anna Madrigal zum Abendessen ins Caffe Sport hätte ich ihn wohl nie kennengelernt.
Das Caffe Sport ist ein kitschiges sizilianisches Kellerlokal an der Green Street in North Beach, praktisch am anderen Ende der Stadt; dort bekommt man riesige, sahnelastige Portionen von Pasta und Meeresfrüchten. Anna ist hier seit über dreißig Jahren Stammgast, und nicht selten hat sie den bäuerlichen Charme des Ladens dazu genutzt, mich aus meiner häuslichen Selbstzufriedenheit im Castro zu locken. Mit ihren fünfundachtzig Jahren ist Anna davon überzeugt, ich würde mich in zu eingefahrenen Bahnen bewegen: Ich bräuchte ein bisschen Aufregung, und genau dafür würde sie sorgen.
Da saßen wir also, inmitten von Farben und Gerüchen, und das Unmögliche geschah. Anna war gerade damit beschäftigt, ihren Turban zu richten. Sie schaute in den Spiegel hinter meinem Rücken und kämpfte mit ein paar widerspenstigen weißen Haarbüscheln. Trotzdem bekam sie irgendwie meinen Gesichtsausdruck mit.
«Was ist, mein Lieber?»
«Ich bin mir nicht sicher», sagte ich.
«Na ja, irgendwas muss doch sein.»
Eine größere Gruppe von Gästen schob sich Richtung Ausgang und verdeckte mir die Sicht. «Ich glaube, ich hab da jemanden gesehen.»
«Jemanden, den du kennst?»
«Nein … nicht wirklich.»
«Mhm … jemanden, den du kennenlernen möchtest.» Sie scheuchte mich mit ihrer großen behandschuhten Hand. «Na los, mach schon, hinterher.»
«Ich weiß nicht … »
«Aber natürlich. Hau ab. Ich bleibe hier bei meinem Wein sitzen.»
Ich sprang auf und schob mich durch die gedrängt stehende Gästeschar. Vor der Tür war er nicht zu sehen. Ich schaute nach rechts, wo die vom Nebel in Watte gepackten Neonreklamen der Columbus schimmerten, dann nach links Richtung Grant Avenue. Er war schon fast am Ende des Blocks und schritt kräftig aus. Mir blieb gar nichts anderes übrig, als mich lächerlich zu machen.
«Entschuldige bitte», brüllte ich hinter ihm her und trabte los.
Keine Reaktion. Er ging einfach weiter.
«Entschuldige bitte! Du im blauen Jackett!»
Er hielt inne und drehte sich um. «Ja?»
«Entschuldige, aber … , ich war da im Restaurant und … »
«O Mist.» Mit einer Reflexbewegung fasste er an seine Gesäßtasche. «Hab ich mein Portemonnaie vergessen?»
«Nein», antwortete ich. «Aber mich.»
Ich hatte gehofft, damit das Eis zu brechen, aber das ging völlig daneben: Der Kerl schaute mich ratlos und mit zusammengekniffenen Augen an.
«Ich glaube, ich hab dich auf einer Website gesehen.»
Noch mehr Augenkneifen.
«CLEANCUTLAD4U?»
Jetzt endlich lächelte er. Zwischen den beiden Schneidezähnen zeigte sich eine reizende Lücke, die den Eindruck eines fickbaren Norman-Rockwell-Typen nur noch verstärkte.
«Ich hätte dir ja auch mein Benutzerprofil mailen können», fuhr ich fort, «aber ich dachte, es ist einfacher, dir auf der Straße nachzustellen.»
Er lachte und hielt mir die Hand hin. «Ich bin Ben McCall.»
«Michael Tolliver.»
Er hielt meine Hand ein bisschen länger als erforderlich. «Ich habe dich im Restaurant gesehen, mit dieser Frau. Ist das deine Mutter?»
Ich kicherte. Das würde Anna großartig finden. «Nicht wirklich.»
«Sie sieht interessant aus.»
«Das ist sie, das kannst du mir glauben.» Allerdings kamen wir damit rapide vom Thema ab, und ich entschloss mich, den Stier bei den Hörnern zu packen. «Ich muss sie noch nach Hause bringen. Würde es dir was ausmachen, mir deine Telefonnummer zu geben? Oder kann ich dir meine geben?»
Er schien etwas überrascht. «Was auch immer», sagte er mit einem Schulterzucken.
Wir gingen zurück ins Restaurant und fragten nach Stift und Papier. Während Ben neben der Kasse stand und kritzelte, schaute ich quer durch den Raum; Anna beobachtete die Transaktion mit einem Ausdruck selbstzufriedener Erfüllung. Und das, wusste ich, war erst der Anfang; über so eine pikante Geschichte konnte sie sich wochenlang amüsieren.
«Oho, oho», sagte sie, kaum dass ich wieder an unserem Tisch war. «Hast du dir seinen Ausweis zeigen lassen?»
«Er ist dreiunddreißig, nun mach mal halblang.»
«Du hast ihn nach seinem Alter gefragt?»
«Ich hab’s aus dem Internet.»
«O schöne neue Welt», intonierte sie melodramatisch. «Machen wir noch einen Spaziergang runter zum Park, mein Lieber? Bevor’s in den Feierabend geht?»
«Dachte schon, du würdest nie mehr fragen.»
Also ging ich mit ihr hinunter zum Washington Park; dort saßen wir in der kühlen, nebligen Dunkelheit und teilten uns noch einen schnellen Joint, bevor es Zeit wurde, schlafen zu gehen.
2Umarmung, Ben
Und jetzt mal was für Rechenexperten. Ben ist einundzwanzig Jahre jünger als ich – eine ganze Generation jünger, wenn ihr es unbedingt so sehen wollt. Dieser Altersunterschied ist allerdings nicht typisch für mich. Mein erster Geliebter, Jon, der 1982 starb, war ein Jahr älter als ich, und Thack und ich sind nur ein paar Monate auseinander. Es stimmt zwar, dass ich in letzter Zeit mit Kerlen ausgegangen bin, von denen man sagen könnte, sie hätten die «besten Jahre» noch vor sich; aber das hat nie lange gehalten. Früher oder später langweilten sie mich bis zum Verblöden mit ihrem Gerede von Partys auf «Crystal Speed» oder der kulturellen Bedeutung von Paris Hiltons Hund. Und die meisten von ihnen, das muss ich leider so festhalten, glaubten auch noch, sie täten mir damit etwas Gutes.
Bevor ich Ben traf, hatte ich kaum Erfahrung mit «Daddy Hunters» gemacht. Ich wusste, es gab jüngere Kerle, die auf ältere Kerle standen, war aber immer der Meinung, dabei ginge es hauptsächlich um Geld und Macht. Doch Ben behauptet, dass er schon scharf auf ältere Männer war, als er noch in Colorado Springs wohnte und im Alter von zwölf anfing, über Zeitschriftenfotos zu wichsen. Er erinnert sich sogar noch daran, wie er von der Schule nach Hause rannte, um in der Sports Illustrated seines Vaters nach dem scharfen Foto von Jim Palmer in Jockeyshorts zu suchen. Jahre später las er in derselben Zeitschrift einen Artikel über Dr. Tom Waddell, den vormaligen olympischen Zehnkämpfer und Begründer der Gay Games. Die pure Existenz dieses schwulen Heroen gab ihm die Hoffnung, dass vielleicht einige der Männer, die er wollte, ihn ebenso wollten. All seine Zweifel verflogen, als er mit dem Collegeabschluss in der Tasche nach San Francisco übersiedelte. Im Starbucks oder The Edge traf Ben Daddies, die zwar manchmal etwas begriffsstutzig waren, was das Funkeln in seinen Augen betraf, aber es reichten eine Andeutung und ein wenig Ermunterung – dann übersprangen sie ganze Jahrzehnte mit einem einzigen Satz.
Und genau das tat ich auch, weiß Gott. Ben rief mich sofort am nächsten Morgen an, und ich lud ihn für denselben Tag zum Abendessen ein. Für den Fall, dass er dies nicht als Einladung zum Sex betrachten würde, kündigte ich einen Braten an. Und für den Fall, dass er dem Sex den Vorzug geben sollte, warf ich eine halbe Stunde vor seinem Eintreffen eine Viagra ein. Auf die Minute pünktlich stand er vor der Tür, in blassblauem T-Shirt und engen Diesel-Jeans; ich zog ihn an mich, und die Flasche Chianti, die er mitgebracht hatte, polterte zu Boden. Als wir uns endlich aus unserem Kuss lösten, stieß er einen Seufzer aus, der Erregung und Erleichterung zugleich ausdrückte: Hatte auch er befürchtet, den Braten vorher essen zu müssen?
Ich gab ihn frei und sagte: «Ich muss dir noch sagen, dass ich positiv bin.»
Er schaute mir in die Augen und grinste: «In welcher Hinsicht?»
«Ein bisschen mehr Respekt vor den Altvorderen, bitte», sagte ich und zog ihn Richtung Schlafzimmer.
«Weißt du was», sagte Ben hinterher, «ich glaube, ich hab dich schon mal gesehen.»
Er lag in meiner Armbeuge und trocknete nachdenklich die nasse Stelle; seine Finger fuhren dabei mit der heiteren Bedächtigkeit eines Zen-Mönches, der seinen Sandgarten recht, durch mein Brusthaar.
Ich fragte ihn, was er meinte.
«Ich glaube, du pflegst den Garten meiner Nachbarn.»
«Im Ernst?Wo?»
«In der Taraval Street.»
«Doch nicht Mrs. Gagnier?»
«Ich habe wirklich keine Ahnung, wie sie heißt.»
«Frankokanadierin, stimmt’s? Früh ergraut. Verarbeitet ihren Lavendel zu Marmelade.»
«Na ja, von der Marmelade weiß ich nichts, aber –»
«Aber ich. Letzte Weihnachten hat sie mir welche geschenkt. Schmeckt wie Shampoo.»
Er lachte leise. «Arbeitest du immer ohne Hemd?»
Zur Strafe kniff ich ihn ins Ohr. «Nur wenn ich glaube, da sitzt einer in den Büschen und spioniert mir nach.»
«Ich war nicht in den Büschen, ich war auf meinem Dach.»
«Warum hast du nicht gerufen oder irgendwas.»
«Weiß auch nicht. Von da oben war schwer zu erkennen, ob du schwul bist.»
Ich bedachte ihn mit einem erstaunten Stirnrunzeln. «Wie hoch ist denn dieses Dach?»
Er lachte und kuschelte sich wieder in meinen Arm. Eine Weile herrschte entspanntes Schweigen, dann sagte er: «Woher kennst du die Frau, mit der du zusammen warst?»
Ich erklärte, sie sei vor Jahren meine Vermieterin gewesen, als ich auf dem Russian Hill wohnte, erzählte ihm von der Marihuanapflanzung hinter dem Haus, von ihrer riesigen Kimonosammlung und dem verwinkelten alten Haus, das versteckt hinter einer Holztreppe lag, die steil wie ein Gebirgsmassiv aufragte.
«Wie kommt sie jetzt damit zurecht?»
«Gar nicht. Vor ein paar Jahren hatte sie einen Schlaganfall, also ist sie ins Duboce-Dreieck gezogen. Da gibt es Leute, die ihr mit dem Haushalt helfen, ein paar von uns teilen sich die Arbeit.»
«Ach, das ist gut.»
«Nicht, dass es Arbeit wäre», fügte ich hinzu. «Ich bin sehr gern bei ihr.»
«Klar.»
«Dadurch kommt sie dankenswerterweise unter Leute, und sie ist immer noch gut drauf, weißt du. Sie ist immer noch ein Freigeist. Das schafft wirklich kaum eine Transe.»
Einen Augenblick lang blinzelte er. «Du meinst … ?»
Ich lächelte zustimmend. «Sie war die erste, die ich kennengelernt habe.»
«Das bekommt sie ja ziemlich gut hin», antwortete er.
Darin hatte sie einige Übung, erzählte ich ihm, sie war ja schon gut vierzig Jahre eine Frau, länger, als sie keine gewesen war.
Ben ließ das einen Moment sacken. «Irgendwann möchte ich sie gerne mal treffen.»
Schon das kam mir gut und richtig vor.
Nach dieser ersten funkensprühenden Nacht trafen Ben und ich uns in den nächsten drei oder vier Monaten zweimal die Woche. Ben war freundlich, heiter und voller Verständnis für alles, wovor mir in den letzten Jahren zunehmend gegraut hatte: mein dicker werdender Rumpf, der verweichlichte Hintern und die grauen Haare, die sich flächenbrandartig auf meinem Brustkorb ausbreiteten. Manche Menschen meinen, man sei erst dann erwachsen, wenn beide Eltern gestorben sind; ich wurde erwachsen, als ich jemanden traf, der denjenigen begehrte, der ich geworden war. Jahrelang hatte ich in einer Art aufgeschobener Kindheit gelebt, hatte beim Zählen meiner Krähenfüße nach dem Mann Ausschau gehalten, dessen allumfassende Liebe es schließlich richten würde. Ben ließ mich glauben, ich könnte dieser Mann sein. Nicht als eine Art Vaterfigur, falls ihr das denkt – dafür war Ben viel zu unabhängig –, sondern einfach als jemand, der wusste, wie es sich anfühlt, wenn man um väterlichen Trost und väterliche Zärtlichkeit betrogen worden ist. Jemand, der dir all das geben kann.
Ben zu lieben würde sein, wie ein sehr viel jüngeres Selbst von mir zu lieben.
Trotzdem versuchte ich, mir nichts vorzumachen. Es gab wenig Anlass zu glauben, dass Ben in Sachen Liebe überhaupt auf dem Markt war. Die E-Mails, die er mir von der Arbeit schickte, schlossen üblicherweise mit «Umarmung, Ben» – für mich ein todsicheres Zeichen, dass er uns als kompatible Bettgenossen betrachtete und nichts anderes. Es stimmte zwar, dass er bereits häufiger Partner gehabt hatte, und immer ältere Männer, aber er war schon erschütternd eigenständig. Meine Stimmung ging in den Keller, wenn er von Plänen zum Umbau seiner kleinen Einzimmerwohnung berichtete oder davon schwärmte, in der Wildnis von Alaska zu wandern und dort stundenlang auf Berggipfeln zu sitzen, um die Einsamkeit zu genießen. Selbst Bens Job bei einem Möbeldesigner südlich der Market Street beunruhigte mich, denn er hoffte, dadurch eines Tages die Möglichkeit zu bekommen, in Mailand oder Paris zu leben.
In keinem dieser Szenarien, hatte ich den Eindruck, gab es viel Platz für mich.
Und trotzdem fand ich sie alle aufregend. Ich liebte es, mir vorzustellen, wie Ben in seinem streichholzschachtelgroßen Zimmer in der Taraval Street saß und sich vor dem Zubettgehen einen Hibiskustee machte. Oder wie er nackt in einem Wildbach schwamm, während seine Jeans auf einem Felsblock am Ufer von der Sonne warm gehalten wurde. Als ich in Bens Alter oder jünger war, habe ich mich oft und heftig in solch männliche Freigeister verliebt, obwohl die meine Zuneigung nur selten erwiderten. Dass mein Prinz jetzt kommen sollte, so begierig wie begehrenswert, war nur schwer zu glauben.
Ich nahm also jeden Tag, wie er kam, und registrierte sorgfältig auch das kleinste Pflänzchen Hoffnung am Wegesrand. Den Tag, an dem er mir Skizzen der Anrichte zeigte, die er gerade entwarf. Den Abend, an dem er uns weiße Pfirsiche vom Farmers Market mitbrachte. Einen Sonntagsausflug über die Golden Gate Bridge zur Küste von Marin County, wo wir den ganzen Tag lang wie alte Kumpel auf einer Armeedecke lagen und null Sex hatten. Die letzten Zweifel verflogen, als aus «Umarmung, Ben» «In Liebe, Ben» wurde, sich die Schleusen endlich öffneten und unsere E-Mails von verwegenen, blumigen Kosenamen überquollen:
Mein süßer Junge
Mein hübscher Mann
Mein Wunderbarer
Mein Eigen
Wir saßen auf einer Bank an Lands End und schauten auf die Brücke, die in der gleichen Farbe erstrahlte wie der Sonnenuntergang, als Ben mit der Frage herausplatzte:
«Ich glaube nicht, dass ich jemals völlig monogam sein könnte. Du etwa?»
Das verschlug mir erst mal die Sprache.
«Ich meine», fuhr er fort, «ich bin wirklich nicht süchtig nach Sex oder so. Das solltest du wirklich nicht glauben … aber manchmal, weißt du, ergeben sich einfach Gelegenheiten.
Und wenn man den Kerl, mit dem man zusammen ist, wirklich liebt … und man sich als Seelenfreunde versteht und all das … , sollte man einander solche Erfahrungen nicht wünschen? Ich meine, sollte die Liebe das nicht möglich machen?»
«Mmm.» Das war mehr ein Geräusch als eine richtige Antwort.
«Jeder, den ich kenne und der monogam lebt, fängt irgendwann mit Heimlichkeiten an und betrügt damit gerade den Menschen, der ihm am wichtigsten ist. Das tut viel mehr weh als … sich über gewisse Regeln zu einigen, damit die Liebe zueinander die Dinge besser werden lässt. Meiner Meinung nach sind Männer nicht monogam, und wenn man sich in dieses Korsett pressen lässt, gibt es irgendwann auf allen Seiten gebrochene Herzen, oder man kastriert sich völlig. Ich meine nicht jede Woche einen neuen Betthasen, nicht mal unbedingt jeden Monat, aber solange man offen damit umgeht und es keinen Einfluss auf … du weißt schon … die Vertrautheit miteinander hat oder anfängt, na … , eine Romanze zu werden oder eine Angelegenheit, die … wissentlich verletzt, dann weiß ich nicht, warum zwei Menschen sich nicht darüber einigen können, dass … » Irgendwie war er durcheinandergeraten und verstummte. «Michael, wann immer du in ein Bett hüpfen möchtest, tu es.»
Ich streichelte ihm kurz über die Wange. «Du bist zu jung, um monogam zu sein», ließ ich ihn wissen, «und ich bin zu alt.»
Einen Augenblick lang sah er mich prüfend an. «Meinst du das ernst?»
Ich nickte mit einem schwachen Lächeln. «In gewisser Weise wünschte ich, nein. Aber ich meine es so. Ich weiß einfach zu viel über das Leben, um anderer Meinung zu sein. Was aber nicht heißt, dass ich nicht immer noch eifersüchtig werden kann … »
«Gut!», entfuhr es ihm.
«Tatsächlich?»
«Na ja, sicher, weil ich auch eifersüchtig werden kann. Und in Bezug auf dich richtig eifersüchtig.»
Warum fühlte sich das so gut an? «Wir werden zusammen daran arbeiten», sagte ich.
Jetzt grinste er breit, und da war sie wieder, diese anbetungswürdige Zahnlücke. «Sagen wir – dreißig Jahre?»
Ich begann, an den Fingern abzuzählen. «Das ließe sich wohl einrichten, ja.»
Am nächsten Tag löschte er seine Kontaktanzeige von der Website.
Und das sagte mehr als jede Heiratsurkunde vom Standesamt.
3Nicht mehr zu retten
Na gut, dreißig Jahre sind – angesichts des Virus, mit dem ich nun schon seit zwanzig Jahren lebe – vielleicht etwas hoch gegriffen. Ich stecke immer noch im «Tal der Schatten» (wie Mama sagen würde), aber immerhin ist es heutzutage ein größeres Tal, und die Szenerie hat sich beträchtlich aufgehellt. In den besten Momenten erfüllt mich ein merkwürdiger Friede, lebe ich eine beinahe annehmbare Imitation früherer Zeiten. Aber dann sinkt der Wert meiner T-Zellen plötzlich ab, oder ich bekomme einen heftigen Ausschlag auf dem Rücken oder scheiße meine beste Cordsamthose voll, während ich bei der Verkehrsbehörde in der Schlange stehe, und so werde ich immer wieder daran erinnert, wie verdammt wackelig das alles ist. Mein Leben – wie lange es auch dauern mag – ist immer noch ein schwankendes Vehikel in Schräglage, das von Kaugummi und Blumendraht zusammengehalten wird.
Und der Clou von alldem ist: Je länger man mit dem Virus lebt, desto näher kommt man einem normalen Tod. Zurzeit besteht mein Rezept zum Weiterleben aus einer gut austarierten Mélange von Viramun und Combivir, die sich in meinem Medizinschränkchen einen Platz neben Lipitor, Wellbutrin und Glukosamin Chondroitin erkämpft haben, jenen heilsamen Helferlein, die gemeinhin für Alter und Hinfälligkeit stehen. (Na ja, vielleicht nicht Wellbutrin, da ja auch junge Leute Depressionen haben – aber während meiner Jugend war das einfach kein Thema.) Das alles strotzt geradezu von Ironie, von Lektionen, die es zu lernen gilt über das Schicksal und die Unberechenbarkeit des Todes und wie das Leben weitergeht, solange es gutgeht, aber genau davon werdet ihr hier nichts zu lesen bekommen. Ich jedenfalls habe durch die Krankheit mehr als genug gelernt.
Es mag merkwürdig erscheinen, aber ich kann mich noch an die Zeit erinnern, als ich sicher war, nicht mal meinen Hund zu überleben. Das gab ich in einer regnerischen Winternacht Harry dem Hund höchstpersönlich zu verstehen, als Thack geschäftlich unterwegs war. Harry lag zusammengerollt auf meinem Schoß, und ich erklärte ihm, dass ich ihn bald verlassen würde, aber er solle sich keine Sorgen machen, ich würde an einem besseren Ort sein. Ich habe keine Ahnung, was da in mich gefahren ist: Ich glaube nicht mal an einen besseren Ort. Aber dort saß ich, krank vor Angst, und versuchte, wie Eltern es mit ihren Kindern machen, mich über das Vergessen hinwegzutrösten. Fünf Jahre später war aus meiner kleinen Notlüge eine schwarze Komödie geworden: Ich begrub Harry unter einem Stein im Garten.
Bei meiner Mutter erging es mir ähnlich. Damals, in der Zeit nächtlicher Schweißattacken und endloser Müdigkeit, gab es kaum einen Grund, nicht anzunehmen, dass ich vor meiner Mutter ins Grab sinken würde. Tatsächlich plädierte Mama selbst tatkräftig dafür, mich «auf diesen netten Friedhof in Orlando, nicht weit von Disneyworld» zu expedieren. Ein paar Jahre zuvor war mein Vater dort beerdigt worden, und Mama schien dazu ausersehen und entschlossen, eine Tradition zu begründen: eine Art Familienzusammenführung, ohne die Mountainbikes und den Jell-O-Salat. Ich versuchte sie behutsam davon abzubringen, aber mein Bruder kapitulierte und kaufte eine Grabstätte, in der problemlos seine ganze Familie Platz finden würde, auch seine Tochter, die nach St. Pete gezogen war und dort für das Verkaufsfernsehen arbeitete. Irwin ist siebenundfünfzig, Christ und Immobilienmakler; beides so von Herzen, dass er Mitglied bei den «Christlichen Immobilienmaklern» geworden ist.
Ich will hier niemanden verarschen: Die haben sogar eine Website mit allem Drum und Dran.
Irwin war derjenige, der anrief: Mama fühle sich schlecht, sagte er, und vielleicht wolle ich ja kurzfristig nach Hause kommen.
«Ich will dir keine Angst machen, Mikey, aber ich dachte, du solltest es wissen.»
«Schon in Ordnung, Irwin. Das ist nett von dir.»
«Es kann sechs Wochen dauern oder sechs Monate, aber es sieht nicht gut aus.»
So schwer diese Nachricht zu verdauen war, sie überraschte mich nicht. Das Lungenemphysem meiner Mutter, Folge einer jahrzehntelangen Emanzipation mittels Virginia Slims, hatte ihr bereits den permanenten Aufenthalt in einem christlichen Genesungsheim in Orlovista, Florida, beschert, wo sie sich in einem Wald von vergilbenden Familienfotos auf dem Weg zum Sterben erholte.
«Hat sie Schmerzen?»
«Eigentlich nicht», sagte Irwin. «Sie keucht halt, weißt du. Sie hat in letzter Zeit häufig nach dir gefragt.»
«Nun gut, sag ihr, dass ich bald komme. Ich habe noch ein paar Meilen angespart.»
«Toll … das ist toll, Mikey.»
Ich fragte ihn, ob Mama das Geburtstagsgeschenk mochte, das ich ihr vor ein paar Wochen geschickt hatte: Der Schnappschuss in einem silbernen Rahmen zeigte mich und Ben kurz nach unserer Hochzeit neben einem Wasserfall in Big Sur. Niemand hatte ein Wort darüber verloren, und ich hatte mir meine Gedanken gemacht.
Er musste einen Augenblick nachdenken. «Oh, ja … das Bild.»
«Richtig.»
Er kicherte nervös. «Der war gut, Mikey. Hat mich eine Weile beschäftigt.»
«Was meinst du damit?»
«Komm schon. Das ist einer deiner Mitarbeiter, stimmt’s? Oder ein Freund oder so.»
«Nein», sagte ich so geduldig, als spräche ich mit einem Dreijährigen. «Das ist Ben. Das ist mein Gatte. Der, von dem ich dir erzählt habe.»
«Oh … , tut mir leid … Ich habe … , er sah so … »
«Muss dir nicht leidtun.»
«Aber ist das nicht wieder annulliert worden oder so?»
Mir blieb nichts anderes übrig, als ihn zu quälen. «Was meinst du damit?»
«Du weißt doch … der Staatsgerichtshof hat eine Entscheidung gefällt, oder nicht?»
«Willst du mich verscheißern?»
«Nein. Das haben sie doch rückgängig gemacht. Es kam in allen Nachrichten, Mikey … , sogar in Florida.»
Darauf kannst du deinen Arsch wetten. Dazu Tanz und Gesang auf den Straßen, zweifelsohne. Ist wahrscheinlich längst ein offizieller Feiertag.
«Das ist ja schrecklich», sagte ich betrübt.
«Ich kann’s kaum glauben, dass du nichts davon gehört hast.»
«Weißt du, was das bedeutet?», sagte ich. «Dass Ben und ich seither in Sünde leben.»
Nach einem Augenblick ging ihm ein Licht auf, und er ächzte genervt. «Siehst du», sagte er, «das meine ich. Immer versuchst du, mich aufzuziehen. Keine verflixte Geschichte kann man dir glauben.»
«Auch keine verfluchte», fügte ich lachend hinzu.
Jetzt lachte er ebenfalls. «Also komm schon, Bruderherz. Du schickst uns ein Foto von … ich weiß nicht … Huckleberry Finn oder so … und erzählst uns, das sei dein Gatte … »
«Wenn dir das weiterhilft», sagte ich, «er ist älter, als er aussieht.»
Schweigen, und dann: «Wie alt ist er denn?»
«Wie alt war Jesus, als er von den Toten auferstand?»
«Mikey, wenn du jetzt respektlos wirst … »
«Ich geb dir einen Anhaltspunkt, Irwin.»
«Oh.»
«Ben ist ein erwachsener Mann, mehr will ich gar nicht sagen. Er hat schon sein eigenes Leben gelebt. Er muss nicht mehr zur Schule.»
«Du meinst, er ist dreiunddreißig?»
«Sehr gut. Eins mit Sternchen für dich.»
«Na gut … » Irwin räusperte sich und machte sich für einen heldenhaften Sprung in den Abgrund bereit. «Er sieht nett aus … , ich meine, sieht wie ein netter Typ aus … , dem Foto nach.»
«Das ist er, Irwin. Er hat ein Herz und ein Gewissen, und uns verbindet ein sehr starkes Band. Wir können miteinander reden, weißt du. Die Sache mit dem Alter ist kein Thema.» Ich versuchte jetzt, ganz offen zu ihm zu sein, wollte, dass er die Bedeutung dessen, was mir widerfahren war, verstand. «Ich werde ihn mitbringen», sagte ich, «wenn er mitkommen will.»
Er brauchte eine Weile für eine Antwort. «Nun ja … , das ist gut. Ich meine, es ist gut, einen Rückhalt zu haben in Zeiten wie diesen.»
Nicht schlecht, Irwin.
«Ich würde dir ja anbieten, bei uns zu wohnen», fuhr er fort, «aber Lenore hat ihre Puppen über das ganze Gästezimmer verteilt. So ein Durcheinander hast du noch nicht gesehen.»
«Schau mal, wir brauchen wirklich … »
«Und … , hätte ich fast vergessen … , die Böden werden neu gemacht, weißt du, das Ganze wird … ein ziemliches Katastrophengebiet.»
«Danke für das Angebot, aber ich schätze, wir werden uns nach einem Motel umsehen. Ein Motel, das kann ich mir sogar ziemlich gut vorstellen. Ein neutraler Ort, weißt du. Und ein bisschen Zurückgezogenheit.»
«Bist du sicher?» Irwins Erleichterung sprudelte nur so aus dem Telefonhörer. «Ich könnte doch zumindest eine Wohnung für euch suchen. Meines Wissens haben wir drüben beim Gospel Palms eine leere Musterwohnung.»
Das Gospel Palms war Mamas Genesungsheim.
«Schon in Ordnung», ließ ich ihn wissen. «Wir werden bestimmt was in der Nähe finden.» (Sogar in Orlando, nahm ich an, sollte es ein annehmbares schwules Bed & Breakfast geben.)
«Na dann – gut.»
«Ich ruf dich an, wenn wir uns ein Datum überlegt haben.»
«Mama wird ziemlich glücklich sein, Mikey.»
«Gut. Drück sie von mir, wenn du sie siehst.»
Und das Bild, großer Bruder. Gib ihr das verdammte Bild.
Um das mal ins rechte Licht zu rücken: Meine Familie weiß seit dreißig Jahren, dass ich schwul bin. Als meine Mutter sich 1977 Anita Bryants Kampagne «Rettet unsere Kinder» anschloss, weil sie wider alle Vernunft der Hoffnung war, ihre beiden Söhne würden nicht in die Fänge der Homosexuellen geraten, schrieb ich ihr einen Brief. Der Nachricht, dass ich nicht mehr zu retten war – und darüber nichts als glücklich, vielen, vielen Dank –, wurde zunächst schweigend und dann mit einem einsamen Kastenkuchen begegnet, den ich als ersten linkischen Schritt in Richtung Erleuchtung ansah.
Aber, he, es war ja bloß ein Kastenkuchen. Meine Familie liebte mich, schon richtig, doch für sie bedeutete diese Liebe, dass sie mir vergaben, und nicht, dass sie mich akzeptierten. Und obwohl Mama und Papa letzten Endes zwei meiner drei Partner kennengelernt hatten – den, der gestorben, und den, der gegangen war –, sahen sie überhaupt keinen Anlass, ihren Standpunkt zu ändern. Bequemerweise hatten sie mein Leben damals auf einen «Lebensstil» reduziert, den sie einfach von mir abspalten und von Herzen verabscheuen konnten, ohne die Angst, als «unchristlich» zu gelten. Als die Berliner Mauer fiel und die Kommunisten auf den großen Fernsehschirmen in der Kirche meines Bruder durch Schwule ersetzt wurden, wusste ich, dass kein Wunder mehr zu erwarten stand; meine Familie war ebenso wenig zu retten wie ich.
«Und dein Bruder ist wirklich Diakon in einer Kirche?»
Bens Stimme kam aus dem Badezimmer gegenüber, wo ich ihn in einer Schublade herumstöbern hörte. Es war kurz nach acht am Abend, und ich lag schon auf dem Bauch im Bett, meine neuen Lucky-Jeans bis zu den Knöcheln heruntergeschoben.
Ich drehte den Kopf in seine Richtung. «Wohl eher ein Sonntagsschullehrer, glaube ich. Ich verstehe die Hierarchie nicht. Da hat jeder irgendwas zu tun.»
«Wirklich?»
«Letztes Jahr war Lenore – das ist Irwins Frau – für die Fötus-Schlüsselanhänger zuständig.»
«Ach, komm!»
«Nein … sie haben da tatsächlich so kleine Plastikfiguren verkauft, die genau die Form eines noch nicht weit entwickelten Fötus hatten. Du weißt schon, damit du ihn mit dir rumtragen kannst und ihn besser kennenlernst. So nach dem Motto: ‹Föten sind auch Menschen.›»
Ben kam ins Zimmer, setzte sich neben mich aufs Bett und riss eine Plastikverpackung auf. «Das ist ja gruselig», murmelte er.
«Du hättest erst mal den riesengroßen sehen sollen, den sie zu Halloween aufgestellt haben.»
«Was meinst du damit?» Ben nahm den Alkoholtupfer aus der Packung. «Wo aufgestellt?» Mit dem Finger zog er eine Linie vom oberen Ende meiner Arschfalte zum östlichen Hügel und bearbeitete das Zielgebiet mit ein paar schnellen Handbewegungen.
«In einem Spukhaus», erklärte ich ihm. «Du weißt schon … , wie für Kinder. Nur dass es da keine Spaghettigedärme und Augäpfel in Soße gibt, sondern den ‹Riesengroßen abgetriebenen Fötus›.»
Ben ächzte.