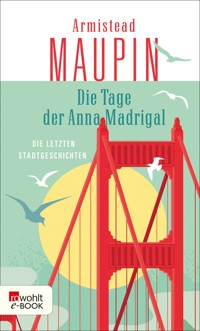7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Stadtgeschichten
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Wie alles begann - die legendären Vorgeschichten zur "Serie der Stunde" (Spiegel online) auf Netflix. «Ich liebe Maupins Bücher aus demselben Grund, aus dem ich die Romane von Dickens liebe.» (Christopher Isherwood) Band vier der «Stadtgeschichten» spielt sich wieder rund um das Haus in der Barbary Lane 28 ab. Diesmal geht es um den Hausmann Brian und seine Karriere-Ehefrau Mary Ann, denen trotz heftigster Versuche eines nicht gelingen will: ein Kind. Hilfe naht von Königin Elisabeth II., auf Staatsbesuch in San Francisco, und von einem flotten Leutnant, der von der königlichen Yacht desertiert. Weitere Assistenz beim Kindermachen: ein trauernder schwuler Nachbar sowie eine dubiose Organisation zur Vermittlung exotischer Bräute. «Ein unaufdringliches kleines Meisterwerk.» (USA Today) «Ein wirklich langer Liebesbrief an das zauberhafte San Francisco.» (New York Times Book Review)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 427
Ähnliche
Armistead Maupin
Tollivers Reisen
Band 4
Aus dem Englischen von Carl Weissner
Rowohlt E-Book
Inhaltsübersicht
When you feel your song is orchestrated wrong,
Why should you prolong
Your stay?
When the wind and the weather blow your Dreams sky-high,
Sail away – sail away – sail away!
Wenn dein Lied nicht mehr gut klingt,
Warum dann noch
Länger bleiben?
Wenn Wind und Wetter deine Träume
In den Himmel wirbeln,
Lass dich treiben – lass dich treiben – lass dich treiben!
Noël Coward
Für Christopher Isherwood und Don Bachardy, in herzlicher Erinnerung an Daniel Katz 1956–1982 und erneut für Steve Beery
Notiz für Lord Jamie Neidpath
Easley House mag sehr an Stanway House erinnern, doch Lord Teddy Roughton hat keinerlei Ähnlichkeit mit dir. Wir beide wissen das. Jetzt wissen es auch die anderen.
Cheers.
A. M.
Ein königlicher Empfang
Sie war siebenundfünfzig, als sie San Francisco zum ersten Mal sah. Als ihre Limousine das Betonlabyrinth des Flughafens verließ, spähte sie durchs Fenster in den strömenden Regen und kommentierte das abscheuliche Wetter mit einem leisen Seufzer.
«Ich weiß», sagte Philip, der ihre Gedanken erriet. «Aber sie rechnen damit, dass es heute aufklart.»
Sie erwiderte sein leichtes Lächeln und kramte in ihrer Handtasche nach einem Papiertaschentuch. Seit der Abreise von der Ranch der Reagans fühlte sie sich ein wenig erkältet, doch ein Schnupfen sollte bei ihr auf entschlossenen Widerstand stoßen.
Die Autokolonne fuhr jetzt auf einen breiten Highway – einen «Freeway», wie sie vermutete –, und bald glitten sie in rascher Fahrt durch die Regenfluten, vorbei an schauerlichen Motels und Reklametafeln von albtraumhaften Dimensionen. Links ragte ein baumloser Hügel auf, der so unnatürlich grün war, dass man sich wie in Irland vorkam. Am Hang war mit weißen Steinen ein Schriftzug ausgelegt: SOUTH SAN FRANCISCO – THE INDUSTRIAL CITY.
Philip sah, wie sie das Gesicht verzog, und beugte sich vor, um die merkwürdigen Hieroglyphen zu studieren.
«Seltsam», murmelte er.
«Mmm», erwiderte sie.
Sie konnte nur hoffen, dass dies noch nicht die eigentliche Stadt war. Das schäbige Gewerbegebiet sah aus wie ein Abklatsch von Ruislip oder Wapping oder einem der grässlichen kleinen Vororte in der Nähe von Gatwick Airport. Nun, sie durfte sich nicht jetzt schon das Schlimmste ausmalen.
Nach dem ursprünglichen Plan hätte sie an Bord der Britannia in San Francisco eintreffen sollen – was die erfreuliche Aussicht geboten hätte, unter der Golden Gate Bridge hindurchzugleiten. Doch als sie Los Angeles erreicht hatte, war die See recht tückisch geworden, und die Unwetter, die sechs kalifornische Flüsse über die Ufer treten ließen, hätten mit ziemlicher Sicherheit auch ihrem unzuverlässigen Magen bös zugesetzt.
Deshalb hatte sie sich für dieses nicht besonders majestätische Entree per Flugzeug und Auto entschieden. Sie würde die Nacht in einem Hotel verbringen und sich dann wieder auf der Britannia einquartieren, wenn diese am folgenden Tag im Hafen eintraf. Da sie ihrem Zeitplan um fast sechzehn Stunden voraus war, hatte sie den Abend ganz für sich, und der Gedanke an so viel Muße und Freizeit ließ ihr unverhofft kleine Schauer der Vorfreude über den Rücken laufen.
Wo würde sie am Abend speisen? Vielleicht im Hotel? Oder bei jemandem zu Hause? Aber bei wem? Das war eine heikle Frage, denn sie hatte bereits inständige Einladungen von mehreren Damen der hiesigen Gesellschaft erhalten; darunter auch und hier überkam sie ein leichtes Schaudern – von dieser grauenhaften Person mit den Erdölraffinerien und dem vielen Haar.
Sie klammerte das Abendessen vorerst aus und wandte sich wieder der vorbeihuschenden Szenerie zu. Der Regen schien ein wenig nachgelassen zu haben, und am schiefergrauen Himmel zeigten sich da und dort ein paar zaghafte blaue Stellen. Dann tauchte wie aus dem Nichts die City vor ihr auf – ein Durcheinander von hochkant stehenden Keksschachteln, das sie vage an Sydney erinnerte.
«Schau!», rief Philip begeistert. Er zeigte auf einen schillernden Regenbogen, der wie ein Diadem über der Stadt schwebte.
«Was für ein prächtiger Anblick», murmelte sie.
«Wahrhaftig. Die Protokollabteilung hat hier wirklich an alles gedacht.»
Sie kicherte über seinen kleinen Scherz und fühlte sich zunehmend unbeschwert. Es schien angebracht, den Augenblick zu würdigen, indem sie den Bürgern huldreich zuwinkte, aber für Menschenansammlungen war entlang dieser Hauptverkehrsader kein Platz. Also ignorierte sie den Impuls und zog sich stattdessen die Lippen nach.
Der Regen war zu einem Nieseln verkümmert, als die Autokolonne vom Highway abbog und in eine Gegend mit flachen Lagerhallen und vergammelten Cafés kam. An der ersten Kreuzung wurde das Tempo dramatisch gedrosselt, und Philip machte sie mit einer Kopfbewegung auf etwas aufmerksam.
«Da drüben, Liebes. Deine ersten Jubler.»
Sie wandte ein wenig den Kopf zur Seite und winkte einigen Dutzend Leuten zu, die sich an der Straßenecke versammelt hatten. Sie winkten kräftig zurück und hielten ein schwarzledernes Transparent hoch, auf dem in Buchstaben aus silberglänzenden Nieten zu lesen war: GOD SAVE THE QUEEN. Erst als sie die Rufe hörte, merkte sie, dass die Jubler alle Männer waren.
Philip rang sich ein mattes Grinsen ab.
«Was ist?», fragte sie.
«Homos», sagte er.
«Wo?»
«Da, Liebes. Die mit dem Transparent.»
Sie warf einen Blick nach hinten und sah, dass sie vor einem Gebäude standen, das sich Arena nannte. «Sei nicht albern», sagte sie. «Das sind irgendwelche Sportler.»
Ein heißer Tipp von Mrs. Halcyon
Im Marina Safeway waren in der Woche vor dem Besuch von Elizabeth II englische Muffins, Imperial Margarine und Royal Crown Cola im Sonderangebot gewesen. Der Flag Store in der Polk Street hatte einen Ansturm auf britische Fahnen gemeldet, und nicht weniger als drei Bars im Castro-Distrikt hatten es unternommen, Wettbewerbe für «Betty Windsor»-Tucken auszurichten.
All dies und mehr war von Mary Ann Singleton – und tausend anderen Reportern – in den aufreibenden Tagen, die dem königlichen Besuch vorausgingen, gewissenhaft dokumentiert worden. Mary Ann hatte auf ihrer Suche nach queenmäßigen Bezugspunkten Tea Rooms in der Maiden Lane abgeklappert, irische Bars in North Beach und Bäckereien in den Avenues, wo rosenwangige Chicanas Steak-und-Nieren-Pasteten für «Olde English»-Restaurants produzierten.
Kein Wunder also, dass das Eintreffen Ihrer Majestät alle aufatmen ließ, aber auch ein enttäuschendes Gefühl der Leere auslöste. Gepeinigt vom unaufhörlichen Regen warteten Mary Ann und ihr Kameramann fast eine ganze Stunde vor dem Hotel St. Francis, nur um feststellen zu müssen (als es schon zu spät war), dass die königliche Limousine diskret in der Tiefgarage des Hotels verschwunden war.
Mary Ann rettete, was noch zu retten war, und lieferte einen Livebericht von der Einfahrt der Garage. Dann schleppte sie sich nach Hause in die Barbary Lane 28, kickte die Schuhe von den Füßen, nahm den ersten Zug von einem Joint und rief ihren Mann bei der Arbeit an.
Sie verabredeten sich am Abend fürs Kino. Gandhi.
Sie wärmte sich gerade einen Rest Schmorbraten auf, als das Telefon läutete.
«-lo», murmelte sie mit vollem Mund.
«Mary Ann?» Die forsche Patrizierstimme von DeDe Halcyon Day.
«Hallo», sagte Mary Ann. «Du musst entschuldigen, ich futtere mich gerade um den Verstand.»
DeDe lachte. «Ich hab deinen Bericht in Bay Window gesehen.»
«Na großartig», sagte Mary Ann geknickt. «Sehr tiefschürfend, was? Ich schätze, jetzt reicht’s mir höchstens noch für einen Emmy.»
«Na, na. Du hast das einwandfrei gebracht.»
«Von wegen.»
«Und wir fanden deinen Hut ganz toll. Er war viel schöner als der von der Bürgermeisterin. Sogar Mutter hat es gesagt.»
Mary Ann verzog das Gesicht, obwohl niemand was davon hatte. Es war zum ersten Mal seit Jahren, dass sie einen getragen hatte, und sie hatte ihn nur aus Anlass des königlichen Besuchs gekauft. «Freut mich, dass er euch gefallen hat», sagte sie trocken. «Ich fand, dass er für eine Tiefgarage vielleicht ein bisschen aufwendig war.»
«Hör mal», sagte DeDe, «warum bist du eigentlich nicht hier? Ich hatte erwartet, dich hier zu sehen.»
«Wo? In Hillsborough?»
DeDe gab einen missmutigen Seufzer von sich. «Im Trader Vic’s natürlich.»
Die meisten Reichen sind nervig, entschied Mary Ann. Nicht weil sie anders sind, sondern weil sie so tun, als würden sie den Unterschied nicht merken. «DeDe», sagte sie so ruhig, wie sie konnte, «das Trader Vic’s gehört nicht grade zu meinen Stammlokalen.»
«Na schön, aber … willst du sie denn nicht sehen?»
«Wen denn?»
«Die Queen, du Dummchen.»
«Die Queen ist im Trader Vic’s?» Totaler Unsinn.
«Moment mal», sagte DeDe. «Du hast das nicht gewusst?»
«DeDe, um Gottes willen … ist sie da?»
«Noch nicht. Aber sie ist auf dem Weg hierher. Ich hatte fest damit gerechnet, dass dir der Sender Bescheid sagt …»
«Bist du sicher?»
«Irgendjemand ist sicher. Auf den Straßen wimmelt es von Bullen, und in der Captain’s Cabin sieht’s aus wie nach einer Opernpremiere. Schau, Vita Keating hat es Mutter gesagt, und Vita hat es von Denise Hale, also muss es wohl stimmen.»
Mary Anns Zweifel verharrten wie eine Narkose. «Ich hab eigentlich nicht gedacht, dass die Queen in Restaurants geht.»
DeDe lachte. «Tut sie auch nicht. Vita sagt, es ist das erste Mal seit siebzehn Jahren!»
«Meine Güte», sagte Mary Ann.
«Wir haben jedenfalls Plätze ganz vorne», fuhr DeDe fort. «Ich bin mit Mutter und D’or und den Kindern da, und wir würden uns freuen, wenn du dazukommen kannst. Mit Brian natürlich.»
«Er muss arbeiten», sagte Mary Ann, «aber ich würde liebend gern kommen.»
«Gut.»
«DeDe, sind noch andere Reporter da? Siehst du jemand vom Fernsehen?»
«Nö. Halt dich ran, und du hast sie ganz für dich.»
Mary Ann stieß einen Freudenschrei aus. «Du bist ein Engel, DeDe! Ich komme, sobald ich ein Taxi erwische!»
Sie drückte die Gabel nieder, rief im Sender an und alarmierte den Leiter der Nachrichtenredaktion. Er war begreiflicherweise skeptisch, versicherte ihr aber, er werde sofort ein Team losschicken. Dann rief sie ein Taxi, schminkte sich, zog ihre Schuhe wieder an und kritzelte hastig einen Zettel für Brian.
Sie eilte bereits durch den dichtbelaubten Canyon der Barbary Lane, als ihr einfiel, was sie vergessen hatte. «Scheiße», murmelte sie, machte nach kurzem Zögern kehrt und rannte zurück, um ihren Hut zu holen.
Als sie am Cosmo Place aus dem Taxi stieg, staunte sie wieder einmal über die mystische Aura, die das Trader Vic’s umgab. Strenggenommen war das ach-so-fashionable polynesische Restaurant nur eine Baracke in einer Seitengasse am Rand des Rotlichtviertels. Doch Leute, die sich im verkitschten Tonga Room auf dem Nob Hill nie hätten erwischen lassen, würden ihre Großmutter umbringen, um sich im Trader Vic’s im gleichen Dekor sonnen zu können.
Der Empfangschef gab sich an diesem Abend besonders streng, doch sie besänftigte ihn mit den magischen Worten – «Mrs. Halcyon erwartet mich» – und bahnte sich einen Weg zu den Nischen neben der Bar, dem Allerheiligsten, genannt Captain’s Cabin. DeDe gab ihr ein verstohlenes elisabethanisches Winkzeichen.
Forsch ging Mary Ann zum Tisch und glitt auf den Polsterstuhl, den sie ihr freigehalten hatten. «Ich hoffe, ihr habt nicht gewartet und schon bestellt», sagte sie.
«Nur Drinks», antwortete DeDe. «Der reinste Zoo hier, nicht?»
Mary Ann schaute zu den Nachbartischen hinüber. «Äh … wer ist denn da?»
«Alle», meinte DeDe schulterzuckend. «Stimmt doch, Mutter?»
Mrs. Halcyon hörte den anzüglichen Unterton heraus und entschied sich dafür, die Bemerkung ihrer Tochter zu übergehen. «Ich freue mich sehr, dass Sie kommen konnten, Mary Ann. D’orothea kennen Sie ja schon … und die Kinder. Edgar, bohr nicht in der Nase, Schatz. Gangie hat es dir schon tausendmal gesagt.»
Der Sechsjährige zog einen Flunsch. Seine zarten eurasischen Züge standen, wie die seiner Zwillingsschwester, ganz in Einklang mit der exotischen Ausstattung des Raums. «Warum können wir nicht ins Chuck E. Cheese?», fragte er.
«Weil die Königin im Chuck E. Cheese nicht speist», erklärte ihm seine Großmutter mit liebenswürdiger Geduld.
D’orothea verdrehte dezent die Augen. «Eigentlich war’s ihre erste Wahl, aber die haben von einer Reservierung für sechzig Leute nichts wissen wollen.»
Mary Ann entfuhr ein Kichern, das sie rasch wieder abwürgte, als sie Mrs. Halcyons Gesichtsausdruck sah. «Ich würde meinen», sagte die Matriarchin mit einem strafenden Seitenblick auf die Liebhaberin ihrer Tochter, «dass ein wenig Takt uns allen gut anstehen würde.»
D’orothea senkte bußfertig den Blick, doch ihre Mundwinkel kräuselten sich verächtlich. Sie rückte eine Gabel gerade und wartete darauf, dass der Augenblick vorüberging.
«Also», sagte Mary Ann etwas zu munter, «wann wird sie denn erwartet?»
«Jeden Moment», erwiderte DeDe. «Sie setzen sie in den Trafalgar Room. Der ist im Obergeschoss und hat einen separaten Eingang, also wird man sie wahrscheinlich durch die Hintertür reinlotsen und …»
«Ich muss pissen», sagte Klein Anna und zupfte DeDe am Ärmel.
«Anna, hab ich dir nicht zu Hause gesagt, du sollst das machen, eh wir gehen?»
«Und», fügte Mrs. Halcyon mit ehrlich entsetzter Miene hinzu, «kleine Mädchen sagen solche Wörter nicht.»
Anna sah verwundert drein. «Was für Wörter?»
«Pissen», sagte ihr Bruder.
«Edgar!» Die Matriarchin sah ihren Enkel entgeistert an. Dann fuhr sie herum und wandte sich gebieterisch an ihre Tochter. «Herrgott, DeDe … sag es ihnen. Das ist nicht meine Aufgabe.»
«Ach, Mutter, das ist wohl kaum …»
«Sag es ihnen.»
«Die Franzosen sagen auch pissen», warf D’orothea ein. «Was ist mit Pissoir?»
«D’or.» DeDe wies den Beitrag ihrer Geliebten mit einem eisigen Blick zurück, ehe sie sich ihre Kinder vornahm. «Hört mal, ihr zwei … ich dachte, wir hätten uns auf pinkeln geeinigt.»
«O Gott», stöhnte die Matriarchin.
Mary Ann und D’orothea tauschten ein verstohlenes Grinsen aus.
«Mutter, wenn du nichts dagegen hast …»
«Was ist denn aus Pipi machen geworden, DeDe? Ich habe dir beigebracht, Pipi zu sagen.»
«Tut sie auch noch», sagte D’or.
Wieder ein funkelnder Blick von DeDe. Mary Ann schaute aufs Tischtuch hinunter, weil sie auf einmal Angst hatte, dass D’or versuchen könnte, sie als Verbündete einzuspannen.
«Komm», sagte Mrs. Halcyon und stand auf. «Gangie geht mit dir zu ‹kleine Mädchen›.»
«Ich auch», meldete sich Edgar.
«Also gut … du auch.» Sie nahm die beiden Patschhändchen in ihre dicken, juwelengeschmückten Pranken und zottelte ins Dunkel hinter den Rattanstellwänden.
D’orothea gab ein theatralisches Stöhnen von sich.
«Fang gar nicht erst an», sagte DeDe.
«Es wird immer schlimmer mit ihr. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber es wird tatsächlich schlimmer.» Sie wandte sich an Mary Ann und gestikulierte mit steifem Zeigefinger in Richtung Toiletten. «Die Frau lebt unter einem Dach mit ihrer lesbischen Tochter und ihrer lesbischen Schwiegertochter und ihren zwei halbchinesischen Enkelkindern von dem beknackten Laufburschen von Jiffy’s …»
«D’or …»
«… und sie führt sich immer noch auf, als wären wir im neunzehnten Jahrhundert und sie wär … die bescheuerte Queen Victoria. Schnapp dir den Kellner, Mary Ann. Ich will noch einen Mai Tai.»
Mary Ann wedelte nach dem Kellner, aber der flitzte gerade in die Küche. Als sie sich wieder zu dem Pärchen umdrehte, schauten sich die beiden in die Augen, als wären sie allein.
«Hab ich recht?», fragte D’orothea.
DeDe zögerte. «Halbwegs, vielleicht.»
«Von wegen halbwegs. Die Frau ist regressiv.»
«Na schön … okay. Aber es ist doch nur ihre Art, mit dem Leben zurande zu kommen.»
«Ach nee. Ist das deine Erklärung für ihr Verhalten draußen auf der Straße?»
«Welches Verhalten?»
«Ach komm. Die Frau ist besessen von dem Gedanken, die Queen zu treffen.»
«Sag nicht immer ‹die Frau›. Und sie ist nicht besessen, sie ist nur … interessiert.»
«Klar. Mmh. So interessiert, dass sie über die Absperrung springt.»
DeDe verdrehte die Augen. «Sie ist über keine Absperrung gesprungen.»
D’orothea schnaubte verächtlich. «Aber beinah. Ich hab schon gedacht, sie plättet den Kerl vom Secret Service!»
Als Mrs. Halcyon mit den Kindern zurückkam, hatten sich die Gemüter wieder einigermaßen beruhigt. Mary Ann ließ sich ein oder zwei Minuten auf den Austausch höflicher Belanglosigkeiten ein, schob dann ihren Stuhl zurück und lächelte die Matriarchin entschuldigend an. «Es hat mich sehr gefreut, aber ich glaube, es ist besser, wenn ich draußen auf mein Team warte. Die Jungs kommen ja nie am Empfangschef vorbei, und ich bin nicht sicher, ob …»
«Ach, bleiben Sie doch noch, meine Liebe. Nur auf einen Drink.»
DeDe warf Mary Ann einen bedeutsamen Blick zu. «Ich glaube, Mutter will dir erzählen, wie sie die Queen kennengelernt hat.»
«Oh», sagte Mary Ann und wandte sich wieder der Matriarchin zu. «Sie sind ihr schon mal begegnet?» Sie fummelte nervös an ihrem Hut. Aus Höflichkeit gegenüber Älteren hatte sie im Leben schon mehr Zeit verloren, als ihr lieb war.
«Sie ist eine ganz reizende Person», legte Mrs. Halcyon los. «Wir hatten im Garten von Buckingham Palace einen netten langen Plausch. Ich kam mir vor, als wären wir alte Bekannte.»
«Wann war das?», fragte Mary Ann.
«In den Sechzigern», sagte DeDe. «Daddy hat damals die BOAC-Werbung gemacht.»
«Ah.» Mary Ann stand auf, hielt aber höflichen Blickkontakt zu Mrs. Halcyon. «Ich nehme an, Sie werden sie dann später sehen. Beim Staatsdiner oder so.»
Falsch. Das Gesicht der Matriarchin verwandelte sich in die Totenmaske eines Apachen. Hochrot vor Verlegenheit wandte sich Mary Ann hilfesuchend an DeDe. «Das Problem», erläuterte DeDe, «ist Nancy Reagan.»
Mary Ann nickte, ohne etwas zu begreifen.
D’orothea verzog sarkastisch den Mund. «Wenigstens ein Problem, das wir alle haben.»
DeDe ignorierte die Bemerkung. «Mutter und Mrs. Reagan waren noch nie ein Herz und eine Seele. Mutter denkt, es gibt eine Intrige … um sie vom Staatsdiner auszuschließen.»
«Denkt?», brauste Mrs. Halcyon auf.
«Wie auch immer.» DeDe zwinkerte Mary Ann teilnahmsvoll zu, um ihr über die peinliche Situation hinwegzuhelfen. «Du solltest besser los, nicht? Komm, ich bring dich zur Tür.» Sie stand auf, sodass Mary Ann der Abgang leichter wurde.
«Viel Glück», sagte die Matriarchin. «Machen Sie eine gute Figur.»
«Danke», antwortete Mary Ann. «Tschüs, D’orothea.»
«Ciao, Liebes. Wir sehn uns bald mal, ja?» Wenn die alte Schachtel nicht dabei ist, war damit gemeint.
«Wo geht sie hin?», fragte Edgar seine Großmutter.
«Zu einem Fernsehauftritt, mein Engel. Anna, mein Schatz, kratz dich nicht da.»
«Warum?»
«Frag nicht. Es ist nicht damenhaft.»
«Die Kinder sehen fabelhaft aus», sagte Mary Ann. «Ich kann es nicht fassen, wie groß sie schon sind.»
«Tja … Du, das von vorhin tut mir leid.»
«Ach, was soll’s.»
«D’or hasst solche Anlässe. Mit Mutter allein geht’s noch, aber wenn Mutters Bekannte dazukommen …» Sie schüttelte matt und schicksalsergeben den Kopf. «Sie nennt sie ‹Die verkrusteten Zehntausend›. Die radikale Linke steckt ihr noch arg in den Knochen.»
Mag sein, dachte Mary Ann, doch allmählich fiel es schwer, sich daran zu erinnern, dass die Frau in dem Zandra-Rhodes-Kleid und mit dem Hauch Lila im Haar einst mit DeDe im Dschungel von Guyana geschuftet hatte. Auch DeDes Entwicklung – von der Debütantin zur Stadtguerilla und zur Junior-League-Matrone – war reich an Widersprüchen, und manchmal hatte Mary Ann das Gefühl, dass die peinliche Verlegenheit, die sie angesichts eines derart wirren Lebens empfanden, das Bindemittel war, das die ‹Ehe› der beiden zusammenhielt.
DeDe bedachte ihr Dilemma mit einem milden Lächeln. «Weißt du, ich hab es nicht drauf angelegt, mal so eine Familie zu haben.»
Mary Ann erwiderte das Lächeln. «Und ob.»
«Anna hat Edgar neulich eine Schwuchtel genannt. Kannst du dir das vorstellen?»
«Mein Gott. Wo hat er das denn aufgeschnappt?»
DeDe zuckte mit den Schultern. «Wahrscheinlich in der Montessorischule. Herrgott, ich weiß nicht … manchmal denke ich, ich komme überhaupt nicht mehr mit. Ich weiß nicht, wie ich mir selbst die Welt erklären soll, geschweige denn meinen Kindern.» Sie machte eine Pause und sah Mary Ann an. «Ich hatte gehofft, darüber könnten wir uns inzwischen längst austauschen.»
«Über was?»
«Kinder. Ich dachte, du und Brian wollten … Gott, was sagt man dazu. Ich rede schon wie Mutter.»
«Macht doch nichts.»
«Du hast so was gesagt … als wir uns das letzte Mal gesehen haben.»
«Stimmt.»
«Aber ich nehme an … die Karriere macht es einigermaßen schwer …» Sie verstummte. Offenbar fand sie es peinlich, dass sie sich anhörten wie zwei Hausfrauen auf Einkaufsbummel in Sacramento. «Sag mir, wenn ich den Mund halten soll, okay?»
Zu Mary Anns Erleichterung hatten sie mittlerweile den Ausgang erreicht. Sie gab DeDe einen flüchtigen Kuss auf die Wange. «Ich freu mich, dass du nachgefragt hast», sagte sie. «Nur, im Moment … ist das Thema auf Sparflamme.»
«Schon verstanden», sagte DeDe.
Wirklich?, dachte Mary Ann. Hatte sie den wahren Grund erraten?
Heftiger Regen prasselte auf die Markise über dem Eingang des Restaurants. «Sind das deine Leute?», fragte DeDe und zeigte auf Mary Anns Kamerateam.
«Das sind sie.» Sie wirkten missmutig und waren klitschnass. Der Gedanke, ihnen noch mehr Nässe und Verdruss zumuten zu müssen, stimmte sie nicht gerade froh. «Danke für den Tipp», sagte sie zu DeDe.
«Schon gut», erwiderte ihre Freundin. «Du hattest noch einen gut bei mir.»
Die Sache mit dem Baby
Brian Hawkins kam von der Arbeit nach Hause, fand die Nachricht seiner Frau und ging nach oben in das Häuschen auf dem Dach, um sich ihre Sendung anzusehen. Das winzige Penthouse war einmal seine Junggesellenbude gewesen und diente jetzt allen Bewohnern der Barbary Lane 28 als Fernseh- und Aufenthaltsraum. Er schien es allerdings immer noch häufiger zu benutzen als die anderen.
Das machte ihm manchmal Sorgen. Er fragte sich, ob er ein ausgewachsener TV-Junkie geworden war, ein chronischer Eskapist, der die Glotze brauchte, um eine Leere zu füllen, die er selbst nicht mehr ausfüllen konnte. Wenn Mary Ann nicht zu Hause war, konnte man ihn fast immer in seinem Fernsehnest antreffen, wo er sich von dem Quasar einlullen ließ.
«Brian, Lieber?»
Mrs. Madrigals Stimme ließ ihn zusammenfahren. Ihre Schritte auf der Treppe waren von Supertramps «It’s Raining Again» auf MTV übertönt worden. «Oh, hallo», sagte er und drehte sich mit einem Grinsen zu ihr um. Sie trug einen blassgrünen Kimono, und ihr Haar umschwebte das eckige Gesicht wie faserige Rauchstreifen.
Sie kräuselte die Lippen und musterte den Bildschirm. Ein Mann in Unterwäsche lief durch einen Wald von aufgespannten Regenschirmen. «Wie passend», sagte sie.
«Ja, wirklich», gab er zurück.
«Ich suche Mary Ann», sagte die Vermieterin.
Es war eine simple Feststellung, doch er fühlte sich nun noch mehr als Außenseiter. «Da werden Sie sich hinter mir anstellen müssen», sagte er und wandte sich wieder dem Fernseher zu.
Mrs. Madrigal schwieg.
Seine kleinliche Reaktion tat ihm augenblicklich leid. «Sie hat eine ganz heiße Verabredung mit der Queen», fügte er hinzu.
«Oh … schon wieder, hm?»
«Ja.»
Sie schwebte durch den Raum und setzte sich zu ihm auf das Sofa. «Sollten wir nicht auf ihren Kanal umschalten?» Ihre großen Wedgwood-Augen verziehen ihm seine Gereiztheit.
Er schüttelte den Kopf. «Es sind noch fünf Minuten bis zur Sendung.»
«Ah.» Ihr Blick schweifte aus dem Fenster und verharrte schließlich auf dem blinkenden Leuchtfeuer von Alcatraz. Das hatte er schon oft an ihr beobachtet. Als wäre dort ein Bezugspunkt für sie; so etwas wie die Quelle ihrer Energie. Sie sah ihn wieder an und rüttelte spielerisch an seinem Knie. «Schon schlimm, nicht?»
«Was?»
«Ein Medienwitwer zu sein.»
Er rang sich ein Lächeln ab. «Das ist es nicht. Ich bin stolz auf sie.»
«Natürlich.»
«Ich hatte mich nur … darauf verlassen, dass ich sie heute Abend für mich habe. Das ist alles.»
«Ich kenne das Gefühl», sagte sie.
Dieses Mal war er es, der aus dem Fenster sah. Auf dem Flachdach eines Nachbarhauses hatte sich eine Regenpfütze gebildet, deren Oberfläche jetzt von den Einschlägen eines weiteren Prasselregens aufgewühlt wurde. Es war noch nicht Nacht, aber es war dunkel geworden. «Haben Sie einen Joint?», fragte er.
Sie legte den Kopf zur Seite und sah ihn spöttisch an, als wollte sie sagen: «Dumme Frage.» Sie tastete im Ärmel ihres Kimonos herum, bis sie das vertraute Kästchen aus Schildpatt zutage förderte. Er nahm sich einen Joint heraus, zündete ihn an und hielt ihn ihr hin. Sie schüttelte den Kopf und sagte: «Mach schon.»
Das tat er und schwieg fast eine Minute, während Michael Jackson in Trippelschritten durch eine Kulissenstraße tänzelte und lauthals protestierte: «Das Kind ist nicht mein Sohn.» Brian fand, dass man ihm das ohne weiteres glauben konnte.
«Es ist bloß», sagte er schließlich, «dass ich was mit ihr besprechen wollte.»
«Ah.»
«Ich wollte mit ihr in Gandhi und sie vorher im Ciao zum Essen einladen und noch mal über Thema eins reden.»
Da sie nichts sagte, warf er ihr einen Seitenblick zu, um zu sehen, ob sie wusste, was er meinte. So war es. Sie wusste es, und sie war davon sichtlich angetan. Gleich fühlte er sich wesentlich besser. Immerhin würde er Mrs. Madrigal stets auf seiner Seite haben.
«Das kannst du ja immer noch», meinte sie schließlich.
«Ich weiß nicht …»
«Was ist?»
«Ich meine … es macht mir eine Heidenangst. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, wenn ich ihr noch mal Gelegenheit gebe, nein zu sagen. Diesmal … könnte es so rauskommen, als ob sie’s auch meint.»
«Aber wenn du nicht wenigstens mit ihr redest …»
«Schauen Sie, was soll das nützen? Wann hätte sie denn mal Zeit dazu, um Himmels willen? Heute Abend ist ja wieder so typisch. Unser Privatleben muss zurückstehen hinter jeder blödsinnigen kleinen Nachrichtenstory, die sich ergibt.»
Die Vermieterin lächelte milde. «Ich weiß nicht, ob Ihrer Majestät diese Beschreibung ihres Aufenthalts gefallen würde.»
«Na schön. Für heute Abend gilt es vielleicht nicht. Das mit der Queen ist einzusehen …»
«Würde ich doch meinen.»
«Aber von der Sorte hat sie sich diesen Monat schon ein halbes Dutzend geleistet. So wie heute ist es ständig.»
«Na ja, ihre Karriere ist eben sehr …»
«Nehme ich etwa keine Rücksicht auf ihre Karriere? Tu ich das vielleicht nicht? Sie kann ja ihre Karriere haben, und das Baby könnte meine sein. Ich finde, das kann man doch verstehen!»
Er war offenbar heftiger geworden, als er beabsichtigt hatte. Ihr besänftigender Blick schien zu sagen, dass er sich beruhigen solle. «Mein Lieber», sagte sie leise, «ich bin die Letzte, die du überzeugen musst.»
«Entschuldigung», sagte er. «Ich sollte nicht an Ihnen üben.»
«Schon gut.»
«Es ist nicht so, als könnten wir uns noch viel Zeit lassen. Sie ist zweiunddreißig, und ich bin achtunddreißig.»
«Uralt», sagte die Vermieterin.
«Wenn’s um Kinderkriegen geht, ja. Jetzt heißt es scheißen oder runter vom Pott.»
Mrs. Madrigal verzog das Gesicht und zupfte ihren Kimono zurecht. «An deinen Metaphern musst du noch arbeiten, mein Lieber. Sag mal, wann hast du das letzte Mal mit ihr darüber gesprochen?»
Er überlegte einen Augenblick. «Vor drei Monaten vielleicht. Und sechs Monate davor.»
«Und?»
«Sie sagt jedes Mal, wir sollten noch warten.»
«Auf was?»
«Das möchte ich auch wissen. Vielleicht, dass sie Chefmoderatorin wird? Das ergäbe ’ne Menge Sinn. Wie viele schwangere Moderatorinnen haben Sie schon gesehen?»
«Ein paar muss es schon gegeben haben.»
«Sie will nicht», sagte er. «Das ist alles. Das ist die Wahrheit hinter den ganzen Ausflüchten.»
«Das weißt du doch nicht», meinte die Vermieterin.
«Ich kenne sie.»
Mrs. Madrigal schaute wieder hinaus zum Leuchtfeuer von Alcatraz. «Sei dir da nicht so sicher», sagte sie.
Das irritierte ihn. Als er sie fragend ansah, hatte sie die Stirn in nachdenkliche Falten gelegt. «Hat sie mit Ihnen gesprochen?», fragte er. «Hat sie was gesagt vom … Kinderkriegen?»
«Nein», sagte die Vermieterin hastig. «Das würde sie nie.»
Ihm fiel ein, dass es höchste Zeit war, und er griff zur Fernbedienung. Auf Knopfdruck erschien Mary Anns Gesicht auf dem Bildschirm, nur wenig überlebensgroß. Sie stand in einer Gasse hinter dem Trader Vic’s, und ihr Lächeln war schwer nachvollziehbar angesichts der vielen blau uniformierten Polizisten, die sie umringten.
Mrs. Madrigal strahlte. «Meine Güte, sieht sie nicht einfach fabelhaft aus?»
Sie sah noch besser aus. Eine Woge zärtlicher Gefühle durchströmte ihn, und einige Augenblicke sah er mit einem stolzen Lächeln auf den Bildschirm. Dann wandte er sich wieder seiner Vermieterin zu. «Sagen Sie mir Ihre ehrliche Meinung.»
«Na gut.»
«Sieht sie wie eine Frau aus, die ein Kind will?»
Mrs. Madrigal furchte erneut die Stirn. Sie betrachtete lange und eingehend Mary Anns Gesicht. «Tja», begann sie und tippte sich mit dem Zeigefinger an die Lippen, «dieser Hut ist verräterisch.»
Ein Ehrenamtlicher
Michael Tolliver hatte den Nachmittag im Castro verbracht. Jetzt war Rushhour, und die jungen Männer, die in den Banken arbeiteten, eilten nach Hause zu den jungen Männern, die in den Kneipen arbeiteten. Von einem Fensterplatz im Twin Peaks sah er zu, wie sie aus der U-Bahn-Station strömten und nur kurz innehielten, um ihre Schirme aufzuspannen – es sah aus, als würde jeder mit einer Armbrust auf den Regen anlegen. Ihre Gesichter wirkten abgekämpft und verwirrt wie Gesichter von Häftlingen, die sich irgendwie einen Tunnel in die Freiheit gebuddelt haben.
Er trank sein Mineralwasser aus und verließ die Bar. Bei dem Mann, der an der Ecke Herrenknirpse verkaufte, löhnte er drei Dollar. Er hatte seinen letzten verloren, und den davor hatte er wegen einer gebrochenen Speiche wegwerfen müssen, aber drei Dollar waren nichts, und Wegwerfschirme fand er eine gute Idee. Es hatte keinen Sinn, sich an einen Schirm zu gewöhnen und sentimental zu werden.
Nachdem er beschlossen hatte, in der Sausage Factory eine Pizza zu essen, ging er die Castro Street hinunter, vorbei an den Kinos und Croissant/Konfekt/Postkarten-Shops. Als er die Eighteenth Street überquerte, schlappte ein Stadtstreicher auf die Kreuzung und schrie hinter einer modisch gekleideten Schwarzen in einem Mitsubishi her: «Geh zurück nach Japan!» Michael sah ihr in die Augen und lächelte. Sie lohnte es ihm mit einem freundschaftlichen Schulterzucken, einem gängigen Ausdruck sozialer Telepathie, der in diesem Fall zu besagen schien: «Den können wir wohl auch abschreiben.» An manchen Tagen war das alles, was man an Menschlichkeit erwarten konnte – dieser kummervolle, verzeihende Blick, wie ihn Überlebende austauschen.
In der Sausage Factory war es so warm und gemütlich, dass er sich wider besseres Wissen dazu hinreißen ließ, einen halben Liter vom roten Hauswein zu bestellen. Was als milder Flirt mit der Erinnerung anfing, degenerierte zu tränenreichem Selbstmitleid, als der Alkohol zu wirken begann. Er versuchte, sich abzulenken, und musterte die angestrengt witzige Wanddekoration, doch sein Blick verhakte sich ausgerechnet an einer Bierreklame für Pabst Blue Ribbon mit dem Spruch: SITZEN SIE NICHT NUR DA – NERVEN SIE IHREN MANN. Sein Gesicht war nass von Tränen, als der Kellner mit der Pizza kam.
«Ähm … is was, Kleiner?»
Michael wischte sich hastig mit der Serviette übers Gesicht und nahm sein Essen in Empfang. «Nein, alles in Ordnung. Die Pizza sieht lecker aus.»
Der Kellner nahm es ihm nicht ab. Er blieb einen Augenblick mit verschränkten Armen stehen, zog sich dann einen Stuhl heran und setzte sich Michael gegenüber. «Wenn bei dir alles in Ordnung ist, bin ich Joan Collins.»
Michael lächelte. Er musste unwillkürlich an eine Kellnerin denken, die er vor Jahren in Orlando getroffen hatte. Auch sie hatte ihn «Kleiner» genannt, ohne seinen Namen zu kennen. Dieser Bursche hier trug eine schwarze Lederweste, und an seiner Levi’s hing ein Schlüsselbund, doch er hatte genau die gleiche Art, auf Fremde zuzugehen. «Wieder mal so ein Tag?», fragte er.
«Wieder mal so ein Tag», sagte Michael.
Der Kellner schüttelte langsam den Kopf. «Und wir sind hier, am falschen Ende der Stadt, während Betty im Trader Vic’s beim Dinner sitzt.»
Michaels Herz machte einen Sprung. «Bette Davis?»
Der Kellner lachte. «Schön wär’s. Betty die Zweite, Kleiner. Die Queen.»
«Oh.»
«Sie ham ihr ein Glücksplätzchen serviert … und sie hat nicht gewusst, was es ist. Ist das zum Aushalten?»
Michael lachte in sich hinein. «Du weißt nicht zufällig, was auf dem Zettelchen stand?»
«Ähm …» Der Kellner schrieb die Worte mit dem Zeigefinger in die Luft. «Du … wirst … sehr … reich … werden.»
«Klar.»
Der Kellner hob beide Hände. «Ich schwör’s. Nancy Reagan hat in ihrem Plätzchen denselben Spruch gekriegt.»
Michael nippte an seinem Wein. «Wo hast du das her?» Der Bursche war furchtbar nett, aber der Text, den er draufhatte, war verdächtig.
«Vom Fernseher in der Küche. Mary Ann Singleton berichtet schon den ganzen Abend darüber.»
«Ehrlich?» Gut für sie, dachte er, gut für sie. «Ist eine alte Bekannte von mir.» Es würde ihr gefallen, wenn sie wüsste, dass er mit ihr angegeben hatte.
«Na, dann sag ihr mal, ich find sie gut.» Der Kellner streckte ihm die Hand hin. «Ich heiße übrigens Michael.»
Michael schüttelte ihm die Hand. «Ebenfalls.»
«Michael?»
«Genau.»
Der Kellner verdrehte die Augen. «Manchmal glaub ich, die Hälfte aller Schwulen auf der Welt heißt Michael. Wer hat bloß diesen Scheiß von wegen Bruce erfunden?» Er stand unvermittelt auf und gab sich wieder professionell. «Also, pass auf dich auf, Kleiner. Vielleicht sehn wir uns mal wieder. Arbeitest du hier in der Nähe?»
Michael schüttelte den Kopf. «Eigentlich nicht. Nur heute Nachmittag.»
«Wo?»
«Gegenüber. Im Switchboard.»
«Ach ja? Da hat mein Freund Max mal ’ne Weile gearbeitet. Er fand es sehr anstrengend.»
«Ist es auch», sagte Michael.
«Da gab’s einen, der hat jeden zweiten Nachmittag angerufen, wenn seine Frau im Aerobic-Kurs war. Meistens wollte er, dass Max … na ja … den kerligen Fernfahrertyp mimt. Max sagte, der Bursche hätte ewig gebraucht, bis es ihm kam. Und er hat immer dasselbe gesagt. ‹Ja, so is gut, schlenker mir deine großen Eier ins Gesicht.› Also ehrlich, wie soll man einem Typ am Telefon die Eier ins Gesicht schlenkern …»
«Falsche Hausnummer», sagte Michael und spürte, wie ihm ein mattes Lächeln in die Mundwinkel kroch.
Der Kellner blinzelte ihn ratlos an. «Dial-a-Load?»
Michael schüttelte den Kopf. «Das Aids-Telefon.»
«Oh.» Die Finger des Kellners glitten an seiner Brust hoch und verharrten vor seinem Mund. «Gott, ich bin vielleicht ein Idiot.»
«Nein, bist du nicht.»
«Da ist so eine Telefonsexagentur, direkt über der neuen Sparkassenfiliale, und ich dachte … Gott, ist mir das peinlich.»
«Lass man», sagte Michael. «Ich find es lustig.»
Die Miene seines Namensvetters drückte erst Dankbarkeit aus, dann Verwirrung und schließlich so was wie Sorge. Michael wusste, woran der andere dachte. «Ich hab es nicht», ergänzte er. «Ich mach bloß als Ehrenamtlicher Telefonberatung.»
Ein langes Schweigen folgte. Als der Kellner wieder etwas sagte, war seine Stimme belegt. «Der Lover von meinem Ex ist letzten Monat dran gestorben.»
Eine Bekundung von Mitgefühl schien irgendwie unangebracht, also nickte Michael nur.
«Es macht mir wirklich Angst», sagte der Kellner. «Ich hab die Folsom Street komplett aufgegeben. Ich geh nur noch in Pulloverbars.»
Michael hätte ihm sagen können, dass die Krankheit auch auf Kaschmirpullover keine Rücksicht nimmt, aber für ein weiteres Beratungsgespräch waren seine Nerven schon viel zu strapaziert. Er hatte fünf Stunden am Telefon mit Leuten gesprochen, die von ihren Liebhabern abserviert, von ihren Vermietern rausgesetzt und von Krankenhäusern abgewiesen worden waren. Für den Rest des Abends wollte er nur noch eines: alles vergessen.
Schmerzliche Erfahrungen
Es war fast Mitternacht, als Mary Ann nach Hause kam. In der verregneten Winterzeit hatte sich auf den Holzstufen der Treppe, die zur Barbary Lane führte, ein moosgrüner Glibber gebildet, deshalb stieg sie vorsichtig hinauf und hielt sich am Geländer fest, bis sie unter ihren Füßen den beruhigend rutschfesten Belag aus Eukalyptuslaub spürte. Als sie das überdachte Gartentor von Nummer 28 erreichte, sah sie, dass bei Michael noch Licht war. Das führte bei ihr zu einer gewissen Besorgnis und weckte einen Instinkt, den man durchaus mütterlich nennen konnte.
Im Obergeschoss klopfte sie nach kurzem Zögern an seine Tür. Als er öffnete, wirkte er etwas zerzaust und verlegen. «Oh, hallo», sagte er und fuhr sich mit den Fingern durchs Haar.
«Ich hoffe, du hast nicht geschlafen.»
«Nein, ich hatte mich nur hingelegt. Komm doch rein.»
Sie trat ins Zimmer. «Hast du zufällig meinen kleinen Coup mitgekriegt?»
Er schüttelte den Kopf. «Aber hinterher davon erfahren. Im Castro wurde von nichts anderem gesprochen.»
«Wirklich?» Die zweite Silbe rutschte ihr so hoch, dass es ein bisschen zu kindlich und begierig klang, doch sie lechzte nach Bestätigung. Ihre heimliche Angst war, dass ihr Auftritt unbeholfen und anfängerhaft gewirkt hatte. «Was haben die Leute denn so gesagt?»
Er lächelte sie schläfrig an. «Was hättest du denn gern gehört?»
«Mouse!» Sieben Jahre waren sie nun miteinander befreundet, und sie konnte noch immer nicht mit Sicherheit sagen, wann er sie auf den Arm nahm.
«Beruhig dich, Schatz. Mein Kellner hat von dir geschwärmt.» Er trat einen Schritt zurück und musterte sie. «Es überrascht mich allerdings, dass er den Hut nicht erwähnt hat.»
Das war eine kalte Dusche. «Was ist mit dem Hut?»
«Nichts», hänselte er sie mit unbewegtem Pokergesicht.
«Mouse …»
«Der Hut ist absolut hübsch.»
«Mouse, wenn jede Tucke in der Stadt über diesen Hut gelacht hat, dann sterbe ich. Hast du gehört? Ich verkriech mich unter dem nächsten Stein und sterbe.»
Er ließ das Spielchen sein. «Er sieht fabelhaft aus. Du siehst fabelhaft aus. Komm … setz dich und erzähl mir alles.»
«Das geht jetzt nicht. Ich wollte nur reinschauen … und hallo sagen.»
Er sah sie kurz an, dann beugte er sich vor und gab ihr einen dezenten Kuss auf die Lippen. «Hallo.»
«Bist du okay?», fragte sie.
Er lächelte matt und zeichnete mit dem Zeigefinger eine Null in die Luft.
«Geht mir auch so», sagte sie.
«Wahrscheinlich liegt’s am Regen.»
«Wahrscheinlich, ja.» Es lag nie am Regen, und sie wussten es beide. Vom Regen ließ sich nur leichter reden. «Tja», sagte sie mit einer Kopfbewegung zur Tür, «Brian denkt bestimmt schon, mich gibt’s gar nicht mehr.»
«Moment noch», sagte Michael. «Ich hab was für ihn.» Er verschwand in der Küche, und als er wiederkam, hielt er ein Paar Rollschuhe in den Händen. «Vierundvierzig», sagte er. «Ist das nicht Brians Schuhgröße?»
Sie starrte die Rollschuhe an und spürte, wie der Schmerz sich wieder meldete.
«Ich hab sie unter der Spüle gefunden», erklärte ihr Michael und wich ihrem Blick aus. «Ich hab sie Jon vorletzte Weihnachten geschenkt, und ich hatte vollkommen vergessen, wo er sie verstaut hat. He … na komm.»
Sie kämpfte gegen die Tränen an, doch es nützte nichts. «Entschuldige, Mouse. Es ist nicht fair von mir, aber … weißt du, manchmal überkommt es mich einfach so … Herrgott noch mal!» Ärgerlich wischte sie sich mit dem Handrücken über die Augen. «Verdammt, wann hört das mal auf?»
Michael stand da, die Rollschuhe an die Brust gedrückt, das Gesicht ganz verzerrt vor Kummer und Leid.
«Ach, Mouse, es tut mir so leid. Ich bin eine solche Plunze.»
Er brachte kein Wort heraus und nickte ihr verständnisvoll zu, während ihm die Tränen über die Wangen liefen. Sie nahm ihm die Rollschuhe ab und stellte sie auf den Boden. Dann drückte sie ihn an sich und strich ihm übers Haar. «Ich weiß, Mouse … ich weiß, Schatz. Es wird schon werden. Du wirst sehen.»
Dabei fiel es ihr selbst schwer, daran zu glauben. Seit Jons Tod waren jetzt mehr als drei Monate vergangen, doch sie litt mehr denn je unter dem Verlust. Um Abstand zu gewinnen von dieser Tragödie, musste man sich erst einmal bewusstmachen, wie erschreckend und unbegreiflich sie war.
Michael löste sich von ihr. «Also … wie wär’s mit einem Kakao, du Medienstar?»
«Prima», sagte sie.
Sie setzte sich an den Küchentisch, während er den Kakao machte. Am Kühlschrank, gehalten von einer Muschel mit einem Magneten, hing noch immer das Foto, das sie von Jon und Michael auf einem Kürbisfeld an der Half Moon Bay gemacht hatte. Sie schaute weg und ermahnte sich, nicht erneut in Tränen auszubrechen. Für einen Abend hatte sie schon genug Schaden angerichtet.
Als der Kakao fertig war, nahm Michael eine blaue Tasse vom Wandbord und stellte sie auf eine graue Untertasse. Einen Augenblick betrachtete er die Zusammenstellung mit leichtem Stirnrunzeln, dann ersetzte er die graue Untertasse durch eine in Altrosa. Mary Ann beobachtete das Ritual und schmunzelte über seine exzentrische Art.
Michael entging ihre Reaktion nicht. «So etwas ist wichtig», sagte er.
«Ich weiß», erwiderte sie mit einem Lächeln.
Er nahm sich eine gelbe Tasse und stellte sie auf die graue Untertasse, bevor er sich zu ihr an den Tisch setzte. «Ich bin froh, dass du reingeschaut hast.»
«Danke», sagte sie. «Ich auch.»
Während sie ihren Kakao schlürften, erzählte sie ihm von DeDe und Mrs. Halcyon, von ihrem rebellischen Team und den rücksichtslosen Polizisten und von den paar kurzen Augenblicken, in denen sie die Queen zu sehen bekommen hatte. Die Monarchin, sagte sie, sei ihr so unwirklich vorgekommen; unwirklich und doch völlig vertraut – wie ein Schneewittchen aus dem Trickfilm, das sich unter gewöhnliche Sterbliche mischt.
Sie blieb lange genug, um ihn mehrmals laut zum Lachen zu bringen, und sagte ihm dann gute Nacht. Als sie in ihre Wohnung kam, war Brian nicht da. Sie stellte die Rollschuhe ins Wohnzimmer und stieg die Treppe hinauf zu dem Häuschen auf dem Dach. Dort fand sie ihren Mann wie üblich schlafend im flackernden Lichtschein von MTV. Sie kniete sich vor das Sofa und legte ihm sanft die Hand auf die Brust. «He», flüsterte sie, «wer soll’s denn sein … ich oder Pat Benatar?»
Er wurde wach und rieb sich mit den Fingerknöcheln die Augen.
«Also?», hakte sie nach.
«Ich überlege noch.»
Sie strich ihm über die Brust, und ihre Fingerspitzen folgten den Windungen seiner gelockten Haare. «Tut mir leid, dass ich unsere Verabredung nicht einhalten konnte.»
Er lächelte sie schläfrig an. «Schon gut.»
«Hast du mich gesehn?», fragte sie.
Er nickte. «Ich hab’s mir mit Mrs. Madrigal angesehen.»
Sie wartete auf seine Reaktion.
«Du warst toll», sagte er schließlich.
«Sagst du das auch nicht bloß so?»
Er stützte sich auf die Ellbogen und rieb sich noch einmal die Augen. «So was sag ich nie bloß so.»
«Na ja … das mit den Glücksplätzchen fand ich schon ganz fabelhaft. Natürlich …» Sie verstummte, als er die Hand ausstreckte und sie zu sich auf das Sofa zog.
«Mund halten», sagte er.
«Mit Vergnügen», gab sie zurück.
Sie küsste ihn lange und heftig, beinahe wild – mit jener Intensität, die ihren ganzen Arbeitstag geprägt hatte. Je mehr sie zu einer öffentlichen Figur wurde, desto stärker genoss sie solche Augenblicke, die sie ganz für sich hatte. Sekunden später hatten Brians Hände den Saum ihres Tweedrocks ertastet und schoben ihn über ihre Hüften hoch. Er fasste sie unter die Arme und drückte sie sanft gegen das Rückenpolster aus grobem Baumwollstoff. Dann fing er an, ihre Knie zu küssen. Sie kam sich ein wenig lächerlich vor.
«Lass uns nach unten gehn», flüsterte sie.
Er schaute von seiner hingebungsvollen Tätigkeit auf. «Warum?»
«Na … damit ich wenigstens mal diesen Hut loswerden kann.»
Ein jungenhaft lüsternes Grinsen erschien auf seinem Gesicht. «Behalt ihn auf, ja?» Sein Kopf ging wieder nach unten, und sie spürte das Schaben seiner unrasierten Wange an ihrer Strumpfhose, als er seine Zunge an der Innenseite ihrer Schenkel aufwärts gleiten ließ. «Was ist das?», fragte sie. «Deine Evita-Phantasie?»
Er lachte, hauchte sie mit seinem warmen Atem an und zerrte ihr mit einem geübten Ruck die Strumpfhose herunter. Sie schlang ihre Finger in seine kastanienbraunen Locken und zog sein Gesicht fest an sich heran, Wärme zu Wärme, Nässe zu Nässe. Leise stöhnend bog sie den Rücken durch und ließ sich nach hinten in das weiche Polster sinken. In so einer Situation, sagte sie sich, war ein Gefühl von Lächerlichkeit das Letzte, womit man sich aufhielt.
Sie waren wieder in der Wohnung, als sie endlich den Hut abnahm. «Die Rollschuhe sind von Mouse», sagte sie. Sie bemühte sich um einen beiläufigen Tonfall.
«Was für Rollschuhe?» Er saß in seinen Boxershorts auf der Bettkante.
«Im Wohnzimmer.» Sie vermied es, ihn anzusehen, indem sie vorgab, den Hut in seiner Schachtel zu verstauen.
Er stand auf und ging aus dem Zimmer. Er blieb so lange weg, dass sie aufhörte, ihre Haare zu bürsten, und nach ihm schaute. Er saß im Lehnstuhl und starrte ins Leere. Die Rollschuhe lagen vor seinen Füßen. Er sah kurz zu ihr auf. «Das sind die von Jon, nicht?»
Sie nickte, ging aber nicht zu ihm. Er lächelte wehmütig und schüttelte langsam den Kopf. «Meine Güte», sagte er leise. Er wischte einen imaginären Fussel von der Armlehne. «Geht’s Michael einigermaßen?», fragte er.
«Einigermaßen», antwortete sie.
Brian schaute auf die Rollschuhe. «Er denkt an alles, wie?»
«Mhm.» Sie ging zu ihm und setzte sich zwischen seinen Beinen auf den Boden. Er strich ihr mechanisch übers Haar und schwieg fast eine Minute lang.
Schließlich sagte er: «Ich hätte heute fast meinen Job verloren.»
«Was?»
«Schon gut. Nichts passiert. Ich hab es wieder eingerenkt.»
«Was war denn?»
«Ach … ich hab so einem Kerl eine verpasst.»
«Brian.» Sie wollte nicht zu vorwurfsvoll klingen, aber solche Vorfälle schienen sich zu häufen.
«Keine Sorge», sagte er, «es war kein Kunde. Nur dieser neue Kellner, Jerry.»
«Den kenne ich nicht.»
«Doch. Der mit dem Jordache-Look.»
«Oh. Ja.»
«Er hat mich den ganzen Tag genervt. Mit einem kleinlichen Scheißdreck nach dem anderen. Dann hat er gesehn, wie ich eine Fritte gegessen hab … von einem Teller, der grad abgeräumt worden war … und da hat er gesagt: ‹Scheiße, Mann, jetzt hast du dich reingeritten.› Ich frag ihn, was das heißen soll, und er sagt: ‹Das war ein Teller von ’ner Schwuchtel, Blödmann … deine Tage sind gezählt.›»
«Na toll.»
«Also hab ich ihn geplättet.»
Sie verdrehte den Kopf nach hinten und starrte ihn an. «Meinst du wirklich, das war nötig?»
«Mir hat es großen Spaß gemacht», meinte er schulterzuckend.
«Brian … die haben dir doch gesagt, wenn so was noch mal vorkommt …»
«Ich weiß, ich weiß.»
Sie schwieg. Diese mickrigen John-Wayne-Szenen entstanden ganz einfach aus seinem Frust wegen des unbefriedigenden Jobs. Wenn sie sich nicht in Acht nahm, würde er ihre Missbilligung zum Vorwand nehmen, um sie daran zu erinnern, dass es für ihn nur einen Job gab, der ihm etwas bedeutete: Vater eines Kindes zu sein.
«Hast du mal 1984 gelesen?», fragte er.
Die Frage machte sie misstrauisch. «Vor Jahren. Warum?»
«Erinnerst du dich an den Typ darin?»
«Vage.»
«Weißt du, was mir von ihm am meisten in Erinnerung geblieben ist?»
Sie fühlte sich unbehaglich. «Keine Ahnung. Dass sie ihm Ratten übers Gesicht laufen ließen?»
«Dass er vierzig war», sagte er.
«Und?»
«Ich war sechzehn, als ich es gelesen habe, und ich weiß noch, wie alt mir der Mann vorkam. Und mir wurde klar: 1984 würde ich vierzig sein, und ich konnte mir nicht vorstellen, wie es sein würde, schon so hinüber zu sein. Tja … und jetzt ist 1984 fast da.»
Sie studierte einen Augenblick seinen Gesichtsausdruck. Dann nahm sie seine Hand, die auf seinem Knie lag, und drückte einen Kuss darauf. «Ich dachte, wir hätten uns geeinigt, dass ein Klimakterium in der Familie genug ist.»
Er zögerte und sagte dann lachend: «Okay, ist gut. Faires Angebot.»
Sie spürte, dass die Krise vorbei war. Er schien zu wissen, dass es im Augenblick nicht angebracht war, das Thema zu vertiefen, und sie war für den Aufschub mehr als dankbar.
Annas Familie
Als Michael zum Frühstück hinunterkam, roch es in Mrs. Madrigals Küche nach frischem Kaffee und brutzelnden Speckstreifen. Die Regenschlieren an dem hohen Fenster über der Spüle verstärkten noch die verschwörerische Gemütlichkeit, die selbst flüchtige Besucher in ihren Bann zog. Er setzte sich an den kleinen, weiß emaillierten Tisch der Vermieterin und schnupperte.
«Dieser Kaffee duftet himmlisch», sagte er.
«Es ist arabischer Mokka», antwortete sie. «Das Sinsemilla der Kaffees.» Sie riss einen Streifen Küchenkrepp ab und legte den Speck zum Entfetten darauf.
Er kicherte in sich hinein, weil er genau verstand, was sie damit sagen wollte. Wenn er ein wahrer Kiffer war – und manchmal fand er, dass er einer war –, dann war diese abgedrehte Sechzigjährige mit den zerzausten Haaren und den alten Kimonos die Versucherin, die ihn dazu verführt hatte. Nun, er hätte es im Leben viel schlechter treffen können.
Sie brachte zwei Porzellanhumpen mit Kaffee und setzte sich zu ihm an den Tisch. «Mary Ann war heute schon in aller Herrgottsfrühe auf den Beinen.»
«Sie ist im Silicon Valley», sagte er. «Mr. Packard macht eine Führung für die Queen.»
«Mr. Packard?»
«Der Computermensch. Unser ehemaliger Staatssekretär im Verteidigungsministerium.»
«Ah. Kein Wunder, dass ich mich nicht an ihn erinnere.»
Er sah sie lächelnd an, nahm seinen Kaffee und pustete den Dampfkringel herunter. «Er schenkt der Queen einen Computer.»
Sie machte ein verblüfftes Gesicht. «Was will die Queen mit einem Computer?»
Er zuckte mit den Schultern. «Es hat was mit Pferdezucht zu tun.»
«Na so was.»
«Ich weiß. Ich kann’s mir auch nicht vorstellen.»
Sie lächelte und nippte eine Weile an ihrem Kaffee, ehe sie fragte: «Hast du mal was von Mona gehört?»
Es war eine alte Wunde, doch sie schmerzte wie eine frische. «Ich hab aufgehört, mir darüber Gedanken zu machen.»
«Na, na.»
«Es hat keinen Sinn. Wir sind für sie abgemeldet. Nicht mal zu einer Postkarte hat sie sich aufraffen können, Mrs. Madrigal. Ich hab nicht mehr mit ihr gesprochen seit mindestens … anderthalb Jahren.»
«Vielleicht denkt sie, wir sind böse mit ihr.»
«Ach, kommen Sie. Sie weiß, wo wir sind. Es hat sich einfach so ergeben, das ist alles. Man verliert sich aus den Augen. Wenn sie von uns hören wollte, würde sie dafür sorgen, dass ihre Nummer im Telefonbuch steht.»
«Ich weiß, was du denkst», sagte sie.
«Was?»
«Nur eine dumme alte Thekla würde sich grämen wegen einer Tochter, die schon auf die vierzig zugeht.»
«Nein, denke ich nicht. Sondern, was für eine dumme alte Thekla Ihre vierzigjährige Tochter ist.»
«Aber, mein Lieber … was, wenn wirklich was mit ihr ist?»
«Na ja», sagte Michael, «Sie sind es, die von uns beiden zuletzt von ihr gehört hat.»
«Vor acht Monaten.» Die Vermieterin runzelte die Stirn. «Ohne Absender. Sie schrieb mir, dass sie gut zurechtkommt – ‹in einem kleinen privaten Druckereibetrieb›, was immer das sein soll. Es sieht ihr nicht ähnlich, nur so Andeutungen zu machen.»
«Ach ja?»
«Na, jedenfalls nicht in dieser Form, mein Lieber.»
Als Mona zu Beginn des Jahrzehnts nach Seattle ziehen wollte, hatte Michael sie fast angefleht, nicht zu gehen. Doch Mona war stur geblieben – Seattle sei die Stadt der achtziger Jahre. «Na, dann geh doch», hatte er höhnisch gesagt. «Du stehst auf Quaaludes … da wirst du von Seattle begeistert sein.» Offenbar hatte er das richtig gesehen. Mona war nicht mehr zurückgekehrt.
Mrs. Madrigal sah ihm an, wie sehr es ihm immer noch zu schaffen machte. «Sei nicht so streng mit ihr, Michael. Vielleicht hat sie Probleme.»
Das wäre nicht neu gewesen. Er konnte sich kaum erinnern, wann seine einstige Mitbewohnerin einmal nicht am Rand irgendeiner düsteren Kalamität gestanden hatte. «Ich hab es Ihnen doch gesagt», meinte er ruhig. «Ich denke inzwischen nicht mehr groß daran.»
«Wenn es einen Weg gäbe, ihr das mit Jon zu sagen …»
«Gibt’s aber nicht. Und wird es vermutlich auch nie geben. Sie lässt ja keinen Zweifel daran, dass sie …»
«Sie hat Jon sehr gemocht, Michael. Ich meine, sie haben sich vielleicht ab und zu gezankt, aber sie hatte ihn genauso gern wie wir. Daran darfst du nie zweifeln.» Sie stand auf und fing an, Eier in eine Schüssel zu schlagen. Sie wussten beide, dass es nichts nützte, das Thema zu vertiefen. Auch noch so viel Wünschen und Hoffen konnte nichts ändern. Als Mona nach Norden geflohen war, hatte sie mehr als nur die Stadt hinter sich gelassen. Wieder bei null anzufangen, war die einzige emotionale Fähigkeit, die sie sich je zugelegt hatte.
Mrs. Madrigal schien seine Ansicht zu teilen. «Ich hoffe, sie hat jemand», murmelte sie. «Irgendjemand.»
Dem hatte er nichts hinzuzufügen. Bei Mona konnte es durchaus ‹irgendjemand› sein.