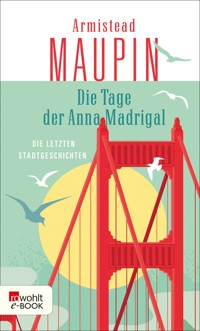9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Stadtgeschichten
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Das Neonlicht flackert in den Clubs von San Francisco, und draußen wartet ein neues Leben auf die Barbary Lane 28. Die Achtziger haben San Francisco und seine Bewohner in ihren Bann gezogen. Mary Ann durchlebt wieder romantische Irrungen und Wirrungen und jagt einem charismatischen Psychopathen hinterher. DeDe wird unverhofft zu einer queeren Galionsfigur, und Brian richtet seinen Blick gen Zukunft. Wird der Frauenheld etwa sesshaft? Unterdessen verliert eine Kolumnistin ihr Herz im Park. Michael Tolliver sucht beim schwulen Rodeo nach der Liebe, und Anna Madrigal verbirgt ein dunkles Geheimnis in ihrem Keller. Was kann da schon schiefgehen? Im dritten Band der «Stadtgeschichten» erleben die Freunde aus der Barbary Lane 28 düstere, romantische und stets erheiternde Abenteuer in der legendärsten Stadt Amerikas. Erstmals in den Siebzigerjahren erschienen, hat Armistead Maupin sich mit seinem «Stadtgeschichten» Zyklus sowohl über soziale als auch über sexuelle Barrieren hinweggesetzt, noch bevor die LGBTQIA+ Community überhaupt so genannt wurde. Er lässt seine heterosexuellen und queeren Charaktere gleichermaßen Herzschmerz und Triumph, atemraubenden Schrecken und erfreuliche Zufälle erleben. Das Ergebnis ist eine funkelnde und süchtig machende Sittenkomödie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 435
Ähnliche
Armistead Maupin
Noch mehr Stadtgeschichten
Roman
Über dieses Buch
Das Neonlicht flackert in den Clubs von San Francisco, und draußen wartet ein neues Leben auf die Barbary Lane 28.
Die Achtziger haben San Francisco und seine Bewohner in ihren Bann gezogen. Mary Ann durchlebt wieder einmal romantische Irrungen und Wirrungen und jagt einem charismatischen Psychopathen hinterher. DeDe wird unverhofft zu einer queeren Galionsfigur, und Brian richtet seinen Blick gen Zukunft. Wird der Schwerenöter womöglich sesshaft? Unterdessen verliert eine Kolumnistin ihr Herz in einem Park von San Francisco. Michael Tolliver sucht beim schwulen Rodeo nach der Liebe, und Anna Madrigal verbirgt ein dunkles Geheimnis in ihrem Keller.
Was kann da schon schiefgehen?
«Maupins Erzählstil ist kult.» Cosmopolitan
«Unterhält, erhellt und macht – wie immer – Lust auf mehr.» Washington Post
Vita
Armistead Maupin, geboren 1944 in Washington, studierte Literatur an der University of North Carolina und arbeitete als Reporter für eine Nachrichtenagentur. Er schrieb für Andy Warhols Zeitschrift Interview, die New York Times und die Los Angeles Times. Seine Geschichten aus San Francisco, die berühmten «Tales of the City», verfasste er über fast zwei Jahrzehnte als täglichen Fortsetzungsroman für den San Francisco Chronicle. Maupin lebt mittlerweile in Großbritannien.
Impressum
Die amerikanische Originalausgabe erschien 1982 unter dem Titel «Further Tales of the City» bei The Chronicle Publishing Company, San Francisco.
Die vorliegende deutsche Fassung von «Noch mehr Stadtgeschichten» wurde für diese Neuausgabe sprachlich durchgesehen. Im Zuge dessen waren einzelne, zum Zeitpunkt der ursprünglichen Übersetzung gewählte Begrifflichkeiten zu ändern, da sie den Differenzierungen des Originals keine Rechenschaft trugen. Weitere damals noch übliche Formulierungen des englischen Originaltexts wurden aus Gründen der Werktreue äquivalent übersetzt beibehalten.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Juni 2024
Copyright © 2007 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«Noch mehr Stadtgeschichten» Copyright © 1993 by Rogner & Bernhard GmbH & Co. Verlags KG, Berlin
«Further Tales of the City» Copyright © 1982 by The Chronicle Publishing Company, San Francisco
Songtext «Help», The Beatles, Text: John Lennon, Paul McCartney
Covergestaltung FAVORITBUERO, München
Coverabbildung Shutterstock
ISBN 978-3-644-01995-9
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Steve Beery
Surely there are in everyone’s life certain connections, twists and turns which pass awhile under the category of Chance, but at the last, well examined, prove to be the very Hand of God.
Gewiss weist ein jedes Leben eine Reihe von Reibungen, Umschwüngen und plötzlichen Impulsen auf, die eine Zeit lang als Wirkungen des Zufalls gelten mögen, bis sie sich endlich nach reiflicher Überlegung als deutlicher Eingriff der Hand Gottes enthüllen.
Sir Thomas Browne
Religio Medici
Heim und Herd
Es gab natürlich immer wieder Fremde, die steif und fest behaupteten, dass San Francisco eine Stadt ohne Jahreszeiten war, doch Mrs. Madrigal schenkte dem keine Beachtung.
Warum auch, die Frühlingsboten waren doch überall zu sehen!
Die chinesischen Schuljungen zum Beispiel, die mit nagelneuen grün-gelben Baseballmützen auf ihren Skateboards den Russian Hill hinuntersausten.
Und was war mit dem alten Mr. Citarelli? Nur wer schon lange in San Francisco lebte, konnte wissen, dass Mr. Citarelli exakt zu dieser Zeit im Jahr seinen Lehnstuhl in die Garage schleppte, das Tor aufmachte und sich in die Sonne setzte. Auf Mr. Citarelli war unendlich mehr Verlass als auf jedes Murmeltier.
In der Barbary Lane selbst wurde die Frühjahrstagundnachtgleiche von einer uralten scharlachroten Azalee neben den Mülltonnen angekündigt, die wie ein Freudenfeuer leuchtete. «Du meine Güte», sagte Mrs. Madrigal, als sie stehen blieb, um die Tüte mit ihren Einkäufen besser zu fassen. «Du schon wieder?» Die Azalee hatte auch im August und Dezember geblüht, aber der Natur verzieh man immer, wenn sie von etwas Schönem zu viel bescherte.
Als Mrs. Madrigal das Gartentor von Nummer 28 erreichte, blieb sie unter dessen Spitzdach stehen und betrachtete ihr Reich – die bemooste Ziegelfläche des Vorgartens, die illegale Üppigkeit ihres «Kräutergartens», den Efeu und die braune Schindelfassade ihres geliebten alten Hauses. Der Anblick begeisterte sie immer wieder.
Sie stellte die Lebensmittel – drei neue Käse von Molinari’s, Glühlampen, Focaccia-Brot, Tender Vittles für Boris – in der Küche ab und eilte ins Wohnzimmer, um Feuer zu machen. Warum auch nicht? In San Francisco war ein Feuer zu jeder Jahreszeit angenehm.
Das Kaminholz – ein ganzer Klafter – war ein Weihnachtsgeschenk ihrer Mieter, und Mrs. Madrigal ging damit um, als würde sie in Fort Knox mit Goldbarren hantieren. Sie hatte allzu lange unter der Zumutung der grauenhaften Dinger aus gepresstem Sägemehl gelitten, die es im Searchlight Market zu kaufen gab. Dank ihrer Kinder hatte sie jetzt ein Feuer, das auch knisterte.
Es waren natürlich nicht ihre richtigen Kinder, aber sie behandelte sie so. Und sie schienen sie in ihrer Mutterrolle zu akzeptieren. Ihre richtige Tochter Mona hatte in den späten Siebzigerjahren eine Zeit lang bei ihr gelebt, war aber vor einem Jahr nach Seattle gezogen. Ihre Begründung war gewohnt kryptisch gewesen: «Weil … na ja, weil’s die Achtziger sind, deshalb.»
Arme Mona. Wie viele ihrer Altersgenossen hatte sie die Achtziger zum Schlagwort und das neue Jahrzehnt zum Götzen erhoben und erhoffte sich so etwas wie Seelenheil und die Befreiung von ihrer düsteren Daseinsvorstellung. Doch ob Mona die Achtziger in Seattle verbrachte oder in San Francisco … oder auch in Sheboygan … das änderte nichts. Nur konnte ihr das keiner sagen. Mona hatte sich nie von den Sechzigern erholt.
Der Vermieterin ging durch den Kopf, dass ihre Ersatzkinder – Mary Ann, Michael und Brian – sich ihre Unschuld irgendwie bewahrt hatten.
Und sie liebte sie von ganzem Herzen dafür.
Ein paar Minuten später stand Michael vor ihrer Tür, in der einen Hand den Scheck für die Miete, in der anderen Boris.
«Ich hab ihn auf dem Fenstersims entdeckt», sagte er. «Er hat leicht selbstmordgefährdet ausgesehen.»
Die Vermieterin schaute die Tigerkatze finster an. «Wohl eher mordsgefährlich. Er war wieder hinter den Vögeln her. Lässt du ihn bitte runter, mein Lieber? Ich kann es nicht ausstehen, wenn sein Atem nach Eichelhäher riecht.»
Michael ließ die Katze los und reichte Mrs. Madrigal den Scheck. «Tut mir leid wegen der Verspätung. Wieder mal.»
Sie tat seine Bemerkung mit einer Handbewegung ab und steckte den Scheck hastig in ein halb gelesenes Buch mit Geschichten von Eudora Welty. Sie fand es grässlich, mit ihren Kindern über Geld zu reden. «Ach so», sagte sie, «was machen wir mit Mary Anns Geburtstag?»
Michael zuckte zusammen. «O Gott. Ist es schon so weit?»
Mrs. Madrigal lächelte. «Nach meiner Rechnung nächsten Dienstag.»
«Sie wird doch dreißig, oder?» Michaels Augen glitzerten diabolisch.
«Wir sollten das wohl besser nicht betonen, mein Lieber.»
«Erwarten Sie von mir nicht, dass ich mich gnädig zurückhalte», sagte Michael. «Mit meinem Dreißigsten hat sie mich voriges Jahr erbarmungslos getriezt. Außerdem ist sie hier im Haus die Letzte, die über die große Schwelle tritt. Da ist es nur normal, wenn wir das Ereignis gebührend feiern.»
Mrs. Madrigal warf ihm ihren «Du ungezogener Junge!»-Blick zu und ließ sich in den Lehnstuhl am Kamin sinken. Boris witterte eine neue Chance, sich malerisch in Szene zu setzen, sprang auf ihren Schoß und blinzelte träge ins Feuer. «Kann ich dich für einen Joint interessieren?», fragte die Vermieterin.
Michael schüttelte lächelnd den Kopf. «Danke. Ich komm so schon zu spät zur Arbeit.»
Sie lächelte ebenfalls. «Dann grüß Ned schön von mir. Dein neuer Haarschnitt sieht übrigens toll aus.»
«Danke», sagte Michael strahlend und wurde leicht rot.
«Es gefällt mir, wenn man deine Ohren sieht. Du wirkst dann richtig jungenhaft. Gar nicht so, als wärst du schon jenseits der großen Schwelle.»
Michael bedankte sich mit einer kleinen eleganten Verbeugung.
«Los jetzt», sagte die Vermieterin. «Lass tausend Blumen blühen.»
Als er fort war, gestattete sie sich ein heimliches Grinsen über sein Gerede von der großen Schwelle. Mein Gott, sie war jetzt sechzig. Hieß das, dass sie schon zweimal darübergetreten war?
Sechzig. Von Nahem war die Zahl lange nicht so dräuend wie einst von fern. Eigentlich besaß sie sogar eine stimmige Rundheit, wie ein reifer Gouda oder ein behagliches Sitzkissen.
Was für Vergleiche? Sie lachte in sich hinein. Was war aus ihr geworden? Ein alter Käse? Ein Einrichtungsgegenstand?
Eigentlich war es ihr egal. Sie war Anna Madrigal, Frau aus freien Stücken, und auf der ganzen Welt war niemand sonst genau wie sie.
Mit dieser beruhigenden Litanei im Hinterkopf drehte sie sich aus ihrem feinsten Sinsemilla einen Joint und lehnte sich mit Boris zurück, um das Feuer zu genießen.
Michael
Seit fast drei Jahren war Michael Tolliver nun Leiter einer Gärtnerei namens God’s Green Earth im Richmond District. Der Besitzer des Geschäfts war Michaels bester Freund Ned Lockwood, ein muskulöser Zweiundvierzigjähriger und quasi der Prototyp eines Schwulen mit Naturberuf.
Schwule mit Naturberuf waren nach Michaels Diktion alle, die sich auf Männerart und im Freien mit schönen, lebendigen Dingen beschäftigten: Gärtner, Landschaftsgärtner, Forstaufseher und manche Landschaftsarchitekten. Floristen gehörten selbstverständlich nicht dazu.
Michael beschäftigte sich gern mit Erde. Die Früchte seiner Anstrengung hatten ästhetische, spirituelle, direkt greifbare und sogar sexuelle Qualitäten – manche Männer aus der Stadt fanden nichts erotischer als den Anblick eines Vornamens, der mit groben Stichen auf die Vorderseite eines verwaschenen grünen Overalls gestickt war.
Wie Michael war Ned nicht seit jeher ein Schwuler mit Naturberuf gewesen. Sein Studium an der University of California in Los Angeles hatte er in den frühen Sechzigerjahren als Tankwart an einer Chevron-Tankstelle in Beverly Hills finanziert. Dann war eines Tages ein berühmter, fünfzehn Jahre älterer Filmstar zum Ölwechsel vorgefahren und hatte sich hoffnungslos in den muskulösen, schlanken Jungen verknallt.
Von da an änderte sich Neds Leben radikal. In null Komma nichts ließ sich der Filmstar mit seinem neuentdeckten Schützling häuslich nieder. Er kam für Neds Studiengebühren auf und integrierte ihn – so weit es der Anstand und sein PR-Berater erlaubten – in sein Leben in Hollywood.
Ned blieb sich selbst ziemlich treu. Er war mit einer sexuellen Ausstrahlung gesegnet, die schon ans Mystische grenzte, und er gewann weiterhin das Herz jedes Mannes, jeder Frau und jedes Tiers, das ihm über den Weg lief. Sie alle waren weniger von seiner Schönheit in Bann geschlagen als von seiner angeborenen, fast kindlichen Gabe, Aufmerksamkeit zu schenken. In einer Stadt, in der niemand je zuhörte, tat er genau das.
Die Liebesaffäre dauerte fast fünf Jahre. Als sie zu Ende war, gingen die beiden Männer als Freunde auseinander. Der Filmstar half Ned sogar bei der Finanzierung seines Umzugs nach San Francisco.
Ned Lockwood war jetzt, in mittleren Jahren, attraktiver denn je, aber er bekam eine Glatze – nein, er hatte eine Glatze. Die verbliebenen Haare hielt er immer kurz, und seinen nackten Skalp trug er genauso stolz wie die Fernfahrer in den Pornofilmen von Wakefield Poole. «Wenn ich mal anfange, mir die Haare von hinten oder von der Seite hochzuharken», hatte er Michael einmal ernsthaft ermahnt, «dann musst du mich wegbringen und erschießen lassen.»
Ned und Michael waren zweimal miteinander ins Bett gegangen – 1977. Seither waren sie Freunde, verschworene Vertraute, Brüder. Michael liebte Ned; er erzählte dem älteren Mann seine amourösen Heldentaten wie ein kleiner Hund, der etwas nach Hause schleppte und es seinem Herrchen ehrfürchtig vor die Füße legt.
Und Ned hörte immer zu.
«Hast du Lust, morgen Abend ins Devil’s Herd zu gehen?», fragte Ned. «Da spielt eine Liveband.»
Michael blickte von seiner Arbeit auf. Er verpackte gerade die Primeln für einen Immobilienmakler aus Pacific Heights, der ewig lange zwischen den rosafarbenen und den gelben geschwankt hatte. Der Immobilienmakler beäugte Ned mit einem giftigen Blick und quengelte weiter: «Natürlich stehen auf der Terrasse ein paar Töpfe mit Fuchsien, und die sind in so einem blaustichigen Rot. Ich meine, vielleicht passt das Rot gar nicht zu dem Gelb. Was sagen Sie denn dazu?»
Michael warf Ned einen entschuldigenden Blick zu und bemühte sich um Geduld seinem Kunden gegenüber. «Alle Blumen passen zueinander», sagte er gelassen. «Gott ist kein Dekorateur.»
Der Immobilienmakler zuckte kurz mit den Augenbrauen. Vielleicht überlegte er, ob die Bemerkung unverschämt gewesen war. Dann lachte er trocken. «Aber manche Dekorateure sind Gott, stimmt’s?»
«Nicht bei mir», sagte Michael lächelnd.
Der Immobilienmakler rückte näher heran. «Sie kannten Jon Fielding, oder?»
Michael tippte die Preise ein. «Könnte man sagen», antwortete er.
«Oh … falls ich einen wunden Punkt getroffen habe, tut es mir leid.»
«Keine Bange.» Er lächelte lässig und hoffte, dass er nicht so gereizt klang, wie er sich fühlte. «Es ist lange her, das ist alles.» Er schob seinem Inquisitor den Karton mit den Primeln hin. «Sie kennen ihn, hm?»
Der Immobilienmakler nickte. «Wir sind mal gemeinsam zu einem Treffen von Gamma Mu geflogen.» Er warf den Namen aus wie einen Köder – als wüsste alle Welt über die nationale Vereinigung schwuler Millionäre Bescheid.
Michael biss nicht an. «Grüßen Sie ihn schön von mir, wenn Sie ihn sehen», sagte er.
«Gut.» Der Immobilienmakler stierte einen Moment lang vor sich hin, dann streckte er die Hand aus und steckte seine Visitenkarte in die Tasche von Michaels Overall. «Damit Sie wissen, wer ich bin», sagte er sotto voce. «Sie sollten abends mal bei mir vorbeikommen. Ich habe Video.»
Er ging, ohne auf Antwort zu warten. An der Tür musste er an Ned vorbei.
«Und, wie isses?», fragte Ned.
Michael schaute die Karte des Immobilienmaklers kurz an, las den Namen Archibald Anson Gidde und warf sie in den Abfalleimer. «Entschuldige, Ned, was hast du gesagt?»
«Das Devil’s Herd», sagte Ned. «Morgen Abend?»
«Ach so … ja. Klar. Gern.»
Ned musterte ihn kurz, dann fuhr er ihm durch die Haare. «Fühlst du dich auch wohl, Bubba?»
«Klar», sagte Michael.
«Hat der Kerl …?»
«Er kennt Jon», sagte Michael. «Das ist alles.»
Die A-Schwulen treffen sich
Arch Gidde war völlig aufgelöst. Zwanzig Minuten vor der erwarteten Ankunft seiner Gäste zum Abendessen steckten die gelben Primeln immer noch in ihren schäbigen Plastiktöpfchen. Und Cleavon – der Teufel sollte den faulen, unzuverlässigen Kerl holen – war immer noch in der Küche und trödelte mit dem Sushi herum.
Arch brüllte aus dem Schlafzimmer. «Cleavon … Cleavon!»
«Jau», antwortete Cleavon.
Der Immobilienmakler zuckte vor dem Spiegel zusammen. Um Himmels willen, jau. Harold hatte nie jau gesagt. Harold war tuntig gewesen, klar, aber niemals respektlos. Doch Arch hatte Harold bei der Scheidung verloren, und Rick war zu egoistisch (und viel zu gewieft), um sich von einem fähigen Diener zu trennen, der Schwarz und schwul war.
«Cleavon», schrie Arch, «ich kann nicht deutlich genug betonen, dass die Primeln eingetopft werden müssen, bevor die Gäste eintreffen. Vier sollen in den Elefantenkübel und vier in den Kasten am Ende der Terrasse.»
Pause. Dann ein weiteres Jau.
Arch Gidde stöhnte laut auf. Dann schob er die Ärmel seines neuen Kansai-Yamamoto-Pullovers von Wilkes hoch. Der war mit einer großen, mehrfarbigen Hyäne bestickt, die sich schräg über seine linke Schulter legte. Ist das zu viel?, fragte er sich.
Nein, entschied er. Nicht zum Sushi.
Die Gäste trafen fast gleichzeitig ein. Sie hatten alle an einer Cocktailparty bei Vita Keating teilgenommen, der Frau des Presto-Pudding-Erben.
Es waren: Edward Paxton Stoker Jr. und Charles Hillary Lord (die Stoker-Lords), William Devereux Hill III und Anthony Ball Hughes (die Hill-Hugheses), John Morrison Stonecypher (manchmal auch «der Pflaumenprinz» genannt) und Peter Prescott Cipriani.
Auffällig war das Fehlen von Richard Evan Hampton, Arch Giddes Ex; die Hampton-Giddes waren nicht mehr.
«Also», gurrte Chuck Lord, als er ins Wohnzimmer rauschte, «ich muss schon sagen, der Diener gefällt mir.»
Arch lächelte reserviert. «Irgendwie hab ich so was erwartet.»
«Er ist aber nicht aus Oakland, oder?», fragte Ed Stoker, Chucks bessere Hälfte.
«Aus San Bruno», sagte Arch.
«Schade. Chuckie mag nur die aus Oakland.»
Chuck Lord warf seinem Liebhaber einen vernichtenden Blick zu, dann wandte er sich wieder an seinen Gastgeber. «Kümmer dich gar nicht um die», sagte er. «Sie hat schon die ganze Woche Wallungen.»
Arch bemühte sich redlich, nicht zu grinsen. Chuck Lords Gier nach «Schwarzen von der East Bay» war unter den A-Schwulen in San Francisco allgemein bekannt. Während Ed Stoker zu Hause blieb, eine Valium nach der anderen schluckte und Allure von Diana Vreeland las, schlich sein Multimillionärsgatte auf der Suche nach Schwarzen Automechanikern durch die Straßen von Oakland.
Und jedes Mal, wenn Ed die Scheidung wollte (jedenfalls erzählte man es so), packte Chuck das schiere Entsetzen. «Aber Liebling», keuchte er in solchen Momenten, «was wird dann aus dem Baby?»
Das Baby war ein Mietshaus mit acht Wohnungen im Haight, das den beiden Männern gemeinsam gehörte.
«Ratet mal, wen ich heute in der Gärtnerei gesehen habe», sagte Arch beim Dessert.
«Wen?», fragte der Pflaumenprinz.
«Michael Tolliver.»
«Wen?»
«Du weißt schon. Das Schnittchen, das mal mit Fielding liiert war.»
«Der Krüppel?»
«Nicht mehr. Gott, wo warst du denn?»
«Entschuldigung, Gnädigste.»
«Er hat mir im Gewächshaus praktisch zwischen die Beine gefasst.»
«Wo ist Fielding übrigens?»
«Auf einem Schiff oder so. Kotztabletten austeilen. Ganz unsäglich.»
Peter Cipriani ging vorbei und ließ eine Zeitschrift in Archs Schoß fallen. «Wo wir gerade bei Unsäglichkeiten sind, hast du dir diesen Monat schon Madame Giroux zu Gemüte geführt?» Die Zeitschrift hieß Western Gentry, und das Objekt von Peters Verachtung war eine gewisse Prue Giroux, die Klatschkolumnistin. Arch blätterte die letzte Seite auf und fing an, seinen Gästen laut vorzulesen:
«‹Als ich heute Morgen mit dem charmanten und reizenden Schwarzen sprach, der in der Garage neben dem L’Etoile die Autos einparkt, musste ich daran denken, wie glücklich wir uns doch schätzen können, in einer Stadt zu leben, in der sich so viele Menschen so vieler interessanter Kulturen, Konfessionen und Hautfarben drängen.›»
Tony Hughes stöhnte und verdrehte die Augen. «Die blöde Schlampe hält sich wohl für die neue Eleanor Roosevelt.»
Arch las weiter: «‹Mich, ein einfaches Mädchen vom Lande aus Grass Valley …›»
Diesmal stöhnten alle.
«‹Mich, ein einfaches Mädchen vom Lande aus Grass Valley, erfüllt es mit großer Freude und Befriedigung, dass ich mich zu den Freunden von so bekannten Schwarzen wie Kathleen Cleaver zählen darf, der Frau des berühmten Bürgerrechtlers, von so bemerkenswerten Juden wie Dr. Heinrich Viertel (dem Autor von Erforschung des Es) und von Ethel Merman, die ich kennengelernt habe, als sie bei uns in der Stadt war, um für ihr fabelhaftes neues Disco-Album zu werben.›»
Diesmal ertönten spitze Schreie. Tony riss Arch die Zeitschrift aus der Hand. «Das hat sie nicht geschrieben! Das hast du erfunden!» Arch überließ Tony das Feld, denn er wollte offensichtlich selbst weiter vorlesen.
Fast unbemerkt entfernte Arch sich vom Tisch, um sich eines Falls anzunehmen, der sich möglicherweise schon zur Krise ausgewachsen hatte: Cleavon hatte den Kaffee nicht gebracht. Und Chuck Lord war noch nicht von der Toilette zurück.
Mit vor Wut hochrotem Kopf horchte Arch an der Toilettentür, bevor er sie gegen alle Höflichkeit aufriss.
Cleavon saß auf dem schwarzen Onyxbecken und hielt sich das eine Nasenloch zu, während Chuck Lord ihm in das andere Kokain spatelte. Chuck grinste affektiert und ließ das Zubehör wieder in der Tasche seines Alexander-Julian-Jacketts verschwinden, ohne auch nur einen Anflug von Reue zu zeigen.
Arch bedachte seinen Gast mit einem mörderischen Blick. «Komm zurück aufs Floß, Huckilein. Man vermisst dich schon.»
Als Chuck gegangen war, kletterte Cleavon vom Waschbecken und schnupfte die Kristalle geräuschvoll in die Nebenhöhlen. Sein Arbeitgeber war fuchsteufelswild, beherrschte sich aber. «Wir hätten jetzt gerne den Kaffee, Cleavon.»
«Jau», sagte der Diener.
Im Wohnzimmer röhrte ein angeheiterter Peter Cipriani dem zurückkommenden Chuck Lord ein Rätsel entgegen: «He, Chuckie! Was ist dreißig Zentimeter lang und weiß?»
«Was?», lautete die verhaltene Antwort.
«Nichts», schrie Peter. «Absolut nichts!»
Arch Gidde hätte sterben können.
Prues Coup
Die Leute sagten die gemeinsten Sachen über Prue Giroux. Ihre gertenschlanke Figur und ihr gutes Aussehen, sagten sie, hatten ihr zu allem verholfen, was sie sich immer gewünscht hatte – außer zu Respekt. Wenn die Leute über ihre Scheidung von Reg Giroux sprachen, war Reg derjenige, der «immer so nett» gewesen war. Durch einen merkwürdigen Zufall war er auch der mit den vierzig Millionen Dollar gewesen.
Von denen hatte Prue jetzt ein paar, Gott sei Dank. Und ein Stadthaus von Tony Hail auf dem Nob Hill. Und genügend Galanos-Kleider, um die gesamte Amtszeit von Nancy Reagan zu überstehen, selbst wenn sie – toi, toi, toi – acht Jahre dauern sollte.
Das wahre Geheimnis von Prues Macht lag jedoch in ihrer Kolumne in der Western Gentry. Prue hatte entdeckt, dass es egal war, wenn man keiner alten Familie entstammte und der eigene Reichtum nur auf einer Abfindung beruhte. Was machte es schon, wenn man sich vertat und Thaïs wie «Thais» aussprach oder nach dem ersten Satz einer Symphonie klatschte oder am helllichten Nachmittag einen Empfang mit Smokingzwang gab? Wenn man eine Klatschkolumne schrieb, kam man bei dem Mistvolk immer rein.
Natürlich nicht bei allen. Manche von den distinguierten Herrschaften aus San Mateo (sie hatte sich dazu erzogen, nicht Hillsborough zu sagen) beobachteten Prue immer noch mit kühler Distanziertheit. Den jungen Salonlöwinnen schien jedoch klar zu sein, dass ihre Stellung ohne eine zumindest nominelle Anerkennung durch die Klatschpresse völlig ungesichert war.
Deshalb luden sie Prue zum Mittagessen ein.
Nicht zum Abendessen, nur zum Mittagessen. Als zum Beispiel Ann Getty im Februar ihre Soiree für Baryschnikow im Bali’s gegeben hatte, war es nicht wirklich nötig gewesen, Prue am Geschehen teilnehmen zu lassen; die Gäste hatten ihr die pikantesten Details einfach am nächsten Morgen telefonisch mitgeteilt.
Prue störte das eigentlich nicht. Sie hatte viel durchgemacht, und das war ihr bewusst. Ihr Hang, sich als «einfaches Mädchen vom Lande aus Grass Valley» vorzustellen, war keine Affektiertheit. Sie war ein einfaches Mädchen vom Lande aus Grass Valley – eines von sieben Kindern, die ein Traktorenvertreter mit seiner Frau, einer Adventistin vom Siebenten Tag, großgezogen hatte.
Als sie Reg Giroux kennenlernte, der damals Chef eines mittelständischen Flugzeugherstellers war, hatte Prue gerade erst als Dentalhygienikerin zu arbeiten angefangen; das heißt, sie reinigte ihm die Zähne mit Zahnseide. Regs Freunde waren entsetzt, als er im Sommer im Bohemian Grove ihre Verlobung bekanntgab.
Trotzdem schien die Ehe einige Zeit zu funktionieren. Prue und Reg bauten sich im Mother Lode Country ein weitläufiges Ferienhaus, das zum Schauplatz vieler aufwendiger, jeweils mit einem Motto versehener Kostümfeste wurde. Bei ihrem Grün-und-Rosa-Ball spielte Prue für Erica Jong, Tony Orlando und Joan Baez die Gastgeberin, und zwar für alle drei am selben Nachmittag. Sie konnte kaum an sich halten.
Das wurde schließlich zum Problem. Reg fühlte sich in seiner Gesellschaftsschicht wohl, und weder teilte noch verstand er das anscheinend unstillbare Verlangen seiner Frau nach Prominenten. Prues wöchentliches Mittagessen inklusive Stargast, das auf dem Nob Hill stattfand und das sie hochtrabend «Forum» getauft hatte, wurde von den distinguierten Herrschaften so einmütig gemieden, dass sogar ihr Mann darunter zu leiden begann.
Deshalb machte er sich aus dem Staub.
Zu Prues Glück fiel ihre Scheidung praktischerweise mit der Verhaftung und Verurteilung (wegen exhibitionistischer Handlungen) des Western-Gentry-Klatschkolumnisten Carson Callas zusammen. Also lud sie den Herausgeber der Zeitschrift zum Mittagessen ein und setzte zu ihrem Coup an. Der Herausgeber, der selber ein einfacher Junge vom Lande war, verwechselte Prues einstudierte Eleganz mit aristokratischer Würde und engagierte sie vom Fleck weg.
Von da an war sie ihre eigene Herrin.
Prues dreijähriger russischer Wolfshund Vuitton war seit fast einer Woche verschwunden. Prue wusste nicht mehr ein noch aus. Dass der Mann von der Parkverwaltung sich in dieser Krise so ekelhaft vage äußerte, machte alles nur noch schlimmer.
«Ja, Ma’am, ich glaub, ich erinner mich an den Bericht. Wo, ham Sie gesagt, ham Sie ihn noch mal verloren?»
Prue seufzte genervt. «In den Baumfarnen. Gegenüber vom Gewächshaus. Den einen Moment war er noch da, und den nächsten …»
«Letzte Woche?»
«Ja. Am Samstag.»
«Kleinen Moment.» Sie hörte ihn Akten durchblättern. Der Trottel pfiff dabei «Oh Where Oh Where Has My Little Dog Gone». Es vergingen ein paar Minuten, bevor er wieder am Telefon war. «Nein, Ma’am. Fehlanzeige. Ich hab’s zweimal durchgeschaut, ’nen russischen Wolfshund hat keiner gesehen in den letzten …»
«Und Sie haben auch keine verdächtigen Kambodschaner gesehen?»
«Ma’am?»
«Kambodschaner. Flüchtlinge. Sie wissen doch.»
«Ja, Ma’am, aber ich versteh nich, was …»
«Muss ich es denn buchstabieren? Die essen nämlich Hunde, müssen Sie wissen. Und sie haben schon welche gegessen!»
Schweigen.
«Das hab ich im Chronicle gelesen», fügte Prue hinzu.
Nach nochmaligem Schweigen: «Hören Sie, Ma’am. Was halten Sie davon, wenn ich die berittne Streife bitte, dass sie ihre Augen offen halten, okay? Aber bei so ’nem Hund isses ziemlich wahrscheinlich, dass er entführt worden is. Ich würd Ihnen ja gern mit was Bessrem kommen, aber leider.»
Prue bedankte sich und legte auf. Armer Vuitton. Sein Schicksal lag in den Händen von Unfähigen. Irgendwo im Tenderloin aßen die Boat People möglicherweise Wolfshund süßsauer, und Prue war hilflos. Hilflos.
Bevor sie sich an ihre Kolumne setzte, ging sie zur Beruhigung zehn Minuten im Huntington Park spazieren. Als sie zurückkehrte, berichtete ihre Sekretärin, dass Frannie Halcyon angerufen und Prue für den nächsten Tag zum Mittagessen eingeladen hatte, um mit ihr «eine Angelegenheit von allerhöchster Dringlichkeit» zu besprechen.
Frannie Halcyon war die Grande Dame von Hillsborough. Mit Leuten wie Prue Giroux hatte sie sich noch nie befasst, geschweige denn sie zum Mittagessen auf den Familiensitz bestellt.
«Eine Angelegenheit von allerhöchster Dringlichkeit.»
Was konnte das nur sein?
Die Matriarchin
Manchmal konnte Frannie sich des Gedankens nicht erwehren, dass ein Fluch auf Halcyon Hill lastete.
Wenn sie sich die Zeit nahm und über das Schreckliche nachdachte, das den Mitgliedern ihrer Familie zugestoßen war, erschien das genauso plausibel wie alles andere. Mit vierundsechzig war sie die einzige überlebende Halcyon, der abgetakelte klägliche Rest einer Dynastie, die so gut wie kapituliert hatte vor Tod, Krankheit und Zerstörung.
Edgar, ihr Mann, war am Heiligen Abend des Jahres 1976 seinen «Schrottnieren» (sein Wort) erlegen.
Beauchamp, ihr Schwiegersohn, war ein Jahr später bei einem Autounfall im Broadway Tunnel verbrannt.
Faust, ihre geliebte Dogge, war kurz danach gestorben.
DeDe, ihre Tochter und Beauchamps von ihm getrennt lebende Frau, hatte Ende 1977 zwei Chinesenmischlinge geboren und war mit einer Freundin von fragwürdiger Herkunft nach Guyana geflohen.
Das Massaker von Jonestown. Noch jetzt, drei Jahre nach dem Ereignis, konnte es passieren, dass Frannie diese Worte von einer Zeitungsseite entgegensprangen wie die tückischen Giftzähne einer Viper.
Edgar, Beauchamp, Faust und DeDe. Ein Schrecken nach dem anderen. Eine Demütigung nach der anderen.
Und nun die äußerste Erniedrigung.
Es war ihr nichts anderes übrig geblieben, als Prue Giroux zum Mittagessen einzuladen.
Emma brachte ein Tablett mit Mai Tais in den Wintergarten.
«Eine kleine Erfrischung?», fragte Frannie.
Die Kolumnistin setzte ihr süßliches Kleinmädchenlächeln auf. «Es ist einen Tick zu früh für mich, danke.»
Frannie hätte sie schlagen können. Stattdessen ließ sie sich von Emma mit einem huldvollen Nicken einen Drink reichen, nippte geziert daran und erwiderte das Lächeln dieser hoffnungslos gewöhnlichen Frau. «Ihre Kolumne», sagte sie, «finde ich … sehr amüsant.»
Prue strahlte. «Wie mich das freut, Frannie. Ich tu mein Bestes, um einen guten Fluss hinzukriegen.»
«Ja. Es plätschert nur so.» Innerlich schäumte Frannie vor Wut. Wie konnte diese Person es wagen, sie mit Vornamen anzusprechen?
«Also, ich finde», fuhr Prue fort – und führte ein offenbar liebgewonnenes Thema weiter aus –, «dass es auf der Welt viel zu viel Hässliches gibt, und wenn jeder von uns auch nur eine kleine Kerze anzünden würde … na, Sie wissen ja.»
Frannie sah ihren Anknüpfungspunkt. «Ich vermute, Sie wissen um meine Tochter.»
«Ja.» Die Kolumnistin setzte ein tragisches Gesicht auf. «Es muss schrecklich gewesen sein für Sie.»
«Ja, das war es. Und ist es noch.»
«Ich kann mir nicht mal vorstellen, wie so etwas ist.»
«Das kann kaum jemand.» Frannie trank einen Schluck Mai Tai. «Außer Catherine Hearst vielleicht. Sie kommt manchmal zu Besuch. Sie war wahnsinnig lieb. Ah … dürfte ich Ihnen etwas zeigen?»
«Natürlich.»
Die Matriarchin entschuldigte sich und kam kurz darauf mit den Beweisstücken zurück, die inzwischen fast bis zur Unkenntlichkeit ramponiert waren. «Die haben mal DeDe gehört», sagte sie.
Die Kolumnistin lächelte. «Pompons. Ich war auch mal Cheerleader.»
«DeDe hat sie sich schicken lassen», fuhr Frannie fort, «als sie in Jonestown war. Sie hatte sie schon im Sacred Heart, und sie fand den Gedanken hübsch, in Guyana bei den Basketballspielen damit aufzutreten.» Sie nestelte an ihrer Cocktailserviette herum. «Man hat sie unter ihren Sachen gefunden … hinterher.»
«Sie … äh … war in Guyana Cheerleader?»
Die Matriarchin nickte. «Nur so zum Spaß. Wussten Sie nicht, dass es dort ein Basketballteam gab?»
«Nein», sagte Prue vorsichtig. «Das wusste ich nicht.»
«DeDe war ein Tatmensch, Prue. Sie hat das Leben über alles geliebt. Jedenfalls steht fest, dass sie und die Kinder nicht unter den Toten von Jonestown waren … und tief in meinem Herzen weiß ich, dass sie dort lebend rausgekommen sind.»
«Wann?»
«Ich weiß nicht. Vorher. Wann auch immer.»
«Aber, vermuten die Behörden denn nicht …?»
«Die vermuten viel, diese Idioten! Sie haben mir schon gesagt, dass DeDe tot ist, bevor sie noch festgestellt hatten, ob ihre Leiche überhaupt dort war.» Frannie beugte sich vor und blickte Prue flehend an. «Sie kennen das wahrscheinlich alles schon, ich weiß. Aber ich habe Sie gerufen, weil ich Ihre Hilfe brauche, um eine neue Entwicklung an die Öffentlichkeit zu bringen.»
«Bitte», sagte die Kolumnistin, «sprechen Sie weiter.»
«Ich habe diese Woche mit einem Medium gesprochen. Mit einem sehr seriösen. Sie sagt, dass DeDe, ihre Freundin und die Zwillinge leben und in einem kleinen südamerikanischen Dorf wohnen.»
Schweigen.
«Ich bin keine Hysterikerin, Prue. Ich halte normalerweise nicht viel von solchen Dingen. Aber diese Frau war sich ihrer Sache dermaßen sicher. Sie hat alles gesehen: die Hütte, ihre Schlafmatten, die Dorfbewohner auf dem Markt, die süßen kleinen Zwillinge, wie sie nackt …» Frannies Stimme versagte; sie spürte, dass sie kurz vor dem Zusammenbruch stand. «Bitte helfen Sie mir», bettelte sie. «Ich weiß nicht, an wen ich mich sonst wenden sollte.»
Prue nahm ihre Hand und drückte sie. «Sie wissen, dass ich Ihnen helfen würde, Frannie, wenn es eine Möglichkeit gäbe … na ja, die Tagespresse oder das Fernsehen sind sicher eher in der Lage, so was in Angriff zu nehmen.»
Ein Ruck ging durch die Matriarchin. «Mit denen habe ich schon gesprochen. Denken Sie etwa, ich würde Sie als Erste anrufen?»
Es hatte keinen Sinn! Dieses lächerliche Frauenzimmer war nicht besser als alle anderen, die sie bloß geduldig ertrugen wie ein seniles, aufdringliches altes Weib. Frannie ließ das Thema fallen und brachte ihren Gast ohne weitere Umstände und in aller Eile durch das Mittagessen und an die Tür.
Um drei lag sie wieder im Bett, trank Mai Tais und schaute auf dem «Bauchflimmi» fern, den DeDe und Beauchamp ihr nach Edgars Tod geschenkt hatten. Als Nachmittagsfilm lief Traum meines Lebens mit Katherine Hepburn, einer von Frannies Lieblingsfilmen.
Während der «Unterbrechung» gab eine hübsche junge Frau den Zuschauern Einkaufstipps: wo man im Gebiet Walnut Creek und Lafayette gute zweite Wahl kaufen konnte. Frannie drehte den Ton weg und schenkte sich noch einen Mai Tai ein.
Als sie wieder auf den Fernseher schaute, fiel ihr fast der Drink aus der Hand.
Dieses Gesicht! Natürlich! Das war Edgars ehemalige Sekretärin. Frannie hatte sie schon mindestens vier Jahre nicht mehr gesehen. Seit Beauchamps Beerdigung wahrscheinlich.
Wie hieß sie überhaupt? Mary Jane Dingsbums. Nein … Mary Lou?
Die Matriarchin drehte den Ton wieder an. «Mary Ann Singleton», zwitscherte die junge Frau, «wünscht Ihnen Schnäppchen in rauen Mengen!»
Mary Ann Singleton.
Vielleicht, dachte Frannie. Nur vielleicht …
Ein Tagesgesicht
Nach fast zwei Jahren beim Fernsehen war Mary Ann Singleton nun endlich eine Frau im Fernsehen.
Ihre Show Bargain Matinee versuchte sich an einer Auffrischung des alten Dialing-for-Dollars-Schemas für den Nachmittagsfilm: Die Zuschauer aus der Bay Area bekamen Tipps, wie sie beim Einkaufen der Inflation ein Schnippchen schlagen konnten. Schließlich befand man sich in den Achtzigern. Im Gegensatz dazu waren die Filme fest in den Fünfzigern verankert: anheimelnde alte Schinken wie Das Geheimnis von Santa Vittoria, Fieber im Blut oder – gerade aktuell – Traum meines Lebens. Solche Filme hatte man in den Tagen vor dem Equal Rights Amendment Frauenfilme genannt.
Mary Anns Sternstunde war ein Fünfminutenspot nach der ersten Hälfte des Films.
Der Inhalt änderte sich kaum: verbeulte Konserven, Zweite-Wahl-Käufe, chinesische Regenschirme als schicke Lampen, selbst gemachtes Parfüm, empfehlenswerte Pastaläden, neue Verwendungsmöglichkeiten für alte Kaffeebüchsen. Michael redete hartnäckig von Mary Anns «Hints from Heloise».
Mary Ann fand das Hausfrauenimage, das sie in ihrer Sendung vermitteln musste, eigentlich peinlich, aber sie konnte nicht abstreiten, dass der Fernsehruhm auch eine angenehm erregende Seite hatte: Fremde starrten sie im Bus an; Nachbarn baten sie im Searchlight Market um ein Autogramm auf ihre Einkaufstüten.
Trotzdem fehlte ihr etwas. Daran hatte sich auch durch den Sprung auf den Bildschirm nichts geändert.
Mary Ann fand, dass man als Frau im Fernsehen eine glamouröse Enthüllungsjournalistin sein musste, eine feminine Feministin à la Jane Fonda in Das China-Syndrom oder Sigourney Weaver in Der Augenzeuge. Nur eine Reporterin, die sich ins Geschehen einmischte, konnte eine richtige Fernsehfrau sein.
Und Mary Ann würde sich nicht mit weniger begnügen.
Sofort nach der Abmoderation verließ sie Studio B und eilte in ihr Kabuff zurück, ohne sich vorher in der Garderobe abzuschminken.
Es war fünf. Noch konnte sie den Nachrichtenchef erwischen, bevor er für die Abendnachrichten mobilmachte.
Auf ihrem Schreibtisch lag eine Notiz:
MRS. HARRISON HAT ANGERUFEN.
«Hast du das angenommen?», fragte sie die Redakteurin von nebenan.
«Nein, Denny. Er ist in der Cafeteria.»
Kollege Denny aß gerade einen Happy Snack aus der Mikrowelle. «Wer ist Mrs. Harrison?», fragte Mary Ann.
«Sie hat gesagt, du wüsstest Bescheid.»
«Harrison?»
«Es hat sich jedenfalls so angehört. Sie hatte einen sitzen.»
«Toll.»
«Sie hat direkt nach deinem Auftritt angerufen. Sie hat gesagt, es sei ‹höchst dringend›.»
«Das liegt an Traum meines Lebens. Die Besoffenen rufen immer bei den Schnulzen an. Keine Nummer, hm?»
Denny zuckte mit den Schultern. «Sie hat gesagt, du kennst sie.»
Larry Kenan, der Nachrichtenchef, rekelte sich in seinem Drehstuhl, verschränkte seine Finger hinter dem föhnfrisierten Kopf und schaute affektiert grinsend zu dem Bo-Derek-Poster hoch, das er über seinem Schreibtisch an die Decke geklebt hatte. Die Inschrift war ebenfalls sein Werk und unauslöschlich in Mary Anns Bewusstsein eingebrannt: KEINER MACHT’S BESSER ALS LARRY – IN WOLLUST, BO.
«Soll ich Ihnen mal die ungeschminkte Wahrheit sagen?», fragte er.
Mary Ann wartete. Der Blödmann deklarierte seine Meinung immer als die ungeschminkte Wahrheit.
«Die ungeschminkte Wahrheit ist, dass Sie ein Tagesgesicht haben, und die Zuschauer wollen bei den Sechs-Uhr-Nachrichten kein Tagesgesicht sehen. Basta und Schluss. Mensch, was soll ich sagen, Mädchen? Es ist nicht schön, aber es ist die Wahrheit.» Er riss sich lang genug von Bo Derek los, um Mary Ann sein «Pech gehabt, Kleines»-Grinsen rüberzuschicken.
«Was ist mit Bambi Kanetaka?»
«Was soll mit ihr sein?»
Mary Ann wusste, dass sie vorsichtig sein musste. «Na ja … sie hatte eine Tagesshow, aber jetzt darf sie …»
«Bei Bambi ist das was anderes.» Larry funkelte sie an.
Ich weiß, dachte Mary Ann. Sie bläst auf Befehl.
«Ihre Werte waren spitze», sagte Larry. Er forderte Mary Ann fast dazu heraus, nicht klein beizugeben.
«Dann testen Sie mich doch auch», sagte Mary Ann. «Ich lass mich gern …»
«Wir haben Sie schon getestet, okay? Das war vor zwei Monaten, und Ihre Werte waren der totale Reinfall. Reicht das?»
Es tat mehr weh, als ihr lieb war. Auf Hautwiderstandsmessungen hatte sie noch nie etwas gegeben. Was war schon zu beweisen, wenn man ein paar Zuschauer als Versuchskaninchen an Elektroden anschloss? Nur, dass manche Darsteller die Zuschauer stärker ins Schwitzen brachten als andere. Toll.
Sie versuchte es andersrum. «Ich bräuchte doch nicht die ganze Zeit vor der Kamera zu stehen. Ich könnte recherchieren. Es gibt ’ne Menge Themen, die die Stammreporter nicht bearbeiten können, weil ihnen die Zeit oder auch die Lust dazu fehlt.»
Larry verzog den Mund. «Zum Beispiel?»
«Na ja …» Denk nach, befahl sie sich, denk nach! «Na ja, die Schwulenszene zum Beispiel.»
«Ach ja?», sagte er mit hochgezogenen Augenbrauen. «Und über die wissen Sie Bescheid, hm?»
Sie wusste nicht recht, wie sie die Bemerkung auffassen sollte. Hielt er sie für eine Lesbe? Oder spielte er nur wieder mit ihr? «Ich hab ’ne Menge … Kontakte», sagte sie. Eine Lüge. Na und? Michael hatte eine Menge Kontakte; und das war praktisch dasselbe.
Er lächelte sie an, wie wohl ein Polizist ein weggelaufenes Kind anlächelte.
«Ich will Ihnen mal die ungeschminkte Wahrheit sagen», sagte er. «Den Zuschauern hängen die Schwulen schon zum Hals raus.»
Der Mann in ihrem Leben
Auch wenn Larry Kenan ein Arschloch war – und daran war inzwischen nicht mehr zu rütteln –, so verschaffte Mary Anns Gehalt ihr doch gewisse Annehmlichkeiten, die das Leben in der Stadt entschieden reizvoller machten:
Sie aß jetzt im Ciao.
Sie fuhr einen Le Car.
Sie trug zu ihren Calvins Samtblazer und Herrenhemden mit Button-down-Kragen – ein Aufzug, den Michael hartnäckig als «Lesbenklassik» bezeichnete.
Sie hatte alles Gelbe und alle Korbmöbel aus ihrer Wohnung verbannt und sie stattdessen mit stahlgrauem Teppichboden und technizistischen Metallregalen ausgestattet.
Sie hatte ihr San-Francisco-Abo gekündigt und las jetzt Interview.
Sie hatte sich für immer von Cost Plus verabschiedet.
Trotzdem kam sie gegen einen gewissen Frust wegen ihrer langsamen beruflichen Fortschritte nicht an.
Dieser Frust steigerte sich nur noch, als sie später am Abend eine besonders spannende Episode von Lou Grant sah, in der eine streitbare Journalistin und ihre Anstrengungen zur Wahrheitsfindung im Mittelpunkt standen.
Der Schmerz war kaum auszuhalten, weshalb Mary Ann den Fernseher ausschaltete und ins Badezimmer ging, um sich die Haare zu sassoonieren. Manchmal war Duschen das beste Beruhigungsmittel.
Ihre Haare waren jetzt kürzer als in den letzten Jahren. Leicht strähnig mit einem Schuss Leslie Caron und einem klitzekleinen Anflug New Wave. Etwas Extravaganteres hätte die Geschäftsleitung des Senders nicht hingenommen.
Als sie ihre neue Frisur mit einem Handtuch trocken rieb, fand sie es erstaunlich, dass sie sich einmal mit langen Haaren so viel Mühe und Umstände gemacht hatte. («Du wolltest dir die Haare immer hinten hochstecken», erinnerte Michael sich gern, «aber du hast damit immer ausgesehen wie Connie Stevens.»)
Nachdem sie ohne Erfolg ihre Kaninchenpantoffeln gesucht hatte, wickelte sie sich in einen übergroßen weißen Frotteebademantel und stieg die Treppe zum Häuschen auf dem Dach der Barbary Lane 28 hinauf.
Sie blieb einen Moment vor der vertrauten orangen Tür stehen und schaute durch das efeuüberwucherte Fenster in den klaren Sternenhimmel hinaus. Ein lichterfunkelnder Ozeandampfer glitt vorbei, als würde ein riesiger Kronleuchter aufs Meer hinausgeschleppt.
Mary Ann hörte sich seufzen. Teils wegen der Aussicht. Teils wegen des Mannes, der sie hinter der Tür erwartete.
Da sie wusste, dass er schon schlief, ging sie ohne Klopfen hinein. Er hatte eine Doppelschicht hinter sich, und die Gäste bei Perry’s waren noch lärmiger und strapaziöser gewesen als sonst. Wie erwartet lag er in seinen Boxershorts bäuchlings auf dem Bett.
Sie setzte sich auf die Bettkante und legte sacht ihre Hand auf die Mulde am Ende seines Rückens.
Der schönste Körperteil eines Mannes, dachte sie. Dieses warme kleine Tal kurz vor dem Po. Na ja, vielleicht der zweitschönste.
Brian bewegte sich, drehte sich dann um und rieb sich wie ein kleiner Junge mit den Fäusten die Augen. «Na», sagte er mit rauer Stimme.
«Na», antwortete sie.
Sie beugte sich vor, legte sich an seine Brust und genoss die Wärme seines Körpers. Als ihr Mund den seinen suchte, drehte Brian den Kopf weg und murmelte eine Warnung: «Mundgeruch, Schatz.»
Sie nahm sein Kinn in die Hand und küsste ihn trotzdem. «Na und?», sagte sie. «Was ist, wenn ich den kleinen Stinker mag?»
Glucksend schloss er sie in die Arme. «Na, wie war’s heute?»
«Beschissen», sagte sie ihm direkt ins Ohr.
«Hast du mit Larry Kenan geredet?»
«Mhmm.»
«Und?»
«Er will immer noch einen Fick, bevor er verhandelt.»
Brian riss sich von ihr los. «Das hat er gesagt?»
«Nein.» Mary Ann lächelte über seine aufgeregte Reaktion. «Jedenfalls nicht direkt. Ich weiß halt, wie er funktioniert. Bambi Kanetaka ist der lebende Beweis dafür.»
Brian tat, als hätte er nicht verstanden. «Ich find sie auch total scharf.»
Mary Ann zwickte ihn in den Po.
«Scharf und forsch. Eine erfolgversprechende Kombination.»
«Ich mach’s noch mal», warnte ihn Mary Ann.
«Ich hab gehofft, dass du das sagst», meinte Brian grinsend. «Nur langsamer diesmal, okay?»
Erinnerungen an Lennon
Das Schöne am Kellnerdasein war, dass man den ganzen verdammten Kram von einem Tag auf den anderen hinschmeißen konnte.
Es gab keine Betriebsrenten, die einen umtrieben, keine Digitaluhren zum fünfzigsten Dienstjubiläum, keine nervtötenden Forderungen nach Loyalität oder Betriebstreue. Kurz, es war etwas für den Lebensunterhalt, aber nie und nimmer ein Beruf.
Hatte er immer gedacht.
Inzwischen, nach sechs Jahren bei Perry’s, kamen ihm einige Zweifel. Wenn es jetzt noch kein Beruf war, wann dann? Nach zehn Jahren? Nach fünfzehn? Wollte er es so? Wollte sie es so?
Er löste sich von ihr und starrte schweigend zur Decke hoch.
«Okay», sagte Mary Ann. «Raus damit.»
«Schon wieder?»
Sie lachte über seinen Witz und kuschelte sich an seine Schulter. «Ich weiß, wie jemand aussieht, der nachdenkt. Also, worüber denkst du nach?»
«Ach … wahrscheinlich über die Zulassung. Ich glaub, es wird langsam Zeit.»
«Ich hab gedacht, du willst auf keinen Fall selber ein Lokal.»
Er zuckte zusammen. «Bei Gericht, Mary Ann. Als Rechtsanwalt in Kalifornien.»
«Oh.» Sie schaute ihn an. «Ich hab gedacht, das wolltest du auch auf keinen Fall.»
Darauf hatte er keine Antwort parat. Es stimmte, dass er diesen Beruf gehasst hatte, dass ihn jede Minute seines Daseins als Rechtsanwalt Brian Hawkins gelangweilt und ihm den letzten Nerv geraubt hatte. Seinen Hass hatte er durch engagierte Arbeit sublimiert – Schwarze, Indianer, Ölteppiche –, aber die «gute alte Langeweile», wie er sie nannte, hatte sich als genauso beharrlich und zählebig erwiesen wie das Gesetz.
Beim Gedanken an die sirrende Neonbeleuchtung, die ihn in dem mit Chinaleinen und Walnussmöbeln ausgestatteten Besprechungszimmer seiner letzten Anwaltskanzlei endlose Stunden lang gequält hatte, krümmte er sich noch jetzt. Eine solche Einrichtung stand für alles, was am Leben – wenn man es denn so nennen konnte – in der Geschäftswelt kleinkariert und ekelhaft war.
Deshalb war er seinem Beruf entflohen und Kellner geworden.
Darüber hinaus war er zum Schwerenöter geworden, der auf seiner hektischen und unersättlichen Jagd nach «Käfern» in Singlebars und Waschsalons eingefallen war. Er hatte sein Leben einfacher gemacht, seinen Körper der Mode angepasst und die «gute alte Langeweile» bezwungen.
Doch jetzt geschah etwas ganz anderes. Die Frau, die er einmal als «verklemmte Tussi aus Cleveland» bezeichnet hatte, war zweifellos die Liebe seines Lebens.
Und sie war diejenige, die Karriere machte.
«Ich muss was tun», sagte er zu Mary Ann.
«In welcher Beziehung?»
«Arbeitsmäßig», sagte Brian. «Jobmäßig.»
«Findest du, dass du zu wenig Trinkgeld …?»
«Es geht nicht ums Geld.» In seiner Stimme lag eine gewisse Schärfe. Sein schwindender Stolz machte ihn reizbar. Lass es nicht an ihr aus, ermahnte er sich. «Ich kann so einfach nicht mehr weitermachen», fügte er in sanfterem Ton hinzu.
«Was heißt ‹so›?», fragte sie vorsichtig.
«Wie jemand, der von dir abhängig ist. Das ertrag ich nicht, Mary Ann.»
Sie sah ihn nüchtern an. «Es geht also doch ums Geld.»
«Getrennte Kasse machen ist das eine. Was anderes ist es … ich weiß nicht … ausgehalten zu werden oder so.» Selbstverachtung und Verlegenheit trieben ihm die Röte ins Gesicht.
Mary Ann lachte unbekümmert. «Ausgehalten! Jetzt mach aber mal ’nen Punkt, Brian! Ich hab uns ein Wochenende in Sierra City bezahlt. Weil ich es wollte, du Dummkopf. Es war für mich das Gleiche wie … ach, Brian.» Sie griff nach seiner Hand. «Ich hab geglaubt, wir hätten diesen Machokram schon hinter uns.»
Er äffte sie affektiert nach. «Ich hab geglaubt, wir hätten diesen Machokram schon hinter uns.» Es war so kleinkariert und grausam, dass es ihm sofort leidtat. Als er in ihrem Gesicht nach Anzeichen von Verletztheit suchte, musste er entnervt feststellen, dass sie ihm bereits vergeben hatte.
«Was ist mit John?», fragte sie.
«Welchem John?»
«Lennon. Ich hab gedacht, du bewunderst ihn dafür, dass er Hausmann geworden ist, als Yoko …»
Brian schnaubte verächtlich. «Es war doch sein Geld, verdammt noch mal! Wenn man der reichste Mann von New York ist, kann man alles machen!»
Mary Ann starrte ihn ungläubig an. Nun war sie wirklich gekränkt. «Wie kannst du nur?», fragte sie leise.
«Wie kannst du etwas in den Dreck ziehen, was wir gemeinsam durchlebt haben?»
Sie sprach von der Mahnwache auf dem Marina Green. Sie und Brian hatten dort sechs Stunden mit dem Betrauern von Lennons Tod zugebracht. Sie hatten sich leer geweint, hatten Kerzen mit Erdbeerduft in der Hand gehalten, «Hey Jude» gesungen und eine neue hawaiianische Marihuanasorte geraucht, die Mrs. Madrigal nach dem Verstorbenen benannt hatte.
Brian hatte sich nie davor – und nie danach – in Mary Anns Gegenwart so verwundbar gezeigt.
Hinterher hatte er eine Notiz an ihre Tür geheftet:
HELP ME, IF YOU CAN, I’M FEELING DOWN, AND I DO APPRECIATE YOU BEING ’ROUND. ICH LIEBE DICH – BRIAN.
Er fühlte sich mies, na schön, aber das hatte mehr mit einer Midlife-Crisis zu tun als mit dem Tod eines Beatles.
Denn am Tag von John Lennons Tod waren alle aus Brian Hawkins’ Generation auf einen Schlag und unwiderruflich vierzig geworden.
«Tut mir leid», sagte er schließlich.
«Macht nichts», sagte sie, beugte sich vor und küsste ihn auf die Schulter.
«Ich bin nur … gerade gereizt.»
«Ich kann heute Nacht bei mir schlafen, wenn du …»
«Nein. Bleib. Bitte.»
Als Antwort gab sie ihm einen neuerlichen Kuss auf die Schulter. «Tu mir einen Gefallen», sagte sie.
«Welchen?»
«Werd nicht meinetwegen Rechtsanwalt. Ich bin schon ein großes Mädchen. Drachen braucht man mir zuliebe keine mehr zu töten.»
Er blickte in ihr strahlendes Gesicht. Manchmal verstand sie ihn besser als sonst jemand. «Gut», murmelte er. «‹With a little help from my friends› schaff ich das schon.»
Und manchmal brachte sie ihn dazu, die sentimentalsten Dinge zu sagen.
Cowboys
An der Valencia Street am anderen Ende der Stadt teilten sich Michael und Ned im Devil’s Herd, der beliebtesten schwulen Country-&-Western-Kneipe der Stadt, eine Flasche Mineralwasser. Calistoga.
Was Michael an dem Saloon am meisten mochte, war seine Glaubwürdigkeit: die gemütliche Band mit dem gedehnten Klang (Western Electric), die von der Decke baumelnden Pferdegeschirre, die hemdsärmeligen Annie-get-your-gun-Lesben, die vom Tresen aus «Yahoo» schrien.
Wenn er die Augen ein bisschen zusammenkniff, konnten die Squaredance tanzenden Kerle auch als angegraute Cowboys durchgehen, als aufgegeilte Goldgräber, die bis zum Eintreffen der nächsten Ladung Saloongirls aus dem Osten einfach einen draufmachten.
Zugegeben, die muskelstrotzenden Cowboys auf den Wandbildern schlugen in der Gesamtkomposition einen leicht verstädterten Ton an, doch das war Michael egal. Er war überzeugt, dass man den homoerotischen Höhlenmalereien in den Schwulenkneipen von San Francisco eines Tages die gleiche Verehrung erweisen würde, wie sie im Moment verstärkt die Wandbilder aus den New-Deal-Zeiten und die Eingangshallen von Mietshäusern aus dem Art-déco erfuhren.
«Mensch, sieh mal!», würde ein eingebildeter, aber gut gebauter Arbeiter rufen und ein Stück verrottete Wandverkleidung abziehen. «Ich glaub, da ist ein Bild dahinter! O Gott, es ist aus der Tom-of-Finland-Schule!»
Die Band spielte «Stand By Your Man». Als sie die Melodie erkannten, mussten Michael und Ned gleichzeitig lächeln. «Jon hat total drauf gestanden …», sagte Michael. «Aber nur als Lied. Nicht als Lebensstil.»
Ned trank einen Schluck aus der Flasche. «Ich hab gedacht, du hast ihn verlassen.»
«Na ja, formal gesehen vielleicht. In Wirklichkeit haben wir uns gegenseitig verlassen. Es war für beide eine große Erleichterung. Wir hatten wirklich immenses Glück. Es ist manchmal gar nicht einfach, aus einer S/M-Beziehung wieder rauszukommen.»
«Moment mal. Seit wann wart ihr beide …?»
«S/M», wiederholte Michael. «Streisand und Midler. Er ist auf die Streisand abgefahren. Ich auf die Midler. Es war die reine Hölle.»
Ned lachte. «Da bin ich dir ja ganz schön auf den Leim gegangen.»
«Aber mal im Ernst», sagte Michael. «Wir haben dauernd gestritten deswegen. Als Jon sich mal an einem Sonntagnachmittag zum wahrscheinlich dreimillionsten Mal «Evergreen» angehört hat, hab ich mich plötzlich dabei ertappt, dass ich ihn gefragt habe, was er eigentlich findet an dieser … ich glaub, ich hab sie damals eine ‹unmusikalische Schlampe mit viel zu großer Nase› genannt.»
«O Gott. Was hat er darauf gesagt?»
«Er hat eigentlich sehr erwachsen reagiert. Er hat mich seelenruhig darauf hingewiesen, dass die Nase von Bette größer ist als die von Barbra. Am liebsten hätt ich ihm mit seinem dämlichen Bakkarat-Briefbeschwerer den Schädel eingeschlagen.»
Diesmal lachte Ned schallend, und Michael wusste, dass er einen Treffer gelandet hatte. Ned war der einzige Mensch aus seinem Bekanntenkreis, der tatsächlich schallend lachte. «Es ist die Wahrheit», sagte Michael grinsend. «Und nichts als die Wahrheit.»
«Ja», sagte Ned, «aber wegen so was trennt man sich doch nicht.»
«Na ja …» Michael dachte einen Moment nach. «Ich glaub, wir haben uns gegenseitig dazu gebracht, Sachen zu machen, die wir gar nicht wollten. Seinetwegen hab ich die Klassikplatten alphabetisch geordnet. Meinetwegen hat er statt der feinen Erdnussbutter die grobe gegessen. Seinetwegen hab ich in einem Zimmer mit auberginefarbenen Wänden geschlafen. Meinetwegen hat er buntes Geschirr aufgedeckt. Wenn ich’s mir recht überlege, hatten wir bei kaum was den gleichen Geschmack. Außer bei Al Parker und Rocky-Road-Eis.»
«Hast du denn rumgehurt?»
«Und ob. Die widerlichen heterosexuellen Rollenspielchen waren für uns tabu. Ich hab unzählige Abende in der Sauna verbracht. Und ich weiß gar nicht mehr, wie oft ich mich im Bett rumgedreht und einem geilen Fremden gesagt habe: ‹Mein Liebhaber würde dir gefallen.›»
«Gab’s denn Wiederauflagen?»
«Einmal», sagte Michael grimmig, «und nie wieder. Jon war die ganze Woche eingeschnappt. Ich hab seinen Standpunkt auch verstehen können: Einmal ist Spaß; zweimal ist Fremdgehen. Wenn man verheiratet ist, lernt man solche kleinen Feinheiten. Deswegen bin ich nicht mehr verheiratet.»
«Aber du könntest es gut sein, hm?»
Michael schüttelte den Kopf. «Jetzt nicht. Und in nächster Zeit auch nicht. Ich weiß nicht … vielleicht sogar nie mehr. Es gehört Talent dazu, oder? Und manche haben das Talent einfach nicht.»
«Du musst es bloß wollen», sagte Ned.
«Dann will ich es vielleicht nicht entschieden genug. Möglich. Sehr gut möglich.» Michael trank einen Schluck Mineralwasser. Dann trommelte er im Takt der Musik mit den Fingern auf den Tresen. Die Band hatte inzwischen aufgehört. Jemand hatte der Musikbox Geld spendiert, damit Hank Williams Jr. «Women I Never Had» sang.
Michael reichte das Calistoga an Ned zurück. «Erinnerst du dich an Mona?», fragte er.
Ned nickte. «Deine ehemalige Mitbewohnerin.»
«Genau. Tja, Mona hat immer gesagt, dass sie gut ohne Liebhaber auskommen kann, solang sie fünf gute Freunde hat. Das trifft meine Situation auch so ungefähr.»
«Ich hoffe, ich bin einer davon», sagte Ned.
Michael runzelte die Stirn und zählte rasch seine Finger ab. «Heiliger Strohsack», sagte er schließlich. «Ich glaub, du bist drei davon.»
Das Wachsfigurenkabinett
Prue Giroux und Victoria Lynch waren verwandte Seelen. Zum einen waren sie beide attraktive Frauen. Zum anderen war Victoria die Verlobte des Ex-Manns der Frau, die jetzt mit Prues Ex-Mann verlobt war. Solche Bande hielten einiges aus.
An diesem Tag hatte Victoria angerufen, um ihrer Schwester im Geiste ein Geheimnis anzuvertrauen.
«Hör zu, Prudy Sue, die Sache ist höchst vertraulich und auf keinen Fall zur Veröffentlichung bestimmt, klar?» (Prues engste Freunde sprachen sie immer mit ihrem Kindernamen an.)
«Klar», sagte Prue.
«Ich meine, wenn die Zeit dafür reif ist, fände ich es natürlich himmlisch, wenn du der Sache in deiner Kolumne ein bisschen Publicity verschaffen würdest, und zum Teil ruf ich auch deswegen an, aber sie steckt noch im Embryonalstadium, und wir wollen das Kleine doch nicht umbringen, oder?»
«Natürlich nicht», sagte Prue.
«Also», hob Victoria an und atmete dabei so tief ein, als wollte sie eine Trompetenfanfare blasen, «meine Wenigkeit ist dabei, der Welt erstes Wachsfigurenkabinett für die gehobenen Kreise ins Leben zu rufen.»
«Der Welt … wie war das noch mal?»