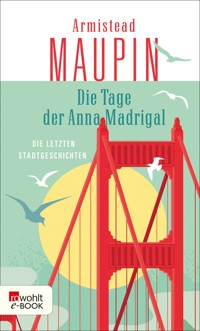9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Stadtgeschichten
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
«Eine Komödie in ihrer klassischsten Form, mit einigen der schärfsten und stärksten Dialoge, die Sie in Ihrem Leben zu lesen bekommen werden.» The Guardian Im zweiten Band der Stadtgeschichten haben alte und neue Fans von Armistead Maupin Gelegenheit, sich bei der Begegnung der Sekretärin Mary Ann Singleton mit einem teuflischen Kult zu gruseln (und zwischendurch heftig zu kichern), sich mit Michael «Mouse» Tolliver Sorgen darüber zu machen, ob seine Hoffnungen auf eine glückliche Zukunft mit Jon, dem Gynäkologen, berechtigt sind; das bisher geheime Anagramm im Namen der Vermieterin Anna Madrigal zu entschlüsseln und über Dutzende irrwitziger Missgeschicke, die den Leuten in San Francisco widerfahren, zu lachen oder zu weinen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 395
Ähnliche
Armistead Maupin
Mehr Stadtgeschichten
Roman
Über dieses Buch
Die Siebziger sind bald vorbei und die Ferne ruft. Wer kehrt zurück in das pulsierende San Francisco?
Mary Ann hat sich endlich mit ihrem neuen Leben in San Francisco angefreundet, aber die Abenteuerlust treibt sie noch immer um. Da kommt ihr ein überraschendes Erbe gerade recht. Zusammen mit Michael Tolliver begibt sie sich auf große Kreuzfahrt, und sie beide finden, was sie so schmerzlich vermisst haben: die Liebe. Doch nicht alles ist, wie es scheint - und in San Francisco wird nichts mehr so sein wie zuvor.
Unterdessen sucht Mona Ramsey an ungewöhnlichen Orten nach Antworten, während Anna Madrigal den Mut findet, das bisher geheime Anagramm in ihrem Namen aufzulösen und gänzlich sie selbst zu sein.
Im zweiten Band von Maupins humorvollem Klassiker geht die Clique aus der Barbary Lane auf emotionale Erkundungstour, in und außerhalb ihrer geliebten Stadt.
»Ich habe mich schockverliebt. Man will sofort mit in die Barbary Lane ziehen.« NDR Podcast Eat.READ.Sleep
Vita
Armistead Maupin, geboren 1944 in Washington, studierte Literatur an der University of North Carolina und arbeitete als Reporter für eine Nachrichtenagentur. Er schrieb für Andy Warhols Zeitschrift Interview, die New York Times und die Los Angeles Times. Seine Geschichten aus San Francisco, die berühmten «Tales of the City», verfasste er über fast zwei Jahrzehnte als täglichen Fortsetzungsroman für den San Francisco Chronicle. Maupin lebt mittlerweile in Großbritannien.
Impressum
Die amerikanische Originalausgabe erschien 1980 unter dem Titel «More Tales of the City» bei The Chronicle Publishing Company, San Francisco.
Die vorliegende deutsche Fassung von «Stadtgeschichten» wurde für diese Neuausgabe sprachlich durchgesehen. Im Zuge dessen waren einzelne, zum Zeitpunkt der ursprünglichen Übersetzung gewählte Begrifflichkeiten zu ändern, da sie den Differenzierungen des Originals keine Rechenschaft trugen. Weitere damals noch übliche Formulierungen des englischen Originaltexts wurden aus Gründen der Werktreue äquivalent übersetzt beibehalten.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Mai 2024
Copyright © 2007 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«Mehr Stadtgeschichten» Copyright © 1993 by Rogner & Bernhard GmbH & Co. Verlags KG, Berlin
«More Tales of the City» Copyright © 1980 by The Chronicle Publishing Company, San Francisco
Covergestaltung FAVORITBUERO, München
Coverabbildung Shutterstock
ISBN 978-3-644-01994-2
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Ken Maley
As the poets have mournfully sung,
Death takes the innocent young,
The rolling in money,
The screamingly funny,
And those who are very well hung.
Von den Dichtern beklagt und besungen,
Nimmt der Tod sich die unschuldgen Jungen,
Die steinreichen Protzer,
Die komischen Motzer,
Und die, die gar üppig behungen.
W.H. Auden
Herzchen und Blümchen
Die Valentinskarte war ein selbst gemachter Mischmasch aus viktorianischen Engelsköpfen mit Flügeln, gepressten Blumen und rotem Flitter. Mary Ann Singleton warf einen Blick darauf und quietschte vor Freude.
«Mouse! Die ist ja vielleicht toll. Wo hast du nur diese entzückenden kleinen …?»
«Mach sie mal auf.» Michael grinste.
Als sie die illustriertengroße Karte aufklappte, sah sie eine Inschrift in Jugendstil-Lettern: MEINE GUTEN VORSÄTZE ZUM VALENTINSTAG. Darunter folgten zehn nummerierte Leerzeilen.
«Siehst du», sagte Michael, «du sollst selber was reinschreiben.»
Mary Ann beugte sich zu ihm hinüber und gab ihm ein Küsschen auf die Wange. «Bin ich denn so verkorkst?»
«Und ob. Ich verschwende meine Zeit doch nicht mit Leuten, die alles auf der Reihe haben. Willst du mal meine Liste sehen?»
«Verwechselst du da nicht was mit Neujahr?»
«Ach, das ist doch Kleinkram. Rauchen-Essen-Trinken-Vorsätze. Aber das hier sind … verstehst du … das sind die Hardcore-Vorsätze, die Vielleicht-diesmal-, Aufgeschoben-ist-nicht-aufgehoben-, Morgen-ist-auch-noch-ein-Tag-Vorsätze.»
Er griff in die Tasche seines karierten Flanellhemds und gab ihr ein Blatt Papier:
MICHAEL TOLLIVERS DRECKIGE DREISSIG FÜR 1977
Ich werde von keinem sagen, dass er eine «Nellie» oder «butch» ist, wenn er nicht so heißt.
Ich werde Frauen, die mich mögen, nicht gleich zu Schwulenmuttchen erklären.
Ich werde die Hoffnung aufgeben, dass ich Jan-Michael Vincent in der Sauna treffe.
Ich werde Poppers nur durch den Mund inhalieren.
Ich werde im YMCA nicht länger als eine halbe Stunde unter der Dusche bleiben.
Ich werde mir nicht mehr den Kopf darüber zerbrechen, welche Farbe mein Signaltuch hätte, wenn ich eines tragen würde.
Ich werde irgendwann eine Tucke jenseits der fünfzig zu einem Drink einladen.
Ich werde die stille Hoffnung aufgeben, dass sich alle attraktiven Männer als hirnlos und langweilig herausstellen.
Ich werde im Glory Holes mit meinem richtigen Namen unterschreiben.
Ich werde mich langsam wieder an die Religion herantasten, indem ich in der Grace Cathedral Konzerte besuche.
Ich werde mich dabei allerdings nicht an die Männer in der Grace Cathedral herantasten.
Ich werde bei der Wahl zur schwulen Miss San Francisco niemandem meine Stimme geben.
Ich werde mich mit einem Hetero anfreunden.
Ich werde mich nicht darüber lustig machen, wie er geht.
Ich werde ihm nichts von Alexander dem Großen, Walt Whitman oder Leonardo da Vinci erzählen.
Ich werde keinem Politiker meine Stimme geben, der den Begriff «schwule Gemeinde» benutzt.
Ich werde nicht flennen, wenn Mary Tyler Moore ihre letzte Show hat.
Ich werde meinen nicht abmessen, ganz egal, wer mich danach fragt.
Ich werde das Jacutin nicht mehr verstecken.
Ich werde kein Lacoste-Hemd kaufen, kein Marimekko-Kissen, keine gebrauchte Ehrenjacke für Sportler, kein All-American-Boy-T-Shirt, keine Halskette mit Rasierklinge dran und schon gar nicht irgendwas aus Jeansstoff.
Ich werde lernen, alleine zu essen und es zu mögen.
Ich werde in meiner Fantasie nicht mehr mit Feuerwehrmännern rumspielen.
Ich werde zu Hause keinem erzählen, dass ich bloß noch nicht die Richtige gefunden habe.
Ich werde auf der Castro Street im Anzug herumlaufen und damit keine Schwierigkeiten haben.
Ich werde weder Bette Davis noch Tallulah Bankhead noch Mae West und auch nicht Paul Lynde nachmachen.
Ich werde pro Abend nicht mehr als ein Sandwich-Eis von It’s-It essen.
Ich werde mich ganz passabel finden.
Ich werde jemand Netten kennenlernen, und zwar weit weg von einer Bar oder der Sauna oder einer Rollschuhbahn, und ich werde mich hoffnungslos, aber ganz konventionell in ihn verlieben.
Ich liebe dich!, werde ich aber erst sagen, wenn er es schon gesagt hat.
Den Teufel werd ich tun.
Mary Ann legte das Blatt weg und sah Michael an. «Du hast dreißig Vorsätze. Warum darf ich nur zehn haben?»
Michael grinste. «Du hast es nicht so schwer im Leben.»
«Was du nicht sagst, du schwules Chauvischwein!»
Sie rückte der Valentinskarte mit einem Flair-Filzstift zu Leibe und kritzelte die ersten vier Leerzeilen voll. «So, jetzt zieh dir das mal rein!»
Ich werde dieses Jahr den Richtigen kennenlernen.
Er wird nicht verheiratet sein.
Er wird nicht schwul sein.
Er wird nicht in Kinderpornos machen.
«Aha», sagte Michael mit einem verschmitzten Lächeln. «Du gehst also nach Cleveland zurück, hm?»
Auf ein Neues
Sie ging nicht nach Cleveland zurück. Sie flüchtete nicht nach Hause zu Mommy und Daddy. So viel stand fest. Trotz aller Heimsuchungen war sie gern in San Francisco, und sie liebte ihre zusammengewürfelte Familie in Mrs. Madrigals gemütlichem altem Haus in der Barbary Lane.
Was störte es da, dass sie immer noch Sekretärin war?
Was störte es da, dass sie den Richtigen noch nicht getroffen hatte … oder wenigstens einen Passablen?
Was störte es da, dass sich Norman Neal Williams, die einzige Beinaheliebschaft ihres ersten halben Jahrs in San Francisco, als Privatdetektiv entpuppt hatte, der nebenbei in Kinderpornos gemacht hatte und schließlich an Heiligabend von einer Klippe am Meer in den Tod gestürzt war?
Und was störte es da, dass sie nie den Mut aufgebracht hatte, außer Mouse noch jemandem von Normans Tod zu erzählen?
Wie Mouse es ausdrücken würde: «Im Vergleich zu Cleveland sieht selbst Scheiße noch aus wie Gold!» Ihr war klar, dass Mouse ihr bester Freund geworden war. Er und seine spaßige, aber herzallerliebste Mitbewohnerin Mona Ramsey waren im Lauf ihrer teils glorreichen, teils qualvollen Initiation in das wirkliche Leben von San Francisco stets ihre Mentoren gewesen und hatten ihr treu zur Seite gestanden.
Sogar Brian Hawkins, ein sexbesessener Kellner, dessen Annäherungsversuche sie einst so gestört hatten, war in letzter Zeit dazu übergegangen, noch recht unbeholfene, aber doch gewinnende Freundschaftsangebote zu machen.
Die windschiefe, efeuumrankte Hütte in der Barbary Lane 28 war jetzt Mary Anns Zuhause, und die einzige Elternfigur in ihrem Leben war Anna Madrigal, eine Vermieterin, deren schräger Charme und exzentrisches Wesen auf dem Russian Hill legendär waren.
Mrs. Madrigal war ihrer aller wahre Mutter. Sie erteilte ihnen Ratschläge, schimpfte mit ihnen und hörte sich unerschütterlich die Berichte über ihre amourösen Niederlagen an. Wenn alles nicht half (aber auch sonst), belohnte sie ihre «Kinder» damit, dass sie ihnen Joints aus selbst gezogenem Gras an die Wohnungstür klebte.
Mary Ann rauchte inzwischen Gras wie eine altgediente Kifferin. Kürzlich hatte sie allen Ernstes daran gedacht, sich in der Mittagspause bei Halcyon Communications einen anzustecken. So groß war die Pein, die sie unter dem neuen Regime Beauchamp Days zu ertragen hatte, des arroganten jungen Mannes aus bestem Hause, der durch den Tod seines Schwiegervaters Edgar Halcyon auf dem Chefsessel der Werbeagentur gelandet war.
Mary Ann hatte Mr. Halcyon sehr gemocht.
Und zwei Wochen nach seinem unzeitigen Ableben (am Heiligen Abend) hatte sie erfahren, wie sehr er sie gemocht hatte.
«Rühr dich nicht von der Stelle», ermahnte sie Michael voller Ausgelassenheit. «Ich habe nämlich auch eine Überraschung für dich!»
Mary Ann verschwand im Schlafzimmer und tauchte Sekunden später mit einem Umschlag in der Hand wieder auf. In einer sehr akzentuierten Handschrift war ihr Name darauf zu lesen. Die Karte in dem Umschlag war ebenfalls mit der Hand geschrieben:
Liebe Mary Ann,
inzwischen haben Sie bestimmt eine kleine Aufheiterung nötig. Das beiliegende Geschenk ist für Sie und einen Freund oder eine Freundin. Fahren Sie irgendwohin, wo nicht nur die Sonne lacht. Und lassen Sie sich von dem kleinen Mistkerl nicht unterkriegen.
Stets der Ihre
EH
«Ich kapier überhaupt nichts», sagte Michael. «Wer ist EH? Und was war drin in dem Umschlag?»
Mary Ann platzte schon fast. «Fünftausend Dollar, Mouse! Von Mr. Halcyon, meinem alten Chef! Sein Anwalt hat mir den Umschlag letzten Monat gegeben.»
«Und wer ist der ‹kleine Mistkerl›?»
Mary Ann lächelte. «Das ist Beauchamp Day, mein neuer Chef. Mouse, ich hab zwei Tickets besorgt für eine Kreuzfahrt nach Mexiko. Auf der Pacific Princess. Hättest du Lust mitzukommen?»
Michael sah sie entgeistert an. «Willst du mich verarschen?»
«Nein.» Mary Ann kicherte.
«Is ja ’n Ding!»
«Kommst du mit?»
«Ob ich mitkomme? Wann? Wie lange?»
«In einer Woche. Elf Tage. Aber wir müssten gemeinsam in eine Kabine, Mouse.»
Michael sprang auf und umarmte sie. «Dann verführen wir die Leute eben im Schichtbetrieb!»
«Oder wir angeln uns einen netten Bisexuellen.»
«Mary Ann! Ich bin schockiert!»
«Oh, freut mich!»
Michael hob sie hoch. «Wir werden braun werden wie die Kaffeebohnen. Und wir suchen dir einen Liebhaber …»
«Dir aber auch.»
Er ließ sie wieder runter. «Bitte nicht gleich zwei Wunder auf einen Schlag.»
«Ach, Mouse, sei kein Pessimist.»
«Ich bin bloß realistisch.» Michael litt noch immer unter einer kurzen Affäre mit Dr. Jon Fielding, einem hübschen blonden Gynäkologen, der ihn als Liebhaber eliminiert hatte, als er Zeuge seines Auftritts beim Jockey-Shorts-Tanzwettbewerb im Endup geworden war.
«Sieh mal», sagte Mary Ann gelassen, «wenn ich dich attraktiv finde, dann gibt’s in dieser Stadt bestimmt haufenweise Männer, denen es genauso geht.»
«Ach», meinte Michael gallig, «die wollen doch alle nur was Großes.»
«Na, jetzt hör aber auf!»
Michael reagierte manchmal wegen der dümmsten Sachen empfindlich. Er ist mindestens eins siebzig, dachte Mary Ann. Da kann sich doch keiner beklagen.
Von Trauer umflort
Frannie Halcyon war ein absolutes Wrack. Acht Wochen nach dem Tod ihres Mannes schleppte sie sich immer noch durch ihr höhlenartiges altes Haus in Hillsborough und hing düsteren Gedanken darüber nach, ob es nicht bald an der Zeit war, sich um die Zulassung als Immobilienmaklerin zu bewerben.
O Gott, wie anders das Leben doch jetzt war!
In der vergeblichen Hoffnung, dass ihr ein kürzerer Tag ausgefüllter vorkommen würde, stand sie immer erst spät auf, manchmal sogar erst mittags. Ihre ausgedehnten Vormittagskaffees auf der Terrasse gehörten der Vergangenheit an, waren ein totes Ritual, das genauso unausweichlich und schnell versagt hatte wie Edgars kranke Nieren.
Nun begnügte sie sich mit einem ausgedehnten Nachmittags-Mai-Tai. Manchmal zog sie natürlich einen Funken Trost aus dem Wissen, dass sie bald Großmutter sein würde. Das heißt, eigentlich zweifache Großmutter. Ihre Tochter DeDe – die Frau von Beauchamp Day, dem neuen Chef von Halcyon Communications – würde Zwillingen das Leben schenken.
Das war die letzte Auskunft von Dr. Jon Fielding gewesen, DeDes reizendem jungen Gynäkologen.
Allerdings gönnte DeDe ihrer Mutter nicht einmal das simple Vergnügen, über ihre neuen Erben auch nur zu sprechen. Für sie war es ein geradezu leidiges Thema, wie Frannie feststellte. Und das kam der Matriarchin doch reichlich merkwürdig vor.
«Warum darf ich nicht wenigstens ein bisschen schwärmen, DeDe?»
«Weil du deine Schwärmerei benutzt, Mutter.»
«Ach, Larifari!»
«Du benutzt sie als Vorwand, damit du … damit du dich vor deinem eigenen Leben drücken kannst.»
«Ich bin nur noch ein halber Mensch, DeDe.»
«Daddy ist tot, Mutter. Du musst dein Leben schon selber in die Hand nehmen.»
«Dann erlaub mir doch endlich, dass ich Babysachen kaufe. Am Ghirardelli Square gibt es einen entzückenden Laden. Er heißt Bébé Pierrot, und ich bin sicher, dass ich dort …»
«Wir wissen doch nicht einmal, ob es Jungen oder Mädchen werden.»
«Dann wäre was Gelbes doch ganz wunderbar.»
DeDe machte ein finsteres Gesicht. «Ich kann Gelb nicht ausstehen.»
«Du magst Gelb sehr. Du hast Gelb immer sehr gemocht. DeDe, mein Schatz, was ist denn mit dir?»
«Nichts!»
«Du kannst mir nichts vormachen, DeDe.»
«Mutter, bitte … Können wir nicht einfach …?»
«Ich muss das Gefühl haben, dass ich gebraucht werde. Kannst du das nicht verstehen? Niemand braucht mich mehr.» Die Matriarchin begann zu schniefen.
DeDe griff nach der Hand ihrer Mutter. «Das de Young braucht dich. Das Legion of Honor braucht dich.»
Frannie lächelte bitter. «Ja, genau so läuft das. Wenn du jung bist, braucht dich deine Familie. Und wenn du alt bist, brauchen dich die Museen.»
DeDe verdrehte entnervt die Augen. «Hör mal, wenn du unbedingt in Selbstmitleid baden willst, kann ich es auch nicht ändern. Aber es ist echt für die Katz.»
Frannies Augen schwammen inzwischen vor Tränen.
«Was erwartest du denn von mir?»
«Ich erwarte von dir …» DeDe schlug einen sanfteren Ton an und wurde zur besorgten Tochter. «Ich erwarte von dir, dass du dir wieder etwas Gutes tust. Bring ein bisschen Schwung in dein Leben. Tritt einem Backgammonclub bei. Schreib dich in Janet Sassoons Trainingskurs ein. Oder bring Kevin Matthews dazu, dass er dich ins Konzert ausführt, Herrgott noch mal! Sein Liebhaber ist bis Juni auf Hydra.»
«Ich weiß, dass du recht hast, aber ich …»
«Sieh dich einmal an, Mutter! Du hast doch das Geld dazu … Lass dir rundherum ein paar Abnäher machen!»
«DeDe!» Die Unverschämtheit ihrer Tochter machte Frannie sprachlos.
«Ich meine es ernst! Mein Gott, warum auch nicht? Gesicht, Titten, Hintern … die ganze Katastrophe! Was hast du schon zu verlieren?»
«Ich glaube nicht, dass es besonders schicklich ist, wenn eine Frau in meinem …»
«Schicklich? Mutter, hast du Mabel Sussman in letzter Zeit mal gesehen? Ihr Gesicht ist glatt wie ein Babypopo! Shugie hat erzählt, dass Mabel in Genf diesen wundervollen Menschen ausfindig gemacht hat, der nur mit Hypnose arbeitet!»
Frannie schaute ungläubig drein. «Irgendwas Chirurgisches muss er doch gemacht haben.»
«Aber nein. Alles nur Hypnose … Jedenfalls schwört Shugie das auf einen ganzen Stapel Town and Country.» DeDe kicherte boshaft. «Stell dir vor, eines Tages klatscht jemand in die Hände oder sagt das Geheimwort oder stellt sonst was an, und die ganze Chose fällt in sich zusammen wie ein Soufflé! Wärst du da nicht platt?» Frannie konnte nicht anders – sie musste lachen.
Und später am Nachmittag fuhr sie mit einem merkwürdig heimlichtuerischen Gefühl in die Stadt, um sich bei F.A.O. Schwarz nach einem Steiff-Tier für die Zwillinge umzusehen.
Sie fühlte sich inzwischen wohler und spielte mit dem Gedanken, dass DeDe vielleicht doch recht hatte. Vielleicht hatte sie tatsächlich zu lange Trübsal geblasen; länger, als es gesund war; länger, als selbst Edgar es gewollt hätte.
Als Frannie den Laden verließ, sah sie im Schaufenster von Mark Cross ihr Spiegelbild. Sie blieb lange genug stehen, um die Haut unterhalb ihrer Ohren zu packen und sie über die Wangenknochen straff nach hinten zu ziehen. «Also gut», sagte sie laut. «Also gut!»
Zwei verwandte Seelen
Mona Ramseys Leben war – in ihren eigenen Worten – restlos beschissen.
Sie war bei Halcyon Communications Werbetexterin mit fünfundzwanzigtausend Dollar im Jahr gewesen, doch nach einer kurzen, aber befriedigenden feministischen Tirade gegen den Chef von Adorable Pantyhose, den größten Kunden der Agentur, hatte man sie dieser Position enthoben.
Die anschließende Zeit der Muße, die sie im gemeinsamen Haushalt mit Michael Tolliver verbracht hatte, war bei oberflächlicher Betrachtung angenehm, auf längere Sicht jedoch gefühlsmäßig unbefriedigend gewesen. Sie sehnte sich nach etwas Dauerhaftem. Zumindest hatte sie das so gesehen, als sie aus der Barbary Lane 28 ausgezogen war, um in D’orothea Wilsons elegantem viktorianischen Haus in Pacific Heights Wohnung zu nehmen.
D’orothea war Model bei Halcyon, vielleicht das bestbezahlte Schwarze Model der Westküste. Sie und Mona waren in New York einmal liiert gewesen. Das Arrangement, das die beiden für San Francisco getroffen hatten, war allerdings ungetrübt von jeder Leidenschaft, blieb ein blutleerer Pakt zur Linderung der Einsamkeit, die die beiden Frauen immer stärker bedrängte.
Es hatte nicht funktioniert.
Zum einen konnte Mona D’orothea nie ganz verzeihen, dass sie eigentlich doch nicht Schwarz war. (Ihre Hautfarbe war, wie Mona schließlich erfuhr, durch pigmentverändernde Tabletten und ultraviolette Bestrahlungen hervorgerufen – ein Trick, der das Model vor einer beruflichen Randexistenz gerettet hatte.) Zum anderen hatte sich Mona, wenn auch missmutig, mit der Tatsache herumschlagen müssen, dass ihr das Zusammensein mit Männern fehlte.
«Als Heterofrau bin ich nicht mal Durchschnitt», hatte sie Michael bei ihrer Rückkehr in das gemeinsame Nest Barbary Lane erklärt, «aber als Lesbe bin ich unter aller Sau.»
Michael hatte volles Verständnis gezeigt. «Das hätte ich dir auch so sagen können, Babycakes!»
Ihre letzte Quaalude begann gerade zu wirken, als Mona die wackelige Holztreppe hochstieg, über die man in die Barbary Lane kam. Sie war den ganzen Abend bei der Cosmic Light Fellowship gewesen, doch ihre Stimmung war schwärzer als je zuvor. Sie hatte einfach ihre Mitte nicht mehr.
Was war mit ihr geschehen? Warum hing sie immer mehr durch? Wann hatte sie zum ersten Mal aus dem dunklen Jammertal ihres Lebens nach oben geblickt und festgestellt, dass dessen Hänge unüberwindlich waren?
Und warum hatte sie so wenig Quaaludes gekauft?
Mona schleppte sich durch den Blättercanyon der Barbary Lane, ging durch den Vorgarten von Nummer 28 und trat in das mit braunen Schindeln verkleidete Haus. Sie klingelte bei Mrs. Madrigal, weil sie hoffte, dass ein Glas Sherry und ein paar sanfte Worte von der Vermieterin ihren Durchhänger verscheuchen könnten.
Mrs. Madrigal, ging Mona durch den Kopf, war eine Verbündete der besonderen Art. Und Mona war nicht einfach eines von den «Kindern» der Vermieterin. Mona war die einzige Bewohnerin des Hauses, die Mrs. Madrigal regelrecht angeworben hatte.
Und sie war – wie sie glaubte – die Einzige, die um Mrs. Madrigals Geheimnis wusste.
Dieses Wissen schuf zwischen den beiden Frauen ein mystisches Band, eine unausgesprochene Seelenverwandtschaft, die Mona auch an den allerdüstersten Tagen wieder aufrichtete. Doch Mrs. Madrigal war nicht zu Hause, weshalb Mona mühsam in ihre Wohnung im ersten Stock hochstieg.
Wie sie schon befürchtet hatte, war auch Michael weg. Zweifellos war er einen Stock höher und plante mit Mary Ann ihre gemeinsame Reise. Mit Mary Ann war er in letzter Zeit sowieso ziemlich viel zusammen.
Das Telefon klingelte genau in dem Moment, als Mona das Licht einschaltete. Es war ihre Mutter, die aus Minneapolis anrief. Mona plumpste in einen Sessel und gab sich große Mühe, gefasst zu klingen.
«Hallo, Betty», sagte sie gelassen. Sie hatte ihre Mutter immer Betty genannt. Betty hatte darauf bestanden. Betty fand es nämlich ziemlich übel, dass sie älter war als ihre Tochter.
«Bist du unter dieser Nummer … wieder dauernd zu erreichen?»
«Ja.»
«Ich habe in dem Haus in Pacific Heights angerufen. D’orothea hat mir gesagt, dass du gerade umgezogen bist. Ich kann gar nicht glauben, dass du aus einem so reizenden Haus in einem so hübschen Viertel ausgezogen bist und jetzt wieder in diesem heruntergekommenen …»
«Du hast das Haus doch noch nie gesehen!» Das passt wieder mal zu ihr, dachte Mona. Denn Betty war Immobilienmaklerin, eine abgebrühte Karrierefrau, die noch zu Monas Säuglingszeiten von ihrem Mann verlassen worden war. Von Häusern, in denen es weder Sicherheitspersonal noch eine Sauna gab, hielt sie nicht viel.
«Na, und ob», brauste Betty auf. «Du hast mir letzten Sommer ein Foto geschickt. Wird das Haus immer noch von dieser … Frau geführt?»
«Wenn du Mrs. Madrigal meinst, dann ja.»
«Beim Anblick dieser Person habe ich eine richtige Gänsehaut gekriegt.»
«Erinnere mich in Zukunft, dass ich dir keine Fotos mehr schicke, ja?»
«Was hat dich am Haus von D’orothea denn gestört?» Natürlich hatte Betty keine Ahnung von der zerbrochenen Beziehung. An Beziehungen verschwendete sie ohnehin kaum einen Gedanken.
«Die Miete wurde mir zu viel», sagte Mona ausweichend.
«Ach, weißt du, wenn das das Problem ist, kann ich schon einspringen, bis du wieder …»
«Nein. Ich will dein Geld nicht.»
«Nur, bis du wieder einen Job gefunden hast, Mona.»
«Danke, aber ich will nicht.»
«Sie hat dich da hineingelockt, Mona!»
«Wer?»
«Diese Frau.»
Mona platzte der Kragen. «Mrs. Madrigal hat mir eine Wohnung angeboten, und zwar nachdem wir schon gute Freundinnen geworden waren! Außerdem ist das schon drei Jahre her! Warum bist du jetzt auf einmal so fürchterlich um mein Wohl besorgt?»
Betty zögerte. «Ich … Ich habe nicht gewusst, wie sie aussieht, bis du mir das Foto …»
«Ach, hör mir bloß damit auf!»
«Es ist doch nur, weil sie so … extrem ist.»
Wenn sie wüsste, dachte Mona. Wenn sie bloß wüsste.
Down sein auf dem Dach
Brian Hawkins war dreiunddreißig.
Als er seine aus Jeansstoff und Cordsamt geschneiderte Kellnerkluft von Perry’s auszog und sich mit einem Oly aufs Bett warf, lief es ihm kalt über den Rücken: Das hieß, er war genauso alt wie Jesus auf Golgatha.
Oder so alt wie der Idiot aus Schall und Wahn.
Er trat auf der Stelle. Nichts weiter. Er arbeitete, um zu überleben, um weiterzuexistieren, um seine Schweinekoteletts und sein Bier und sein blödes Palmolive bezahlen zu können. Und keine noch so große Dosis entspannter, abgeklärter, dämlicher Philosophiererei über Kalifornien reichte als Kompensation für die Leere, die er fühlte.
Er wurde alt. Und zwar allein.
Der Briefträger brachte fast nur Postwurfsendungen. Dabei war er vor langer, langer Zeit natürlich einmal ein hitziger und radikaler junger Anwalt gewesen. Bevor diese Hitzigkeit sich gelegt hatte (und zwischen seinen Beinen zu neuem Leben erwacht war), hatte er den gerechten Kampf zugunsten von Wehrdienstverweigerern in Toronto, von Schwarzen in Chicago, von Indianern in Arizona und von mexikanischen Einwanderern in Los Angeles geführt.
Jetzt war er in San Francisco Kellner und bediente WASPs.
Und er ging jetzt mit der gleichen Inbrunst auf «Mösenfang», mit der er früher gegen Nixon protestiert hatte. Auf der Suche nach diesem glanzlosen Gral trieb es ihn in Farnkrautkneipen und gemischte Saunen, in Waschsalons, Supermärkte und rund um die Uhr geöffnete Junk-Food-Restaurants, wo sich der Ertrag zwar in Grenzen hielt, die Befriedigung aber fast an Ort und Stelle zu haben war. Er hatte keine Zeit zu verlieren, sagte er sich. Die Wechseljahre standen vor der Tür.
Falls er auf etwas Dauerhaftes aus war – und manchmal hatte er dieses Gefühl –, blieb er jedenfalls mit keiner Frau lang genug zusammen, um dieses Bedürfnis erkennen zu lassen.
Seine Logik führte ihn im Kreis, war aber unschlagbar: Die Art Frau, die er haben wollte, konnte an der Art Mann, zu der er sich entwickelt hatte, keinesfalls interessiert sein.
Sein gesamtes Dasein stand unter der Fuchtel seiner Libido.
Sie hatte sogar die Entscheidung für seine jetzige Wohnung bestimmt, für dieses zugige und beengte Häuschen auf dem Dach der Barbary Lane 28. Er war zu dem Schluss gekommen, dass Frauen auf die wunderbare Rundumsicht und die Putzigkeit der Wohnung abfahren würden. Das Häuschen würde zu seinem Vorteil als architektonisches Aphrodisiakum wirken.
«Und du willst es wirklich haben?», hatte Mrs. Madrigal ihn damals gefragt, als er sie um einen Wohnungstausch ersucht hatte. (Zu der Zeit hatte er im zweiten Stock gewohnt, gleich gegenüber von Mary Ann Singleton, die furchtbar sexy, aber auch furchtbar zugeknöpft war.) Brian hatte damals ohne zu zögern ja gesagt.
Er nahm an, dass die Ungläubigkeit der Vermieterin mit dem Vormieter der Wohnung zu tun hatte, einem etwa vierzigjährigen Vitaminpräparatevertreter namens Norman Neal Williams.
Doch von Williams wusste er nur, dass der im letzten Dezember spurlos verschwunden war.
Ein heftiger Wind schüttelte das Häuschen durch und verhalf Brian zu einem leicht morbiden Déjà-vu-Gefühl.
Fünf auf der Richterskala, dachte er.
Er wusste inzwischen, was das hieß, denn er hatte in der Woche davor sein erstes Erdbeben gespürt. Ein tiefes, gespenstisches Grollen hatte ihn um zwei Uhr nachts geweckt, seine Fenster klirren lassen und ihn augenblicklich in ein verängstigtes Urwesen verwandelt.
Aber jetzt war es bloß der Wind, und das Knirschen von «The Big One» würde sich im zweiten Stock genauso schauerlich anhören wie oben auf dem Dach. Jedenfalls sagte er sich das, seit er in dem Häuschen wohnte.
Die Türklingel schreckte ihn auf. Er zog nur ein Sweatshirt über und ging in Boxershorts an die Tür. Es war Mary Ann Singleton.
«Brian, ich … Entschuldige bitte, dass ich dich so spät noch störe.» Seine Unterhose hatte sie offensichtlich durcheinandergebracht.
«Ist schon okay.»
«Du bist nicht angezogen. Ich werd jemand anderen fragen.»
«Kein Problem. Ich kann mir ja schnell ’ne Hose anziehen.»
«Wirklich, Brian, es ist nicht so …»
«Stopp! Hab ich gesagt, dass ich dir helfe, oder nicht?»
Sein Ton brachte sie auf. Aber sie legte dennoch ein schwaches Lächeln hin. «Michael und ich fahren nach Mexiko, und ich hab da einen Koffer, den ich nicht …»
«Warte mal eben.»
Brian zog ein Paar Levi’s an und ging vor Mary Ann die Treppe zu ihrer Wohnung hinunter. Er hob den Koffer, den sie brauchte, vom obersten Regalbrett in ihrem Wandschrank. «Danke», sagte sie lächelnd. «Jetzt komm ich wieder allein zurecht.»
Sein Blick durchbohrte sie fast. «Bist du sicher?»
«Ja, Brian.» Ihre Stimme hatte einen festen und leicht gouvernantenhaften Klang. Sie wusste, worauf er angespielt hatte, und sie sagte Nein. Wieder einmal.
Oben auf dem Dach stieg Brian aus den Levi’s und griff nach dem Fernglas, das er auf dem Regal neben dem Bett stehen hatte. Er stellte sich vor das Südfenster des Häuschens und verfluchte die unzugängliche Miss Singleton, während er seinen Blick suchend über die mitternächtliche Stadt gleiten ließ.
Zuerst das grün-schwarze Mysterium Lafayette Park, dann die als ultramoderne St. Mary’s Cathedral daherkommende Maytag-Rührmaschine, dann die amerikanische Flagge auf dem Mark Hopkins in ihrer obszönen Übergröße, die vor dem tintenblauen Himmel wild hin und her schlug, als stammte sie aus dem Acid-Trip eines Anhängers der John Birch Society.
Das war alles nur Vorspiel.
Sein eigentliches Begehr galt einem Gebäude, das er Superman Building nannte.
Vater des Jahres
Zum ersten Mal seit Wochen stand DeDe vor Beauchamp auf.
Sie begrüßte ihren Gatten mit einem Kuss und einem Croissant, als er um Viertel vor sieben in die Küche wankte. Für die Tageszeit war sie ziemlich aufgekratzt – übertrieben aufgekratzt sogar –, sodass Beauchamp sofort argwöhnisch wurde.
Er lehnte sich an die stabverleimte Arbeitsplatte und rieb sich die Augen. «Hast du ein Junior-League-Treffen oder so was?»
«Kann ich meinem Ehemann nicht mal das Frühstück machen?»
«Kannst du schon», sagte er trocken, während er zögerlich an dem Croissant knabberte, «aber du tust es nicht.»
DeDe warf zwei Schalotten in die Küchenmaschine. «Wir essen Omeletts. Und ein paar von den köstlichen französischen Würstchen von Marcel & Henry.» Sie lächelte matt. «Ich … mache mir einfach zu viele Sorgen, Beauchamp, und als ich heute … na ja, als ich heute diese albernen Papageien draußen im Eukalyptusbaum vor dem Fenster gehört habe, da ist mir durch den Kopf gegangen … Also, ich finde, wir haben mehr Glück als die meisten anderen.»
Beauchamp, der noch immer mit dem Wachwerden kämpfte, massierte sich die Schläfen. «Ich kann diese verfluchten Papageien nicht ausstehen.»
DeDe sah ihn bloß an.
Er drehte sich um und machte sich an der Mr.-Coffee-Maschine zu schaffen. DeDes Gesicht war regelrecht getränkt mit dem idiotischen, flehenden Ausdruck, den sie bekam, wenn sie ihm ein schlechtes Gewissen machen wollte. Aber er war nicht bereit, sich damit so früh am Morgen abzugeben.
«Beauchamp?»
Er blieb mit dem Rücken zu ihr stehen. «Dieses verdammte Ding hat auch schon seit ewigen Zeiten keinen Wischlappen mehr …»
«Beauchamp! Sieh mich an!»
Er drehte sich mehr als langsam um. Auf seinem Gesicht klebte ein dünnes Lächeln. «Ja, mein Schatz?»
«Willst du mir nicht wenigstens sagen, dass du … glücklich bist?»
«Worüber?»
Sie legte die Hände auf ihren dicken Bauch. «Darüber, verdammt noch mal!»
Schweigen.
Sie ließ nicht locker. «Und?»
«Ich bin außer mir vor Freude.»
Mit einem melodramatischen Seufzer wandte sie sich ab.
«DeDe … Eltern tragen eine große Verantwortung.» Er bemühte sich um einen ruhigen Ton. «Ich habe die Verantwortung akzeptiert, ein Kind großzuziehen, wenn auch nur sehr widerstrebend. Sei mir also bitte nicht böse, wenn ich nicht gerade Freudentänze aufführe angesichts der Aussicht auf …»
«Ach, halt doch die Klappe!»
«Sieh an. Wie geistreich.»
«Ich brauch keine dämlichen Thesen zur Elternschaft. Ich brauch deine Unterstützung. Alleine schaffe ich das nicht, Beauchamp. Ich schaffe das nicht!»
Er grinste affektiert und deutete auf ihren Bauch. «Das da hast du weiß Gott auch nicht alleine hingekriegt.»
«Nein», gab sie sofort zurück, «aber ich hab es auch garantiert nicht mit dir hingekriegt!»
Sie starrten sich über die Küchenmaschine hinweg an und bleckten die Zähne. Beauchamp brach das Schweigen mit einem kurzen, boshaften Lachen, schlug mit der flachen Hand auf die Arbeitsfläche und ließ sich auf einen Marcel-Breuer-Stuhl sinken.
«Das war wirklich nicht schlecht. Für dich jedenfalls.»
«Beauchamp …»
«Es gibt bessere Möglichkeiten, meine Aufmerksamkeit zu erregen, aber im Großen und Ganzen war das nicht schlecht.»
«Es ist die Wahrheit, Beauchamp! Du bist nicht der Vater!»
Schweigen.
«Verdammt noch mal, Beauchamp! Kannst du nicht zwei und zwei zusammenzählen? Hör zu …» Ihre Stimme begann zu zittern. Sie zog sich einen Stuhl heran und setzte sich neben ihn. «Ich wollte es dir schon lange sagen. Ehrlich. Ich habe sogar überlegt, ob ich …»
«Wer?», fragte er frostig.
«Ich glaube nicht, dass wir …»
«Splinter Riley vielleicht? Oder wie wär’s mit dem charmanten, aber so unendlich schmierigen Jorge Montoya-Corona?»
«Du kennst ihn nicht, Beauchamp.»
«Wie interessant. Du vielleicht?»
DeDe brach in Tränen aus und lief aus der Küche. Beauchamp wusste, dass sie sich im Schlafzimmer einschließen und dort schmollen würde, bis er außer Haus war. Dann würde sie sich ein paar Dutzend bunte Tabletten in die zitternde Hand schütten und alle auf einmal hinunterwürgen.
In einer Krisensituation konnte sie ihren M & M’s nie widerstehen.
Als Beauchamp am Jackson Square eintraf, überreichte ihm Mary Ann Singleton die Nachrichten, die man für ihn hinterlassen hatte.
«Außerdem hat vor fünf Minuten D’orothea Wilson angerufen.»
Das war alles. Nicht Mr. Day. Nicht einmal Beauchamp. Er hatte keinen Namen mehr, seit dieses Betthäschen seine Sekretärin geworden war.
Beauchamp ächzte. «Sie hat sich wohl nicht zu einer Erklärung herabgelassen, warum sie zu dem Adorable-Fototermin im Icehouse nicht erschienen ist, oder? Alleine diesen Monat hat sie schon drei Termine abgesagt.»
«Sie hat gemeint, dass ihr Aussehen … nicht mehr passt.»
«Was soll das denn heißen?»
Die Sekretärin zuckte mit den Schultern. «Vielleicht hat sie über die Feiertage Gewicht zugelegt, oder sie …»
«Vielleicht ist ihr Halcyon Communications auch ganz einfach schnurz! Vielleicht macht sie lieber eine Reise nach Mexiko!» Die Spitze gegen seine Sekretärin wirkte genau so, wie Beauchamp es sich gewünscht hatte.
Sie zerbog eine Büroklammer. «Beauchamp … Es war Mr. Halcyon, der wollte, dass ich …»
«Das brauche ich mir nicht schon wieder anzuhören!» Er stürmte in sein Büro und schlug die Tür hinter sich zu. Dann wütete er im Stillen gegen die Familie Halcyon.
Post von Mama
Lieber Mikey,
Dein Papa und ich haben uns sehr darüber gefreut, dass Du mit Mary Ann eine Reise nach Mexiko machst. Ihr werdet bestimmt eine Menge Spaß haben. Bitte schreib uns eine Ansichtskarte, wenn sich die Gelegenheit bietet, und gib acht, dass Du nicht zu viel Tequila trinkst. Haha.
In Orlando war es diesen Winter so richtig kalt, aber das hast Du wahrscheinlich alles schon von Walter Cronkite in den Nachrichten gehört. Die Pflanzung unten bei dem neuen Bungalow von den Bledsoes hat es am schlimmsten erwischt. Ein paar von den Orangen waren durch und durch gefroren. Papa sagt aber, das ist halb so schlimm, weil wir sie an die Saftfabrik verkaufen können. Ich tue, was ich kann, um Papa zu helfen, aber Du weißt ja, wie er zur Erntezeit ist. (Das nur mal so zum Spaß.) Papa lässt Dir ausrichten, dass Du Dir keine Sorgen machen sollst, denn wir kriegen ungefähr drei Dollar fünfzig die Kiste, und außerdem ist die Ernte im Ganzen höher ausgefallen, selbst mit dem Frost und so. Das einzige Problem haben wir jetzt mit den Homosexuellen.
Ich schätze, Du weißt gar nichts davon. Angefangen hat die ganze Sache damit, dass die Dade County Commission ein Gesetz zugunsten von Homosexuellen erlassen hat. Es besagt, dass man sich nicht weigern kann, Homosexuelle einzustellen oder an sie zu vermieten, aber Anita Bryant hat sich als die christgläubige Mutter von vier Kindern und Zweite bei der Miss-America-Wahl, die sie ist, dagegen ausgesprochen, und alle normalen und gottesfürchtigen Menschen in Miami haben sich voll hinter sie gestellt.
Wir haben uns natürlich keine besonderen Gedanken darüber gemacht, weil wir hier oben lang nicht so viele Homosexuelle haben wie die in Miami. Sie mögen nämlich das Meer, sagt Papa. Jedenfalls hat es nicht lange gedauert, bis so eine organisierte Gruppe von Homosexuellen versucht hat, Druck auszuüben auf die Citrus Commission, damit die ihre Fernsehspots mit Anita Bryant aus dem Programm nimmt. Stell Dir das mal vor! Anita hat gesagt, nur weiter so, und sie wird tun, was nötig ist, damit ihre Kinder wieder gefahrlos durch die Straßen von Miami laufen können. Gott schütze sie!
Ich würde selber ja gar nicht so viel darüber wissen, aber am Dienstag ist Etta Norris (die Mutter von Bubba) bei uns vorbeigekommen, weil sie sich auf unserem neuen Farbfernseher die Oral-Roberts-Bibel-Show anschauen wollte, und da hat sie erzählt, dass sie in Orlando Leute zusammentrommelt für ein Komitee, das die Gruppe von Anita Bryant unterstützen soll. Save Our Children, Inc. heißt die. Ich bin sofort Mitglied geworden bei diesem Komitee, aber Papa hat gesagt, dass er nicht Mitglied werden will, weil Du schon ein erwachsener Mann bist, und ein Sohn von ihm hat es nicht nötig, dass man ihn vor Homosexuellen beschützt. Ich habe gesagt, dass es ums Prinzip geht, und dann habe ich ihn gefragt, was denn passiert, wenn die Homosexuellen aufhören, Orangensaft zu trinken. Er hat gesagt, dass die meisten Homosexuellen sowieso keinen Orangensaft trinken, aber er ist dann doch Mitglied geworden.
Gestern Abend hatten wir im Raum der Veterans of Foreign Wars im Fruitland Bowl-a-Rama unser erstes Treffen. Etta hat gesagt, das Wichtigste ist, dass wir Anita Bryant zeigen, dass wir hinter ihr stehen. Sie hat auch gesagt, wir sollten in unsere Erklärung hineinschreiben, dass wir keine Vorurteile haben, dass wir Homosexuelle in der Schule aber nicht als gute Vorbilder für Kinder ansehen. Lolly Newton hat gesagt, dass die Sache mit den Lehrern ihrer Meinung nach auch wichtig ist, denn wenn da vorne ein Lehrer steht, der den ganzen Tag herumtuckt, dann werden die Kinder automatisch auch zu Tucken. Ralph Taggart hat den Antrag unterstützt.
Dein Vater hat mir dauernd gesagt, ich soll bloß still sein und mich nicht lächerlich machen, aber Du kennst mich ja. Ich musste natürlich auch mein Scherflein dazu beitragen. Ich bin aufgestanden und habe gesagt, dass wir meiner Meinung nach alle niederknien und dem Herrn danken sollten, dass jemand so Berühmtes wie Anita Bryant den Mächten von Sodom und Gomorrha den Kampf angesagt hat. Etta hat gesagt, dass wir das in unsere Resolution aufnehmen sollten, und da war ich dann mächtig stolz.
Reverend Harker hat gemeint, dass wir zu der Mietgeschichte vielleicht lieber nichts schreiben sollten, weil doch Lucy McNeil das Zimmer über ihrer Garage an diesen tuckigen Mann vermietet hat, der in der Dixie Dell Mall Teppiche verkauft. Lolly hat aber gesagt, dass das nichts ausmacht, denn Lucy hat das ja freiwillig gemacht, und außerdem ist es viel einfacher, wenn man es einem von denen ansieht, dass er homosexuell ist. Auf die Weise kann man seine Kinder vor so einem warnen.
Na, wahrscheinlich höre ich mich an, als würde ich bei einem Kreuzzug mitmachen, was? Ich hoffe, Du hältst Deine alte Mama nicht für eine lächerliche Idealistin. Ich glaube bloß fest daran, dass der Herr uns geschaffen hat, damit wir alle sein geheiligtes Wort hinaustragen.
Heute Vormittag habe ich bei Etta drüben Bubba getroffen. Er ist so ein netter junger Mann. Meine Güte! Ich kann es kaum glauben, dass es schon mehr als acht Jahre her ist, dass ihr beide zum letzten Mal am Cedar Creek zelten wart. Er hat nach Dir gefragt. Er unterrichtet jetzt an der Highschool Geschichte und ist immer noch nicht verheiratet, aber wahrscheinlich ist es heutzutage auch reichlich schwer, die Richtige zu finden.
Blackie hat den Frost nicht besonders vertragen und liegt bloß träge im Haus herum. Ich fürchte, wir müssen ihn bald einschläfern lassen. Er ist schon furchtbar alt.
Pass auf Dich auf, Mikey. Wir lieben Dich sehr.
Mama
PS: Wenn Du für Deine Reise noch etwas zu lesen brauchst, dann empfehle ich Dir Anita Bryants Autobiografie. Sie heißt «Mine Eyes Have Seen the Glory».
Die Flucht
Am Vorabend ihrer Kreuzfahrt nach Mexiko steckten Mary Ann und Michael über ihren Koffern verschwörerisch die Köpfe zusammen. «Wie wär’s», sagte Michael grinsend, «wenn wir es in ein Kleenex einwickeln und dann in deinen BH …»
«Das finde ich gar nicht komisch, Mouse.»
«Aber, sieh mal: Wir müssen es doch nicht mit an Land nehmen. Es ist ja nicht so, als wollten wir es in Acapulco auf der Straße rauchen. Herrgott, einen Zöllner kriegen wir sowieso erst zu sehen, wenn wir wieder nach L.A. zurückkommen.»
Mary Ann seufzte und setzte sich auf die Bettkante.
«Ich hab mal zu den Future Homemakers of America gehört, Mouse.»
«Na und?»
«Na, und jetzt schmuggle ich Dope nach Mexiko.»
«Und außerdem verreist du mit einem» – er senkte seine Stimme zu einem bedrohlich klingenden Bass – «bekennenden Homosexuellen.»
Mary Ann lächelte schwach. «Das noch dazu.»
Michael schaute sie einen Moment lang an, um herauszufinden, wie ernst sie ihn genommen hatte. Es gab selbst jetzt noch Situationen, in denen seine Ironie dem, was sie tatsächlich empfand, gefährlich nahekam. Sie zwinkerte ihm allerdings zu, sodass er mit dem Packen weitermachte.
«Der Ausdruck gefällt mir», sagte er, ohne aufzublicken.
«Welcher?»
«‹Ein bekennender Homosexueller.› Ich meine, hast du jemals von einem bekennenden Heilsarmisten gehört? Oder von einem bekennenden Versicherungsvertreter? Und wenn du kein bekennender Homosexueller bist, dann bist du ein notorischer. ‹Mr. Farquar, ein notorischer Börsenmakler, wurde heute Morgen im Golden Gate Park erstochen aufge…›»
«Mouse, davon kriege ich Gänsehaut!»
«Entschuldige.»
Sie drückte seine Hand. «Ich wollte dich nicht anschnauzen. Es ist bloß … Na ja, ich bin immer noch ein bisschen schreckhaft, wenn es um Tote geht, das ist alles.»
Er wollte schon sagen: «Über die Klippe kommst du auch noch hinweg», besann sich dann aber eines Besseren. Er hielt stattdessen Mary Anns Hand fest und besänftigte sie zum dritten oder vierten Mal in dieser Woche. «Wird schon werden, Babycakes. Es ist ja erst zwei Monate her.»
Sie bekam feuchte Augen. «Und du glaubst nicht, dass wir … davonlaufen oder so?»
«Vor was?»
Sie wischte sich eine Träne aus dem Auge, zuckte mit den Schultern und sagte etwas kleinlaut: «Vor der Polizei vielleicht?»
«Du hast doch nichts verbrochen, Mary Ann.»
«Ich habe seinen Tod nicht angezeigt.»
Er zwang sich zur Geduld. Sie hatten es schon so oft durchgekaut, dass das Reden darüber zu einem Ritual geworden war. «Dieser Kerl», sagte Michael sanft, «war ein ausgesprochenes Arschloch. Vergiss nicht, dass er Kinderpornos gemacht hat. Und du hast ihn doch nicht runtergestoßen von der Klippe, Mary Ann. Sein Tod war ein Unglück. Und wenn du seinen Tod angezeigt hättest, wärst du außerdem verpflichtet gewesen, der Polizei davon zu erzählen, dass er über Mrs. Madrigal Nachforschungen angestellt hat. Dafür mögen wir Mrs. Madrigal aber beide viel zu gern, und zwar unabhängig davon, was in der Akte gestanden hat.»
Schon bei der bloßen Erwähnung der Akte schüttelte es Mary Ann. «Ich hätte sie auf keinen Fall verbrennen sollen, Mouse.»
Also kaute Michael ihr auch das noch einmal vor. Dass sie die Akte verbrannt hatte, erklärte er ihr, war ihre allerklügste Entscheidung gewesen. Indem sie das Dossier des Privatdetektivs über Mrs. Madrigal vernichtet hatte, hatte sie gleich einen doppelten Treffer gelandet: Erstens hatte sie verhindert, zur Mitwisserin von vertraulichen Informationen zu werden, die sie dann vielleicht an die Polizei hätte weitergeben müssen. Und zweitens hatte sie die Akte dem Zugriff der Polizei entzogen.
Die Polizei war in der Barbary Lane 28 aufgetaucht, sobald Mrs. Madrigal ihren Mieter als vermisst gemeldet hatte. Es stellte sich heraus, dass die Beamten ihre Ermittlungen nach Schema F betrieben und nach kurzer Zeit wieder einstellten. Wie die Polizisten in Erfahrung brachten, handelte es sich bei Norman Neal Williams um einen Durchreisenden, einen Handelsvertreter für Vitaminpräparate, der ohne greifbare Verwandte war. Seine Verwicklung in das Kinderpornogeschäft wurde sofort aufgedeckt, doch Mary Ann tat so, als hätte sie davon nichts gewusst.
Sie erzählte der Polizei, dass sie ein paarmal «mit ihm ausgegangen» war. Sie hatte ihn nicht besonders gut gekannt. Er war ihr manchmal «ein bisschen eigenartig» vorgekommen. Und, ja, sie hielt es für möglich, dass er in eine andere Stadt gezogen war.
Nachdem die Polizei gegangen war, hatte sie Michael in ihre Wohnung gerufen und war mit ihm die tatsächlichen Geheimnisse dieses schrecklichen Kapitels in ihrem Leben durchgegangen.
Wusste die Polizei, dass Norman Neal Williams Privatdetektiv gewesen war?
Wusste Mrs. Madrigal, dass sie Gegenstand von Williams’ Nachforschungen gewesen war?
Würde Williams’ Leiche an Land gespült werden?
Und warum sollte jemand Nachforschungen anstellen über eine so warmherzige und mitfühlende und … harmlose Frau wie Anna Madrigal?
Mexiko war natürlich eine Flucht, aber keine von der Art, wie Mary Ann sie gemeint hatte. Eine morbide Beklommenheit hatte sich in ihrem Körper breitgemacht wie Moder. Sie beschloss, sie aus sich herauszubraten. In jungen Jahren war das ihre Lösung für so gut wie alles gewesen.
Sie verstaute eine Flasche Coppertone-Sonnenmilch in einer Seitentasche ihres American-Tourister-Rucksacks. «Weißt du was?», sagte sie mit gekünsteltem Optimismus.
«Was?»
«Diese Reise wird ein Schlager. Ich lerne garantiert jemand kennen, Mouse.»
«Meinst du etwa einen Mann?»
«Mouse, natürlich bist du der tollste Begleiter von der Welt, aber …»
«Hör mal, das brauchst du mir nicht zu erklären. Ich hab eh schon einen sagenhaften Plan: Ich entdecke auf dem Schiff einen Typen, ja? Er räkelt sich am Swimmingpool, oder … Jedenfalls schlender ich ganz lässig auf ihn zu, mit dir am Arm, und du bist braun gebrannt und siehst einfach zum Anbeißen aus, sodass er gar nicht anders kann, als vor Neid zu vergehen, und dann sage ich mit meiner markigsten Lee-Majors-Stimme: ‹Heh, du da, ich bin Michael Tolliver, und das ist Mary Ann Singleton. Bist du auf sie scharf oder auf mich?›»
Mary Ann kicherte. «Und was ist, wenn er weder auf dich noch auf mich scharf ist?»
«Dann», sagte Michael nüchtern, «stößt du ihn in Acapulco von der erstbesten Klippe.»
Mona reißt aus
Nachdem sie Mary Ann und Michael zum Flughafen gefahren hatte, kehrte Mona in die Barbary Lane zurück. Dort verfiel sie in eine Niedergeschlagenheit von kosmischen Ausmaßen.
Sie war schwer verunsichert. Einerseits wegen des sonderbaren Anrufs ihrer Mutter, andererseits deswegen, weil zwei ihrer Freunde es geschafft hatten, dem inzestuösen Provinzbabylon namens San Francisco zu entkommen.
Das war es, was auch sie nötig hatte. Einen Tapetenwechsel. Blauen Himmel. Zwiesprache mit der Ewigkeit. Eine Gelegenheit, ihr Leben so umzugestalten, dass es ihr zu der inneren Ruhe verhalf, nach der sie sich so heftig sehnte.
In weniger als zehn Minuten entwarf sie einen Schlachtplan und hinterließ an Mrs. Madrigals Tür eine knappe Nachricht:
Mrs. M,
ich bin einige Zeit weg.
Bitte machen Sie sich keine Sorgen.
Ich muss mal Luft holen.
Alles Liebe
Mona
Mona bewerkstelligte ihre Flucht per Cable Car – eine bittere Ironie, die ihr einigen Verdruss bereitete. Würde Tony Bennett sich nicht ins Fäustchen lachen, wenn er wüsste, dass Mona Ramsey, alternder Freak und transzendentale Zynikerin, gezwungen war, sich bei ihrer Flucht aus Everybody’s Favorite City eines dieser grauenhaft niedlichen Touristenwägelchen zu bedienen?
An der Ecke Powell und Market stieg sie aus und ließ die geschniegelten Massen schnellstmöglich hinter sich. Sie schlenderte die Market hinauf bis zur Seventh, bog in die Seventh ein und blieb mit einem Seufzer vor der Greyhound-Station stehen. Nach dreiminütiger Bedenkzeit kaufte sie eine Fahrkarte nach Reno, weil sie spontan entschieden hatte, dass Sonne und Himmel und Wüste ihr möglicherweise neue Horizonte eröffnen würden. Sie bekam die Auskunft, dass der Bus kurz nach Mitternacht abfahren würde.
Den Rest des Nachmittags saß sie auf dem Union Square, wo die Betrunkenen, die Penner und die kaputten Hippies sie nur bestärken konnten in ihrem Entschluss wegzugehen. Sobald die Dunkelheit hereinbrach, rauchte sie eine kräftige Mischung aus Gras und Angel Dust und ging langsam zurück zur Busstation.
Sie aß in der Snackbar gerade ein Käsesandwich, als ein grell geschminktes altes Weib von mindestens achtzig versuchte, mit ihr ins Gespräch zu kommen.
«Wo soll’s denn hingehen, Püppi?»
«Nach Reno», antwortete Mona leise.
«Das is eine Station nach mir. Nimmste auch den Bus um Mitternacht?»
Mona nickte. Sie fragte sich, ob die Frau durch das Angel Dust grotesker aussah, als sie in Wirklichkeit war. «Was hältste davon, wenn wir zwei beide uns zusammensetzen? Ich werd beim Busfahren immer arg nervös wegen diesen Perversen und so.»
«Tja, ich weiß nicht, ob ich Ihnen da viel …»
«Ich stör dich garantiert nich. Ich red nur, wenn’s dir grade recht is.»
Mona war eigentümlich berührt. «Ja, klar», sagte sie schließlich. «Abgemacht.»
Die alte Frau grinste. «Wie heißte denn, Püppi?»
«Mo … Judy.»
«Ich bin Mother Mucca.»
«Mother …?»
«Mucca. So ’ne Art Spitzname. Weil ich aus Winnemucca bin, verstehste?» Sie kicherte vor sich hin. «Aber das is ’ne lange Geschichte, und es hätt eh keinen Sinn, dass … Sag mal, Püppi, is was mit dir?»
«Nein.»
«Du schaust irgendwie abgefuckt aus.»