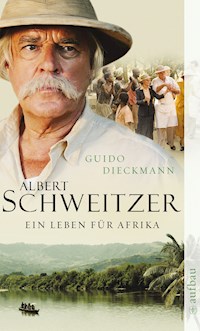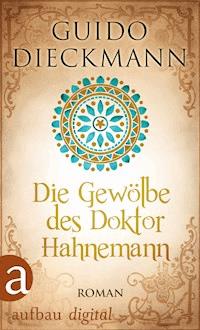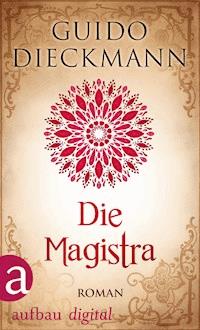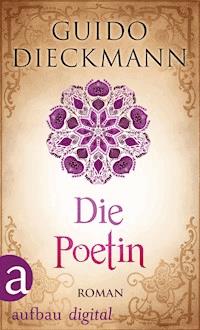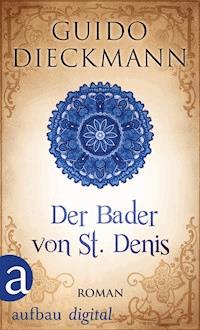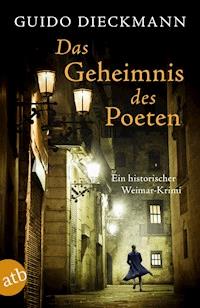9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Templer-Saga
- Sprache: Deutsch
Das Mysterium der verbotenen Templer.
Frankreich im Jahre 1318. Die junge Heilkundige Prisca von Speyer führt auf dem Landgut ihres Großvaters in Aquitanien ein zurückgezogenes Leben. Was niemand ahnt: Prisca hütet ein Geheimnis des verbotenen Templerordens. Zeitgleich bietet sich sieben überlebenden Templern die Gelegenheit, in Portugal einen neuen Orden zu gründen. Unter einer Bedingung: Die Männer müssen drei verschollene Reliquien aufspüren. Und dazu müssen sie nicht nur mächtige Verfolger abschütteln, sondern auch Priscas Versteck finden ...
Packend und auf historischen Fakten basierend – ein Roman über die Templer nach deren Untergang.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 721
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Über Guido Dieckmann
Guido Dieckmann, geboren 1969 in Heidelberg, arbeitete nach dem Studium der Geschichte und Anglistik als Übersetzer und Wirtschaftshistoriker. Heute ist er als freier Schriftsteller erfolgreich und zählt mit seinen historischen Romanen, u.a. dem Bestseller »Luther« (2003), zu den bekanntesten Autoren dieses Genres in Deutschland. Guido Dieckmann lebt mit seiner Frau an der Deutschen Weinstraße.
Als Aufbau Taschenbuch sind von ihm lieferbar: ›Die sieben Templer‹, ›Luther‹ sowie die historischen Weimar-Krimis ›Das Geheimnis des Poeten‹ und ›Der Fluch der Kartenlegerin‹.
Mehr Informationen zum Autor unter www.guido-dieckmann.de
Informationen zum Buch
Das Mysterium der verbotenen Templer
Frankreich im Jahre 1318. Die junge Heilkundige Prisca von Speyer führt auf dem Landgut ihres Großvaters in Aquitanien ein zurückgezogenes Leben. Was niemand ahnt: Prisca hütet ein Geheimnis des verbotenen Templerordens. Zeitgleich bietet sich sieben überlebenden Templern die Gelegenheit, in Portugal einen neuen Orden zu gründen. Unter einer Bedingung: Die Männer müssen drei verschollene Reliquien aufspüren. Und dazu müssen sie nicht nur mächtige Verfolger abschütteln, sondern auch Priscas Versteck finden.
Packend und auf historischen Fakten basierend – ein Roman über die Templer nach deren Untergang
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Guido Dieckmann
Der Pakt der sieben Templer
Historischer Roman
Inhaltsübersicht
Über Guido Dieckmann
Informationen zum Buch
Newsletter
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Kapitel XIII
Kapitel XIV
Kapitel XV
Kapitel XVI
Kapitel XVII
Kapitel XVIII
Kapitel XIX
Kapitel XX
Kapitel XXI
Kapitel XXII
Kapitel XXIII
Kapitel XXIV
Kapitel XXV
Kapitel XXVI
Kapitel XXVII
Kapitel XXVIII
Kapitel XXVIX
Kapitel XXX
Kapitel XXXI
Kapitel XXXII
Kapitel XXXIII
Kapitel XXXIV
Kapitel XXXV
Kapitel XXXVI
Kapitel XXXVII
Kapitel XXXVIII
Nachwort
Impressum
Wir verbieten jedoch, dass es einem gestattet sei, sich übermäßiger Enthaltsamkeit hinzugeben, vielmehr soll er sich standhaft an das gemeinsame Leben halten.
Auszug aus der Ordensregel der Tempelritter aus dem Jahr 1128
Niemand konnte den Tempel betreten, bis die sieben Plagen aus der Hand der sieben Engel zu ihrem Ende gekommen waren.
Offenbarung des Johannes, 15,8
I.
FRAUENKLOSTER MÜHLEN, DIÖZESE WORMS, SOMMER 1318
Jakobus von Hahnheim war nicht nur schlecht gelaunt, er schäumte geradezu vor Wut, als er mit seiner Schar bewaffneter Reiter durch die schmale Dorfstraße auf das Kloster zuritt.
Sein weiter Mantel, dessen mit weißem Garn aufgesticktes Kreuz ihn als Ordensritter auswies, flatterte im Wind, wirkte aber schwarz wie er war wie ein Zeichen des Friedens. Als der ältere Mann den Dorfanger überquerte, sprang ihm alles, was Beine hatte, erschrocken aus dem Weg, um nicht von seinem Pferd niedergetrampelt zu werden. Bauern suchten hinter ihren Heukarren Schutz, Mütter zogen ihre Kinder von der Gasse in die Hütten. Hühner, Enten und Gänse stoben mit den Flügeln schlagend in alle Richtungen davon. Unter den Hufen der Pferde zerbarsten Tonkrüge und Schalen. Körbe mit Kohl und Zwiebeln wurden in den Morast gestampft. Jakobus kümmerte das nicht. Er ignorierte die finsteren Blicke, die sich ihm wie Pfeile in den Rücken bohrten; das Bauernvolk interessierte ihn nicht. Auf das Kloster und dessen Bewohnerinnen hatte er es abgesehen.
Am Ende des Dorfwegs gab Jakobus seinen Männern mit einer Geste zu verstehen, dass er von hier ab allein weiterreiten wollte. Nur Germund, an dessen Seite er bereits im Heiligen Land gekämpft hatte, wählte er aus, um ihn zu der Unterredung mit der Äbtissin von Mühlen zu begleiten. Als Jakobus durch das Tor ritt, stellte er mit Genugtuung fest, dass seine Ankunft bei dem Gesinde auf dem Klosterhof Unruhe hervorrief. Mit offenen Mündern starrte man ihn an, aber keiner von ihnen wagte es, ihn aufzuhalten oder dumme Fragen zu stellen. Zehn Jahre zuvor wäre ein solches Eindringen noch nicht so einfach gewesen, denn damals hatte es in der Nachbarschaft des Klosters ein Ordenshaus der Templer gegeben, und die hatten sowohl das Kloster als auch das Dorf unter ihren Schutz gestellt. Doch inzwischen waren die Nonnen hier draußen in der Einöde wehrlos und allein auf den Schutz ihrer Patronin, der heiligen Margareta, angewiesen.
Als Jakobus sich aus dem Sattel gleiten ließ, blies ihm ein stürmischer Ostwind Sand in die Augen, sodass er einen Moment lang wie blind umherging. Hoch oben am Himmel zogen sich schwarze Wolken zusammen, die ein Unwetter ankündigten. Doch trotz des drohenden Regens nahm der Mann sich Zeit, um den Klosterhof zu erkunden. Aufmerksam betrachtete er sich Scheunen, Lagerräume und das kleine Brauhaus, begutachtete die Pferde im Stall sowie den Zustand der Weinkeller. Der Besitz der Nonnen von Mühlen mochte bescheiden sein, schlecht bewirtschaftet war er jedoch keineswegs. Jenseits der Mauern stand ihr Korn goldgelb und reif auf den Feldern. Dazu kamen mehrere Obstgärten und ein Fischteich, der vom Wasser eines Baches gespeist wurde. In Kürze würden die Bauern eine reiche Ernte einfahren und ihre Herrinnen in dem grauen, zweistöckigen Haus neben der Kapelle noch reicher machen.
Jakobus von Hahnheim wandte seine Aufmerksamkeit wieder dem Klosterhof zu. Ein wenig erinnerte der ihn mit seinen frei umherlaufenden Hühnern und Schweinen an den elsässischen Gutshof, auf dem er seine Kindheit verbracht hatte. Auch hier wurde fleißig gearbeitet. Einige Mägde schleppten eilig große Bündel mit frischen Binsen für die Fußböden des Klosters heran, andere beluden Karren mit duftendem Heu, während kleine Bauernmädchen Buckelkörbe, die für die Weinlese benötigt wurden, mit einigen Streifen Bast flickten. Bereits eine Meile vor dem Dorf waren Jakobus die gepflegten Weingärten aufgefallen, die zum Klosterbesitz gehörten und einen reichen Ertrag versprachen. Es war nicht schwer zu erraten, wer dies den Ordensfrauen beigebracht hatte. Jakobus ärgerte sich darüber, sobald er nur daran dachte.
Eine Insel der Seligkeit inmitten eines Reiches, das von den Machtkämpfen eines Königs und Gegenkönigs, eines Papstes im fernen Avignon sowie Dutzender Fürsten erschüttert wurde. Recht und Gesetz, für das auch Jakobus von Hahnheim mit dem Schwert in der Hand gekämpft hatte, lösten sich in Rauch auf. Der Klerus wirtschaftete in die eigene Tasche, anstatt sich um die Nöte der Armen zu kümmern. Und wie stand es um den Besitz von Mühlen? Gern hätte Jakobus den Erfolg der Nonnen ihrem Fleiß und ihrer Frömmigkeit zugeschrieben, doch was ihm zu Ohren gekommen war, ließ ihn daran zweifeln, dass die Frauen hier draußen nur beteten und arbeiteten, wie es ihre Regel vorschrieb. Wenn sein Verdacht sich bestätigte, waren sie keine harmlosen Klosterschwestern, sondern befanden sich auf einem gefährlichen Irrweg, ja, womöglich waren sie sogar mit dem Teufel im Bunde. Jakobus zog die Kapuze seines Mantels bis in die Stirn. Seine Blicke wanderten an dem hohen Turm aus grauem Feldstein empor, und er schwor sich dabei, den Satan aus ihrer Mitte zu vertreiben. Nur aus diesem Grund hatte er den anstrengenden Ritt auf sich genommen. Rasch schloss er die Augen und besann sich auf die Worte aus der Schrift, die ihm sein Kaplan mit auf den Weg gegeben hatte. Es ist unvermeidlich, dass Verführungen kommen. Aber wehe dem, der sie verschuldet.
Jakobus’ Misstrauen richtete sich vordergründig gegen die neue Äbtissin, eine Frau, die wie ein Blitz aus heiterem Himmel aus dem Osten hierhergekommen war.
Sie nannte sich Benedicta, die Gesegnete, doch in Wahrheit war sie eine Verführerin, die ihre Mitschwestern zu Aufsässigkeit anstiftete. Ihr musste das Handwerk gelegt werden, ehe sie weitere Frauen verdarb und Jakobus als neuen Vorsteher der benachbarten Kommende damit der Lächerlichkeit preisgab. Bis hin zu Peter von Aspelt, dem Erzbischof von Mainz, hatte sich schon herumgesprochen, was die frechen Weiber hinter ihren Mauern trieben. Der Kirchenfürst war ein vorsichtiger Mann, der nur ungern in eine Angelegenheit eingriff, bevor er alle Fakten kannte.
Nun, Fakten würde Jakobus von Hahnheim ihm bald in Hülle und Fülle liefern können.
»He, du!« Schroff rief er einen dünnen, blondgelockten Burschen herbei, der den Mägden mit dem Heukarren half, und drückte ihm die Zügel seines Rappens in die Hand. »Führ unsere Gäule zur Tränke«, befahl er. »Füttere und striegle sie, während ich mit deiner Herrin spreche! Machst du deine Sache gut, bekommst du einen halben Silberpfennig von mir! Also lass dich später nicht beim Faulenzen erwischen!« Der junge Knecht verbeugte sich wortlos vor den beiden Männern. Bevor er sich jedoch mit den Pferden entfernen konnte, packte Jakobus’ Begleiter ihn stirnrunzelnd am Arm.
»Sind wir einander nicht schon einmal begegnet?« Germund kniff die Augen zusammen und musterte den Burschen aufmerksam von Kopf bis Fuß. »Du kommst mir bekannt vor!«
Jakobus lachte halb verärgert, halb amüsiert. Er war schon daran gewöhnt, dass sein guter Germund seit ihrer Rückkehr aus Palästina jedermann misstraute, der ihm über den Weg lief, und hinter jedem Baum einen Angreifer lauern sah. Dabei war der bärtige und breitschultrige Hüne, der Jakobus fast um Haupteslänge überragte, alles andere als ein Waschweib, sondern ein erprobter Schwertkämpfer und ein scharfsinniger Beobachter, der im Gegensatz zu dem oft jähzornigen Jakobus kalt wie Marmor war. Obwohl er nie darüber redete, was ihm im Kopf herumging, gehörte Germund zu den wenigen Rittern des Ordens, deren Ratschläge Jakobus schätzte, und wenn man es recht bedachte, war es auch Germund gewesen, der ihn gedrängt hatte, die aufsässigen Nonnen aufzusuchen.
»Ich könnte schwören, dass ich das dünne Kerlchen schon einmal irgendwo gesehen habe«, holte Germunds Stimme ihn aus seinen Gedanken. »Aber hier war das nicht. Ich bin schließlich heute zum ersten Mal an diesem gottverlassenen Ort.«
Jakobus winkte gelangweilt ab. Was zum Teufel kümmerte ihn ein zerlumpter Fronknecht? Die Äbtissin war es, die er in die Knie zwingen musste, nicht ihre Leibeigenen. Seine Geduld mit der Frau war erschöpft, und das sollte sie zu spüren bekommen. Wehe, sie führte ihn noch einmal an der Nase herum.
»Es ist eine Schande, wie Ihr Euch uns Johannitern gegenüber aufführt«, fing er zu toben an, kaum dass die Äbtissin, eine zierliche, noch junge Person mit klugen Augen ihm und Germund Platz angeboten hatte. Sie saßen in einer Kammer, die äußerst schlicht ausgestattet war und ihr dürftiges Licht nur von einem Tonlämpchen auf dem Schreibpult erhielt. Während Jakobus Vorwurf an Vorwurf reihte, goss die Ordensfrau Wein in den Becher ihres wütenden Besuchers und verdünnte diesen anschließend mit frischem Brunnenwasser, damit er nicht zu Kopf stieg. »Ein ausgezeichneter Tropfen«, sagte sie unbekümmert. »Kostet nur!«
»Hört Ihr mir eigentlich zu?«, rief der Johanniter. Ihm kam es so vor, als machte sich die Frau über ihn lustig. Nun, das würde dieser Hexe noch schlecht bekommen. Er war nicht hier, um sich verspotten zu lassen, sondern, um die Rechte seines Ritterordens zu verteidigen.
Mit einem nachsichtigen Lächeln reichte Benedicta von Rosenfeld ihm den Trunk, den er nach kurzem Zögern entgegennahm.
»Aber natürlich höre ich Euch zu, Bruder Jakobus«, sagte sie. »Es wäre sehr freundlich, wenn Ihr mich über meine Verfehlungen aufklären würdet. Aber bitte nur, wenn es nicht zu lange dauert.« Sie seufzte. »Legt es mir nicht als Hochmut oder Desinteresse aus, aber es ist spät, und meine Schwestern und ich werden bald in der Kirche erwartet, um die Gebete zur Vesper zu sprechen! Vielleicht mögt Ihr Euch uns anschließen?«
Jakobus von Hahnheim verzichtete auf eine Antwort, denn er bemerkte, wie Germund den Becher in seiner Hand anstarrte, ohne einen Schluck daraus zu nehmen. Ob er den Wein für vergiftet hielt? Unsinn, soweit würde die Frau nicht gehen, um sich der neuen Herren im Dorf zu entledigen. Dass er nicht trank, hatte damit zu tun, dass er sich geschworen hatte, erst von dem Mühlener Wein zu kosten, wenn die Klosterfrauen sich seinem Orden unterworfen und ihm die Schlüssel zum Haus mitsamt seinen Weinkellern und Kornspeichern ausgehändigt hatten. Der Wein gehörte ihm, verflucht. Ebenso die Obstgärten und das Vieh. Sogar diese nach Lampenruß stinkende Kammer!
Während er sich noch an der Vorstellung berauschte, bald über Mühlen und seine Güter befehlen zu können, sprach Germund Benedicta von Rosenfeld an. »Wir wissen, dass das Land, auf dem Ihr lebt, noch vor zehn Jahren von den Templern kontrolliert wurde!«
Die Äbtissin nickte. »Ja, aber damit verratet Ihr mir kein Geheimnis, guter Bruder. Bischof Eberhard von Worms entschied im Jahr des Herrn 1272, der ansässigen Templerkomturei ein paar Güter zur Verwaltung zu übertragen. Ihr Ordenshaus grenzte direkt an unseren Besitz, da war es sinnvoll, dass die frommen Herren auch den Schutz unseres Klosters übernahmen. Einige der älteren Schwestern erinnern sich noch gut an die Schwertübungen der Ritter auf dem Waffenplatz am Seebach.« Sie spitzte die Lippen. »Aber das ist vorbei. Nun haben ja bekanntlich Eure Leute ihr Ordenshaus übernommen.«
»Ihr wollt hoffentlich nicht behaupten, wir hätten es gestohlen«, sagte Jakobus schroff. »Papst Clemens V. hat uns Johannitern die Güter des Templerordens zugesprochen, nachdem er diesen wegen seiner ungeheuerlichen Verbrechen auflösen musste. Als gute Tochter der Kirche und Vorsteherin eines Klosters solltet Ihr diese Entscheidung eigentlich begrüßen. Die Templer sind auf und davon. Sie werden nie wieder nach Mühlen zurückkehren.«
»Eine Rückkehr würde diesen Teufeln auch schlecht bekommen«, pflichtete Germund bei. »Mögen sie in der tiefsten Hölle schmoren, und möge Gott mit den Sündern gnädig sein, die ihnen bis auf den heutigen Tag aus falsch verstandener Treue Hilfe zukommen lassen!«
Benedicta von Rosenfeld sah nicht so aus, als würde sie diesen Vorwurf auf sich beziehen. Selbstbewusst erwiderte sie Germunds Blick. Dann wandte sie sich dem schlichten Holzkreuz zu, das neben dem Fenster hing, faltete die Hände und neigte andächtig den Kopf. Während sie betete, betrachte Jakobus die Frau aufmerksamer. Sie war noch recht jung für das Amt, das sie bekleidete. Jakobus schätzte sie auf kaum mehr als dreißig Jahre. Viel Erfahrung konnte sie demnach als Äbtissin nicht haben. Dennoch gab es da etwas an ihr, das ihn irritierte. Anders als viele Weiber, auch Ordensfrauen, mit denen er es schon zu tun gehabt hatte, wirkte sie trotz ihrer Jugend kampferprobt und auf eine geradezu hinterhältige Weise energisch. In ihren Blicken erkannte er Verachtung für die Männer, die im Begriff standen, das Erbe der Templer anzutreten.
»Ihr behauptet also, der Erzbischof von Mainz habe Euch Vollmachten erteilt«, wandte sich die Äbtissin schließlich an Jakobus. »Hat nicht derselbe Bischof die Templer auf seiner Synode vor fünf Jahren von all diesen schrecklichen Vorwürfen freigesprochen?«
Germund verschränkte die Arme vor der Brust und lachte spöttisch. »Welche Überraschung, nachdem zwanzig Tempelritter in voller Rüstung und von einem Wildgrafen begleitet, vor dem bischöflichen Gerichtshof aufmarschierten, um das Urteil in ihrem Sinne zu beeinflussen. Welcher Pfaffe hätte es da gewagt, die Ritter nicht frei zu sprechen? Mit einem Schwert an der Kehle lässt sich schlecht ein gerechtes Urteil fällen. Inzwischen sind diese Entscheidungen aber nicht mehr gültig. Der Orden wurde vom Papst aufgelöst. Der letzte Großmeister starb vor fast fünf Jahren in Paris auf dem Scheiterhaufen, und alles, was seine Ordensbrüder hinterließen, wurde gerecht aufgeteilt.«
»Zum Vorteil der Johanniter, die schon immer mit den Templern wetteiferten!«, erinnerte ihn die Äbtissin. Ihr Ton ließ keinen Zweifel daran, dass sie die Entscheidung des verstorbenen Papstes missbilligte. »Ihr dürft Euch beglückwünschen, damit ist Euch ein fetter Fisch ins Netz gegangen: Burgen, Gutshöfe, Dörfer und Ländereien … Wie ich hörte, haben Eure Leute schon damit begonnen, Templergüter aus Mühlen weiterzuverkaufen.«
»Ganz recht!« Jakobus von Hahnheim erhob drohend den Zeigefinger. »Und das betrifft auch dieses Kloster, ehrwürdige Äbtissin! Falls ich Euch überhaupt noch so anreden darf, denn wie uns zu Ohren gekommen ist, habt Ihr Euch vom Orden der Zisterzienserinnen losgesagt. Soll ich Euch verraten, wie Eure Schwestern zwischen Worms und Mainz genannt werden?«
»Nur zu!« Benedicta faltete die Hände. »Man nennt uns Templerinnen, was natürlich Unsinn ist, weil Frauen nicht Angehörige eines Ritterordens sein können. Nein, wir Frauen von Mühlen kämpfen gegen die Tücke des Teufels nicht mit dem Schwert in der Hand, sondern mit der Kraft des Gebets. Aber wenn Ihr Euch die Mühe machtet, die Ordensregel der Templer zu studieren, so müsstet Ihr zugeben, dass sich darin nicht ein Punkt befindet, der verwerflich wäre. Die Nonnen hier hatten niemals einen Grund, sich über ihre Schutzherren zu beklagen. Wären sie noch hier, würdet Ihr auch in einem anderen Ton mit mir sprechen.«
»Dass Ihr darauf auch noch stolz seid, ist der Gipfel der Niedertracht«, widersprach Jakobus aufgeregt. »Seit Jahren weigert Ihr Euch, die Bulle des Mainzer Bischofs anzuerkennen, in dem uns Brüdern des Johanniterordens das Recht auf die Verwaltung dieses Klosters zugesprochen wurde. Bis zum heutigen Tage übten wir Nachsicht mit Euch Nonnen, weil …«
»… meine Vorgängerin eine nahe Verwandte des Erzbischofs von Mainz und Angehörige der Leininger Grafenfamilie war, ich weiß!«
Benedicta von Rosenfeld füllte sich nun selbst einen Becher mit Wein, und Jakobus nahm mit Genugtuung zur Kenntnis, dass ihre Hand dabei leicht zitterte. Sollte es ihm gelungen sein, die Äbtissin aus der Fassung zu bringen? In die Enge zu treiben? Wenn, so war dies gut, denn er war noch lange nicht fertig mit der feinen Dame. Noch bevor heute die Sonne versank, würde sie ihn anflehen, sie nicht mit dem Bettelstab vor die Tür zu setzen.
»O ja, die Zeiten, in denen der Bischof über euren Stolz und Starrsinn hinweggesehen hat, sind vorbei«, sagte er selbstgefällig. »Von nun an wird er seine Hand nicht mehr über Euch halten, im Gegenteil. Es ist sein Wunsch, alles, was hierzulande noch an die Templer erinnert, endgültig aus dem Gedächtnis der Menschen zu tilgen. Die Bauern hier schulden ihnen nichts mehr. Sie sollten sich daran gewöhnen, ihren neuen Herren zu gehorchen. Ihr und Eure Mitschwestern seid ihnen jedoch ein schlechtes Vorbild.« Jakobus stemmte die Hände in die Hüften. Der erschrockene Ausdruck auf dem Gesicht der Nonne gefiel ihm. Er hätte nicht gedacht, dass es so leicht werden würde, ihr Angst einzujagen, nachdem sie sich so lange trotzig gezeigt hatte. Nun gut, ihm konnte es recht sein. »Ich werde morgen früh mit einer Abordnung von Ordensrittern und mit den Gesandten der Bischöfe von Worms und Mainz zurückkehren, um das Haus in Besitz zu nehmen«, kündigte er an. »Ihr, Schwester Benedicta von Rosenfeld, werdet mir die Schlüssel aushändigen und zum Zeichen Eurer Unterwerfung einen Umhang mit unserem Ordenszeichen anlegen: dem weißen Kreuz.«
Die Frau gab einen erstickten Laut von sich, doch Jakobus hatte keinerlei Mitleid mit ihr.
»Anschließend werdet Ihr feierlich der Regel der Templer abschwören und sie auf dem Hof vor den Augen Eurer Mitschwestern und der versammelten Dorfbewohner verbrennen. Habt Ihr das verstanden? Künftig gilt für die Nonnen von Kloster Mühlen nur noch ein einziges Gelübde, das des Johanniterordens! Widersetzt Ihr Euch, werde ich dafür sorgen, dass Ihr es bitter bereuen werdet!«
Jakobus’ letzte Worte wurden vom Geläut der Gebetsglocke übertönt, was ihn ein wenig ärgerte. Doch natürlich konnte er den Nonnen nicht das gemeinsame Vespergebet untersagen. Als wolle der Himmel ihm beipflichten, drang von fern dumpfes Donnergrollen an sein Ohr. Nur wenige Augenblicke später schlugen die ersten Regentropfen gegen den hölzernen Fensterladen der Kammer.
»Nun gut, wenn Ihr darauf besteht!« Benedicta von Rosenfeld stand einen Wimpernschlag lang wie betäubt da, dann straffte sie seufzend die Schulter. »Ich gebe zu, dass die Johanniter einen begründeten Anspruch auf Kloster Mühlen haben, also sollen sie es auch bekommen. Lasst mir nur noch einige Tage Zeit, damit ich mich mit meinen Schwestern beraten und einen neuen Habit schneidern lassen kann.«
Jakobus von Hahnheim starrte die Frau begriffsstutzig an. Nanu, hatte er sich verhört? Der Sinneswandel kam ein wenig zu plötzlich. Noch vor wenigen Augenblicken hatte sich das Weib störrisch und frech gezeigt, und nun das? Sie lenkte tatsächlich ein? Einfach so? Verwirrt suchte er Germunds Blick, der ihm mit einem Stirnrunzeln zu verstehen gab, dass er der Nonne nicht über den Weg traute.
Irgendetwas führte diese Schwester Benedicta im Schilde. Zweifellos eine Teufelei, die mit den Templern, ihren ehemaligen Schutzherren, zu tun hatte.
Während Jakobus noch darüber nachsann, richtete sich Germunds Aufmerksamkeit auf das Schreibpult, auf dem einige Briefe und gesiegelte Urkunden zu sehen waren. Rasch ging er auf die Schriftstücke zu. Benedicta, die ihn aufhalten wollte, stieß er grob zur Seite.
»Mir war so, als hätte die ehrwürdige Äbtissin wiederholt verstohlen zu ihrem Pult geblickt, während sie vorgab, ihre Augen auf das Kreuz unseres Erlösers zu richten«, sagte Germund nicht ohne Häme. »Möglich, dass Euch eines dieser Schriftstücke erklärt, warum sie so plötzlich bereit ist, uns Johannitern die Tore zu ihrem Herzen zu öffnen. Kommt nur, schaut sie Euch an! Wie Ihr wisst, habe ich weder lesen noch schreiben gelernt!«
Jakobus von Hahnheim klopfte seinem Gefährten anerkennend auf die Schulter. Er war froh, dass er Germund nicht bei den anderen Ordensbrüdern im Dorf zurückgelassen hatte. Wieder einmal hatte sich dessen Spürsinn für ihn bezahlt gemacht.
»Wie könnt Ihr es wagen?« In ohnmächtigem Zorn schnappte Benedicta von Rosenfeld nach Luft. Sie hatte offenbar nicht damit gerechnet, von den Johannitern überrumpelt zu werden. »Diese Schriftstücke gehen Euch gar nichts an! Ich habe Euch zugesichert, dass Ihr bekommt, was Ihr verlangt. Genügt Euch das immer noch nicht?«
Jakobus schüttelte den Kopf. Nein, das genügte ihm nicht. Er wollte herausfinden, mit wem die Frau so fleißig Briefe austauschte. Flink nahm er Germund das erste Pergament aus der Hand und studierte es mit aufmerksamer Miene. Nachdem er es gelesen hatte, stieß er einen Pfiff aus. »Na, wenn das keine Entdeckung ist! Ihr seid also die Schreiberin der berüchtigten Äbtissin Gertrud gewesen, die einer Gruppe von Templern zur Flucht aus der Markgrafschaft Brandenburg verholfen hat.« Abwartend starrte er die Ordensfrau an, doch die dachte nicht daran, ihm diesen Gefallen zu tun. Erst als Germund drohend einen Schritt auf sie zumachte, ergab sie sich in ihr Schicksal.
»Es sind sieben Männer gewesen«, sagte sie leise. »Sieben Templer. Meine Mentorin, die Äbtissin von Halberstadt, deren Bruder selbst dem Templerorden angehörte, wollte nicht, dass ihre Geschichte in Vergessenheit gerät, deshalb gab sie mir den Auftrag, sie niederzuschreiben. Bevor sie im Winter vor zwei Jahren starb, händigte sie mir die Schriften aus. Ich sollte auf sie achtgeben, hat sie gesagt, und von keiner unwürdigen Hand berühren lassen.«
Germund schlug mit der Faust auf die geöffnete Lade des Schreibpults. »Ich erinnere mich, Bruder Jakobus! Diese Ketzer besetzten damals eine verlassene Templerkomturei in der Nähe des Städtchens Berlin in der Markgrafschaft Brandenburg, die auch schon längst an uns hätte übergeben werden sollen. Ihr Anführer, ein Bursche namens Thomas Lermond, soll sich dort als Kaufmann getarnt haben, um eine Kostbarkeit zu hüten, die seine Ordensoberen während des letzten Kreuzzugs aus dem Heiligen Land geraubt hatten.«
Jakobus stöhnte auf. Die Worte seines Freundes riefen eine Erinnerung in ihm wach. Auch unter den Männern seines Ritterordens hatten Gerüchte über diese sieben Männer die Runde gemacht. Über sie und das Mysterium, das sie in den finsteren Wäldern Brandenburgs angeblich versteckt hatten. Knappen und Novizen hatten sich abends am Feuer Geschichten darüber erzählt und dabei nicht abgestoßen, sondern tief beeindruckt geklungen.
»Willst du etwa behaupten, diese Legenden seien wahr?«, brummte er nachdenklich.
Germund zuckte mit den Achseln. »Es muss etwas dran sein. Diese Äbtissin hätte sich sonst wohl kaum die Mühe gemacht, das Vermächtnis dieser Männer aufschreiben zu lassen. Man erzählt sich, es handele sich um eine Reliquie aus Jerusalem von nahezu unschätzbarem Wert. Etwas Einmaliges in der Christenheit. Doch anstatt diesen Fund der Kirche zu übergeben, wie es ihre Pflicht gewesen wäre, haben diese Templer sich der heiligen Inquisition widersetzt. Vor vier Jahren kam es zum entscheidenden Kampf, den die Ritter wohl kaum überlebt hätten, wenn der Markgraf ihnen nicht mit seinen Männern zu Hilfe geeilt wäre. Wie es heißt, ist Waldemar von Brandenburg selbst hinter der Reliquie her gewesen, wie vor ihm schon König Philipp IV. von Frankreich, der den Templerorden vernichtet hat. Doch keiner von ihnen hat sie je gefunden.«
Jakobus von Hahnheim begab sich zum Fenster und starrte in den strömenden Regen, der den Klosterhof unter ihm in eine schlammige Dunggrube verwandelte. Wenn selbst ein so spröder Mann wie der Markgraf diese Gerüchte für bare Münze hielt, waren sie vielleicht doch mehr als törichtes Gerede. Ihm fiel ein, dass die Männer, von denen das alte Pergament berichtete, seit ihrer Flucht vom Tempelhof als verschollen galten. Ihr Schicksal berührte ihn wenig, doch dass sich mit ihnen auch die in der Schrift erwähnte Reliquie in Luft aufgelöst hatte, bedauerte er zutiefst. Er atmete tief durch. Was, wenn das kostbare Stück doch nicht für immer verloren war und wenn ihm durch den Brief an diese Äbtissin der Schlüssel zu seinem Geheimnis in die Hände gefallen war? Schon die Vorstellung, durch den Besitz der Templerreliquie Macht und Einfluss zu gewinnen, zauberte ein erregendes Prickeln auf seine von Wind und Wetter gegerbte Haut, ein Gefühl, das er schon seit seiner Jugend nicht mehr gehabt hatte. Geistliche wie weltliche Würdenträger würden sich um seine Gunst bemühen und ihm helfen, zum Großmeister seines Ordens aufzusteigen, vielleicht sogar selbst Bischof zu werden. Oder die nächste Papstwahl für sich zu entscheiden. Die Päpste, die er kannte, waren schwach. Seit sie nicht mehr in Rom, sondern im Einflussbereich des französischen Königs zu Avignon residierten, ließen sie sich benutzen wie Wachspuppen. Er, Jakobus, würde das ändern. Mit Hilfe einer Reliquie könnte er gar zu einem neuen Kreuzzug aufrufen, um den Sarazenen die Stadt Christi wieder zu entreißen. Dies würde seinen Ruhm mehren und ihn in den Augen der Nachwelt unsterblich machen.
Misstrauisch beäugte er die Äbtissin, die wieder vor dem Holzkreuz an der Wand betete. Benedicta von Rosenfeld wusste etwas über den Verbleib der geflohenen Tempelritter, soviel stand für ihn fest. Und was sie wusste, würde er aus ihr herausholen, auch wenn dies nicht dem Auftrag entsprach, den er von seinem Orden erhalten hatte. Aber wen scherte schon ein Frauenkloster mit einem Bauerndorf und ein paar läppischen Weinbergen, wenn es für seinen Orden viel mehr zu gewinnen gab? Die Templer waren arrogant gewesen, nie hatten sie sich dem Johanniterorden gegenüber rücksichtsvoll verhalten. Also war es gewiss kein Fehler, sich nebst ihren Besitzungen auch noch das letzte Stück anzueignen, das sie zu schützen versuchten.
»Du solltest weiterlesen, Bruder Jakobus«, unterbrach Germunds Stimme seine Überlegung. »Gewiss finden wir in den Briefen an die Äbtissin Hinweise darauf, was diese Leute vorhaben!«
Jakobus nickte finster. Während Germund unter Benedictas Protest fortfuhr, ihr Pult zu untersuchen, wandte er seine Aufmerksamkeit dem nächsten Schreiben zu, einem kurzen Brief, von ungelenker Hand geschrieben, welcher der Äbtissin vermutlich erst kurz vor Ankunft der Johanniter zugestellt worden war. Beim Überfliegen der Zeilen weiteten sich seine Augen. »Jetzt habe ich Euch, verruchtes Weib!«, keuchte er. »Kein Wunder, dass Ihr Euch plötzlich so gefügig zeigt!« Anklagend hielt der Ordensbruder Benedicta von Rosenfeld das Schreiben vor die Nase. »In diesem Brief fordert Euch Euer ehemaliger Schutzherr, der Templer Otto von Alzey, auf, einem Boten einen Gegenstand von großem Wert auszuhändigen. Wollt Ihr den genauen Wortlaut hören? Es sei an der Zeit, heißt es hier, den einst so mächtigen Orden, der durch die Sünde zweier Männer zu Boden getreten wurde, nun wiederauferstehen und blühen zu lassen.« Er hob streng den Blick. »Sie wollen den Orden wiederbegründen, trotz des Verbots des Papstes. Das ist Verrat, werte Äbtissin! Hochverrat und Ketzerei. Sobald dieser Brief der päpstlichen Kurie in Avignon vorliegt, wird man Euch aus dem Kloster holen und in den Kerker werfen! Dort wird Euch niemand zu Hilfe kommen!«
Mit ein paar knappen Worten informierte er Germund über seine Entdeckung, woraufhin der stämmige Ordensritter der am ganzen Leib zitternden Benedicta einen geringschätzigen Blick zuwarf. »Es sieht nicht gut für Euch aus, ehrwürdige Äbtissin!«
»Ich bin bereit … zu sterben«, flüsterte Benedicta von Rosenfeld um Haltung bemüht.
Germund verschwand aus der Kammer, kehrte aber nur wenige Augenblicke später mit zwei blutjungen Klosterschwestern zurück, die er grob über die Türschwelle stieß. »Sind diese Novizinnen auch bereit, für Euch ins Feuer zu gehen?«, herrschte er Benedicta an, ohne dabei die Stimme zu erheben. »Sie stammen aus adeligen Familien der Umgebung, nicht wahr? Bei einem Prozess würde auch untersucht werden, ob nicht nur sie, sondern auch ihre Väter und Brüder heimliche Verbindungen zu den Templern unterhalten. Das wäre ihr Ruin.«
Eines der Mädchen versuchte sich zappelnd aus Germunds Griff zu befreien, was ihr jedoch misslang.
»Ihr könnt Euer Kloster nur retten, wenn Ihr Bruder Jakobus diesen Gegenstand aushändigt, von dem in dem Brief die Rede ist. Ihr habt ihn doch, nicht wahr?«
Die Äbtissin tauschte einen kurzen Blick mit ihren Schwestern. Den verängstigten Mädchen war anzusehen, dass sie keine Silbe von dem verstanden hatten, was der Ordensritter sagte. »Nun gut«, sagte sie müde. »Es gibt da eine Schatulle, die ich seit dem Tod der alten Äbtissin Gertrud verwahre. Darin befindet sich jedoch nur ein Teil der Reliquie.«
»Ihr lügt«, brauste Jakobus von Hahnheim auf, doch Germund legte ihm eine Hand auf den Arm und ermunterte die Frau auf diese Weise fortzufahren. Er wollte hören, was sie zu sagen hatte.
»Das Vermächtnis der sieben Templer fiel in die Hände einer Frau, die sich damals bei ihnen auf dem Brandenburger Tempelhof aufhielt. Sie hatte vor, das Land zu verlassen, doch für ein Weib ohne männlichen Schutz war dies viel zu gefährlich. Sie musste befürchten, die Reliquie nicht heil über die Grenze zu bringen, daher teilte sie sie auf und legte sie in drei Schatullen. Meine Lehrmeisterin im Kloster zu Halberstadt erhielt eine davon, die sie mir vor ihrem Tod übergab.« Die Äbtissin zuckte mit den Achseln. »Was aus den anderen Kästchen wurde, weiß ich nicht. Ich schwöre es. Und wenn ihr mich foltern würdet, könnte ich Euch doch nicht mehr darüber sagen. Nicht einmal der Name dieser Frau ist mir bekannt. Ich weiß nur, dass sie über ärztliches Wissen verfügte und mit einem der Männer vom Tempelhof sehr vertraut gewesen sein muss. Wie sonst hätte sie etwas über die Reliquie erfahren können?«
Germund strich sich über den struppigen Bart. Er schien nachzudenken. »Und nun ist jemand auf dem Weg nach Mühlen, um diesen merkwürdigen Kasten abzuholen? Das bedeutet, dass die Templer wieder aus den Erdlöchern hervorkommen, in die sie sich nach der Auflösung ihres Ordens verkrochen haben. Wir sollten uns auf die Lauer legen und den Boten abpassen, bevor …«
»Die Reliquie ist aber nicht im Kloster«, fiel die Äbtissin ihm ins Wort. Würdevoll ging sie zu den beiden Novizinnen, legte ihnen begütigend einen Arm um die Schulter und redete ihnen mit sanften Worten gut zu. Unter den erstaunten Blicken der Männer geleitete sie die beiden zur Tür und ließ sie hinaus auf den Flur treten. Erst dann drehte sie sich zu Jakobus um.
»Was habt Ihr erwartet? Dass ich etwas so Kostbares in einem Haus aufbewahre, das nur von einer Handvoll wehrloser Frauen bewohnt wird?« Sie schüttelte energisch den Kopf. »O nein. Da allgemein bekannt ist, dass das meiste Land ringsum dem Templerorden gehörte, hielt ich es für viel sicherer, die Schatulle einem Vertrauten des ehemaligen Templerpräzeptors Otto von Alzey zu übergeben. Ihr müsstet Euch also schon in die Stadt bemühen, wenn Ihr sie haben wollt.«
II.
Jakobus bestand darauf, sich sofort auf den Weg nach Alzey zu machen. Um nichts in der Welt wollte er riskieren, dass der Bote der Templer ihm auf der Suche nach der Reliquie zuvorkam. Hielt er das kostbare Stück erst einmal in Händen, würde er es Germund überlassen, sich um den Burschen zu kümmern. Um seiner habhaft zu werden, genügte es, das Haus im Auge zu behalten, welches die Äbtissin ihm beschrieben hatte. Früher oder später würde der Mann dort auftauchen, und unter der Folter würde er ihnen schon verraten, in wessen Auftrag er nach Alzey gesandt worden war und wo sich seine Auftraggeber aufhielten. Jakobus musste sie mundtot machen. Jeden von ihnen. Bis außer ihm keiner mehr übrig war, der ihm die Reliquie streitig machen konnte.
Germund fügte sich, obwohl ihm anzusehen war, dass er es vorgezogen hätte, das Ende des Unwetters in einer Schenke bei Eintopf und heißem Würzwein abzuwarten. Doch er war lange genug bei Jakobus, um zu wissen, dass man ihm nichts abschlug. Sein Wille war Gesetz. Im Gegenzug hatte Germund aber darauf bestanden, dass die Äbtissin ihnen einen ihrer Knechte mit auf den Weg gab, der sie auf schnellstem Wege in die Stadt bringen konnte. Erleichtert darüber, die Männer rasch loszuwerden, willigte Benedicta von Rosenfeld ein. Ihre Wahl fiel auf den jungen Stallknecht, der Jakobus’ und Germunds Pferde versorgt hatte.
Die Männer ritten durch das Alzeyer Stadttor, kurz bevor dieses geschlossen wurde. Jakobus steckte einem der Torwächter eine Börse mit Silberpfennigen zu und befahl ihm, jeden Reiter, der sich der Stadt in den nächsten Stunden näherte, festzuhalten und unverzüglich zu ihm zu bringen. Dann schickte er seine Männer bis auf Germund in eine der Schenken am Marktplatz, aus denen leise Flötenmusik, ein Tamburin und der melodiöse Gesang eines Mannes zu hören war. Wie es schien, hatte sich eine Gruppe Spielleute in der kleinen Stadt eingefunden. Als der völlig durchnässte Knecht der Äbtissin sich den Ordensmännern anschließen wollte, wurde er von Germund zurückgehalten.
»Du nicht, mein Freund«, raunte er ihm ins Ohr. »Bevor du dir den Bauch vollschlägst, wirst du uns zum Haus dieses Freundes deiner Herrin führen!«
»Wie Ihr befehlt, Herr!« Der Junge verbeugte sich lustlos, schien sich jedoch ohne weiteren Widerspruch zu fügen. »Hier entlang, es ist nicht weit!«
»Und was tun wir, wenn die Äbtissin uns angelogen hat und der Templerbote sich doch zum Kloster aufmacht?« Skeptisch folgte Germund Jakobus und dem Klosterknecht stadteinwärts. Nie wäre es ihm in den Sinn gekommen, sich zu beklagen, doch durchnässt bis auf die Haut und trotz des wärmenden Mantels fröstelnd, hielt er nur widerwillig mit seinem Ordensoberen Schritt. Benedictas Stallknecht schien sich in dem Gewirr der kleinen Gässchen, in denen es so finster war, dass man kaum die Hand vor Augen sah, nicht auszukennen. Alle zehn Schritte blieb er stehen, um sich fragend umzublicken. Zudem hustete und nieste er, dass es einen erbarmte. Den Kerl würde morgen gewiss ein gehöriges Sommerfieber packen, doch wen kümmerte schon das Los eines Leibeigenen?
»Oh, sie wird es nicht wagen, mich zu hintergehen«, antwortete Jakobus grimmig lächelnd. »Schwester Benedicta ahnt, welches Schicksal ihr blüht, falls wir die Reliquie der Templer nicht finden. Ich würde sogleich zurückreiten und dieses Ketzernest mit Pechfackeln ausräuchern, darauf kannst du dich verlassen.« Entschlossen setzte er seinen Weg durch Marsch und Unrat fort, wobei er die Ratten, die um ihn herumwuselten, mit Stiefeltritten davonscheuchte. Sie hatten den kleinen Marktplatz längst hinter sich gelassen, als der Stallknecht in einer schmalen Gasse verschwand. Ein übler Geruch von Fäulnis und Mist stieg Jakobus in die Nase.
»Du willst uns doch wohl nicht ausgerechnet hier durchführen, Kerl«, sagte der Johanniter, das Gesicht verziehend. »Nie und nimmer befindet sich hier das Haus des Templers Otto von Alzey!« Sein Blick wanderte über die ärmlich wirkenden Hütten, aus denen kaum Licht auf die Straße drang. Die meisten bestanden aus Holz und waren mit Stroh gedeckt. Der Morast war noch tiefer als in der Gegend vor dem Stadttor. Es gab, soweit man sah, nur zwei Steinbauten, die über den Luxus eines teuren Schindeldaches verfügten. Beide lagen ein wenig abseits und teilten sich einen großzügigen, ummauerten Innenhof, zu dem ein Weg aus Holzbohlen führte. Das linke Haus war schlicht, das rechte besaß dafür eine Reihe spitz zulaufender Bogenfenster, die ihm einen Hauch sakraler Würde verliehen. Doch um eine Kirche handelte es sich nicht.
Germund ging als Erstem ein Licht auf. »Hier hausen Juden«, sagte er. »Das ist ihr Bethaus!«
Der Junge zuckte mit den Achseln. »Es war nie die Rede davon, Euch zum Haus des Otto von Alzey zu führen. Der einstige Vorsteher der Templer von Mühlen lebt nämlich gar nicht mehr in der Stadt. Nach der Auflösung des Ordens hat er schleunigst das Weite gesucht. Keiner weiß, was aus ihm geworden ist.« Er zeigte auf das der Synagoge benachbarte Haus. »Dort müsst Ihr suchen, beim Pfandleiher Gänslein. Den Juden hat meine Herrin ins Vertrauen gezogen.«
Jakobus von Hahnheim verdrehte die Augen, womit er zu erkennen gab, dass er von der Frau kaum etwas anderes erwartet hatte, als sich mit diesem gottlosen Volk gemein zu machen. Anders als in Worms, Mainz oder Speyer, wo es bedeutende jüdische Gemeinden gab, lebte in Alzey nur eine Handvoll Juden, die, gemessen am Zustand ihrer Gasse, ein ärmliches Leben zu fristen schienen. Vermutlich war dieser Gänslein ihr Vorsteher.
Jakobus durchquerte den Hof und hielt auf den schmalen Eingang zu. Die Fenster zur Gasse waren dunkel, auch drang kein Rauch aus dem Schornstein ins Freie. Jakobus hoffte, dass der Vogel nicht rechtzeitig gewarnt worden und ausgeflogen war.
»Ist es das? Wohnt der Kerl hier?« An die Haustür hatte jemand mit ungelenken Strichen das Konterfei eines Mannes mit spitzem Hut, Ziegenbart und langem Schnabel gezeichnet, woraus zu schließen war, dass sich Gänslein in der Stadt keiner großen Beliebtheit erfreut. Doch gab es im Reich einen Ort, an dem Juden geschätzt wurden? Kaum. Sie galten als Fremde, denen der Vorwurf anhaftete, den Kreuzestod des Heilands verschuldet zu haben und an sonderbaren Ritualen festzuhalten. In den Tavernen raunte man, dabei würde das Blut unschuldiger Kinder vergossen werden.
Es sieht den Templern ähnlich, mit Juden zu paktieren, dachte Jakobus verächtlich. Im Heiligen Land hatten sie sich sogar mit den Sarazenen oft besser verstanden als mit den Angehörigen anderer christlicher Ritterorden.
»Warum dauert das so lange?«, knurrte Jakobus, als nach einer gefühlten Ewigkeit jemand auf sein Klopfen reagierte und zur Tür kam. Vor ihm stand ein mittelgroßer Mann mit schiefen Schultern und einem müden Blick, der eine Lampe in der Hand hielt. Ihr Schein fiel auf Jakobus’ Gesicht und blendete seine Augen. Ehe der Mann im Haus ein Wort sagen konnte, wurde er auch schon von Germund mit einem Stoß gegen die Brust ins Innere des Hauses befördert. Krachend flog die Tür auf, und die beiden Ordensritter drangen ein, als besäßen sie jedes Recht dazu, sich Zutritt zu verschaffen. Der Knecht der Äbtissin folgte ihnen neugierig.
»Aber … ich bitte Euch!«, stammelte der Mann mit der Lampe aufgeregt, als die Männer durch die Stube stapften, die ihm offensichtlich nicht nur als Wohnung, sondern auch als Lager für Trödel und Pfänder jeglicher Art diente. Sein Alter war schwer zu schätzen. Er mochte vierzig, vielleicht aber auch schon fünfzig Jahre alt sein. Sein Gesicht war nicht nur faltig wie ein gepflügter Acker, sondern auch von hässlichen Narben entstellt, und unter dem spitzen Hut, den er tief in die Stirn gezogen hatte, quoll ein Nest aus wirrem, weißem Haar hervor. Das Bärtchen am Kinn ließ das Gesicht des Mannes lang und hager wirken. Sein Erscheinungsbild entsprach bis ins Detail der Spottzeichnung an der Tür.
»Du bist also der Jude Gänslein und mit der Äbtissin des Klosters Mühlen bekannt?« Germund stellte diese Frage, während Jakobus’ Blicke abschätzend über den Trödel glitten.
Der Mann rieb sich nervös die Hände.
»Nun, Alter, hast du deine Zunge verschluckt?« Jakobus konnte den Drang, den Krämer am Kragen zu packen, nur mühsam unterdrücken. Allein um nicht unnötig Zeit zu verschwenden, zügelte er sein Temperament. Er hatte nicht die Absicht, mehr Zeit als nötig in dieser muffigen Stube zu verbringen, denn wenn er eines nicht leiden mochte, so war dies Unordnung. Unordnung kam gleich nach Schmutz, und Schmutz, soviel hatte Jakobus während seiner Zeit im Orient gelernt, verursachte Krankheit.
»Wir kommen vom Kloster Mühlen«, sagte Germund mit einem Lächeln, das nicht zu der Kälte passte, die in seinen Augen lag. »Die ehrwürdige Äbtissin hat uns anvertraut, dass du einen gewissen Gegenstand aufbewahrst. Eine Schatulle, deren Inhalt einst unseren Freunden und Ordensbrüdern, den Tempelrittern gehörte.«
Er sah sich aufmerksam in dem nur schwach beleuchteten Raum um und stellte überrascht fest, dass er um ein Vielfaches größer war, als es von außen betrachtet den Anschein gehabt hatte. Von dem halbdunklen Lager, in dem neben einem wuchtigen Rechentisch nur noch eine Anzahl Fässer und Kisten stand, gingen drei Gänge ab, die in weitere Lagerräume mündeten. Darin breitete sich ein wahres Labyrinth aus finsteren Nischen und Winkeln aus, die teilweise hinter Vorhängen und Wandteppichen verborgen, zum Teil aber auch offen einsehbar waren. Hinzu kam ein Dickicht aus Stützbalken und dicken, mit Schnitzereien verzierten Pfeilern. Im Holz der Stützbalken steckten Eisennägel, an denen Kettenpanzer, Zaumzeug, Tongeschirr und Kräuterbündel hingen. Überall konnte man Wein- und Ölkrüge entdecken. Von den Vorräten konnte der Jude wochenlang, vielleicht sogar einige Monate lang leben, ohne vor die Tür treten zu müssen.
Jakobus hob ungeduldig den Zeigefinger. »Ich hoffe für dich, dass du weißt, wovon ich rede! Also rücke das Pfand heraus, bevor mein Freund sich vergisst und deinem Gedächtnis mit dem Schwert auf die Sprünge hilft!«
Der Mann schien einen Moment nachzudenken, dann warf er die Arme in die Luft und stieß einen Seufzer der Erleichterung aus. »Also, wenn die ehrwürdige Äbtissin Benedicta Euch zu mir schickt, habe ich keinerlei Einwände, Euch das Gewünschte auszuhändigen. Im Vertrauen, sie hat mich schon vor einiger Zeit darauf vorbereitet, dass mich jemand wegen dieses … äh … Gegenstands aufsuchen würde.« Er kicherte. »Nun, mit zwei frommen Ordensrittern hätte ich aber nicht gerechnet.«
»Was du nicht sagst«, erwiderte Germund. »Dann sind wir froh, dich heute von dieser Last befreien zu können.«
Flink raffte der Jude sein Gewand, huschte zu einem Wandregal, das vom Fußboden bis zum Deckengebälk mit Trödel gefüllt war, und fing an, sich durch einen Berg von Schüsseln, Krügen, Beuteln und Kästchen zu arbeiten.
»Na, na, wo habe ich es nur hingelegt? Ich kann mich noch gut an die Schatulle erinnern. Sie war mit Perlen und Smaragden besetzt. Ein Pfand des edlen Grafen von Leiningen.« Mit dem Ellbogen stieß er einen Topf vom Regal, der klirrend auf dem Fußboden zersprang. Scherben flogen, klebriges Öl rann über den Fußboden. »Ja, ich erinnere mich. War zur Verlobung der Tochter. Ein süßes Täubchen von sechzehn Jahren.«
Jakobus und Germund tauschten einen Blick, woraufhin letzterer den Stallknecht der Äbtissin kurzerhand aus dem Haus warf. Als er die Tür ins Schloss fallen hörte, baute sich der Johanniter vor dem Krämer auf. Unvermittelt schnellte seine Hand vor und packte ihn an der Gurgel. »Ich gebe dir noch Zeit für ein Paternoster, du ungläubiger Hund«, flüsterte er ihm ins Ohr. »Wenn du die Reliquie bis dahin nicht gefunden hast, zerquetsche ich dich wie eine Made.«
Jakobus von Hahnheim wollte soeben einwerfen, dass dem Krämer gewiss kein christliches Gebet über die Lippen kommen würde, als das Geräusch einer zuschlagenden Tür in seinem Rücken ihn zusammenzucken ließ. Er wirbelte herum und sah zu seiner Überraschung, dass Benedictas Stallknecht zurückgekehrt war. Der Junge hielt ein Schwert in der Hand, mit dem er in Germunds Richtung zeigte.
»Was zum Teufel suchst du schon wieder hier und woher hast du dieses Schwert?«, brüllte Jakobus den Knecht an, während seine Hand hinab zum Schwertgut wanderte. »Germund, worauf wartest du? Nimm diesem erbärmlichen Bauernlümmel die Waffe ab!«
»Ich hätte meinem Bauchgefühl vertrauen sollen«, knurrte der bärtige Ordensritter. »Dieser Bursche kam mir doch schon im Klosterhof verdächtig vor.«
Der junge Mann wischte sich mit dem Handrücken das nasse blonde Haar aus der Stirn. »Ihr irrt Euch nicht, Germund. Wir hatten vor zwei Jahren am Hof des Markgrafen Waldemar von Brandenburg das Vergnügen, und ich muss gestehen, dass ich ein wenig enttäuscht darüber bin, wie lange Ihr gebraucht habt, um darauf zu kommen. Damals, zu Allerseelen, erhielt ich mit fünf weiteren Knappen meinen Ritterschlag, was einigen der anwesenden Herren sauer aufgestoßen ist.« Er deutete eine Verbeugung an. »Wenn ich mich richtig erinnere, war Euch meine Abkunft nicht edel genug.«
Der bärtige Johanniter spie aus, womit er seine Verachtung für den blondgelockten jungen Mann zum Ausdruck brachte. An Jakobus gewandt, erklärte er: »Ein namenloser Bauerntölpel, der von Templern aufgezogen wurde. Dass Waldemar von Brandenburg einen Bastard wie ihn gegen jedes Recht in den Ritterstand erhoben hat, ist eine Frechheit. Warum er es getan hat, liegt für mich aber klar auf der Hand.«
»Tatsächlich?«, fragte Jakobus irritiert. Das Gefühl, blindlings in eine Falle getappt zu sein, wuchs von Augenblick zu Augenblick, und am liebsten hätte er sein Schwert gezogen, um dem angeblichen Klosterleibeigenen damit den Schädel zu spalten. Doch wenn dieser tatsächlich zu Markgraf Waldemars Gefolgsleuten gehörte, konnte er ihn nicht einfach erschlagen wie einen rechtlosen Vagabunden.
Germund schnaubte. »Wenn Waldemar Burschen wie den Namenlosen unter seinen Rittern duldet, dann doch wohl nur, weil er hofft, durch ihn an das zu kommen, was wir auch suchen.«
»Oh, keine Sorge«, sagte der junge Mann spöttisch. »Inzwischen trage ich einen hübschen neuen Namen, den mein Herr, der Markgraf, sogar urkundlich bestätigt hat. Man nennt mich Primus von Tempelhof, nach der Komturei, die dem Templerorden entrissen und Eurem Orden übergeben wurde. Klingt gut, nicht wahr?«
»Macht sich gut auf einem Grabstein«, erwiderte Germund höhnisch. »Aber für mich bist und bleibst du ein Ketzerknecht, den ich zur Hölle schicken werde.«
Germund ließ den Juden los, zog sein Schwert und machte ein paar Schritte auf den jungen Mann am Eingang zu. Auch Jakobus wollte seine Waffe aus der Scheide ziehen, doch da spürte er ganz plötzlich kaltes Metall an seiner Kehle. Es war eine Klinge. Erschrocken versteiften sich seine Glieder, und er verwünschte seine Nachlässigkeit. Der Wortwechsel zwischen Germund und diesem Primus an der Tür hatte ihn von dem Krämer abgelenkt. Dieser schien in seinem Trödel einen Dolch gefunden zu haben, mit dem er ihn nun bedrohte.
»Wie … kannst du es wagen, einen ehrbaren Ritter des Johanniterordens mit einer Waffe zu bedrohen«, stammelte Jakobus heiser. »Dafür lasse ich dich … aufs Rad flechten!«
Eine Antwort folgte mit einem kräftigen Tritt in den Rücken, der ihn wenig elegant zu Boden beförderte. Als er sich mit zornrotem Gesicht umwandte, bemerkte er fassungslos, wie der vermeintliche Krämer listig lächelnd hinter ihm stand. Mit ein paar Handgriffen entledigte sich der Mann seines Kinnbartes. Mit dem spitzen Hut zog er auch eine Perücke vom Kopf.
»Wer bei allen Teufeln bist du?«, keuchte Jakobus, während er fassungslos die Verwandlung beobachtete, die sich direkt vor seinen Augen vollzog.
III.
FRANKREICH, GUTSHOF DES BALTHASAR DE GROS, SOMMER 1318
Ich fürchte, Ihr seid heute nicht ganz bei der Sache, meine Liebe. Wir wollen noch einmal von vorn beginnen. An wie viele Heilige erinnert Ihr Euch und wie lauten die sieben Todsünden?« Die Stimme des Mönchs klang an diesem Nachmittag noch lustloser als sonst. Kein Wunder also, dass Priscas Gedanken bald abschweiften. Gelangweilt schaute sie aus dem Fenster und ließ die zauberhafte hügelige Landschaft auf sich wirken. Sie verspürte eine starke Sehnsucht, sich die Schuhe von den Füßen zu streifen, die Kammer zu verlassen und mit gerafftem Kleid in den Bach zu steigen, der direkt am Gut vorbeifloss. Welch eine Zeitverschwendung, bei diesem Wetter in einer muffigen Stube zu sitzen und in Gegenwart eines Mönchs, den sie ohnehin nur schwer verstand, mit Fragen des Glaubens traktiert zu werden. Unglücklicherweise hatte Balthasar de Gros, dessen Gastfreundschaft sie genoss, darauf bestanden, sie mit dem christlichen Glauben vertraut zu machen. Mehr noch, er hatte ihr unmissverständlich klargemacht, dass er sie unter seinem Dach nur dulden würde, wenn sie dem Glauben ihrer Mutter abschwor und den seinen annahm. Den langweiligen Mönch, der aus einem Kloster in der Nähe stammte, bezahlte er großzügig für den Unterricht, aber auch dafür, dass er den Mund hielt und nicht zu viele Fragen stellte.
Der korpulente Mann wartete nicht mehr auf ihre Antwort. Längst waren ihm die Augen zugefallen, was jedoch nicht nur an der brütenden Nachmittagshitze lag, die unerbittlich durch das Fenster drang, sondern auch an der halben Hammelkeule und dem Krug Wein, mit dem sich der fromme Mann über Priscas Begriffsstutzigkeit hinwegtröstete.
Prisca räusperte sich, aber der Mönch rührte sich nicht einmal, als eine Fliege auf seinem glänzenden Schädel landete. Sein leises Schnarchen erklärte den Unterricht für heute für beendet. Prisca war dies sehr recht. Sie hatte sich in das Unvermeidliche gefügt, um den alten Gutsherrn nicht noch mehr gegen sich aufzubringen. Als sie an seine Tür geklopft und ihm nach einigem Zögern eröffnet hatte, was sie, eine fremde, mittellose Jüdin, zu ihm führte, war er nicht gerade begeistert gewesen. Sie rechnete es ihm jedoch hoch an, dass er sie trotz seiner Vorbehalte nicht davongejagt hatte.
Hätte er ihr damals die Tür gewiesen, wäre sie verhungert oder als Hure in einem Dirnenhaus geendet. So aber besaß sie wenigstens ein Dach über dem Kopf. Sie bekam genug zu essen und hatte mit der Zeit sogar gelernt, sich in der okzitanischen Mundart ihres Gastgebers verständlich zu machen. Die Menschen auf Balthasars Gut hatten ihr viel beigebracht und niemals die Geduld verloren, wenn sie mit Händen und Füßen neue Fragen gestellt hatte.
Ganz allgemein schätzte man sie, sowohl auf dem Besitz des Alten als auch in den Dörfern der Umgebung, weil sie sich nicht zu fein war, bei der Geburt eines Kalbes zu helfen oder mit den Dienstmägden über die Anwendung verschiedener Gewürze und Heilkräuter zu diskutieren.
Prisca beschloss, den Mönch schlafen zu lassen und währenddessen ein wenig Abkühlung am Bach zu suchen. Die Gelegenheit war günstig, denn Balthasar hatte gleich nach Sonnenaufgang für sich und seine Tochter Adaliz Pferde satteln lassen. Wohin die beiden so früh aufgebrochen waren, war ihr Geheimnis geblieben, doch Prisca vermutete, dass Vater und Tochter spät nach Hause zurückkehren würden. So lange sie fort waren, konnte sie tun und lassen, was sie wollte.
Prisca umrundete den Donjon, einen trutzigen Rundturm, in dem die Familie des Grundherrn ihre Gemächer hatte, und schlug den Weg hinab zum Tor des Gutshofes ein. Sie mochte den Turm nicht. Vielleicht, weil es ihr nur dann erlaubt wurde, ihn zu betreten, wenn Balthasar sie zu sich befahl, um ihr ins Gewissen zu reden. Er hasste es, wenn sie sich mit dem Gesinde abgab, und hegte zudem den Verdacht, dass sie ihre Taufe mit Absicht hinauszögerte. Der Mönch, der ihm wöchentlich über ihre Fortschritte Bericht erstattete, musste ihm längst mitgeteilt haben, wie schwer von Begriff sie war, wenn es um die Vermittlung einfacher kirchlicher Dogmen ging, und dass noch viel Zeit vergehen würde, bevor er sie taufen konnte. Prisca wiederum vermutete, dass der Klosterbruder selbst es damit gar nicht so eilig hatte, immerhin genoss er die Besuche auf dem Gut. Hier bekam er eine weitaus bessere Verpflegung als im Dorf oder in seiner Abtei.
Ohne Eile schlenderte Prisca den mit Wildblumen bewachsenen Hügel zum Bach hinunter und überquerte die schmale Brücke, die über das munter plätschernde Wasser führte. Vom anderen Ufer aus genoss sie den wunderbaren Ausblick über die schier endlosen Felder und Wiesen, auf denen Schafe weideten, und atmete den Duft von Lavendel und anderen Kräutern ein, welche sie lange nur dem Namen nach gekannt hatte. Sie pflückte einige Blätter und schnupperte vorsichtig an ihnen, wie sie es schon als Kind bei Ausflügen über die Rheinauen bei ihrer Vaterstadt Speyer an der Hand ihrer Mutter getan hatte. Dabei überkam sie ein so tiefes Gefühl von Traurigkeit und Verlust, dass sie die Pflanzen sogleich wieder fallen ließ. Ihre Gedanken wanderten zu ihrem Vater, der auf diesem Gutsbesitz geboren und aufgewachsen war. Sie versuchte sich vorzustellen, wie er als Junge über die Felder galoppiert war oder sich an heißen Tagen im kühlen Bach erfrischt hatte. Hatte er Freunde gehabt, Spielgefährten? Hatte ihn sein Vater zum Jagen und Fischen mitgenommen und ihm das Bogenschießen beigebracht? Wie schwer war es doch, sich ein Bild von dem Mann zu machen, den sie nur so kurz gekannt hatte. Sie war ihm in Speyer begegnet, ihrer Geburtsstadt, wohin er sich schwer verwundet und von Fieber geschüttelt geschleppt hatte, um sie zu sehen. In einer verschlossenen Kammer hatte sie ihn gepflegt, und die Erinnerung an die Stunden, die sie neben seinem Lager gesessen hatte, waren ihr bis heute heilig geblieben. Ihr Vater war ein kräftiger, energischer Mann gewesen, und doch musste er geahnt haben, dass er Speyer nicht mehr lebendig verlassen würde. Daher hatte er sie, seine so lange verleugnete und verheimlichte Tochter, nach und nach in all seine Geheimnisse eingeweiht. Sein Erscheinen hatte ihr Leben nachhaltig verändert, und sie hatte es zugelassen, verändert zu werden. Zuletzt hatte er ihr auch von diesem Gut und der Familie erzählt, die es bewirtschaftete. Noch kurz vor seinem Tod hatte er ihr geraten, sich dorthin durchzuschlagen, falls sie jemals auf der Suche nach einem sicheren Ort sein sollte.
Ja, einen sicheren Ort brauchte Prisca in der Tat. Nach Speyer, wo inzwischen jeder über sie Bescheid wusste, konnte sie nicht wieder zurück. Hier, in der Einsamkeit dieses Besitzes, fragte niemand nach ihr – weder die Waffengefährten ihres Vaters noch der König von Frankreich. Für sie war Prisca längst der Vergessenheit anheimgefallen, und die einzige Frage, die sie sich heute noch stellte, war, ob ausgerechnet Balthasars Turm inmitten der Felder und unter der heißen südfranzösischen Sonne sie vor traurigen Erinnerungen beschützen konnte.
Tief in Gedanken versunken suchte sich Prisca einen flachen Findling, auf dem sie sich für ein Weilchen niederlassen konnte, und starrte dann auf die dichten Brombeerhecken, die das Gut von den ersten Häusern des nahen Bauerndorfs trennten. Versteckt unter den dornigen Ranken befand sich ein fast mannshoher, behauener Block aus Sandstein, der sie fast magisch anzog, seit sie ihn beim Umherstreifen zufällig entdeckt hatte. Er war von Wind und Wetter schwer geschädigt worden und um fast ein Drittel seiner Größe in den Erdboden eingegraben, doch noch immer ließen sich auf der Vorderseite zwei mit Geschick eingemeißelte Köpfe erkennen und darunter einige verwitterte Schriftzeichen, die Prisca allerdings nicht entziffern konnte. Sooft sie den Stein betrachtete, musste Prisca an den jüdischen Friedhof ihrer Vaterstadt denken, auf dem ähnlich uralte und verwitterte Grabmäler standen. Dieser Stein schien jedoch noch um einiges älter zu sein. Außerdem war die Beschriftung nicht Hebräisch. Und überhaupt gab es, soweit Prisca wusste, in dieser Gegend weit und breit keine Juden. Der verstorbene König Philipp von Frankreich, der von manchen auch »der Schöne« genannt worden war, hatte die jüdischen Kaufleute seines Landes bereits vor mehr als zwölf Jahren vertrieben, nachdem er sich ihr Vermögen unter den Nagel gerissen hatte. Damals war Prisca noch ein Kind gewesen, dennoch erinnerte sie sich noch ganz deutlich an die Empörung, welche die Berichte davon unter den Bewohnern ihres Viertels hervorgerufen hatten. Doch das jüdische Vermögen hatte dem schönen Philipp nicht lange genügt. Als seine Staatskasse wieder leer gewesen war, hatte er die Hand nach dem Reichtum des Templerordens ausgestreckt, dessen Hauptquartier in Paris gewesen war. Im Morgengrauen eines nebligen Oktobertages waren die Soldaten des Königs überfallartig in die Templerburg eingedrungen, hatten die überraschten Ritter überwältigt und den Großmeister in Ketten gelegt. Philipp hatte einen Vorwand für sein Handeln gebraucht, denn die Templer zählten nicht nur zu den wohlhabendsten, sondern auch zu den einflussreichsten Ritterorden und unterstanden allein der Gerichtsbarkeit des Papstes. Doch dem verschlagenen König fiel es nicht schwer, in Windeseile Gerüchte in Umlauf zu bringen, welche die gefangenen Ritter in die Nähe von Ketzern und Teufelsanbetern rückten. Keine Anschuldigung war ihm zu billig, kein Vorwurf zu unglaubwürdig, um ihn nicht gegen die Templer zur Sprache bringen zu lassen. Papst Clemens V., der eigentlich hätte wissen müssen, dass die Prozesse die reinste Farce waren, hatte dem König nicht widersprochen und zuletzt gar die Auflösung des einst ruhmreichen Ordens sowie die Beschlagnahmung seiner Güter angeordnet.
Prisca versuchte sich vorzustellen, wie die Familie ihres Vaters es aufgenommen hatte, als sie von der Verdammung des Ordens erfahren hatte. Waren die Schergen des Königs auch hier gewesen, um nach ihm zu suchen? Zweifellos war ein diesbezüglicher Befehl erlassen worden, denn ihr Vater hatte dem Orden nicht nur als einfacher Ritter angehört, sondern war in den Monaten vor dem Untergang ein Vertrauter des letzten Großmeisters gewesen. Einer, der von Geheimnissen wusste, und das konnte dem König in seiner Gier nach Gold kaum verborgen geblieben sein.
Zu Priscas Bedauern gab es jedoch keinen Menschen, der es wagte, mit ihr über ihren Vater zu sprechen. Wie es schien, hatte der alte Balthasar jegliche Erinnerung an ihn tilgen lassen. Weder in der Dorfkirche noch im nahen Zisterzienserkloster wurden für den Verstorbenen Seelenmessen gelesen, und falls es sich doch einmal einer der Bediensteten einfallen ließ, den Ritter zu erwähnen, bezahlte er diesen Fehler mit einer Nacht am Pranger.
»Besser du merkst dir gleich, dass wir nicht an diese Zeiten erinnert werden wollen«, hatte der alte Balthasar Prisca nach ihrer Ankunft auf dem Gut ermahnt. »Die Templer und ihr Orden sind Vergangenheit, und über Vergangenes lässt man Gras wachsen. Merk dir das, Mädchen, dann kannst du hierbleiben.«
Prisca hatte sich die Worte des Alten gut eingeprägt. Balthasar de Gros war bei den Bauern, die seine Felder bestellten, als streng, aber auch gerecht bekannt. Fällte er ein Urteil, so durfte man davon ausgehen, dass er gründlich darüber nachgedacht hatte und sich an das Gesetz des Königs hielt, auch wenn dieser viele Tagesreisen von hier entfernt residierte.
Prisca stand auf, ging zu dem Stein und streckte die Hand aus, um ihn zu berühren. Wenn er doch nur reden könnte, dachte sie versonnen. Er hatte gewiss Generationen von Menschen auf diesem Land kommen und gehen sehen und würde sich bestimmt nicht weigern, ihr etwas über die Vergangenheit des Mannes zu erzählen, dessen Namen sie niemals tragen durfte.
»Nicht, meine Schöne!«
Die Stimme des Mannes, der plötzlich hinter ihr stand und ihr Handgelenk packte, war tief, klang aber angenehm. Dennoch erschrak Prisca so sehr, dass sie sogleich mit einem Aufschrei herumwirbelte, bereit, sich gegen den Burschen zu verteidigen, der sich so unvermittelt an sie herangepirscht hatte. Der Mann lachte, als er ihren verstörten Gesichtsausdruck bemerkte. Sofort ließ er ihr Gelenk los, machte einen Schritt zurück und hob beide Hände, zum Zeichen, dass er nicht vorhatte, ihr etwas anzutun.
»Ach, Ihr seid das, Albin!« Prisca atmete erleichtert auf, verzichtete aber nicht darauf, dem Mann, der plötzlich vor ihr aufgetaucht war, einen vorwurfsvollen Blick zuzuwerfen. »Darf ich fragen, warum Ihr Euch anschleicht, als wäret Ihr auf der Jagd nach Rebhühnern? Ihr habt mich fast zu Tode erschreckt!«
»Zu Tode erschreckt ist besser als zu Tode gestochen, meint Ihr nicht auch?«
Prisca hob verwirrt die Augenbrauen.
»Habt Ihr die Wespennester nicht bemerkt? Der Sandstein ist voller Risse, und dort nisten Dutzende dieser kleinen Biester. Glaubt mir, die können ziemlich angriffslustig werden, wenn sie sich gestört fühlen.« Er lächelte. »Die Erfahrung mussten mein Freund und ich als Knaben machen, als wir den alten Stein freilegten. Vor den Wespen rettete uns nur ein Sprung in den Bach, trotzdem bekam jeder von uns ein paar Stiche ab, die uns tagelang wie Aussätzige aussehen ließen. Vom Spott der Leibeigenen ganz zu schweigen. Dieses Schicksal wollte ich einer geheimnisvollen Schönen wie Euch gerne ersparen, nur deshalb hielt ich Euer Handgelenk fest.« Er verbeugte sich galant. »Ich bitte Euch um Vergebung, falls die Berührung Euch unangenehm war.«
Prisca spürte, wie ihr vor Scham das Blut in den Kopf stieg und ihre Wangen rötete. Daran war jedoch weniger Albins Berührung schuld, sondern die Tatsache, dass er schon wieder so völlig ungeniert mit ihr scherzte. Wie hatte er sie genannt? Geheimnisvolle Schöne?
Albin de Fanion war Balthasars Nachbar, wenngleich man stundenlang reiten musste, um sein Anwesen zu erreichen. Albin schien das nicht zu stören, denn er kreuzte hier auf, sooft er konnte. Er war schrecklich alt, Prisca schätzte ihn auf über dreißig Jahre, aber, wie sie zugeben musste, nicht unattraktiv. Sein haselnussbraunes Haar war voll und lockig, und der Umstand, dass es an den Schläfen einen silbernen Schimmer bekam, verlieh seinem schmalen, bartlosen Gesicht eine markante Note. Mit seinen breiten Schultern und der olivfarbenen Haut brachte er zweifellos so manche Magd dazu, ihm schmachtende Blicke nachzusenden, wenn er auf seinem Pferd durch die Dörfer ritt.
Prisca gegenüber hatte sich der Edelmann bei seinen Besuchen nie anders als taktvoll und höflich benommen, und doch hätte sie zu gern gewusst, wie Balthasar ihm ihre Anwesenheit auf dem Gut erklärt hatte. Hatte er etwa behauptet, sie sei eine neue Magd, der man keine Beachtung schenken musste? Den meisten Gutsbewohnern hier galt sie als Vertraute und Begleiterin der Edeldame Adaliz, doch die gute Kleidung, die man ihr zugestand, hob sie von einer einfachen Dienerin oder Zofe ab. Sie speiste nicht mit der Familie und wohnte nicht im Donjon, versah aber auch nicht die Pflichten einer Magd. Dass dieser Umstand Fragen aufwarf, verstand sich von selbst, und es war weiß Gott kein Wunder, dass Außenstehende wie Albin de Fanion in ihr eine rätselhafte Person sehen mussten. Eine Person, die Neugier weckte.
Gottlob war sie noch nie mit ihm alleingewesen, weswegen er ihr auch nicht mit neugierigen Fragen zusetzen konnte. Doch allein schon der Umstand, dass er sie »geheimnisvolle Schöne« genannt hatte, versetzte sie in Alarmbereitschaft.