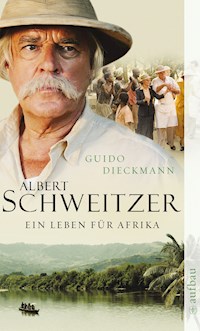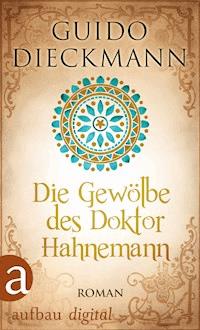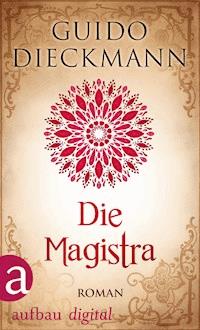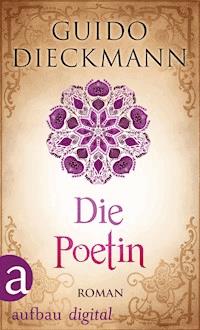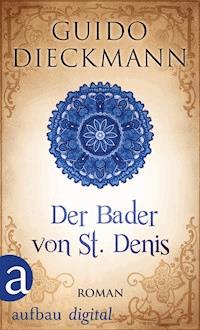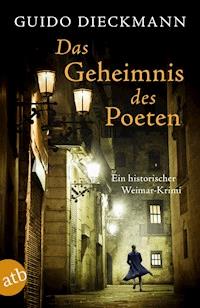7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Eine schutzlose Frau. Ihre einzige Waffe: das gedruckte Wort. Deutschland 1605: Als Tochter einer Gebrandmarkten ist die junge Henrika in ihrem Dorf Zielscheibe gehässiger Angriffe. Nachdem ihr einziger Gönner ermordet und sie der Tat verdächtigt wird, flieht das Mädchen nach Straßburg. Dort nimmt sie Johannes Carolus bei sich auf. Er ist ein «Meister der schwarzen Kunst» und hat für seine Druckerei das Privileg erworben, eine Zeitung zu gründen – die erste Zeitung der Welt. Als Nachrichtenschreiberin kämpft Henrika mit ihm gegen die mächtigen Feinde der Gazette und verliebt sich in den jungen Druckermeister Laurenz. Während die ersten Boten auf der Jagd nach Neuigkeiten durch die Lande ziehen, geraten Henrika und Laurenz immer tiefer in ein Netz aus Intrigen und Verrat. Und als der Vorwurf, Henrika sei eine Mörderin, sie auch in Straßburg einholt, bleibt ihr nur wenig Zeit, sich und Carolus' Lebenswerk vor dem Untergang zu retten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 688
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Guido Dieckmann
Die Meisterin der schwarzen Kunst
Historischer Roman
Über dieses Buch
Eine schutzlose Frau. Ihre einzige Waffe: das gedruckte Wort.
Deutschland 1605: Als Tochter einer Gebrandmarkten ist die junge Henrika in ihrem Dorf Zielscheibe gehässiger Angriffe. Nachdem ihr einziger Gönner ermordet und sie der Tat verdächtigt wird, flieht das Mädchen nach Straßburg. Dort nimmt sie Johannes Carolus bei sich auf. Er ist ein «Meister der schwarzen Kunst» und hat für seine Druckerei das Privileg erworben, eine Zeitung zu gründen – die erste Zeitung der Welt. Als Nachrichtenschreiberin kämpft Henrika mit ihm gegen die mächtigen Feinde der Gazette und verliebt sich in den jungen Druckermeister Laurenz. Während die ersten Boten auf der Jagd nach Neuigkeiten durch die Lande ziehen, geraten Henrika und Laurenz immer tiefer in ein Netz aus Intrigen und Verrat. Und als der Vorwurf, Henrika sei eine Mörderin, sie auch in Straßburg einholt, bleibt ihr nur wenig Zeit, sich und Carolus' Lebenswerk vor dem Untergang zu retten.
Vita
Guido Dieckmann, geboren 1969 in Heidelberg, arbeitete nach dem Studium der Geschichte und Anglistik als Übersetzer und Wirtschaftshistoriker. Heute zählt er als freier Schriftsteller mit seinen historischen Romanen, u.a. dem Bestseller «Luther» (2003), zu den bekanntesten Autoren dieses Genres in Deutschland. Guido Dieckmann lebt mit seiner Familie an der Deutschen Weinstraße.
Weitere Veröffentlichung:
Die Jungfrau mit dem Bogen
Prolog
In der Nähe von Heidelberg, Herbst 1590
Was du da siehst, ist nichts Natürliches. Hier darf man nicht stehen bleiben, sondern muss sehen, dass man weiterkommt und rasch ein Vaterunser betet, damit einem nichts Böses geschieht.
Wie oft hatte Hahns Mutter diese Warnung aussprechen müssen, bevor er sich dazu herabgelassen hatte, sie ernst zu nehmen? Er erinnerte sich nicht mehr, denn als junger Mensch war er einfältig genug gewesen, die Mahnungen der Älteren in den Wind zu schlagen, sie als abergläubisches Geschwätz abzutun. Nun aber, da er selbst das Alter in seinen Knochen spürte, kamen ihm die Worte seiner Mutter wieder in den Sinn, als hätten sie dort genistet und nur darauf gewartet, dass er eine Dummheit beging.
Hahn hatte genug Zeit, darüber nachzudenken, als er an diesem Abend seinen Karren über den Feldweg nach Hause schob. Es war kalt und ungemütlich, ein feiner Nieselregen durchnässte seinen Mantel. Doch nicht nur das Wetter machte ihm zu schaffen; Hahn musste höllisch aufpassen, dass kein Stück seiner kostbaren Habe verloren ging oder im Straßenschmutz landete. Das Ergebnis zäher Verhandlungen auf dem Heidelberger Markt. Verdarben Wolle und Filz, würde es in seiner Werkstatt womöglich wochenlang keine Arbeit geben.
Was du da siehst, ist nichts Natürliches. Hier darf man nicht stehen bleiben. Nicht stehen bleiben, sondern muss sehen …
Hahn versuchte die Worte aus seinen Gedanken zu vertreiben, aber es gelang ihm nicht. Dabei hatte er gar nicht die Absicht anzuhalten, wenngleich eine Ruhepause verlockend war. Bis zu seinem Heimatdorf war es noch weit, er würde sein Haus mit der kleinen Hutmacherwerkstatt vor Einbruch der Nacht nicht mehr erreichen. Aber er und sein Weib konnten doch nicht unter freiem Himmel schlafen. Schon gar nicht bei diesem unwirtlichen Wetter.
Hahn seufzte. Warum mussten ihn seine Kräfte verlassen, ausgerechnet jetzt, wo doch der Nebel immer dichter wurde? Es war schon eine ganze Weile her, dass er etwas zu sich genommen hatte, und der Wunsch nach einem Stück Braten und einem Becher heißem Würzwein wurde immer stärker.
Auf dem Karren hockte sein Neffe, der hin und wieder mit ihm und seiner Frau in die Stadt fahren durfte. Leise summend spielte der Junge mit einer Laterne. Sie spendete ein wenig Licht, doch es reichte kaum aus, um zu sehen, in welche Richtung sie eigentlich marschierten. In Kürze würde der ausgetretene Pfad nicht mehr zu erkennen sein. Hahn, dem das Gesumme des Jungen auf die Nerven ging, war versucht, ihn anzubrüllen, aber er wusste nur zu gut, dass dies keinen Sinn hatte. Der kleine Lutz war ein eigenwilliges Kind und tat nur, was ihm gefiel.
Nicht stehen bleiben, befahl er sich selber streng. Nicht stehen bleiben.
Irgendwo in seiner Nähe hörte er einen Raben krächzen. Das Tier musste sich ganz in der Nähe, auf einem der alten Bäume niedergelassen haben, die rechts und links des Weges standen.
Was du hier siehst, ist nichts Natürliches …
Solange er denken konnte, hatte Hahn den Weg über die abgeschiedenen Hügel der Herrensümpfe gemieden. Mochte man die Erzählungen der Ältesten im Dorf für bare Münze nehmen, so gab es hier draußen manche Stelle, an der das Gras selbst im Winter frisch blieb und nicht verdorrte. Dafür erfüllten grauenvolle Schreie die Nacht.
Es war ein verfluchter Ort.
Ein Ort, über den der Teufel wanderte, um einen neuen Hiob zu finden, den er quälen konnte, und vor dessen bösem Atem jeder Wanderer zu Recht gewarnt wurde.
Hahn fröstelte; im Stillen sprach er ein Vaterunser und warf, wie man es ihn als Kind gelehrt hatte, Steinchen über die linke Schulter, um Irrlichter und Dämonen zu erschrecken. Dann wandte er sich mit einem schuldbewussten Blick seiner Frau Agatha zu, die wortlos neben ihm einherschritt, den Blick auf den Boden gerichtet, um nicht über Wurzeln und Steine zu stolpern.
Hahn wollte etwas zu ihr sagen, doch er wagte es nicht, sie anzusprechen. Wenn Agatha in dieser Stimmung war, machte man besser einen Bogen um sie. Obwohl sie sich seit ihrem Aufbruch aus der Stadt nicht beklagt hatte, war ihr anzusehen, dass sie Hahn die Schuld dafür gab, bei Nacht und Nebel über den Hügel laufen zu müssen. In der Tat war es seine Idee gewesen, noch eine Schänke aufzusuchen, um sich aufzuwärmen und den Staub des Marktplatzes mit Kräuterbier hinunterzuspülen.
Auf dem Karren begann der Neffe des Hutmachers leise zu wimmern.
«Willst du dem Bengel nicht endlich die Laterne abnehmen, ehe er sie fallen lässt und den ganzen Karren in Brand steckt?», beendete Agatha Hahn ihr Schweigen. Hahn nickte. Er streichelte dem Jungen über das flachsblonde Haar und nahm ihm dann die Laterne aus der Hand.
«Wir werden das Dorf nicht vor Morgengrauen erreichen», sagte er seiner Frau. «Aber wer konnte schon ahnen, dass in Heidelberg so viel Aufregung herrschen würde? Wenn ein Galgenvogel aus seinem Kerker gezerrt und aufs Schafott getrieben wird, drängen sich die Bauern aus den umliegenden Dörfern wie eine Herde Schafe durch die Stadttore und verstopfen Plätze und Gassen, um den Malefikanten zappeln zu sehen.»
Die Hutmacherin schüttelte erbost den Kopf. «Wie scheinheilig ihr Männer doch sein könnt. War es nicht eine Büßerin, die man heute zur Richtstätte führte? Der Teufel soll ihr die Gestalt eines Engels geschenkt und sie mit ihrer hübschen Fratze zum Bösen verführt haben. Wenn sie einen Burschen gehenkt hätten, wären nicht halb so viele Schaulustige herbeigeströmt.»
Ihr Mann hütete sich, darauf etwas zu erwidern. Sie hatten inzwischen den steilen Anstieg hinter sich gebracht. Bei normalen Sichtverhältnissen wären die Lichter, die abends vor dem Dorfgatter brannten, um Wölfe abzuschrecken, bereits von weitem zu sehen gewesen. Aber wenigstens ging es nun bergab, und sie mussten sich mit dem Karren nicht mehr so schinden.
Hahn dachte an die Frau, über die Agatha gesprochen hatte. Eine Ehebrecherin, so hieß es zumindest. Gesehen hatte die Verurteilte jedoch keiner der Wirtshausbesucher, denn aus heiterem Himmel war verfügt worden, die Bestrafung an einem geheimen Ort zu vollziehen. Das war seltsam. Nicht weniger eigenartig war es aber, dass die Sünderin nicht am Galgen hatte baumeln müssen, sondern nur gebrandmarkt worden war, obwohl das Gesetz des seligen Kaisers Karl V. für Ehebruch bei Frauen durchaus härtere Strafen vorsah. Hahn fragte sich, was für ein Zeichen man der Frau ins Fleisch gebrannt haben mochte. Eine Rose mit Dornen? Eine Teufelsfratze?
«Schafft den Bösen fort aus eurer Mitte, steht in der Bibel», stieß Agatha auf einmal hervor. Sie schien gemerkt zu haben, wohin die Gedanken ihres Mannes wanderten.
«Und sondert euch ab von denen, die …»
Die Worte erstarben in ihrem Mund, als Hahn den Wollkarren mit einem Ruck zum Stehen brachte. Er packte seine Frau am Arm und wies auf eine einsame Baumgruppe, deren Wipfel trotz des Nebels noch zu sehen waren. Zwischen den Bäumen befand sich ein verfallenes Gutshaus.
«Dort unten geht etwas vor sich», flüsterte Hahn. «Ich sehe Männer mit Fackeln. Sie zerren einen Sack hinter sich her. Gott steh uns bei, der Sack bewegt sich. Bei Gott, es sieht aus, als würde ein Mensch darin stecken.»
Hahn löschte die Laterne und bedeutete seinem Neffen, sich still zu verhalten. Wer auch immer um das verlassene Haus herumstrich, er brauchte sie nicht zu sehen. So leise er konnte, schob er den Karren hinter dichtes Gestrüpp und winkte seine Frau und den Jungen zu sich. Schweigend verharrten sie dort.
Eine ganze Weile später ging die Tür plötzlich auf, und vier Gestalten verließen das Haus. Aus seinem Versteck heraus konnte Hahn sehen, dass sie dunkle Umhänge und Hüte mit breiten Krempen trugen. Nur einen Augenblick lang streifte der Schein einer Fackel das Gesicht eines der Männer. Dieser blickte sich argwöhnisch um, und für ein paar bange Sekunden verweilte sein Blick auf den Büschen, hinter denen die Hahns kauerten.
Der Hutmacher hielt die Luft an; sein Herz raste vor Aufregung. Dann aber gab der Mann im schwarzen Umhang seinen Begleitern ein Zeichen. Ohne Umschweife schwang sich die unheimliche Schar auf ihre Pferde und preschte davon, ohne sich noch einmal nach dem Haus im Wald umzublicken.
Der Spuk war vorüber.
Erleichtert atmete Hahn auf. Was auch immer die Fremden in dem alten Gutshaus zu tun gehabt hatten, es wäre sicher gefährlich gewesen, sie dabei zu stören.
«Sie haben sich davongemacht», sagte er leise. «Ich denke, wir können die Nacht in dem Haus verbringen.»
Agatha blickte ihn skeptisch an. «Mir ist nicht wohl bei der Sache, aber ein Dach über dem Kopf hätte ich schon gern. Und die Männer sahen nicht aus, als würden sie noch einmal zurückkehren.»
Das Gutshaus war größer, als Hahn angenommen hatte, befand sich aber in einem beklagenswerten Zustand. Das Schindeldach war an mehreren Stellen undicht, und da es auch keine Fensterscheiben oder Holzläden mehr gab, drang die Kälte ungehindert ins Innere. In der Wohnstube gab es einen festgemauerten Kamin, doch es war nicht möglich, ein Feuer anzuzünden; irgendetwas verstopfte den Schlot. Angeekelt betrachtete Agatha den Unrat, der überall herumlag. Ein Fest für die Ratten.
«Der Gestank ist abscheulich», beklagte sie sich. «Ich werde hier kein Auge zumachen.» Sie überließ es Hahn, den Karren zu entladen. Energisch nahm sie Lutz an der Hand und durchquerte mit ihm die Stube. Wenige Augenblicke später hörte Hahn ihren Schrei.
Erschrocken ließ er das Bündel fallen, das er soeben zu den Decken hatte legen wollen, und stürzte auf die Tür zu, durch die seine Frau verschwunden war.
Er fand Agatha in einem kleinen Raum, gleich neben der Wohnstube.
Bleich stand sie neben der Tür, den Blick starr auf den Herrgottswinkel geheftet, aus dem ein leises Wimmern und Stöhnen erklang.
Hahn machte ein paar Schritte auf den Winkel zu. Vor Angst zog sich sein Magen krampfartig zusammen. Was beim heiligen Tisch des Herrn lauerte dort drüben? Im Zwielicht erkannte er einen Berg aus zerknüllten Decken und Fellen, die einen ekelhaften Gestank von verbranntem Fleisch absonderten. Zweige und Blätter verteilten sich um das Lager.
Der kleine Lutz schien als Einziger im Raum keine Angst zu haben. Im Gegenteil, er begann plötzlich zu lachen.
«Kind», krähte der Kleine fröhlich und zeigte mit dem Finger auf die Felle. «Wie Lutz!»
Tatsächlich kam unter der Ansammlung von Decken und Fellen der Kopf eines Mädchens zum Vorschein. Voller Furcht sah sie Hahn und Agatha an. Erst als ihr Blick auf Lutz fiel, wich die Besorgnis aus ihrem kleinen Gesicht. Sie lächelte nicht, schien aber zu begreifen, dass ihr keine Gefahr drohte.
«Gott sei gedankt», entfuhr es Hahn. Auf wackeligen Beinen ging er auf das Kind zu und streckte ihm die Hand entgegen.
«Bleib zurück!», kreischte Agatha schrill.
Das Mädchen zuckte zusammen. Sie war ein wenig jünger als Lutz. Hahn schätzte sie auf etwa drei bis vier Jahre. Ihr langes Haar war wirr und strähnig, und sie roch nicht besser als die Fellstücke, mit denen sie sich zu wärmen versucht hatte. Doch die goldene Spange, die in den rotbraunen Locken des Kindes steckte, war mit winzigen Perlen besetzt und schien kostbar zu sein. Dergleichen Schmuckstücke trugen keine Bauernkinder. Und auch kein fahrendes Volk.
«Diese Männer haben sie ausgesetzt», sagte Agatha. «Das ist ein böses Omen.»
«Herzlose Schufte!»
«Ich weiß nicht recht.» Agatha näherte sich dem Kind, das inzwischen ganz unter dem Deckenberg hervorgekrochen war.
«Vielleicht hatten sie gute Gründe, das Mädchen loszuwerden. Lutz, rühr sie nicht an; bleib weg von ihr. Möglicherweise ist sie aussätzig. Es fehlte gerade noch, dass sie uns die Pest bringt.»
Lutz hatte sich im Schneidersitz auf dem Boden niedergelassen und strahlte. Er schien erfreut darüber, ein Kind entdeckt zu haben, das kleiner war als er.
Hahn runzelte die Stirn. Wer würde ein kleines Mädchen allein in einem Haus zurücklassen und danach das Weite suchen, als wäre der Teufel hinter ihm her? Natürlich geschah es alle Tage, dass Kinder ausgesetzt wurden, wenn ihre Eltern zu arm waren, um sie zu versorgen. Oder wenn es sich um die Frucht eines Fehltritts handelte, die man sich klammheimlich vom Halse schaffen wollte. Doch wenn tatsächlich einmal eine Dienstmagd schwanger wurde und ihr neugeborenes Kind aussetzte, geschah das in der Regel bald nach der Niederkunft und nicht erst Jahre später. Diese Kinder waren auch nicht so wohlgenährt, und gewiss trugen sie keine perlenbesetzten Silberspangen im Haar. Das Kleid des Kindes sah ebenfalls kostbar aus, wenngleich das dunkle Tuch feucht und am Saum gerissen war.
Ein heftiges Stöhnen holte Hahn aus seinen Gedanken. Es kam nicht aus dem Mund des Mädchens, aber unüberhörbar aus dem dunklen Winkel, in dem es gesteckt hatte. Der Hutmacher erstarrte. Agatha schrie entsetzt auf.
«Barmherziger, steh uns bei», rief sie. «Da liegt noch jemand unter den Decken. Ich habe es gewusst, das ist Teufelswerk. Du weißt doch, was man sich über diese Gegend erzählt. Lass uns verschwinden, bevor dieser Wechselbalg uns verhext.»
Das kleine Mädchen kniete sich vorsichtig neben den Decken nieder.
Unschlüssig wanderten Hahns Blicke von seiner Frau zu dem kleinen Mädchen hinüber. Er hatte nie eine Tochter gehabt, glaubte aber nicht, dass von einem derart engelsgleichen Geschöpf etwas Böses ausgehen konnte.
Und doch spürte er, wie ihm der Schweiß auf die Stirn trat.
«Alte Frau», rief Lutz da auch schon. Er klang nicht begeistert, dennoch klatschte er in die Hände.
Ein altes Weib war es nicht, das sich mit Hilfe des Mädchens mühsam aufrichtete, auch wenn ihr verzerrtes Gesicht und die wächsern wirkende Haut diesen Schluss zunächst zulassen mochten. Sie und die Kleine schienen miteinander verwandt zu sein, denn die Frau besaß das gleiche dunkle Haar. Anders als das Mädchen, das einen recht munteren Eindruck machte, war die Frau krank. Schwer krank.
Ihr Gesicht war bleich, die Wangen glühten vor Fieber, und ihre Augenlider zuckten bei der kleinsten Bewegung. Auf ihrem Kittel waren Spuren getrockneten Bluts und Asche auszumachen. Es sah aus, als wäre sie unlängst durch ein Feuer geschritten.
Die Kranke schien kaum bei Bewusstsein zu sein. Erst als das Mädchen ihr etwas ins Ohr flüsterte, schlug sie plötzlich die Augen auf und blinzelte.
«Wer ist da?», brachte sie erschöpft hervor.
«Du brauchst keine Angst zu haben», antwortete Hahn. «Ich bin Hutmacher, auf dem Heimweg von Heidelberg. Aber vielleicht solltest du meiner Frau und mir erst einmal erklären, wer du bist und warum man dich mitten in der Nacht hier draußen ablegt wie eine …»
«Vermutlich, weil sie eben eine solche ist», fiel Agatha ihrem Mann brüsk ins Wort. Mit grimmiger Miene lief sie auf die fiebernde Frau zu, stieß das kleine Mädchen unsanft zur Seite und begann sich am Kleid der Fiebernden zu schaffen zu machen. Dabei kümmerte sie sich weder um deren schwache Gegenwehr noch um das Geschrei des Mädchens.
«Was … machst du da?»
Erschüttert verfolgte Hahn, wie Agatha den Stoff über das Schulterblatt der Frau zog und einen rötlichen Fleck entblößte. Der erwies sich als entzündetes Brandmal, in dem Hahn voller Entsetzen die Konturen einer höhnisch grinsenden Teufelsfratze zu erkennen glaubte. Die Wunde sonderte einen ekelhaften Geruch ab; Spuren gelblichen Eiters verteilten sich auf der Haut. Während Hahn und Agatha das Mal anstarrten, zuckte die junge Frau zusammen und wandte schamhaft ihr Gesicht ab. Ihre Lippen zitterten.
Daran wird sie sich gewöhnen müssen, dachte Hahn bekümmert. Für den Rest ihres Lebens. Mit Gebrandmarkten ging niemand freundlich oder mitleidsvoll um. Wollte ein Gezeichneter seine Schande verbergen, musste er es geschickt anstellen. Doch im Grunde befand er sich auf der Flucht, solange er lebte. Wohin er auch kam, wies man ihm die Tür oder bewarf ihn mit Steinen und faulem Obst. Den Kindern erging es kaum besser.
«Das Weib ist die Ehebrecherin, die heute in der Stadt gerichtet wurde», verkündete Agatha triumphierend. «Darauf hätten wir eigentlich gleich kommen können. Man hat sie nach der Vollstreckung des Urteils mit Ruten aus der Stadt gejagt und hier draußen zwischen all dem stinkenden Unrat abgelegt. Abfall zu Abfall, wie es sich gehört!»
Hahn warf seiner Frau einen mahnenden Blick zu, sich in Gegenwart des Kindes zusammenzunehmen. Aber die Kleine schien ohnehin nicht verstanden zu haben, was Agatha erregte. Stumm saß sie neben der Gebrandmarkten und strich ihr sanft die schweißnassen Haare aus der Stirn.
«Ich kann sie wieder gesund machen», flüsterte sie unvermittelt. Ein zartes Lächeln glitt über ihr hübsches Gesicht, während sie den Hutmacher aus ihren dunklen Augen erwartungsvoll ansah. «Ich kann sie gesund machen, genau wie mein Kaninchen.»
Hahn ergriff die Hand des Mädchens. Sie fühlte sich warm an. «Wie ist dein Name?», fragte er. Offensichtlich fieberte das Kind und wusste nicht, was es redete. «Sag mir doch, wie du heißt!»
Das Mädchen sah ihn an. «Ich heiße Henrika Gutmeister, mein Herr.»
Ihre Ausdrucksweise überraschte den Hutmacher. Wer auch immer diese Leute sein mochten, sie waren wohlerzogen.
«Und die Frau mit dem roten Mal auf der Schulter», hakte Hahn nach. «Ist das deine Mutter?»
«Ich kann sie wieder gesund machen.»
Agatha, die ihren Mann zunächst hatte gewähren lassen, stieß nun einen Laut der Empörung aus. «Was bezweckst du mit all diesen Fragen?», rief sie. «Merkst du nicht, dass dich der Teufelsbraten zum Narren hält?» Sie machte einen Schritt auf das Kind zu und drohte ihm mit dem Zeigefinger. «Lasterhafte Reden kosten dich die Gunst des Herrn. Nur Gott kann Menschen gesund machen. In seiner Weisheit heilt er diejenigen, die ein braves Leben führen und die, mit denen er noch Großes hier auf Erden vorhat. Deine Mutter gehört weder zu den einen noch zu den anderen.»
Die Kranke rang mühsam nach Atem. Ihre Augen waren geschlossen bis auf einen winzigen Spalt, durch den sie ihre Tochter zu beobachten schien. Zweifellos hatte sie Agathas Ausbruch mit angehört.
«Wir werden dich und deine Mutter mit zu uns nach Hause nehmen», verkündete Hahn und staunte dabei selbst über seine Worte. Es war ihm völlig gleichgültig, was seine Frau dachte oder sagte. Dieses eine Mal würde er nicht nachgeben.
«Habe ich dich richtig verstanden? Du willst dieses geschundene Pack mit ins Dorf nehmen?» Angriffslustig stemmte Agatha die Hände in die Hüften und funkelte ihn wütend an. «Ich fürchte, mein lieber Hahn, dass du nun völlig den Verstand verloren hast. Niemals werde ich das zulassen. Du setzt nicht nur unseren guten Ruf aufs Spiel, sondern bringst auch unser aller Seelenheil in Gefahr!»
Hahn wollte etwas entgegnen, schwieg aber. Gewiss hätte er versuchen können, Agathas Bedenken auszuräumen, denn obwohl er die Heilige Schrift nicht annähernd so gut kannte wie sie, fiel ihm ein, dass auch der Heiland einst einer Ehebrecherin begegnet war und denjenigen aufgefordert hatte, den ersten Stein auf sie zu werfen, der ohne Sünde war. Aber da Hahn wusste, dass er bei Agatha ohnehin auf taube Ohren stoßen würde, zuckte er nur trotzig mit den Schultern.
Das Mädchen hatte sich vor dem Krankenlager seiner Mutter niedergelassen und fing an, ein Lied zu singen. Es erzählte von einem See, in dem sich wunderschöne Wesen tummelten. Kein Mensch durfte sie jemals sehen, aber sie waren da, um Gutes zu tun, wann immer ihre Hilfe gebraucht wurde. Im Lied des Mädchens versuchten die Geschöpfe des Sees den Fischern in ihren Booten etwas mitzuteilen, doch die Männer stellten sich taub oder verstanden ihre Botschaft nicht. So blieb die Kluft zwischen ihrem Reich und der Welt oberhalb der Wasseroberfläche bestehen, ohne dass sie einander berührten.
Die Melodie des Liedes klang fremdartig, jedenfalls anders als die Musik, die Hahn kannte, doch war sie gleichzeitig so rührend, dass selbst Agatha voller Staunen die Brauen hob. Hahn spürte in seinem Herzen Sehnsucht nach etwas, das er nicht benennen konnte.
Als das Mädchen die Augen schloss und die Hände auf die Stirn seiner Mutter legte, war es um Agathas Selbstbeherrschung geschehen. Sie schrie das Kind an und verlangte, es solle auf der Stelle still sein.
«Aber ich kann sie gesund machen», begehrte das Mädchen noch einmal auf.
«Und ich will nichts mehr von diesem abscheulichen Hexenkram hören!» Agatha Hahn packte die Kleine am Handgelenk und zerrte sie vom Lager der Sterbenden fort. Hahn hätte schwören mögen, dass es während des Gesangs der Kleinen im Raum wärmer geworden war und die graue Haut der Kranken einen leicht rosigen Schimmer angenommen hatte. Doch dies war wohl eine Täuschung gewesen, denn noch immer heulte draußen der Wind unbarmherzig um das alte Gemäuer. Es war finster, und über dem eingefallenen Gesicht der Gebrandmarkten lauerte ein Schatten, der von Moment zu Moment tiefer auf sie herabsank.
«Lasst mich bei ihr bleiben, ihr dürft mich nicht wegbringen», schrie das Mädchen. Ihre Stimme klang so verzweifelt, dass ein kalter Schauer über Hahns Rücken lief. «Ich bin die Einzige, die ihr helfen kann. Lasst mich mein Lied zu Ende singen.» Sie fing an zu weinen.
«Schluss jetzt, du stures Balg.» Agatha verpasste dem Kind mit der flachen Hand eine Ohrfeige. «Ich werde nicht dulden, dass du in meiner Gegenwart … Au …» Ein Tritt gegen das Bein ließ Agatha aufheulen. Doch nachdem sich ihre Verblüffung gelegt hatte, gewann der Zorn wieder die Oberhand. Zeternd schleifte sie das Kind aus der Kammer. Als die Tür unter lautem Wehgeschrei ins Schloss fiel, hob die Fremde auf dem Deckenlager hilflos den Kopf und bat Hahn mit einer schwachen Handbewegung, zu ihr zu treten.
«Sie hat nicht gelogen», erklärte sie mit gebrochener Stimme. «Henrika wurde mit besonderen Gaben geboren, auch wenn ich mir wünschte, sie hätte niemals von diesen Dingen erfahren. Wahrscheinlich ist es besser, wenn ich meinen Frieden mit Gott mache und Henrika nicht mehr an mich denkt. Aber wenn ich doch nur …» Die Fieberkrämpfe, die ihren schmächtigen Körper erbeben ließen, schienen ihr den Atem zu rauben. Sie brauchte keine Lieder von verwunschenen Seen mehr, so viel stand für Hahn fest. Mit letzter Kraft richtete sie sich auf.
«Werdet Ihr meine Tochter … von hier fortbringen?»
Hahn nickte. «Wir sind einfache Handwerker, aber bei uns im Dorf wird sie es gut haben», versprach er. Er meinte es durchaus ernst und hoffte, dass er die Frau in ihrer letzten Stunde auf Erden von dieser Sorge befreien konnte. Gleichgültig wer sie war und warum sie das Brandeisen verpasst bekommen hatte: Hahn spürte, dass er keinen schlechten Menschen vor sich hatte. Wahrscheinlich war das Leben nicht gut mit ihr umgesprungen, daher verdiente sie es, diese Welt zu verlassen, ohne sich um das Schicksal ihrer Tochter sorgen zu müssen. Gewiss würde es für das Mädchen nicht einfach werden, sich an das karge Leben im Dorf zu gewöhnen. Sie würde keine silbernen Spangen tragen, sondern das grobe Kleid einer Magd, und singen würde sie höchstens Psalmen oder fromme Lieder im täglichen Gottesdienst. Aber sie war jung, und schließlich war es besser, als über die Landstraßen zu ziehen und das Leben einer Ausgestoßenen zu führen.
«Ihr müsst es nicht aus Barmherzigkeit tun. Das würden wir nicht wollen. Nennt es Stolz und verurteilt mich für meine Anmaßung, aber für Henrikas Unterhalt werde ich aufkommen. Versteht Ihr?»
«Wer bist du, und wer ist das Mädchen?», fragte er unsicher.
«Du musst es mir jetzt sagen …»
«Einmal im Jahr werdet Ihr Geld erhalten, und zwar so lange, bis … nun, Ihr werdet sehen», wehrte die Sterbende hustend ab. «Es ist gutes Geld. Kein Hurenlohn, sondern Geld, das ihr zusteht. Henrika ist nicht schuld daran, dass sie nicht das Leben führen darf, das ich einmal für sie vorgesehen hatte …»
Hahn horchte auf. Die Gebrandmarkte wollte ihm ihren Namen nicht verraten, aber darauf kam es nicht an. Er würde es herausfinden, sobald er wieder in die Stadt kam. «Und wer wird uns das Geld zukommen lassen?», erkundigte er sich und hoffte, dass seine Frage beiläufig genug klang, um nicht den Verdacht der Habgier zu wecken. «Ich sehe hier nichts, was irgendeinen Wert besäße.»
«Einmal im Jahr, sobald der erste Markt nach dem Winter abgehalten wird, wird ein Mann neben der Heiliggeistkirche auf Euch warten und Euch einen Beutel mit Geld überreichen. Ihr müsst nichts weiter tun, als ihm erklären, dass Ihr in meinem Auftrag kommt, dann wird er keine weiteren Fragen stellen. Weder nach mir noch nach dem Kind. Allerdings … wird er auch auf keine Eurer Fragen antworten, also versucht erst gar nicht, in ihn zu dringen.» Sie atmete nun stoßweise, und ihre eingefallenen Wangen zitterten. Ein letztes Mal suchten ihre dunklen Augen seinen Blick. Hahn sah Erleichterung in ihnen. Und Frieden. Die Frau schien vor dem Tod keine Angst zu haben, und das nötigte ihm Achtung ab, hatte er doch viele fromme Menschen jammernd und klagend sterben sehen.
«Ihr dürft dem Boten niemals folgen», bat sie. «Schwört mir, dass Ihr und Eure Frau sich daran halten werden!»
Für Agatha zu schwören, war in etwa so unmöglich, wie ein festes Haus aus Mehl zu bauen. Aber der Hutmacher versprach, die Worte der Sterbenden zu beherzigen. Als er ihre Hand in der seinen erschlaffen spürte, musste er sich jedoch eingestehen, dass er Angst vor dem hatte, auf das er sich einließ.
War es Gottes Wille, dass er den letzten Wunsch der Sterbenden erfüllte, oder ein unverzeihlicher Fehler?
Als Hahn schließlich die Kammer verließ, überkam ihn die finstere Gewissheit, dass sein Leben nie wieder so sein würde wie vor dieser Nacht.
Mannheim, fünfzehn Jahre später
1. Kapitel
Im Wirtshaus «Zum Grünen Baum» gab es an Donnerstagabenden nur wenig zu tun. Nur ein paar Bauern und Handwerker saßen mit ihren Knechten im Schankraum. Sie wärmten sich am Kaminfeuer, tranken Bier und unterhielten sich leise über den zu frühen Wintereinbruch, der Eis und Schnee gebracht hatte, die neuen Zölle und die anstehenden Hausbesuche des Dorfpfarrers und seiner Gehilfen. Fast jeder der Anwesenden hatte diese Prozedur schon einmal erlebt und wusste etwas darüber zu berichten. Die Kirchendiener durchstöberten bei ihren Kontrollbesuchen rücksichtslos die Häuser und prüften anhand langer Listen, ob etwas aufbewahrt wurde, was dem Gesetz der Kirche nach verboten war.
Gegen einen Hafner war jüngst eine empfindliche Buße erhoben worden, weil die Ältesten der Gemeinde bei ihm eine Anzahl zu freizügiger Weiberröcke gefunden hatten. Dabei war der Eigenbrötler nie verheiratet gewesen. Was er damit trieb, konnte sich jeder denken. Bei seinem Nachbarn hatten sie ein Kartenspiel und drei Würfel entdeckt. Der Bauer war zwar schlau genug gewesen, die bunten Spielkarten in seiner Stube unter ein Tischbein zu klemmen, doch genutzt hatte ihm das nichts. Die Kirchendiener schienen ein untrügliches Gespür für jede Art von Versteck zu haben. Wie der Hafner musste auch der Bauer vor der versammelten Gemeinde Besserung geloben und einen empfindlichen Tadel einstecken.
Nach einer Weile wandten sich die Männer im Schankraum anderen Themen zu. Im Dorf, so erzählte ein Bauer, waren kurfürstliche Soldaten aufgetaucht. Die Männer seien bewaffnet und trieben sich in der Nähe der Zollschreiberei herum.
Darüber ärgerten sich die Dorfleute. Soldaten waren im Ort nicht besonders beliebt, gleichgültig welches Wappen ihren Harnisch zierte. Zu oft schon waren die Bauern während der letzten Jahre gezwungen gewesen, Hals über Kopf in die Wälder und Sümpfe zu fliehen, wenn bewaffnetes Kriegsvolk durch das Dorf gezogen war und eine Schneise der Verwüstung hinter sich gelassen hatte. Im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation galt zwar seit fast einem Menschenalter Religionsfrieden, doch jedermann wusste, dass der Streit der Mächtigen um den wahren Glauben sich nur eine Atempause gönnte, um danach wieder umso heftiger zu toben.
Eine Schankmagd scheuerte mit griesgrämigem Gesicht den Boden, bis dieser im Licht der einsamen Kerze, die neben dem Zinngeschirr stand, vor Sauberkeit glänzte. Die Wirtin hatte ihre Dienstboten angewiesen, heute nur eine Seite der Schankstube zu beleuchten, denn Kerzen und Lampenöl waren teuer, insbesondere im Winter. Den wenigen Zechern musste das Feuer im Kamin genügen.
Henrika Gutmeister bedachte den kleinen Schankraum mit einem liebevollen Blick. Die mit rötlichem Holz getäfelte Stube mit ihrer niedrigen Decke, der verrußte Kamin und die blauen Tonkrüge waren ihr seit der Kindheit ebenso vertraut wie der Geruch von geräuchertem Schinken, Bier, Schweiß und Kerzenwachs. In dichten Bündeln hingen getrocknete Kräuter von den Balken herab.
Sie hatte sich hier stets zu Hause gefühlt. Die Schänke war ihr Zufluchtsort gewesen, wenn sie von ihrer Ziehmutter gescholten worden war und die Spottverse der Gassenkinder sie verletzt hatten. Mit prüfendem Blick überzeugte sich Henrika, dass die Eichentische in der Stube blank gescheuert und Reste von verschüttetem Bier weggewischt worden waren. Dann wusch sie ihre Hände und rollte die Ärmel ihrer weiten Bluse sorgfältig hinunter. Vorsichtig spähte sie hinüber zu dem letzten Tisch, an dem noch getrunken wurde, aber die Männer nahmen keine Notiz von ihr. Das war auch besser so, denn sie half im Wirtshaus nur aus, um ihrer Tante einen Gefallen zu tun, nicht um den Männern des Dorfes oder deren Frauen Anlass zu geben, sich das Maul über sie zu zerreißen. Sie tat es, ohne etwas dafür zu verlangen, denn nachdem im vergangenen Winter ein Feuer in der Gaststube gewütet hatte, musste Tante Elisabeth den Gürtel enger schnallen. Die Reparaturen hatten ihre Ersparnisse verschlungen und sie darüber hinaus gezwungen, Schulden zu machen. Hinzu kamen die vom Gesetz auferlegten Einschränkungen, welche die strenge Kirchenzucht im Fürstentum verlangten. Sie waren der Grund, warum immer weniger Bauern und Reisende Lust verspürten, ein Wirtshaus aufzusuchen. Regelmäßig musste sich Elisabeth der Büttel erwehren, die sie und das Gesinde streng befragten, ihre Weinvorräte kontrollierten und ihr ins Gewissen redeten, wenn sie in einer Woche zu viel unverdünntes Bier ausgeschenkt hatte. Dazu kamen die wachsenden Abgaben und die Rechnungen der Weinhändler, der Fleischer und Bäcker. Henrika wusste, dass ihre Tante darunter litt, auch wenn sie kein Wort darüber verlor und den wenigen Gästen, die nach wie vor einkehrten, mit gleichbleibender Freundlichkeit begegnete.
«Wenn es für mich nichts mehr zu tun gibt, würde ich gerne nach Hause gehen, Tante», rief sie Elisabeth zu, die mit vor Hitze geröteten Wangen aus der Küche kam.
Elisabeth nickte ihr wohlwollend zu. «Tut mir leid, dass ich dich umsonst geholt habe, mein Kind, aber ich dachte wirklich, es wäre heute mehr los. Und seit meine Beine nicht mehr so recht wollen …»
Henrika winkte verständnisvoll ab. Sie mochte Elisabeth gut leiden und hätte ihr auch dann geholfen, wenn kein einziger Gast zu bedienen gewesen wäre. Elisabeth hatte immer zu ihr gehalten, anders als die meisten Leute im Dorf. Sie hatte niemals über Henrikas Unbeholfenheit gelacht oder ungehörige Witze über ihre Mutter gerissen. Im Gegenteil, die Wirtin hatte die Mägde zur Ordnung gerufen, die es ihr gegenüber an Achtung fehlen ließen, und den Gästen klargemacht, dass Henrika Gutmeister, ungeachtet ihrer zweifelhaften Herkunft, zu ihrer Verwandtschaft gehörte. Da Elisabeths Wort im Dorf Gewicht hatte, wagten die wenigsten, ihr zu widersprechen. So war Henrika schon früh in ihrem Leben zu einer Tante und einem Vetter gekommen, denen sie vertraute, denn auch Lutz, Elisabeths Sohn, hatte sie von Kindheit an als Spielkameradin akzeptiert. Es war daher nicht weiter verwunderlich, dass Henrika jede Gelegenheit nutzte, um ihre Verwandten im Gasthaus zu besuchen. An ihrem Pflegevater hing sie indes mit Dankbarkeit, denn immerhin versorgte er sie mit allem, was sie mit ihren bald zwanzig Jahren zum Leben brauchte. Seit ihrem siebzehnten Geburtstag musste sie nicht mehr gemeinsam mit der griesgrämigen Magd in der Küche schlafen, sondern bewohnte eine winzige Kammer hinter der Werkstatt. Der Hutmacher hatte darauf bestanden und seiner Frau klargemacht, dass es sich nicht ziemte, Henrika den Blicken der Gesellen auszusetzen, die manchmal mitten in der Nacht in die Küche schlichen, um ihre immerzu knurrenden Mägen zu füllen. Henrika mochte Hahn und bedauerte es, dass er sich nur selten dazu bequemte, mit ihr zu reden. Trug er ihr in der Werkstatt eine Arbeit auf, so tat er es mit knappen Worten, ohne sie dabei wirklich wahrzunehmen. Er schien mit seinen Gedanken stets woanders zu sein, und dorthin ließ er keinen anderen Menschen blicken. Henrika erinnerte sich nicht daran, dass er ihr jemals freundlich in die Wange gekniffen oder übers Haar gestreichelt hatte, wie Elisabeth es oft bei Lutz tat. Seit sie erwachsen war, kam es ihr so vor, als wäre er noch schweigsamer geworden. Er ging ihr aus dem Weg und verschanzte sich in seiner Werkstatt zwischen Leim, Filz und Tierhäuten.
Henrikas Pflegemutter Agatha war da schon leichter zu durchschauen. Sie hatte nie einen Hehl daraus gemacht, dass ihr die Anwesenheit des Mädchens in ihrem Haus nicht behagte. Sie lehnte Henrika ab, bemühte sich aber dennoch, sie zu erziehen. Niemand im Dorf sollte ihr nachsagen können, ein Mitglied ihres Haushalts sehe liederlich aus und benehme sich nicht gottesfürchtig. Was Henrikas zweifelhafte Herkunft betraf, so hatte die Meisterin neugierige Fragen anfangs nur mit Trotz beantwortet, doch als die Gemeindeältesten und der Dorfschreiber auf das fremde Kind im Haus der Hahns aufmerksam geworden waren, hatte sie erkannt, dass sie nicht alle ihre Nachbarn mit ein paar dürren Worten abspeisen konnte. Daher hatte sie beschlossen, sich den Ältesten anzuvertrauen und die rührselige Geschichte vom Kind einer Sünderin zu erzählen, der sie eines Abends zufällig im Nebel begegnet waren. War es nicht ihre Pflicht, das Mädchen davor zu bewahren, eines Tages eine Hure zu werden wie ihre gebrandmarkte Mutter? Von dem Geld, das sie jedes Jahr pünktlich vor dem ersten Frost in ihrer Truhe einschloss, hatte sie den Gemeindeältesten nichts verraten. Wozu auch? Die Herren hatten nach ihrem Besuch Tränen in den Augen gehabt, so sehr hatte sie das empfindsame Herz der Hutmacherin gerührt. Und sie hatten ihr hoch und heilig versprochen, niemals ein Wort über die Herkunft der unglückseligen Henrika zu verlieren.
Am nächsten Morgen hatte jedermann im Dorf Bescheid gewusst. Wochenlang war darüber gelästert worden, dass ausgerechnet die Hahns das Kind einer in Schande Gestorbenen bei sich duldeten. Ja, der Hutmacher und seine Frau mussten miterleben, wie sich im Dorf zwei Parteien bildeten. Die einen achteten die Hahns wegen ihrer Güte, die anderen warfen ihnen Dummheit vor. Was beide Gruppen einte, war ihr Misstrauen gegenüber Henrika. Manch eine der Bauersfrauen behauptete, in den dunklen Augen des Kindes ein sonderbares Blitzen, in ihrer Miene einen heimtückischen Zug wahrzunehmen. Man munkelte, dass ein kalter Wind aufkäme, wann immer Henrika an der Hand ihrer Pflegemutter über den Dorfanger lief. Ob sie nun Wäsche wusch, zur Kirche ging oder vor der Werkstatttür des Hutmachers Butter stampfte – im Dorf gewöhnte man sich rasch an, um Henrika einen großen Bogen zu machen.
Elisabeth unterdrückte ein Gähnen; mit einer müden Handbewegung bat sie Henrika, die Gäste zu verabschieden und die Tür zu schließen.
«Heute klopfen meine Füße, als schimpften sie mich aus», klagte sie. «Vor Sonnenaufgang bin ich aufgestanden, um den frischen Most, der gestern geliefert wurde, in kleinere Fässer umzufüllen. Dann erschien der Zollschreiber und ließ mich stundenlang irgendwelche Listen unterzeichnen. Und wofür die ganze Schinderei?»
«Es kommen auch wieder bessere Zeiten», sprach Henrika ihrer Tante Mut zu. Sie rückte Haube und Schürze zurecht und trat mit einem höflichen Lächeln an den Tisch, an dem die Männer vor ihren Bierkrügen saßen.
«Hab ich dich gerufen, Mädchen?», knurrte Wilhelm Bunter, ein untersetzter Mann mit wulstigen Lippen. Im Dorf reparierte er ausgetretene Schuhe, an die Herstellung neuer wagte er sich nicht so recht heran, weshalb er von der Hand in den Mund lebte.
«Bring mir und meinen Freunden noch einen Krug von dem verdammten Gesöff. Ist eine Schande, so etwas überhaupt Bier zu nennen. Aber an die Weinvorräte lässt deine geizige Herrin uns ja nicht heran, also müssen wir uns damit begnügen.»
Die Männer lachten beifällig, aber keiner von ihnen hob den Kopf, um Henrika eines Blickes zu würdigen.
Henrika gefror das Lächeln auf ihren Lippen. Einen Moment lang war sie sprachlos über die Unverfrorenheit, mit der ein Gast ihr in der Wirtschaft der Tante begegnete, dann aber siegte der Ärger über ihre Schüchternheit. Sie war keine Schankmagd, hätte es aber auch nicht geduldet, wenn eines der Mädchen, das für ihre Tante arbeitete, von den Zechbrüdern beleidigt worden wäre.
«Für diese Äußerung wirst du zehn Kreuzer in die Fluchgeldbüchse werfen müssen, Wilhelm», erklärte sie mit einem sanften Lächeln. Dabei deutete sie auf einen Behälter aus Metall, der auf dem Schanktisch stand. «So will es nun mal das Gesetz!»
«Wovon zum Teufel redest du?»
«Nicht vom Teufel, aber von deiner Bemerkung über die Qualität unseres Biers! Aber da du ihn erwähnst: Jetzt schuldest du schon zwanzig Kreuzer.»
Der Flickschuster lachte auf und schüttelte den Kopf. Zweifellos ärgerte es ihn, dass ausgerechnet Henrika ihn im Beisein mehrerer Zeugen beim Fluchen ertappt hatte und er keine Möglichkeit mehr fand, seine Bemerkung zurückzunehmen. Zwar kam es in Wirtshäusern vor, dass Streitigkeiten zwischen den Gästen zu Wortgefechten führten, aber das Gesetz des frommen Kurfürsten sah vor, dass derjenige, der sich dabei einer Gottlosigkeit schuldig machte, auf der Stelle eine Buße zu entrichten hatte. Zur Schadenfreude aller musste er seine Groschen in eine eigens dafür vorgesehene Büchse werfen, auf der hässliche Fratzen mit langen Ohren, krummen Nasen und blöde grinsenden Mäulern den Fluchenden ermahnten, künftig keine Flüche und Schimpfwörter mehr zu gebrauchen. Auf Befehl des Kurfürsten war jeder Wirt verpflichtet, in seinem Schankraum eine Fluchgeldbüchse aufzustellen und sorgfältig darüber zu wachen, dass ihr Inhalt am Monatsende bei der Kirchenvisitation vorgelegt wurde. Bereicherte sich ein Wirt an den Fluchgeldern, musste er selbst mit einer empfindlichen Strafe rechnen.
«Ich fürchte, dir bleibt keine Wahl, als dein Gewissen zu erleichtern», rief nun einer der Männer. «Schließlich hast du mit deinem Fluch nicht nur die zarten Ohren dieses Mädchens verletzt. Aber die zweite Runde spendierst du uns doch trotzdem, oder?»
«Ach, hol dich doch der …» Gerade noch rechtzeitig besann sich Bunter. Auf der Suche nach Verbündeten blickte er in die Mienen seiner Nachbarn, doch er bemerkte rasch ihre Schadenfreude. Daher wühlte er in seinem Gürtelbeutel, bis er zwei kleine Münzen fand. Mit hochrotem Kopf erhob er sich, trottete zum Schanktisch und warf die Geldstücke in die Büchse. Seine Freunde klopften derweil spöttisch auf den Tisch und rissen Witze über den Pechvogel.
«Ich hoffe, du bist jetzt zufrieden, du Miststück», raunte Bunter Henrika zu, als er an ihr vorüberlief. Sein Gesicht war vor Wut gerötet.
«Warum sollte man für dich eine Ausnahme machen? Das Gesetz sieht vor …»
«Scheinheiliges Luder. Ausgerechnet du willst mich über Gesetze und Gebote unserer heiligen Kirche belehren? Wo doch jeder weiß, dass deine Mutter eine Hure war. Der Apfel fällt nie weit vom Stamm. Du bist nicht besser als eine fahrende Gauklerin, auch wenn das törichte Weib des Hutmachers überall im Dorf herumposaunt, dass ihr Mündel in Samt und Seide zur Welt gekommen ist!» Er verzog den Mund zu einem hässlichen Grinsen, wurde aber gleich darauf wieder ernst. Sein Blick wanderte über Henrikas Dekolleté. «Du hast mich vor meinen Freunden absichtlich bloßgestellt. Vielleicht überlegst du dir schon mal, wie du das wiedergutmachst?»
Henrika erbleichte. Der Flickschuster mit seiner bläulichen, von allerlei Narben zerfurchten Haut und den kalten Augen war ihr zuwider. Als gewalttätig war er nicht bekannt, doch gehörte er zu den Männern, die anderen durch Hinterlist schaden konnten. Henrika überlegte, ob sie nicht einen Fehler gemacht hatte, sich den Zorn des Schuhmachers zuzuziehen. Vielleicht wäre es besser gewesen, sein Schimpfen einfach zu überhören. Die Hahns hatten nie etwas mit Bunter zu tun gehabt, denn sein Lebenswandel war Agatha ein Dorn im Auge. Hartnäckig ging das Gerücht, dass Bunter zuweilen heimlich in seiner Werkstatt Branntwein trinke und danach zu betrunken sei, um seinen Aufträgen nachzukommen.
«Ich hoffe, du hast nicht die Absicht, Ärger zu machen, Wilhelm Bunter», war plötzlich Elisabeths Stimme zu vernehmen. Die Wirtin verschränkte die Arme und warf den Gästen, die unbeweglich am Tisch saßen, einen strengen Blick zu. Murrend erhoben sich die Männer, stülpten ihre Mützen auf und trotteten zum Ausgang. Wilhelm Bunter funkelte Elisabeth ärgerlich an. «Keine Angst, Frau Wirtin, ich werde dafür sorgen, dass dir und deiner kleinen Schankmagd so bald kein Gast mehr Ärger machen wird.»
«Danke, aber auf die Hilfe eines versoffenen Tagediebs pfeife ich. Sieh lieber zu, dass du mein Haus verlässt, sonst melde ich dich dem Schankwächter, sobald er das nächste Mal erscheint!»
«Ich vergraule deine letzten Gäste», sagte Henrika, als alle gegangen waren.
Nach dem Schrecken, den ihr der Schuster eingejagt hatte, war ihr nicht danach, schon nach Hause zu gehen. Stattdessen goss sie mit flinken Bewegungen Wasser in den Spülstein, tauchte schmutzige Becher und Krüge hinein und begann sie so heftig mit der Bürste zu bearbeiten, als hätte ein Dutzend Pestkranker aus ihnen getrunken.
«Nicht so wild, Kind», mahnte die Wirtin. «Ich hab nichts von deiner Hilfe, wenn mein gutes Geschirr nur noch aus Scherben besteht.»
Henrika legte die Bürste aus der Hand und sah ihre Tante an. Sie machte sich wirklich Sorgen.
«Dieser Bunter ist im Dorf zwar nicht sonderlich beliebt, aber wie die Dinge stehen, bin ich es noch weniger. Wenn er seine Drohung wahr macht und die Leute gegen dich aufhetzt, könntest du viel verlieren. Denk an die Schulden, die du machen musstest, um die Weinvorräte aufzustocken.»
Elisabeth winkte ab; sie wollte nichts davon hören. Sie hatte es sich in einem mit Fellen ausgeschlagenen Lehnstuhl gemütlich gemacht und beobachtete versonnen, wie der Widerschein der tanzenden Flammen im Kamin das helle Zinngeschirr zum Funkeln brachte. «Unsinn, mein Kind», sagte sie. «Du glaubst immer, im Dorf würden dich alle mit schiefen Blicken verfolgen, aber ich kenne dich nun schon so viele Jahre und finde, dass dich nichts von den Mädchen deines Alters unterscheidet. Du bist hübsch und klug. Aber immer dann, wenn du es am wenigsten gebrauchen kannst, regt sich in deinem Körper ein Ungeheuer, das dir einredet, du seiest zu hässlich und zu plump, um anderen zu gefallen. Zu hoffärtig, um für fromm zu gelten, und so eigenartig, dass jeder einen großen Bogen um dich macht.»
«Aber die meisten unserer Nachbarn machen doch einen Bogen um mich. Sie finden mich eigenartig, seit ich hierherkam. Und was soll ich davon halten, dass mich der Pfarrer auf die letzte Bank in der Kirche verbannt hat?» An ihrem siebzehnten Geburtstag hatte man Henrika auf eine rot angestrichene Kirchenbank gesetzt, die eigentlich für ausgewiesene Trunkenbolde und fahrendes Volk angefertigt worden war. Weder ihr Protest noch Hahns Spende für den Klingelbeutel hatten daran etwas ändern können. Am liebsten wäre Henrika gar nicht mehr zur Kirche gegangen, doch auch das war verboten und wurde streng bestraft.
«Weißt du, unser Dorf wird seit Generationen von einer Schar einfacher Menschen bewohnt, die morgens mit den ersten Sonnenstrahlen aufstehen und mit den Hühnern schlafen gehen. Das einzige Vergnügen, das sie sich gönnen, ist der Jahrmarkt zu Michaelis und ein Schluck Bier im Wirtshaus. Das heißt, sie taten es, bevor … Nun, das ist eine andere Geschichte. Was die Bauern hier allerdings ebenso hassen wie die schwarzen Blattern sind … Geheimnisse.»
Henrika hob erstaunt die Augenbrauen. Sie verstand nicht recht, was ihre Tante damit meinte. Hatte nicht jeder Mensch Geheimnisse? Ihre Pflegeeltern verschwiegen den Gemeindeältesten, wie viel Geld sie verdienten. Der älteste Sohn des Schneiders verschwieg seinen Eltern, dass er heimlich die Tochter des Pfarrers liebte, obwohl ihn sein Vater zu Pfingsten mit einem Mädchen aus dem Nachbardorf verlobt hatte. Auch Elisabeth hatte ihre Geheimnisse. Sie hatte ein Recht darauf, selbst wenn der Pfarrer und die Ältesten das vielleicht anders sahen.
«Geheimnisse können gefährlich sein», fuhr Elisabeth fort,
«denn das Unbekannte flößt Angst ein. Daher sind unsere Nachbarn misstrauisch gegen alle, die sie nicht durchschauen. Aber du bist ein so liebenswertes Geschöpf, eines Tages werden das alle einsehen.»
Henrika stieß die Luft aus. Die Worte ihrer Tante waren gut gemeint, räumten ihre Zweifel aber nicht aus. Verlangte man von ihr, sich in ihr Schicksal zu fügen und ihre verstorbene Mutter zu verleugnen, dann würde sich an ihrem schlechten Verhältnis zur Dorfbevölkerung vermutlich nie etwas ändern. Dieser Preis war eindeutig zu hoch. Sie hatte nicht vor, den Ältesten Demut und Verständnis vorzuheucheln, während sie grundlos gemaßregelt und erniedrigt wurde. Dass dies wiederum den Argwohn der Leute weckte, die nur darauf warteten, dass sie einen Fehler machte, war ihr ebenfalls klar, doch was würden sie mit ihr tun, wenn sie eines Tages entschieden, nun lange genug gewartet zu haben?
Henrika tauchte den Krug ein letztes Mal in den Stein und trocknete ihn so lange, bis er glänzte.
«Ich hatte immer das Gefühl, nicht hierherzugehören», bekannte sie nach einigem Nachdenken.
«Daran sind nur die Launen meiner törichten Schwester schuld», murmelte Elisabeth kopfschüttelnd. Es klang verbittert. «Wäre sie nicht so dumm gewesen, den Ältesten reinen Wein einzuschenken, könntet ihr hier alle in Ruhe miteinander leben.»
«Aber sie war doch verpflichtet, sich der Kirche anzuvertrauen», versuchte Henrika ihre Pflegemutter zu verteidigen. Obwohl sie stets unter Agatha Hahns harter Hand gelitten hatte, mochte sie es nicht, dass andere schlecht über sie redeten. «Hätte Mutter den Herrn Pfarrer und die Ältesten etwa anlügen sollen?»
«Mir wäre schon eine Ausrede eingefallen, die mir nicht den Schlaf geraubt hätte. Weißt du überhaupt, warum sie geplaudert hat?»
Henrika runzelte die Stirn. «Nun, ich nehme an, sie hatte Angst um ihr Seelenheil. Heißt es nicht, dass Gott uns bereits in diesem Leben zeigt, wer errettet wird und wer zu den Verworfenen gehört? Oder habe ich das falsch verstanden?»
«Calvin vertrat diese Auffassung», gab Elisabeth zu. «Für die Lutheraner und die Katholiken gelten andere Regeln. Frag mich nicht, welche. Ich bin nur eine einfache Schankwirtin und hab genug damit zu tun, während der Predigt nicht einzuschlafen. Meine Schwester hat sich immer dafür geschämt, dass ich nach dem Tod unseres Vaters einen Wirt geheiratet habe.»
«Aber das ist doch nicht verboten.»
Elisabeth hob resigniert die Hand. «Nein, verboten ist es natürlich nicht. Das Schankprivileg wurde im vergangenen Jahr von der kurfürstlichen Kanzlei erneuert. Aber Agatha sieht es nun einmal nicht gern, dass ihre Schwester für durstige Männer Bier zapft.»
Natürlich wusste Henrika, was ihre Ziehmutter von Elisabeths Gewerbe hielt. Umso mehr wunderte es sie auch, dass Agatha ihr erlaubte, der Wirtin zur Hand zu gehen. Es schien ein stilles Einvernehmen zwischen den beiden Frauen zu geben, von dem sie nichts wusste. Geheimnisse.
«Soviel ich weiß, haben die Hahns heute Abend Besuch von den Ältesten der Gemeinde», sagte Elisabeth. «Vielleicht suchen sie einen Mann für dich.»
Henrika ließ den Krug sinken und schaute ihre Tante bestürzt an. Es war das erste Mal, dass sie von einem solchen Ansinnen hörte.
«Vater Hahn will mich verheiraten?», platzte es aus ihr heraus. «An einen Mann aus dem Dorf? Eher friert der Rhein im Juli zu, als dass er mit einem der Bauern handelseinig wird.»
«Mag sein. Aber was ist, wenn seine Wahl gar nicht auf einen Mann aus dem Dorf fällt? Überlege doch einmal, Mädchen. Wenn dich jemand von hier wegbrächte, könntest du einen eigenen Hausstand gründen, eine eigene Familie. Träumst du nicht manchmal davon, deine enge Kammer hinter der Werkstatt zu verlassen?» Elisabeth stand schwerfällig auf und strich die Decke, auf der sie gesessen war, glatt. «Mich wundert nur, dass sich die Hahns mit der Suche nach einem Mann für dich so viel Zeit gelassen haben. Es gibt nicht mehr viele Jungfern deines Alters im Dorf.»
Henrika atmete tief ein. Sie spürte, dass Elisabeth ihr nicht alles sagte, was sie über die Pläne ihrer Schwester wusste, aber so geschickt sie es auch anstellte, es gelang ihr an diesem Abend nicht, der Tante mehr als ein paar Andeutungen zu entlocken.
Schließlich gab sie es auf und verabschiedete sich.
2. Kapitel
Auf dem Heimweg dachte Henrika über die Worte ihrer Tante nach. Würde es ihr mit einem Ehemann tatsächlich besser ergehen? Hatte sie kein Verlangen nach einem Gehöft, auf dem sie als Ehefrau das Sagen hatte und nicht nur geduldet wurde? Der Gedanke an eine Heirat hatte gewiss einiges für sich. Auch wenn es in diesem Fall galt, den Hahns und Elisabeth für immer Lebewohl zu sagen, war Henrika davon überzeugt, dass der Sprung ins Ungewisse einem Leben als verachtete Außenseiterin vorzuziehen war.
Trotz der Kälte hatte Henrika es plötzlich nicht mehr eilig, nach Hause zu kommen. Sie träumte selten, denn meistens gab es im Haus der Hutmacher so viel Arbeit, dass ihr keine Zeit blieb, ins Grübeln zu kommen. Nun aber genoss sie es, ihre Gedanken schweifen zu lassen und gemächlich an den Holzhäusern und Scheunen vorbeizulaufen. Das Dorf hatte sich seit Regierungsantritt des Kurfürsten ausgedehnt. Die staubige Straße, die von zwei Gräben gesäumt wurde, reichte nun fast bis an die Felder und Weingärten heran. Neben den Wiesen, die hinter dem Schafgarten lagen, waren eine Hufschmiede, ein Räucherhaus und eine Mühle entstanden. Henrika atmete tief durch. Die Luft, die von den beiden Flussarmen zu ihr heraufstieg, war eisig. Eine Katze strich auf der Suche nach Vögeln durch das dichte Unterholz. Es war seit Tagen frostig. In den Eimern, die an einer Stange über dem Dorfbrunnen hingen, hatte sich eine dicke Eisschicht gebildet.
Als Henrika den Kirchhof überquerte, musste sie an die Frau denken, die sie als kleines Kind Mutter genannt hatte. Nur wenige Erinnerungen waren ihr geblieben, die sich hin und wieder in ihre Träume drängten, wie die an eine zierliche, dunkelhaarige Frau, die sie anlächelte und ihr befahl, ihre Hand nicht loszulassen.
Aber sie hatte die Hand losgelassen, und im Lauf der Jahre war das Bild der Frau in Henrikas Gedächtnis verblasst wie eine Blume, die man zum Trocknen zwischen zwei Holzbrettchen presst. So gern sie sich auch an der Vergangenheit festgehalten hätte, sie erinnerte sich nicht mehr an das Leben, das sie geführt hatte, bevor die Hutmacher sie ins Dorf gebracht hatten. Den Andeutungen der Pflegeeltern entnahm sie, dass sie in einer großen Stadt gelebt hatte, vielleicht in Heidelberg. Schließlich musste es einen Grund dafür geben, dass ihr Pflegevater es stets ablehnte, sie mitzunehmen, wenn er den Markt dort besuchte oder im Schloss Hüte ablieferte. In all den Jahren hatte er ihr nie erlaubt, das Dorf zu verlassen. Fürchtete er etwa, jemand könnte sie in Heidelberg wiedererkennen, weil sie ihrer leiblichen Mutter ähnlich sah?
Es gab Tage, da wünschte sich Henrika nichts sehnlicher, als mehr über die Frau in Erfahrung zu bringen, die ihr das Leben geschenkt hatte. Es musste doch jemanden geben, der etwas über sie sagen konnte. Wenn man ihrer Mutter vorgeworfen hatte, Ehebruch begangen zu haben, so musste sie verheiratet gewesen sein. Aber mit wem? An ihren leiblichen Vater konnte Henrika sich nicht erinnern. Sie war sich ziemlich sicher, dass sie bis zu jenem verhängnisvollen Tag, an dem man sie aus dem Schlaf gerissen und in ein verlassenes Gutshaus gebracht hatte, mit ihrer Mutter allein gelebt hatte. Aber wie schwer wogen schon die Erinnerungen eines kleinen Mädchens? Als sie es vor Jahren einmal gewagt hatte, die Hutmacherin auf ihre Herkunft anzusprechen, war diese so wütend geworden, dass sie es fortan unterlassen hatte, das Thema anzuschneiden. Auch der Pfarrer, der in Heidelberg viele Gelehrte, Edelleute und sogar einige Hofbeamte des Kurfürsten kannte, zeigte für Henrikas Fragen kein Verständnis. Er hatte sie ermahnt, nicht hochmütig zu werden. Selbst wenn sie in einem herrschaftlichen Haus zur Welt gekommen sei, läge es doch auf der Hand, dass etwaige Vorrechte ihrer Geburt durch die Verbannung ihrer Mutter getilgt worden waren. Der Geistliche hatte Henrika das Versprechen abgenommen, den Hutmacher zu ehren und niemals einen Versuch zu unternehmen, etwas über ihre Vergangenheit herauszufinden, denn schließlich sei ihre Familie durch die Sünde eines Weibes zerstört worden.
Im Hühnerstall des Pfarrers gackerten die Hennen aufgeregt durcheinander. Das taten sie immer, wenn sich jemand der Gartenpforte näherte. Die Tiere verfügten über ein besseres Gespür für Gefahr als jeder Wachhund. Henrika blieb stehen und spähte durch das grobe Dornengeflecht, das den kleinen Kirchhof wie eine schützende Mauer umgab. Es war dunkel, doch im Licht des Mondes konnte sie mühelos erkennen, dass jemand um die Ställe herumschlich. Ein Hühnerdieb? Sie hielt die Luft an, als sie eine Gestalt ausmachte, die eine Kappe aus rotem Filz trug. Die Kappe gehörte Lutz, Elisabeths Sohn, der sie wegen ihrer hübschen roten Farbe abgöttisch liebte und sie niemals absetzte. Manchmal fragte sich Henrika, ob sie gar mit seinem gewaltigen Schädel verwachsen war. Doch obwohl Lutz über einen massigen Körper verfügte, hatte sein Verstand sich doch bereits im zarten Kindesalter entschieden, nicht mit dem übrigen Körper zu wachsen. Lutz zählte zwanzig Jahre, war dem Gemüt nach aber ein Kind, dem die Natur in einer boshaften Laune die Gestalt eines Erwachsenen verliehen hatte. Elisabeth hatte den Schwachsinn ihres Sohnes lange ignoriert, doch irgendwann hatte auch sie sich damit abfinden müssen. Sie tat es klaglos, beinahe trotzig, indem sie den Blicken der Dorfbewohner niemals auswich. Sie hing an ihrem Sohn mit großer Zärtlichkeit. Nie wäre es ihr in den Sinn gekommen, ihn im Haus zu verstecken oder auch nur zu verheimlichen, dass er nicht in der Lage war, ein Handwerk zu erlernen.
Anders als Henrika war Lutz für die Bewohner des Dorfs aber kein Geheimnis, das ihnen Unbehagen einflößte. Schwachsinnige hatte es zu allen Zeiten gegeben, es war nichts Besonderes dabei. In den Städten gab es Narrentürme und Tollhäuser, an deren Türschwellen man fromme Gaben niederlegte. In den Dörfern ließ man sie links liegen. Die Kinder verspotteten sie und bewarfen sie zuweilen mit Steinen, aber ihre Angehörigen verweigerten ihnen selten das Plätzchen hinter dem Ofen oder einen Becher Milch. So war auch der Sohn der Baumwirtin aufgewachsen: verhöhnt und bemitleidet, aber nicht angefeindet. Solange Lutz friedlich blieb, hatte niemand Anlass, sich vor ihm zu fürchten.
Henrika fragte sich, was Lutz wohl zu dieser Stunde noch im Dorf zu suchen hatte. Elisabeth hatte angenommen, er hielte sich in der Stube über dem Schankraum auf. Vermutlich wusste sie nicht, dass er noch einmal hinausgegangen war. Es gab eine kleine Außentreppe, über die man die oberen Räume der Schänke verlassen konnte, ohne die Gaststube durchqueren zu müssen. Lutz hatte unlängst herausgefunden, dass seine Mutter diese Treppe nicht mehr benutzte, da zwei ihrer Stufen gebrochen waren. Ihm machte das nichts aus. Mit seinen langen Beinen konnte er die zerborstenen Stufen mühelos überspringen.
Auch wenn Henrika nicht daran dachte, Elisabeth von den nächtlichen Ausflügen ihres Sohns zu erzählen, war sie doch der Meinung, dass er nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr durchs Dorf schleichen sollte. Die Stimmung im Dorf war wegen der angeblichen Landsknechte, die sich nahe der Rheinfähre herumgetrieben haben sollten, bereits angespannt genug. Vielleicht waren die Männer Späher der Kaiserlichen. Die waren auf den Kurfürsten nicht gut zu sprechen, seit er im Reich die Protestanten unter seinem Banner vereinigt hatte. Henrika musste an die Drohungen des Flickschusters denken. Fehlte morgen auch nur ein einziges Huhn im Stall oder wurde ein Garten niedergetrampelt, so bestand die Gefahr, dass sich die Bauern voller Zorn zusammenrotteten, um sich am schwächsten Mitglied der Dorfgemeinschaft schadlos zu halten.
«Lutz, bleib hier», zischte Henrika der Gestalt mit der roten Filzkappe hinterher, die zwischen den mächtigen Kornspeichern des Zollhauses verschwunden war. Seufzend folgte sie dem Wirtssohn. Was um alles in der Welt hatte Lutz hier bei den Scheunen verloren? Sie gehörten zum kurfürstlichen Grundbesitz; hier wurden Waren gestapelt und gewogen, und die Bauern der Umgebung lieferten in den zum Zollhaus gehörenden Gebäuden ihre Pachterträge ab. Henrika untersuchte die Flügeltüren, über deren Querbalken das Wappen Kurfürst Friedrichs hing. Beide Türen waren gesichert. Wer auch immer sie außer an den dafür vorgesehenen Zoll- und Zehnttagen öffnete, musste mit schweren Strafen rechnen.
Auf Zehenspitzen schlich Henrika um die größere der beiden Scheunen herum, doch sie konnte in der Dunkelheit beim besten Willen keinen Durchschlupf finden, der groß genug gewesen wäre, dass Lutz sich hätte hindurchzwängen können. An der westlichen Bretterwand, etwa fünfzehn Fuß über ihrem Kopf, fand sie eine kleine Fensteröffnung. Sie erinnerte sich, dass diese Öffnung vom Heuboden aus leicht zu erreichen war. Aber von außen? Ohne eine Leiter? Unmöglich.
Ratlos blickte sich Henrika um, erwog einen bangen Moment sogar, zum Haus des Pfarrers zu laufen und ihn um Hilfe zu bitten. Aber vermutlich machte das die Sache nicht besser. Der alte Mann würde einen Heidenlärm veranstalten, wenn man ihn aus dem Schlaf riss.
Als Henrika zur Nachbarscheune lief, sah sie mit Schrecken, dass die Tür nur angelehnt war. Das Schloss lag auf der Erde.
Henrika starrte fassungslos auf die Tür. Wenn man sie und Lutz hier erwischte, steckte sie in der Klemme. Niemand würde ihr glauben, dass sie nur Elisabeths Sohn gefolgt war. Man würde sie beschuldigen, die Tür aufgebrochen zu haben, um etwas zu stehlen, was dem Kurfürsten zustand. Mit klopfendem Herzen betrat sie den dunklen Raum. Als sich ihre Augen an die Finsternis gewöhnt hatten, erkannte sie die Umrisse der Waage und einiger Kisten und Truhen, die vermutlich in den nächsten Tagen abgeholt und zum Schloss nach Heidelberg geschafft werden würden.
Von Lutz war nichts zu sehen. Allmählich begann sie an ihrem Verstand zu zweifeln. Sie hatte die rote Kappe doch eindeutig erkannt. Machte er sich einen Spaß daraus, sich hinter einem Balken oder oben, auf dem Heuboden, vor ihr zu verstecken? Jeden Augenblick würde er mit seinem üblichen breiten Grinsen hervorspringen, sie bei beiden Händen packen und mit ihr durch die Scheune tanzen. Plötzlich drang ein Rascheln an Henrikas Ohr. Sie blickte hinauf zum Boden und entdeckte eine Leiter. Also hatte sie sich nicht getäuscht. Wut erfüllte sie.
«Lutz, du Taugenichts, ich warne dich! Wenn du nicht auf der Stelle diesen Unfug lässt, wird deine Mutter dir das Fell gerben, auch wenn sie dir nur bis zu den Schultern reicht!»
Ein verhaltenes Lachen drang durch die Scheune. Es klang dumpf und tief. Ehe Henrika ausmachen konnte, wo es herkam, traf etwas Schweres ihren Kopf und riss sie zu Boden. Sie schrie auf. Staub drang in ihre Kehle, dazu kam Panik, als sie bemerkte, dass sie sich kaum bewegen konnte. Sie zappelte verzweifelt, doch der Kampf gegen die Gewichte, die auf ihren Armen und Beinen lagen, war aussichtslos. Je mehr sie strampelte, desto weniger konnte sie sich rühren.
Ein Fischernetz, erkannte sie, und ihr Entsetzen wuchs. Jemand musste gewartet haben, bis sie die Leiter erreicht hatte, um ihr von oben ein Netz über den Kopf zu werfen.
Während sie an den Maschen zerrte, die sich immer fester um ihren Leib schnürten, hörte sie Schritte auf der Leiter. Dann blies ihr ein Mann seinen nach Bier riechenden Atem ins Gesicht. Trotz der Dunkelheit erkannte Henrika den Flickschuster. Nach ihm stiegen noch weitere Männer die Leiter herunter.
Bunter packte sie derb und zwang sie, ihm in die Augen zu sehen, die vor Genugtuung leuchteten.
«Nun, Täubchen, hast du dir inzwischen überlegt, wie du mich milde stimmen kannst?», raunte er ihr zu.
«Du Mistkerl! Du hast das Schloss aufgebrochen und mich in die Scheune gelockt.»
Bunters Freunde lachten hämisch. Auf einen Wink des Schusters begab sich einer von ihnen zum Tor, um Wache zu stehen.
«Ich würde an deiner Stelle nicht schreien», sagte Wilhelm Bunter hämisch. «Wenn du es tust, werden vier ehrbare Männer bezeugen, dass sie dich auf ihrem Heimweg vom Wirtshaus dabei ertappten, wie du die Zollhaustür aufgebrochen hast, um zu plündern. Du weißt hoffentlich, wem hier Glauben geschenkt wird, oder? Mein alter Freund Ulrich, der gerade die Tür bewacht, sitzt sogar im Ältestenrat der Kirche.»
Henrika wandte den Kopf. Bunter würde mit seinen Lügen durchkommen, während man sie für einen Einbruch zur Rechenschaft ziehen würde, den sie nicht begangen hatte. Sie war ihm und seinen Freunden auf Gedeih und Verderb ausgeliefert.
«Was habt ihr mit Lutz gemacht?», fragte sie mit erstickter Stimme. «Er hat dir seine Kappe gewiss nicht freiwillig gegeben, um mir eins auszuwischen. Also, wo ist er?»
«Ach, das hässliche Ding meinst du?» Bunter nahm die Mütze vom Kopf und warf sie Henrika mit einem boshaften Grinsen vor die Füße. «Ich hatte eine ganz ähnliche zu Hause. Hab sie allerdings nie getragen. Wer will schon im Dunkeln mit einem Schwachkopf verwechselt werden?»
Der Flickschuster imitierte Lutz, indem er die Augen verdrehte und in die Hände klatschte. Seine Kameraden prusteten vor Lachen los, verstummten jedoch sofort, als Bunter ihnen mit einem strengen Blick bedeutete, leise zu sein.