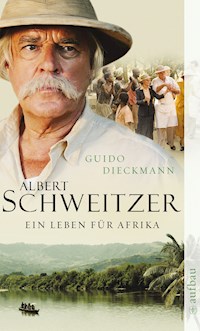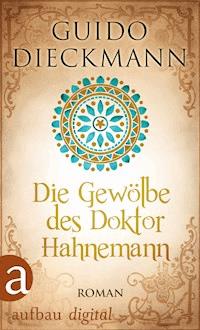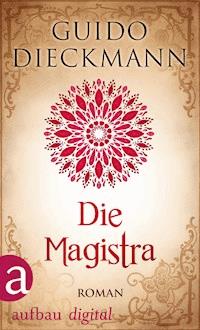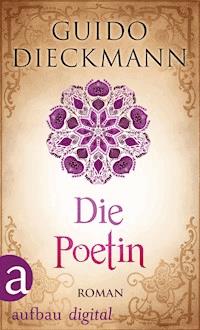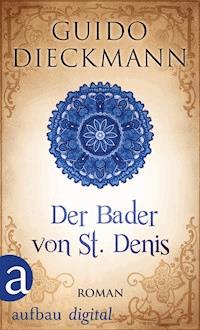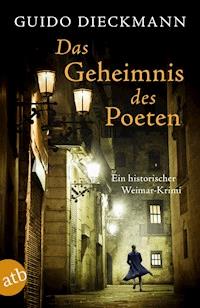4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Heilige oder Hexe? Trier im Jahre 1432: Der Streit um die Nachfolge des verstorbenen Erzbischofs spaltet die Stadt. Auch Lucia, die Enkelin des bischöflichen Gewandschneiders, bleibt davon nicht unberührt: Ihr Großvater gerät in finanzielle Not; ihm droht der Schuldturm. Um den alten Mann zu retten, wagt Lucia etwas Unerhörtes: Allein und in Männerkleidern will sie sich nach Mainz durchschlagen, um ihre reich verheiratete Schwester Magdalena um Hilfe zu bitten. Da der Weg durch feindliches Gebiet führt, schließt sich die begabte Bogenschützin einem Kaufmannszug an. Sie wird enttarnt und gerät in die Fänge des Grafen von Manderscheid, der seinen Anspruch auf den Bischofsstuhl um jeden Preis durchsetzen will. Er zwingt Lucia, ihm als gottgesandte Jungfrau mit dem Bogen den Weg in das hohe Amt zu ebnen. Doch wer den einen als Heilige gilt, wird den anderen schnell zur Hexe ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 731
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Guido Dieckmann
Die Jungfrau mit dem Bogen
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Heilige oder Hexe?
Trier im Jahre 1432: Der Streit um die Nachfolge des verstorbenen Erzbischofs spaltet die Stadt. Auch Lucia, die Enkelin des bischöflichen Gewandschneiders, bleibt davon nicht unberührt: Ihr Großvater gerät in finanzielle Not; ihm droht der Schuldturm. Um den alten Mann zu retten, wagt Lucia etwas Unerhörtes: Allein und in Männerkleidern will sie sich nach Mainz durchschlagen, um ihre reich verheiratete Schwester Magdalena um Hilfe zu bitten. Da der Weg durch feindliches Gebiet führt, schließt sich die begabte Bogenschützin einem Kaufmannszug an. Sie wird enttarnt und gerät in die Fänge des Grafen von Manderscheid, der seinen Anspruch auf den Bischofsstuhl um jeden Preis durchsetzen will. Er zwingt Lucia, ihm als gottgesandte Jungfrau mit dem Bogen den Weg in das hohe Amt zu ebnen. Doch wer den einen als Heilige gilt, wird den anderen schnell zur Hexe ...
Über Guido Dieckmann
Guido Dieckmann, geboren 1969 in Heidelberg, arbeitete nach dem Studium der Geschichte und Anglistik als Übersetzer und Wirtschaftshistoriker. Heute ist er als freier Schriftsteller erfolgreich und zählt mit seinen historischen Romanen, u.a. dem Bestseller «Luther» (2003), zu den bekanntesten Autoren dieses Genres in Deutschland. Guido Dieckmann lebt mit seiner Frau an der Deutschen Weinstraße.
Inhaltsübersicht
Prolog
Mainz, im März 1432
«Mörderin!»
Dumpf hallte die Anklage von den Wänden der Kammer wider, die Martin Herrlinger, Zunftmeister der Färber von Mainz, mit seiner jungen Gemahlin teilte. Das Echo verhallte im Brausen des Sturmwinds, der um die Giebel der Häuser heulte und Mensch wie Vieh in Unruhe versetzte.
Magdalena fuhr auf und starrte benommen in das dämmrige Licht, das sie wie ein Netz aus düsteren Ahnungen umgab. Sie brauchte eine Weile, bis ihr einfiel, wo sie sich befand. Sie war allein. Das Laken auf der linken Seite ihres Ehebettes war straff gespannt und kalt wie Eis.
Unberührt.
Stöhnend versuchte sie, sich aufzurichten. Hatte sie geträumt? Wenn ja, dann war es ein fürchterlicher Albtraum gewesen, einer jener Träume, deren Bilder so glaubhaft und nah waren, dass man auch eine ganze Weile nach dem Erwachen noch nicht wagte, sie anzuzweifeln. Sie hatte Martin gesehen, ihren Mann. Im Traum hatte er an einem Balken gehangen, den Kopf nach unten, und sie mit starren Augen angeblickt.
Wenige Spannen über ihrem Kopf bewegten sich die moosgrünen Bettvorhänge, das Tuch sperrte die Kälte der regnerischen Frühjahrsnacht nur notdürftig aus. Magdalenas Mund war trocken, doch sie verspürte weder Hunger noch Durst. Wie eine eisige Flüssigkeit durchdrang der Frost der Nacht ihren Körper. Sie war bloß mit einem dünnen Schnürgewand bekleidet und fror so erbärmlich, dass ihre Zähne zu klappern begannen.
Von der mit Schnitzereien reichverzierten Kleidertruhe sandte die Lampe ihren Schein herüber. Die müden Flämmchen reichten nicht einmal aus, um die Schatten vor der Fensterluke zu vertreiben; dafür beleuchteten sie die zackigen, vom Hausschwamm unterlaufenen Risse, die sich ins Mauerwerk gefressen hatten. Martin hatte sie schon vor Tagen ausbessern wollen. Er war sehr gewissenhaft in allem, was das Handwerk betraf, und obwohl Magdalena vermutete, dass ihr Gemahl es kaum abwarten konnte, bis er mit ihr und dem Gesinde das alte Haus verlassen und auf den größeren Hof umziehen konnte, hielt er die Wohnräume und Vorratsspeicher an der großen Bleiche vorbildlich in Schuss. Seine Diener hatten hier oben nichts zu suchen. Er war der Herr des Hauses; seine Schlüssel vertraute er nicht einmal Magdalena an.
Als Magdalena den Kopf zur Fußseite des Alkovens wendete, entdeckte sie ein Tragebrett, das jemand nachlässig gegen die Wand gelehnt hatte. Das Holz trug dunkle Flecken, es roch scharf nach Moder, feuchter Erde und gewissen Substanzen, die Martin in seiner Tuchfärberei verwendete. Erschöpft ließ sich Magdalena wieder in die Kissen gleiten.
Was hatte die Bahre hier oben verloren?
Was, bei allen Heiligen, mochte ihr zugestoßen sein? Bei dem Gedanken packte sie Entsetzen. Sie tastete Brust, Hüften und Oberschenkel ab und stellte erleichtert fest, dass sie noch immer Strümpfe trug. Wer auch immer sie während ihrer Ohnmacht hinauf in die Kammer getragen hatte, war wieder verschwunden, ohne ihre Hilflosigkeit auszunutzen.
Aber wo blieb Martin? Warum ließ er sie allein in einem Haus, in dem jedermann sie verachtete? Er wusste doch, wie ungern sie hier oben allein zu Bett ging.
Auf dem Gang vor ihrer Kammer hörte sie Flüstern, doch sie vermochte keiner der Stimmen ein Gesicht zu geben. Sie lauschte angestrengt, und eine böse Ahnung stieg in ihr auf.
«Wie könnt ihr noch an meinen Worten zweifeln?», zischte einer der Unbekannten aufgebracht. «Ganz bestimmt hat sie etwas mit seinem Tod zu tun. Mit ihrem Blick hat sie ihn zum Bösen verführt, bis ihm kein anderer Ausweg mehr blieb!»
Ihm. Wer war ihm?
«Ich habe trotzdem keine Ahnung, warum du uns gerufen hast», widersprach zaghaft eine dunkle Männerstimme. Selbst durch das Holz der Tür klang sie ängstlich, als fürchtete der Mann, selbst beschimpft oder angeklagt zu werden.
«Dies ist kein Fall für das Schöffengericht. Vernünftiger wäre es, nach einem Wundarzt oder einem Baderchirurgen zu schicken, der sich auf die Leichenbeschau versteht.»
«Nun gut, dann wartet aber wenigstens unten in der Stube, bis ich den Wundarzt verständigt habe. Der versteht sich auf Todeszeichen. Einer von euch sollte die Tür zur Kammer im Auge behalten. Der Satansbraten darf uns nicht entwischen.»
Satansbraten. Wer? Sie?
Magdalena geriet in Panik. Man verdächtigte sie eines teuflischen Verbrechens. Aber warum? Welcher Wahnsinn mochte die Leute gepackt haben? War sie denn nicht mehr die Herrin des Hauses?
Draußen stürmte und regnete es zum Gotterbarmen. Geräuschvoll prasselten die Tropfen gegen das schmale Vordach, das sich zur Hofseite hin erhob. Unter dem Dach standen Karren, mit denen Martins Gesellen gefärbte Tuche zu den Lagergewölben der Kaufleute am Domplatz zogen. Auch Butterfässer, Honig- und Ölkrüge wurden dort verwahrt. Die Pferde- und Ziegenställe befanden sich jenseits der Hofmauer.
Kein kluger Mensch verließ sein Haus in einer derart schaurigen Sturmnacht, wenn ihn nicht ein guter Grund antrieb. Magdalena musste einen solchen gehabt haben, ihr Haar war noch immer feucht. Aber sosehr sie sich auch bemühte, sie vermochte sich einfach nicht daran zu erinnern, weshalb sie ohne Haube und Umhang hinaus in die Gasse gestürzt sein sollte.
Als Magdalena ihre Finger betrachtete, bemerkte sie eine Anzahl hässlicher Schrammen und Schürfwunden. Getrocknetes Blut befand sich selbst auf den Ärmeln ihres Gewandes und auf dem Laken. Die Flecken sahen aus wie Blütenblätter in frischgefallenem Schnee. «Heilige Jungfrau Maria», betete sie leise, «lass Martin nach Hause kommen. Er wird die Leute fortschicken und mir beistehen, so wie er es vom ersten Tag unserer Ehe an getan hat. Verleih mir die nötige Kraft, um …» Die Worte erstarben auf ihren Lippen, als plötzlich dunkel eine schreckliche Erinnerung aufflackerte. Es waren nicht mehr als Bruchstücke, zu vage, um einen Sinn zu ergeben. Doch immerhin entsann sie sich nun, das Haus etwa um die neunte Stunde verlassen zu haben. Der Regen hatte kurz zuvor eingesetzt. Einer von Martins Lehrjungen war in die Stube gekommen und hatte sie gebeten, ihn in die Stadt zu begleiten.
Martin hat nach mir gefragt, durchfuhr es sie. Natürlich, so war es gewesen. Er hatte noch auf der Baustelle zu tun gehabt, irgendwelche Geschäfte mit auswärtigen Kaufleuten. Er hatte ihr auftragen lassen, etwas dorthin zu bringen. Anscheinend hatte es sehr geeilt. Aber was hatte er zu dieser Stunde so dringend gebraucht, und warum hatte der Junge es ihm nicht selbst bringen können?
Ich muss mich erinnern, ich muss, ich muss … Doch es war zwecklos. Je verzweifelter sie sich zu erinnern versuchte, desto mehr verschwammen die Bilder. Den Rest der Nacht verschluckte ein dichter Nebel, der sich nicht lichten wollte.
Ich muss ihn suchen gehen. Entschlossen zog sich Magdalena an dem geschnitzten Bettpfosten empor. Martin würde dem Spuk ein Ende machen. Sie hoffte nur, das Haus verlassen zu können, ohne den Männern, die unten auf den Wundarzt warteten, in die Arme zu laufen. Mit einem leisen Stöhnen stützte sie sich auf die Ellbogen, dann hielt sie plötzlich inne. Ungläubig blickte sie auf ihre Beine. Heilige Mutter Gottes, sie gehorchten ihr nicht mehr, schienen zu Fremdkörpern geworden zu sein. Taub waren sie. Kalt und steif. Magdalena krümmte sich, weil sie fürchtete, sich jeden Augenblick übergeben zu müssen.
Mit einem energischen Ruck wurde die Tür aufgestoßen, und eine Frau trat in die Kammer. Drei Männer folgten ihr. Magdalena erkannte Basilius Fust, den städtischen Wundarzt, mit dem sich ihr Mann von Zeit zu Zeit in einer Schenke am Rhein auf einige Becher Wein traf. Der Arzt trug enganliegende, zitronengelbe Beinkleider und einen pelzverbrämten Mantel, der im Regen feucht geworden war.
«Dort liegt sie», rief die Frau. «Nun seht Ihr, dass ich Euch die Wahrheit gesagt habe.» Sie stellte ihre Kerze auf einem Schemel ab und betrachtete Magdalena hasserfüllt. Es war Annegret, Martins ältere Schwester. «Schaut Euch das Weib an, damit Ihr später vor den Schöffen beschwören könnt, wie Ihr sie angetroffen habt: Das Kleid besteht nur noch aus Fetzen, die Hände sind blutig, die Stirn ist zerkratzt, ebenso wie bei dem armen Martin. Und dann dieser wahnsinnige Ausdruck in ihren Augen. Wie die Buhlschaft eines Höllenteufels sieht sie aus. Ich habe meinen Bruder immer wieder vor ihr gewarnt, doch nun ist es zu spät.»
Der Arzt räusperte sich; sein Gesicht verriet, dass er Angst hatte. «Wir sollten nicht voreilig handeln, Frau Annegret. Immerhin ist Martin ein geachteter Zunftmeister und Ratsherr, außerdem ist er mein ältester Freund.»
«Solltet Ihr dann nicht wissen, was Ihr ihm schuldig seid?» Magdalenas Schwägerin sah den Arzt feindselig an. Sie war eine unscheinbare Frau, deren Gesicht die graue Farbe ihrer Kleidung angenommen hatte. Am Gürtelband ihrer Witwentracht klapperten einige Schlüssel. Magdalena erkannte das Geräusch auf Anhieb. Diese Schlüssel gehörten Martin.
Magdalena stöhnte leise. «Was geschieht hier? Annegret, was haben die Männer in meinem Haus zu schaffen?»
«In deinem Haus? Ich lasse dich vor die Tür setzen!» Magdalenas Schwägerin drehte sich zu den ratlos wirkenden Männern um. «Ihr seht, dass ich nicht übertrieben habe. Ihr Haar ist nass wie das Fell einer ersoffenen Katze. Und auf der Stirn trägt sie ein Mal, das ihr mein armer Bruder in seinem Todeskampf beigebracht hat.»
«Was redest du da von einem Todeskampf?», stieß Magdalena hervor.
«Martin liegt mit eingeschlagenem Schädel unten in der Werkstatt! Pater Edmund ist bei ihm, aber er kam zu spät, um ihm die Ölung zu spenden. Auch das ist deine Schuld, du dahergelaufene Hure. Warum hast du ihm das angetan? Er hat dich doch auf Händen getragen und dir jeden Wunsch erfüllt!»
Magdalena wollte nicht länger zuhören. Sie beugte sich vor und knetete ihre Beine in dem erfolglosen Versuch, sie zu kräftigen.
«Sie hat ihn umgebracht», jammerte Annegret. «Oder zumindest in den Tod getrieben. Und dafür hat Gottes Zorn sie noch zur selben Stunde gestraft wie einst Lots Frau.»
Gereizt verzog der Wundarzt das Gesicht. Dass Annegret biblische Vorbilder bemühte, um die angebliche Verworfenheit der Zunftmeisterin zu bekräftigen, hob seine Laune nicht gerade. Dennoch war er bereit, sich die Verletzungen der Hausherrin anzusehen. Ihre Schönheit trieb ihm die Röte ins Gesicht. Viele Frauen in Magdalenas Alter begannen zu verblühen, ihr hingegen schienen die Jahre, die seit ihrem triumphalen Einzug in die Stadt vergangen waren, zu einer zarteren Haut, zu strahlenderem Glanz in den mandelförmigen Augen verholfen zu haben.
Während ihm einer seiner schweigsamen Begleiter die Lampe hielt, unterzog der Arzt Magdalena einer flüchtigen Untersuchung und wandte sich dann an Annegret: «Lasst Eure Magd saubere Leinentücher, eine Schüssel mit warmem Wasser und ein wenig Branntwein heraufbringen, damit ich die Schürfwunden reinigen kann. Und habt keine Angst, Frau. In diesem Zustand wird Eure Schwägerin auch ohne Fesseln nicht davonlaufen. Ich würde mich wundern, wenn sie jemals wieder auf eigenen Beinen stehen könnte.»
Martins Schwester schnaubte, doch was sie hörte, schien ihr zu gefallen. «Nun gut, wenn Ihr es sagt, Meister.»
«Wir sollten draußen warten, damit die Zunftmeisterin ihr Mieder lockern kann.» Der Arzt gab seinen Begleitern einen Wink, ihm hinaus auf den Korridor zu folgen.
Magdalena blieb allein zurück. Eine unbändige Angst, auch noch die Kontrolle über Arme und Hände zu verlieren, beschleunigte ihren Herzschlag. Mit letzter Kraft tastete sie im Zwielicht nach dem Kasten, den Martin an der Kopfseite des gemeinsamen Bettes aufbewahrt und wie einen Schatz gehütet hatte. Du schläfst lieber auf deinem Kasten als auf einem weichen Kissen, hatte sie ihn oft geneckt. Warum war ihr nur früher nicht aufgefallen, dass er jedermann in diesem Haus mit Argwohn begegnete? Wenn Martin verlangt hatte, dass sie ihm etwas zur Baustelle brachte, dann konnte sie es eigentlich nur dem Kasten entnommen haben.
Als sie ihn öffnete, stieg ihr ein aromatischer Duft in die Nase: getrocknete Nelken und Pfefferkörner. In einem der Seitenfächer fand sie einige Schreibfedern und Radiersteine sowie einen Kelch, den sie nie zuvor gesehen hatte. Er sah wertvoll aus. Sie suchte weiter und fand schließlich einen Bogen Papier. Er lag in einer gefetteten Lederhülle, gleich neben dem prächtigen violetten Siegel, das Martin als Zunftmeister und Ratsherrn der Stadt Mainz auswies.
Magdalena nahm einen Kohlestift zur Hand. Sie musste auf der Stelle verschwinden, bevor Martins Schwester den gesamten Schöffenrat von Mainz gegen sie aufbrachte. Am besten fort aus der Stadt. Hier hielt sie nichts mehr, kein Haus und auch kein Mann. Doch sie zögerte, der Stift in ihrer Hand schien auf einmal schwer wie Blei zu werden.
Gewiss gab es Menschen, die sie um Hilfe bitten konnte. Menschen, die ihr etwas schuldeten. Auch wenn sie für diese schon seit vielen Jahren tot und begraben war.
I
Trier, im April 1432
«Wenn der unzuverlässige Bursche nicht vor Einbruch der Dunkelheit hier ist, braucht er gar nicht erst wiederzukommen! Ich dulde keine Taugenichtse in meiner Werkstatt!»
Grimmig steckte Schneidermeister Melchior Kastenberg eine Nadel in das weiche Samtkissen, das er mit Lederschnüren um seinen Bauch gebunden hatte. Dann bahnte er sich einen Weg durch die Stapel von Tuchproben, abgetrennten Ärmeln, Kleiderpuppen und Garnrollen und öffnete ein Fenster, um einen Blick in die Gasse zu werfen, die am nahe gelegenen Klosterplatz von St. Maximin vorbeiführte.
Dort herrschte geschäftiges Treiben. Trotz des wechselhaften Wetters hatten einige seiner Zunftgenossen ihre Tische und Garntruhen vor die Häuser getragen, um frische Luft zu schnappen. Das muntere Geplauder der Handwerker vermengte sich mit dem Geschnatter der Gänse und dem Geklapper von Tongeschirr, das aus den geöffneten Fenstern der umliegenden Häuser ins Freie drang. Die Handwerker, die sich jenseits des alten Nordtores angesiedelt hatten, bewohnten niedrige Holz- und Lehmhäuser, deren Erker beinahe mit den Vordächern der gegenüberliegenden Gebäude zusammenstießen. Über die Gassen waren Wäscheleinen gespannt, an denen Kleider, geflochtene Körbe, Seile und Ölkrüge befestigt waren. Im Sommer spendeten die vorgebauten Dächer kühlenden Schatten, im Winter hingegen erweckten sie ein trostloses Gefühl der Enge.
Die Tuchmacher, Walker, Schönfärber und Gewandschneider, die das geschäftige Klosterviertel bevölkerten, waren robuste Gesellen. Sie hatten sich entschieden, ihre Werkstätten und Buden außerhalb des befestigten Stadtgürtels aufzuschlagen, um sich der Aufsicht des Bischofs und der strengen Marktgesetze zu entziehen. Dafür vertrauten sie sich dem Schutz an, den die Nähe der Abtei von St. Maximin bot. Die Mönche waren umgänglicher als die steifen Pfaffen in der Stadt, außerdem ging die zuweilen stupide Tätigkeit ihres Gewerbes in einer so buntgemischten Gesellschaft leichter von der Hand. Warum sollte man sich nicht mit seinen Nachbarn über die Beschlüsse der Ratsherrn oder des Domkapitels austauschen oder gemeinsam über die gestiegenen Preise für Garn, Leinen und Samt jammern? Vor den Toren des Klosters machten Neuigkeiten für gewöhnlich rasch die Runde. Pilger und Ritter zogen hier vorbei. Und nicht selten lockte man den einen oder anderen neuen Kunden, der auf dem Weg zum Kloster war, über die Schwelle der Werkstätten.
Ein Jüngling mit Sommersprossen grüßte Kastenberg höflich. Der Alte erwiderte den Gruß, dann schlug er das Fenster so heftig zu, dass die dünnen Bleiglasscheiben zitterten. Nach einem Schwatz unter Zunftbrüdern stand ihm heute nicht der Sinn. «Verflixte Schlamperei», knurrte er. «Nie wieder vertraue ich auf die Hilfe junger Müßiggänger! War doch klar, dass der Sohn eines Patriziers sich heute nicht mehr an das erinnert, was er gestern versprach.»
Seine Enkelin Lucia blickte von ihrer Näharbeit auf. Ein nachsichtiges Lächeln glitt über ihre Lippen. Sie war ein aufgewecktes Mädchen von achtzehn Jahren und arbeitete schon lange in der Gewandschneiderei. Sie wusste genau, wie sehr ihr Großvater es hasste, bei den letzten Anproben vor einer wichtigen Lieferung an die Kirche versetzt zu werden. Insbesondere vor den hohen Feiertagen fiel in der Gewandschneiderei jede Menge Arbeit an. Die bestellten Gewänder mussten noch zugeschnitten, geändert, anprobiert und ausgeliefert werden. Passten sie nicht wie angegossen, schadete dies Kastenbergs Ruf und seinem Geldbeutel.
«Die Scheiben werden Sprünge bekommen, wenn du das Fenster so heftig zuschlägst. Dreimal musste der Glaser schon kommen. Und er wartet immer noch auf sein Geld.»
«Soll er warten, meine Rechnungen werden auch nicht pünktlich bezahlt!»
Lucia zuckte mit den Achseln. Ihre Finger waren kalt geworden, weder sie noch Melchior hatten daran gedacht, im Ofen Feuerholz nachzulegen. Nun aber, als sie die Nadel für einen Augenblick beiseitelegte, spürte sie, wie steif ihre Gelenke geworden waren. Auch der Rücken schmerzte Lucia, dabei hatte sie noch mehrere Stunden langweiliger Arbeit vor sich.
Am Kreuzbalken, der die Nähstube vom eigentlichen Ladenraum abteilte, hatte Kastenberg eine Reihe bunter Gewänder aufgehängt: kirschrote Priesterroben für den Karfreitag, goldene für das sich anschließende Hochfest und Schärpen in sattem Grün, die von den geistlichen Herren zu Sonntagsmessen und an Werktagen angelegt wurden. Ein Durcheinander von Samt- und Leinenstoffen, aufgeschnittenen Filzresten, Wachstafeln und Plätteisen verteilte sich in Körben und Schachteln quer über den Boden bis hin zur Werkstatttür.
«Wahrscheinlich wurde Paulyn am Nordtor oder beim Überqueren der Römerbrücke aufgehalten», versuchte Lucia ihren Großvater zu besänftigen. «Du weißt doch selbst, wie schwierig es für ihn ist, zu dieser Stunde noch an den bischöflichen Wachen vorbeizukommen.»
Melchior blickte erstaunt auf und schüttelte den Kopf. «Ich wusste nicht, dass Paulyn Ärger hat. Obwohl … Unverbesserliche Faulpelze und Träumer wie er geraten doch ständig in Schwierigkeiten, nicht wahr?»
Lucia seufzte leise; sie hatte sich längst damit abgefunden, dass ihr Großvater trotz seiner Gutmütigkeit für die Nöte anderer Menschen nur wenig Mitgefühl aufbrachte. Auch um die Lage des Reiches kümmerte er sich nur, wenn seine Gewandschneiderei davon betroffen war. Für ihn waren die Krisen der Mächtigen schon immer etwas gewesen, das ihn nichts anging. Dies hatte sich an jenem Tag geändert, als er seinen Sohn an die Pläne eines ehrgeizigen Königs verloren und die verwaiste Lucia in sein Haus aufgenommen hatte. Damals hatte er kurzerhand beschlossen, seine Enkeltochter zur Gewandschneiderin auszubilden, und seine Entscheidung in all den Jahren nie bereut, denn Lucia ging mit Nadel und Garn äußerst geschickt um. Auch ihre Einfälle waren durchaus brauchbar, wenngleich sie für seinen Geschmack mitunter etwas gewagt waren. Dennoch ahnte Melchior, dass das Herz seiner Enkelin nicht so sehr für Roben, Schleier und den anderen Weiberkram schlug, wie es bei den Mädchen ihres Alters sonst der Fall war. In der Regel gehörten diese auch längst nicht mehr dem Jungfrauenstand an. Sie waren vermählt, hatten Kinder und führten nicht dem Großvater, sondern ihrem Ehemann die Wirtschaft.
Stumm beobachtete Kastenberg die junge Frau. Sie war keinesfalls hässlich mit ihren braunen Augen und den markanten, hohen Wangenknochen. Und über Geschmack verfügte sie auch, obgleich sie ihre eigene Kleidung für gewöhnlich betont schlicht und schmucklos hielt. Warum also hatte sie nicht den gottgewollten Wunsch, einen Mann glücklich zu machen? Als der Alte bemerkte, dass Lucia seinen Blick erwiderte, fuhr er sich verlegen durch das Haar.
«Wie die Mehrheit der Ratsmitglieder hält es Paulyns Vater mit dem Manderscheider Grafen», erklärte Lucia. «Er unterstützt ihn in seinem Kampf um das Amt des Erzbischofs, weil er ja bereits Domherr ist und die Verhältnisse in der Stadt gut kennt. Im Unterschied zu dem fremden Herrn aus Speyer.»
«Paulyn und sein Vater können viel erzählen! Mir ist es gleich, wer sich die Albe überstreift, solange sie nur aus meiner Werkstatt stammt und tadellos sitzt. Schließlich hat schon mein Vater am Weberbach die liturgischen Gewänder entworfen und genäht.»
Lucia unterdrückte ihren Wunsch zu widersprechen. Melchior Kastenberg ließ nur allzu gern die Vergangenheit hochleben, wenn ihm die Zukunft nicht behagte. Lucia aber dachte mit Sorge an die nahezu leere Kasse, die Melchior hinter einem losen Stein an der Treppe zum Vorratskeller aufbewahrte. Seit der alte Bischof Konrad von Ziegenhain gestorben war, hatte keiner ihrer geistlichen Auftraggeber mehr seine Rechnungen bezahlt. Das Geld war knapp geworden, und von der Ehre, sich bischöflicher Gewandschneider nennen zu dürfen, bekam Lucia weder ihren Großvater noch dessen Gesinde satt. Die Hausmagd weiter zu beschäftigen, war ohnehin eine Verschwendung, die Lucia nachts den Schlaf raubte.
Aber auch auf den Märkten der Stadt, in den Gildehäusern und den Domfreihöfen ging nun schon seit Wochen das Gefühl drohenden Unheils um. Keiner, weder Rat noch Klerus, konnte vorhersagen, wie lange der Frieden im Bistum andauern würde. Möglicherweise war der Manderscheider es bald leid, dass ihm die Trierer Ratsherren den Einzug in die Stadt verweigerten. Das Domkapitel sprach sich fast geschlossen für ihn aus und drohte damit, keine Messen mehr lesen zu lassen, ehe die Ratsherren nicht eingelenkt und den vom Papst eingesetzten Speyrer Bischof Raban von Helmstadt davongejagt hatten.
«Ich begreife nicht, wie es so weit kommen konnte.» Melchior Kastenberg machte eine abfällige Handbewegung in Richtung des bestickten Gewandes, in dem noch die Nadeln steckten. «Mit unserem alten Bischof, Gott hab ihn selig, hatte die Stadt selten Schwierigkeiten, aber kaum ist er unter der Erde, da kreisen auch schon die Aasgeier über Trier. Sie sind maßlos in ihrer Gier nach Macht und Pfründen, die ihnen nicht zustehen. Und die ehrenwerten Kaufherren? Sie legen sich in dem Streit nicht fest. Auf die Entscheidung des Papstes wollen sie nicht hören, weil sie befürchten, dass ein fremder, zu papsttreuer Bischof wie Raban die Zölle an den Moselbrücken erhöhen und sich mit den Luxemburgern anlegen könnte. Das Domkapitel bevorzugt mal diesen, mal jenen Bewerber. Einerseits hoffen die Herren, dass ihre Macht wächst, wenn sie einen aus ihrer Mitte hofieren, andererseits sind sie zu stolz, sich zu entscheiden. Du wirst sehen, Lucia, die Männer schaufeln sich noch ihr eigenes Grab. Eine Ausnahme mag Kaufmann Emmerich sein. Er ist klug und außerdem sehr geduldig. Ich verstehe gar nicht, warum du dich so dagegen sträubst, ihm einmal zuzulächeln. Das kostet weniger als eine zerbrochene Fensterscheibe. Und es liegt doch auf der Hand, dass er sich für dich interessiert, sonst würde er dir beim Kirchgang nicht heimlich zunicken.»
Mit müden Schritten stapfte der Schneider hinüber zum Wandschrank und entnahm ein sauberes Wams aus dunkelgrünem Tuch. Ungeschickt nestelte er an den Haken, um es sich über den Kittel zu streifen. Lucia hätte ihm gern dabei geholfen, doch sie wusste, dass er es nicht mochte, wenn sich eine Frau an seinen Kleidern zu schaffen machte. In diesen Dingen war er eigen und sogar ein wenig eitel. Lucia musste sich ein Lächeln verkneifen. Sie fand, dass ihr Großvater für sein Alter noch immer gut aussah. Er hatte breite, beinahe muskulöse Schultern, welche die landläufige Meinung, Schneider seien schmächtig, Lügen straften. Sein silbergraues Haar fiel ihm in sanften Wellen über die Schultern. Über das bartlose, scharf geschnittene Gesicht zogen sich nur wenige Falten. Lucia konnte sich vorstellen, dass Kastenberg in jüngeren Jahren viele bewundernde Frauenblicke auf sich gezogen hatte. Obwohl er tagein, tagaus auf dem Schneidertisch hockte, waren seine Beine stämmig, der Rücken gerade und sein Blick der eines Falken. Nur an sehr trüben Tagen im Winter benutzte er ein dickes, in Blei gefasstes Sehglas, das ihm sein Freund, Vater Reginald von St. Maximin, zur Verfügung gestellt hatte.
Lucia legte den Saum, dessen Nähte sie gerade aufgetrennt hatte, zur Seite und gesellte sich zu ihrem Großvater. Liebevoll berührte sie den Arm des alten Meisters und lächelte ihn an. Doch er schien Lucia nicht einmal zu bemerken. Erst als sie sich enttäuscht abwenden wollte, nahm er ihre Hand und drückte sie kurz. Er hatte Sorgen, das verstand sie. Aber da war noch etwas anderes in seinen Augen, ein seltsames Funkeln, das sie nicht zu deuten wusste.
Sie kehrte zum Nähtisch zurück und beugte sich über die Schiefertafel, auf der sie das Muster einer Albe gezeichnet hatte. Mit einem Kreidestück versah sie das geistliche Kleidungsstück mit dem obligatorischen Schultertuch und einem Cingulum.
«Vergiss nicht, dass der Gürtel wenigstens eine Elle lang sein muss», brummte Melchior, nachdem sie ihm den Entwurf gezeigt hatte. «Und den dritten Teil der Stola lässt du frei für die Stickereien. Der Himmel allein weiß, was unseren Herren hierzu noch einfallen mag. Wahrscheinlich muss ich auf dem Rückweg vom Domplatz beim Garnhändler vorbeischauen, um einige Spulen Silberfäden zu bestellen.»
Lucia nickte verständnisvoll. Sie spürte, dass ihren Großvater etwas anderes beschäftigte als sein Auftrag, wagte es aber nicht, ihn danach zu fragen. Für gewöhnlich besprach er seine Sorgen mit Vater Reginald oder dem städtischen Münzmeister, aber niemals mit ihr. Auch wenn Kastenberg es nie offen äußerte, lag auf der Hand, dass seine Schneiderei ohne Lucias Mühen längst nicht mehr bestehen würde. Mit List und Schmeichelei hatte sie ihm das Recht abgetrotzt, nicht nur Schleppen auszulassen oder Röcke und Schalkragen für die Frauen der Trierer Patrizier zu nähen, sondern auch in die Geheimnisse der liturgischen Gewänder eingewiesen zu werden. Anfangs war Kastenberg nicht begeistert gewesen, doch inzwischen hatte er sich damit abgefunden, dass Lucia eigenständig Muster entwarf und diese persönlich bei den Stickerinnen der Klostersiedlung in Auftrag gab. Nähten nicht auch die Nonnen des Dominikanerordens geistliche Kleidung für Männer? Wen sollte es also stören, wenn Lucia ihrem Großvater zur Hand ging, solange seine Auftraggeber nichts davon wussten.
«Es hilft nichts, ich werde auf die Anprobe verzichten müssen», sagte Melchior niedergeschlagen, als das Läuten der Glocken von St. Maximin in die Stube drang, das die Mönche zum Gebet der Vesper rief. An manchen Tagen konnten die Bewohner der umliegenden Häuser und Werkstätten den melodischen Gesang der frommen Brüder selbst bei geschlossenen Türen und Fenstern hören.
«Über dem Dom stehen schon dunkle Wolken. Wenn ich mich jetzt nicht auf den Weg mache, lässt man mich heute gewiss nicht mehr zum Dompropst.»
Lucia musste ihm beipflichten. Wenn er seine Lieferung bei einem Diener des Propstes zurücklassen musste, würde er heute bestimmt kein Geld mehr bekommen. Vermutlich würden die Herren ihn im Kreuzgang warten lassen, bis er vor Müdigkeit zusammenbrach. Kurz entschlossen räumte sie den Schemel frei, auf dem Paulyn für gewöhnlich stand, wenn er Messgewänder und Stolen anprobierte. Dann nahm sie das Altarhemd, warf ihre widerspenstigen Haare zurück und begann, sich das glockenförmige Kleidungsstück über den Kopf zu streifen. Entsetzt starrte Kastenberg sie an.
«Was machst du da, Mädchen? Hast du den Verstand verloren, oder willst du mich ruinieren?»
«Keines von beiden, Großvater. Ich weiß, wie wichtig dir der Auftrag des Dompropstes ist, und außerdem hat der Garnhändler uns bereits mehrfach gemahnt. Keine Spanne will er mehr liefern, wenn wir die ausstehenden Rechnungen nicht begleichen. Und da Paulyn nicht erschienen ist, werde ich das Gewand anprobieren.»
Hilflos griff Melchior nach der Elle. «Aber du kannst doch nicht die Albe eines geweihten Dompropstes berühren. Ein Weib darf keine Männerkleidung tragen, schon gar keine geistliche, das wäre ein Frevel, der mich meinen Hals kosten könnte. Außerdem ist das Gewand …»
«Keine Bange», erklärte Lucia mit einem spöttischen Lächeln. «Der ehrwürdige Propst ist ein wenig schwächer gebaut als ich, insbesondere um die Hüften herum.»
«Das ist meine geringste Sorge! Der edle Herr hat seit meinem letzten Besuch im Kapitelhof mehr Fett angesetzt als ein Spanferkel. Kein Wunder, da sich seit neuestem zwei Anwärter auf den Bischofsstuhl gleichzeitig um seine Gunst bemühen. In seinem Weinkeller soll schon kein Platz mehr für all die Fässer sein, die ihm die beiden Streithähne zukommen lassen. Allerdings hat Gott ihn mit … äh … etwas weniger üppigen Brüsten gesegnet als dich!» Melchior spürte, wie ihm das Blut in die Wangen schoss, und wandte sich ab. Nun hatte dieses junge Ding es tatsächlich wieder einmal geschafft, ihn mit seiner Unbefangenheit anzustecken. «Lass endlich den Unfug bleiben», knurrte er mit gespielter Strenge. «Und steig von dem Schemel herunter. Du brichst dir noch den Hals, und mich machst du ganz wirr im Kopf.»
Lucia musste lachen. Sie streckte beide Arme aus und ließ den weichen Stoff an ihrem schlanken Körper hinabgleiten. Wenige Blicke genügten, um festzustellen, dass die Arbeit des Großvaters gelungen war. Die Nähte waren sauber gezogen, und zwei seitliche Einschnitte ließen dem Träger des Gewandes ausreichend Bewegungsfreiheit. Mochte der Propst auch weiterhin seine Tage mit Prassen und Schmausen zubringen, diese Kasel würde ihn vermutlich noch in sein Grab begleiten.
Sorgfältig legte Lucia die Gewänder zusammen, schlug sie in ein Tuch und übergab sie ihrem Großvater mit einem entwaffnenden Lächeln. «Ich denke, der Propst wird keinen Anstoß daran nehmen!»
Sie begleitete den alten Mann zur Tür und blickte ihm nach, bis er hinter den Wirtschaftsgebäuden des Simeonstifts verschwunden war. Wenn das nur gutgeht, dachte sie. Hoffentlich ließ Melchior sich nicht wieder mit einem huldvollen Lächeln und einem Schuldschein abspeisen.
Als ihr Blick die Mauern und Türme streifte, überfiel sie plötzlich ein beklemmendes Gefühl. Von Osten her jagten heftige Windböen über die Dächer der gedrungenen Fachwerkhäuser. Das dichte Laub der Bäume und Hecken, welche die Gärten sowie den Gottesacker des Klosters umfriedeten, rauschte, dass es wie aufgeregtes Geflüster klang. Die Glocken der Klosterkirche waren noch immer nicht verstummt. Obwohl Lucia ihren Klang gernhatte, verursachte das monotone Dröhnen ihr nun Unbehagen, zumal es keinen ersichtlichen Grund für das anhaltende Läuten gab.
Neugierig geworden, bedeckte Lucia ihr Haar mit einem Schultertuch und eilte dem Klosterhof entgegen. Um diesen zu erreichen, musste sie nur einen kurzen Weg zurücklegen, am Brunnenplatz vorbei, der zu dieser Tageszeit verödet vor ihr lag, dann einen schmalen Pfad entlang, über den für gewöhnlich die zum Klosterbesitz gehörende Schafherde getrieben wurde. Das Gras war noch feucht vom Regen der vergangenen Nacht und gab unter dem Gewicht ihrer Sandalen nach. Nur wenige Menschen hielten sich zu dieser Stunde noch in der Gasse auf, die meisten hatten sich in ihre Behausungen zurückgezogen. Einige der jüngeren Männer standen jedoch in kleinen Gruppen beisammen und deuteten auf die Klosterkirche. Vor dem Altgewandhaus, dessen ältester Teil aus der Zeit stammte, in der die Römer am Rhein gelebt hatten, beeilte sich das Weib eines Wollwebers, gemeinsam mit der Magd, den Webstuhl ihres Gatten über die hohe Türschwelle zu schaffen.
Die Unruhe trieb Lucia weiter. Zu ihrem Erstaunen bemerkte sie, dass weder das große Tor noch die schmale Pforte zum Klosterhof verschlossen war. Als sie durch die Pforte trat, fiel ihr Blick auf eine Schar von Mönchen, die sich um das steinerne Hofkreuz scharte und miteinander flüsterte.
Irgendetwas Schlimmes musste geschehen sein, wenn die Mönche ihr Gebet abkürzten und die Tore öffneten. Als Lucia sich umwandte, bemerkte sie, dass ein gutes Dutzend Bewohner der Klostersiedlung, darunter die Frau des Wollwebers, ihrem Beispiel gefolgt und ans Tor gelaufen war.
«Was soll dieses fürchterliche Sturmläuten?», fragte die rundliche Meisterin. Doch Lucia wusste keine Antwort und hob nur ratlos die Schultern. In Erwartung eines drohenden Unheils wanderten ihre Blicke von der Klosterkirche hinüber zum Turm des Stadttors, von dem in der fortgeschrittenen Dämmerung freilich nur noch die Umrisse zu erkennen waren. Sie musste an ihren Großvater denken, der inzwischen vermutlich den Domfreihof erreicht hatte und im Kreuzgang der Liebfrauenkirche auf den Diener des Propstes wartete. Wenn das Tor nun früher geschlossen wurde, konnte der alte Mann in dieser Nacht nicht mehr nach Hause zurückkehren. Und das, wo Kastenberg die Dunkelheit mehr hasste als eine verpatzte Naht. Sie tröstete sich mit dem Gedanken, dass er in diesem Fall sicherlich bei Freunden, die am Marktplatz wohnten, unterkommen würde.
Unweit des alten Gräberfelds entdeckte sie Vater Reginald. Vor Jahren hatte sich der arme Mann abgemüht, Lucia Lesen und Schreiben beizubringen. Sein Unterricht hatte nur wenige Früchte getragen.
«Was willst du, sie ist nun mal ein Soldatenkind», hatte Vater Reginald zu Kastenberg gesagt. «Sie kann die Hände weder in den Schoß noch um die Seiten eines Buches legen. Finde einen guten, gottesfürchtigen Mann für sie, für den Rest wird unser Herrgott schon sorgen.» Obwohl Lucia vermutete, dass sie Vater Reginald mit ihrer Ungeduld enttäuscht hatte, war er ihr auch in den folgenden Jahren stets ein väterlicher Freund geblieben. Er hatte sie über den frühen Tod ihrer Mutter und das Ausbleiben des Vaters mit Worten getröstet, die dem ruppigen Melchior Kastenberg niemals über die Lippen gekommen wären.
Vater Reginalds gutmütiges Gesicht mit den buschigen Augenbrauen war heute blass und wirkte auf Lucia erschreckend angespannt; nachdenklich starrte der alte Mann zum Glockenturm hinauf, hinter dem die Sonne in einem Meer aus kupferroten Funken unterging.
Noch ehe Lucia ihren ehemaligen Lehrer auf sich aufmerksam machen konnte, setzten weitere Glockenschläge ein. Sie drangen vom Dom herüber und erinnerten noch deutlicher an Sturmgeläut als die Klänge von St. Maximin. Als Lucia einige Mönche mit Fackeln aus dem Refektorium treten und auf das Tor zur Siedlung der Färber und Tuchweber zustreben sah, schlug ihr Herz vor Aufregung schneller. Ohne sich um die Blicke und das Getuschel der umstehenden Handwerker, Gesellen und Mägde zu kümmern, lief sie über den dämmrigen Hof, geradewegs auf Vater Reginald zu. Dieser empfing das Mädchen mit einem vorwurfsvollen Kopfschütteln.
«Du hättest am Tor warten sollen, bis der Bruder Kellermeister euch eintreten lässt, dummes Kind!» Trotz seiner tadelnden Worte berührte der Mönch Lucias Lockenkopf mit einer beinahe zärtlichen Geste. Es machte ihm nichts aus, dass seine Ordensbrüder ihn dabei sehen konnten.
«Na ja, jetzt bist du hier, und ich freue mich, dich zu sehen.»
«Was ist denn passiert, Vater?», fragte Lucia. «Warum läuten zu dieser Stunde die Glocken? Ist etwa schon wieder ein Bischof gestorben? Und warum öffnet ihr die Tore zur Klostersiedlung, sodass jeder hereinspazieren kann?»
Vater Reginald antwortete nicht sofort, denn im gleichen Moment geschah etwas, das seine Aufmerksamkeit vollkommen in Anspruch nahm. Drei Reiter preschten in wildem Galopp durch das Klostertor, ohne die herandrängenden Menschen überhaupt wahrzunehmen; erschrocken sprangen die Mönche mit ihren Fackeln zur Seite, um nicht von den Hufen der Tiere niedergetrampelt zu werden.
Die Männer ritten zielstrebig auf das Refektorium zu, ein kastenförmiges Gebäude aus grauem Feldstein, das direkt an die Mauern des Gotteshauses anschloss. Sie trugen Brustharnische aus stumpfem Erz, Beinschienen und Helme, die nach burgundischem Vorbild wie Teller geformt waren. Die Farben ihrer Umhänge und Wappen ließen erkennen, dass zwei von ihnen zu den Bewaffneten gehörten, die Bischof Raban von Helmstadt zu seinem Schutz angeworben hatte. Es hieß, der neue Bischof fürchtete in der Stadt um sein Leben und sei fortwährend vor Anschlägen auf der Hut. Seine Hofhaltung ähnelte weniger einer geistlichen Residenz als vielmehr einer Festung, in die nur seine engsten Vertrauten Einlass fanden.
Der dritte Reiter war bis auf seine wattierten Handschuhe deutlich nachlässiger gerüstet als seine Begleiter, offensichtlich gehörte er nicht zu den Soldaten, sondern war ein weltlicher Abgesandter des Schöffenrats, der von den Bischöflichen lediglich geduldet wurde und sein Pferd in einigem Abstand zu ihnen zügeln musste.
«Was haben die bischöflichen Soldaten hier zu suchen?», fragte Lucia.
«Büschfeld und Niederlosheim stehen in Flammen», antwortete Vater Reginald leise. «Unser Glöckner hat das Feuer vom Kirchturm aus entdeckt, als er zur Vesper läuten wollte.» Der Mönch hielt einen Moment lang inne, um sich zu sammeln, doch ein Laut hilflosen Zorns drang aus seiner Kehle. «Das ist Ulrich von Manderscheids Werk», stieß er hervor. «Seine Männer haben die Dörfer geplündert, um zu zeigen, dass der Graf Trier jederzeit in die Knie zwingen kann.»
Ungläubig starrte Lucia den alten Klosterbruder an. Sie erinnerte sich daran, mit wie viel Hochachtung die Bekannten ihres Großvaters vom Manderscheider gesprochen hatten. Der Trierer Rat unterstützte doch Ulrichs Ansprüche auf den geistlichen Stuhl. Hatten sich die Schöffen womöglich in ihm getäuscht?
«Und das ist leider noch nicht alles», fuhr der Mönch fort. «Da unser Domkapitel das Vorgehen des Grafen gutheißt, soll es exkommuniziert werden, und mit ihm zahlreiche geistliche Würdenträger des Bistums. Wenn Bischof Raban sich wirklich durchsetzt, werden wir in Trier fortan keine Messen mehr lesen dürfen. Wir werden keine Beichte mehr abnehmen, keinen Sterbenden mit den heiligen Sakramenten ausstatten und niemanden in geweihter Erde begraben, ehe nicht der letzte Mann Raban die Treue geschworen hat.»
Angst überkam Lucia. Sie rannte hinüber zur Mauer und erklomm sie über einige ausgetretene Stufen, die auf eine kleine Plattform mit Holzgeländer führten. Als sie den Blick gen Norden wandte, sah sie, dass sich der Himmel über den Wäldern rot gefärbt hatte. Unweit vor den Toren Triers brannten zwei Bauerndörfer lichterloh. Lucias Wangen begannen zu glühen, als spürte sie selbst den Flammenwall; sie mochte sich gar nicht ausmalen, was sich in den schutzlosen Siedlungen zu dieser Stunde abspielte.
Auf einmal fühlte sie Vater Reginalds schwere Hand auf ihrer Schulter. Sie hatte ihn nicht kommen gehört.
«Wir sind hier nicht mehr sicher, nicht wahr, Vater?», flüsterte sie leise. «Graf Ulrich will die Stadt in die Knie zwingen, und unsere Klostersiedlung liegt außerhalb der Befestigungen. Sie ist leicht einzunehmen. Wenn Manderscheids Truppen auch uns angreifen …»
Der Mönch schüttelte abwehrend den Kopf; ein Windstoß blähte die Kapuze seiner groben Kutte auf wie ein Segel. «Davor mögen uns alle Heiligen bewahren, mein Kind. Der Manderscheider mag gewisse Rechte haben, aber er riskiert es, seine Seele an den Teufel zu verlieren, wenn er ein Kloster plündern lässt, das die Ruhestätte heiliger Bischöfe und Märtyrer ist. Nein, das wird er nicht wagen, so ehrgeizige Ziele er auch verfolgt. Das Einzige, was wir momentan tun können, ist zu beten und unsere Tore für jedermann zu öffnen, der keine Möglichkeit hat, jenseits des Stadttores Zuflucht zu suchen.»
Wie gebannt starrte Lucia auf die sich langsam nähernden roten Punkte, die unweit der Moselniederung wie Glühwürmchen um die Wipfel der Bäume tanzten. Sie glaubte sogar, Brandgeruch und Gebrüll von Vieh wahrzunehmen. Tief unter ihr drängten sich derweil die Menschen durch beide Flügel des hölzernen Tores, viele schleppten Bündel und Kisten mit ihren Habseligkeiten heran oder schoben Karren, auf denen eilig zusammengetragener Hausrat lag. Einige Knaben trieben Hühner, Gänse und eine Ziege über den Hof.
Was soll nur aus uns werden, dachte Lucia verzweifelt. Die Gewandschneiderei, in der sie und ihr Großvater vor nicht einmal einer Stunde noch friedlich gearbeitet hatten, würde es vielleicht schon bald nicht mehr geben. Nach dem, was Vater Reginald ihr erzählt hatte, waren die Herren des Domkapitels und mit ihnen alle höheren Geistlichen der Stadt, die sich Bischof Raban widersetzten, dem Kirchenbann verfallen. Sie würden Kastenberg keine Aufträge mehr erteilen, geschweige denn, ihn für seine bisherigen Dienste entlohnen. Der neuberufene Bischof galt als misstrauisch gegenüber jedermann, ob es sich nun um Ratsherren, Kaufleute oder Gewandschneider handelte. Von ihm war keine Hilfe zu erwarten. Doch selbst wenn der Großvater seinem Gewerbe weiterhin nachgehen durfte, so war es nur eine Frage der Zeit, bis Graf Ulrich von Manderscheid und seine Ritter die schlechtbefestigte Klostersiedlung einnehmen und ihnen das Dach über dem Kopf anzünden würden.
«Bring eure Sachen besser gleich in den Hof, mein Kind», riet Vater Reginald. «Ich werde dafür sorgen, dass man dir eine Kammer im Gesindetrakt der Laienbrüder zur Verfügung stellt. Dort werden auch Frauen und Mädchen geduldet, solange sie sich zu benehmen wissen.»
Lucia seufzte. Vater Reginald konnte es einfach nicht lassen, wie ein Schulmeister zu reden. Unterhalb der Mauer erleichterte sich einer der Laienbrüder gerade mit heruntergelassenen Hosen gegen den Torpfosten. Danach rupfte er Gras aus, um sich zu säubern. So viel zum guten Benehmen der Männer, das keiner der Mönche, nicht einmal Vater Reginald, in Frage stellte.
Das Glockengeläut war inzwischen verstummt, und aufgeregte Rufe hallten über den Hof. Endlos schien der Strom von Menschen und Tieren, die sich durch die Pforte zwängten, während sich unter dem Torbogen Karren und Fuhrwerke stauten. In dem Getümmel erkannte Lucia die Wollweberin, die ihre Magd mahnte, mit dem kostbaren Webstuhl vorsichtig umzugehen. Doch unter den Ankömmlingen befanden sich auch zahlreiche Menschen, die Lucia nicht kannte. Ihrer schäbigen Kleidung nach zu urteilen, handelte es sich bei den meisten um Bauern aus benachbarten Weilern. Vermutlich hatten sie ihre Gehöfte verlassen, nachdem sie von der Plünderung der beiden Dörfer erfahren hatten. In diesem Augenblick traf Lucia eine Entscheidung.
«Ich danke Euch, Vater, aber es ist mir nicht möglich, Euer Angebot anzunehmen», sagte sie entschlossen. «Großvater und ich werden die Stadt verlassen, denn hier sitzen wir in der Falle. Bleiben wir, werden wir über kurz oder lang als Bettler oder im Schuldturm enden, und wir wissen doch beide, dass Melchior Kastenberg lieber tot umfallen würde, als auf Almosen angewiesen zu sein.»
«Aber es wird ihm auch das Herz brechen, wenn du ihn nach all den Mühen, die ihm die Gewandschneiderei auferlegt hat, nun in die Fremde entführst», brauste der alte Mönch auf. «Hast du vergessen, seit wie vielen Generationen deine Familie im Erzbistum ansässig ist? Dein Urgroßvater hat schon für Fürstbischof Balduin die Albe genäht. Der Onkel deiner Mutter war ein allseits geachteter Schöffenmeister und mit den ersten Patriziersippen der Stadt verschwägert.»
«Erinnerungen an gute Zeiten haben noch keinen Magen gefüllt», erwiderte Lucia. «Wir hätten Trier schon vor Monaten verlassen sollen, gleich nachdem die Entscheidung des Papstes unsere Stadt in zwei Lager gespaltet hat. Nein, ehrwürdiger Vater, hier haben wir Gewandschneider keine Zukunft mehr. Woanders hingegen …» Sie hielt einen Moment lang inne, um nachzudenken. «Man erzählt sich, dass unsere Zunftgenossen in Basel ein recht angenehmes Leben führen. Nachdem der Heilige Vater im vergangenen Jahr dort das Konzil einberufen hat, können sich geschickte Handwerker vor Aufträgen kaum noch retten.»
Vater Reginald unterdrückte die bittere Bemerkung, die ihm auf der Zunge lag. Es stimmte. In Basel pulsierte zurzeit das Leben, doch hatte das Licht des Konzils leider auch seine Schattenseiten. Es war kein Geheimnis, dass die Hurenhäuser und Schenken der Stadt seit Beginn des Konzils mehr Zuspruch hatten als sämtliche Kirchen und frommen Stifte zusammengenommen. Taschendiebe, Trunkenbolde und Glücksritter bevölkerten die Märkte. Für ein junges Mädchen wie Lucia, das daran gewöhnt war, allein durchs Leben zu gehen, war Basel ebenso gefährlich wie ein Basar im Morgenland.
Vater Reginald musste indes einsehen, dass es keinen Zweck hatte, die Enkeltochter seines alten Freundes umzustimmen; in ihr vereinigten sich der Eigensinn des alten Gewandschneiders und das heiße Blut seines Sohnes. Eine gefährliche Mischung. Eines Tages würde das arme Kind in Teufels Küche kommen, das spürte er in jedem Knochen seines Leibes.
Eine Weile stand der Mönch einfach nur da und dachte nach. Es gab da etwas, das er Lucia sagen wollte, doch entgegen seiner ansonsten eher unverblümten Art fiel es ihm diesmal schwer, mit der Sprache herauszurücken.
«Vielleicht gibt es ja noch eine andere Möglichkeit für euch. Gestern überbrachte mir ein Pilger einen Brief, der in gewisser Weise an dich gerichtet ist.»
«In gewisser Weise?» Verwirrt schüttelte Lucia den Kopf. «Ich wünschte, Ihr würdet Euch etwas deutlicher ausdrücken, Vater.»
Der Mönch blickte sich nach allen Seiten um, als befürchtete er, unterhalb des Mauerabschnitts könnte ihn jemand belauschen. Mit gesenkter Stimme flüsterte er dem Mädchen zu: «Das Schreiben kommt aus Mainz, der Pilger sagte mir, eine Frau habe ihm aufgetragen, es hier abzuliefern …»
«Aus Mainz? Dann ist es von meiner Schwester?» Mit dieser Neuigkeit hatte Lucia nun wirklich nicht gerechnet.
«Nun, wie ich bereits versucht habe, dir zu erklären, wollte sie eigentlich mit dir Kontakt aufnehmen, aber wahrscheinlich kann sie sich gut daran erinnern, dass das Lesen von Urkunden und Briefen nicht gerade zu deinen Stärken gehört. Was ich dir übrigens noch immer übelnehme, mein Kind. Du erinnerst dich sicher: Usus homines multa docuit. Übung hat die Menschen vieles gelehrt.»
«Vater!»
«Na schön, jedenfalls sandte sie ihren Brief heimlich an die Abtei. Sie war ja lange genug meine Schülerin, um zu wissen, dass es zu meinen Aufgaben gehört, sämtliche Schreiben an den ehrwürdigen Abt zu sichten.» Er zögerte, ehe er leise hinzufügte: «Das arme Kind scheint in ernsthaften Schwierigkeiten zu stecken.»
Lucia runzelte die Stirn. Sie fand es merkwürdig, ja geradezu unangebracht, dass der Mönch ihre Schwester als armes Kind bezeichnete; in ihren Augen war Magdalena nie etwas anderes gewesen als eine eitle, leichtfertige Person, die es sich in Mainz als Gemahlin eines wohlhabenden Zunftmeisters gutgehen ließ, während die Kastenbergs ums nackte Überleben kämpften. Lucia erinnerte sich nur noch dunkel an die Jahre, die Magdalena und sie in ihrem Trierer Elternhaus zugebracht hatten. Wenn sie heute an die Schwester zurückdachte, fiel ihr ein Papier ohne Unterschrift ein, eine Laute, die niemand spielte, ein Gericht, das erkaltet war, weil niemand von ihm hatte kosten wollen.
War Magdalena wirklich so hübsch gewesen, wie viele behaupteten, hübscher als sie selbst? War sie so anmutig, geistreich und begabt, wie der Mönch behauptete, wenn ihn manchmal die Schwermut packte?
War sie nicht hinterhältig gewesen, lasterhaft und selbstgefällig? Immer nur auf den eigenen Vorteil bedacht? Lucia überkam ein eigenartiges Gefühl. Sie ahnte, dass das Bild, das sie von ihrer Schwester hatte, einer gerechten Bewertung nicht standhielt. Alles, was Lucia von Magdalena wusste, hatte sie den Äußerungen ihres Großvaters entnommen und den Gerüchten, welche schwatzhafte Dienstmägde und abgewiesene Verehrer hinter vorgehaltener Hand verbreitet hatten.
Doch selbst dieses Gerede lag lange zurück. Inzwischen schien Trier Magdalena Kastenberg vergessen zu haben, zumindest wenn man von Vater Reginald absah. Dieser hütete sich, bei seinen Besuchen in der Gewandschneiderei offen über seine ehemalige Lieblingsschülerin zu reden, aber Lucia konnte er nichts vormachen. Sie wusste, dass er sie selbst bei jeder sich bietenden Gelegenheit mit Magdalena verglich; und es kränkte sie zutiefst.
Dass Magdalena nach all den Jahren des Stillschweigens nun einen Brief an ihre Trierer Verwandten richtete, schien daher mehr als rätselhaft.
«Was ist, mein Kind? Werdet ihr nach Mainz gehen?», fragte Vater Reginald, als er Lucia wenig später mit energischen Gesten durch die Menge schleuste, die sich entlang der Ställe, Scheunen und Wirtschaftsgebäude des Klosters auf eine Belagerung einrichtete.
Ausweichend zuckte Lucia mit den Achseln, doch wenn man es recht besah, blieb ihr keine andere Wahl.
II
Paulyn Besselich spürte, wie ihm kalter Schweiß über die Stirn rann. Er wagte kaum, Luft zu holen, geschweige denn, sich zu bewegen. Dabei kribbelten seine Füße so heftig, als stünde er inmitten eines Ameisenhaufens.
Eine halbe Ewigkeit verharrte Paulyn schon in der unnatürlichen Haltung: die langen Beine leicht angewinkelt, die Arme vor der schmalen Brust gekreuzt. Sein Versteck, ein hohler Baumstamm unweit des Dorfangers, war alles andere als bequem, aber dafür entging er dem Schicksal, gemeinsam mit den vergebens um Hilfe rufenden Bauern zusammengetrieben und verschleppt zu werden.
Er war zu Tode erschöpft, doch der Schrecken, der ihm in den Gliedern saß, hielt ihn wach. Wie gelähmt vernahm er die verzweifelten Rufe der Männer, die sich mit Forken und Äxten gegen die übermächtigen Angreifer zur Wehr setzten. Doch nach einer Weile verstummten auch die letzten Klagelaute und gaben einer gespenstischen Friedhofsstille Raum, die nur vom Rauschen des Windes und dem Knistern der Flammen durchbrochen wurde.
Paulyn konnte sein Glück kaum fassen; die Reiter hatten ihn tatsächlich nicht bemerkt. Nur langsam verließ ihn das Gefühl der Anspannung, und ein befreites Schluchzen brach aus ihm heraus.
Vorsichtig neigte er den Kopf, um durch eines der Astlöcher zu spähen. Obwohl er sich für den Gedanken schämte, fand er es eigentlich gerecht, verschont geblieben zu sein. Schließlich war er nicht aus dem Dorf, er war weder ein zehntpflichtiger Bauer noch ein aufsässiger Leibeigener, der seinem Herrn die Abgaben oder den Frondienst schuldig blieb, sondern ein Bürger Triers und einziger Sohn eines Ratsherrn. Was hatte er schon mit den Fehden zu tun, die jenseits der Mauern seiner Vaterstadt ausgetragen wurden? Er war doch nur zufällig Zeuge der Brandschatzung geworden.
Paulyn fragte sich, ob seine Nachbarn die Plünderung des kleinen Dorfes wohl von den Stadtmauern aus mitangesehen hatten, verzweifelt und wütend, weil der neue Bischof ihnen nicht erlaubte, etwas zu unternehmen, was sein Bistum gefährdete.
Er musste an die Kastenbergs denken, die heute umsonst auf ihn gewartet hatten. Der Alte war ihm egal, doch beim Gedanken an Lucia wurde ihm warm ums Herz. Trotz seiner misslichen Lage verspürte er sogar eine plötzliche Erregung in der Lendengegend. Sie durfte ruhig ein wenig Angst um ihn haben. Wenn die Gewandschneiderin erfuhr, was er für sie auf sich genommen hatte und dass er als Einziger entkommen war, würde sie ihn gewiss nicht mehr wie einen unreifen Knaben behandeln. Auch freute er sich bereits darauf, ihr zu berichten, dass der Baum, ihr Baum, ihn gerettet hatte.
Für Lucia hatte dieser Baum eine besondere Bedeutung. Im vorletzten Frühjahr, kurz bevor ihre Mutter am Wechselfieber gestorben war, hatte er noch geblüht, im Sommer darauf Laub und Früchte getragen. Mit Wehmut erinnerte sich Paulyn daran, wie er und Lucia sich mit bloßen Füßen auf seine starken Äste geschwungen, grüne Äpfel verzehrt und gemeinsam auf die sanft dahinrauschenden Wellen der Mosel geblickt hatten.
Erneut spähte Paulyn durch das Astloch. Über den Wipfeln der Bäume wurde es allmählich dunkel. Er begann zu zählen, erst langsam, dann etwas schneller, bis er glaubte, sich endlich aus seinem Versteck wagen zu können. Vorsichtig zwängte Paulyn seinen hageren Körper durch die längliche Öffnung des Stammes, dann schulterte er das Bündel, das er bei sich trug, und lief mit wackeligen Beinen den Hügel hinunter. Es war riskant, den Weg durchs Dorf zu nehmen, möglicherweise machten sich noch immer Plünderer zwischen den rauchenden Ruinen zu schaffen. Oder einige der Bauern waren zurückgekehrt und hielten ihn für einen Plünderer. Aber wenn er sich nicht verlaufen wollte, musste er zumindest den kleinen Anger überqueren und den Pfad jenseits der Schafweiden einschlagen. Um nichts auf der Welt wollte er dem fremden Raubgesindel auf der Landstraße in die Hände fallen.
Mit klopfendem Herzen blickte er sich um, aber von den Bewaffneten war keine Spur mehr zu entdecken. Wie Gespenster waren sie über den kleinen Ort hergefallen, hatten ihm den Todesstoß versetzt und waren auf ihren Pferden verschwunden, ehe die Bauern auch nur begriffen hatten, wie ihnen geschah.
Dieses verdammte Pack hat ganze Arbeit geleistet, dachte Paulyn wütend, als er das Ausmaß der Verwüstung sah. An das Schicksal der Dorfbewohner dachte er dabei weniger; doch die Zerstörung des Ortes mit seinen blühenden Kräutergärten regte ihn auf. Lucia würde traurig sein, wenn sie davon erfuhr.
Überall waberten Rauchschwaden. Es war heiß, und der helle Qualm reizte Paulyn so sehr, dass er ein Husten nicht unterdrücken konnte. Seine Augen begannen zu tränen, sodass er kaum mehr als eine verschwommene, milchige Wand vor sich sah. Erst als der Abendwind langsam stärker wurde, erkannte er, dass er vor dem Haus des Dorfältesten stand. Wie die benachbarten Gehöfte war auch das große Lehmhaus den Flammen zum Opfer gefallen. Halbverkohlte Balken, zerschlagene Tonkrüge, zerfetzte Kissen und Strohsäcke bildeten eine Schneise der Zerstörung, die sich bis in den von Hufen niedergetrampelten Garten zog. Im Hof der Schenke, in der Paulyn noch am Nachmittag einen Krug Dünnbier getrunken hatte, lag der Wirt mit weit ausgestreckten Armen auf dem Rücken. Der rothaarige Hüne sah ganz friedlich aus, es schien, als habe er sich in das gelbe Gras gelegt, um ein wenig zu schlummern. Paulyn kniete sich neben den massigen Körper des Mannes und berührte vorsichtig seine Schultern. Doch dies war ein Fehler: Paulyn vernahm ein schreckliches Knacken, dann rollte der Kopf des Wirtes langsam über den sandigen Boden.
Mit einem Schrei sprang Paulyn auf. Der Wirt war enthauptet worden, aber seine Mörder hatten ihm den Kopf nur zur Hälfte abgetrennt und seinen Körper danach so hingelegt, dass jeder, der ihn fand, zunächst glauben mochte, er sei noch am Leben. Ein grausamer Scherz.
Entsetzt wandte Paulyn sich ab. Er trauerte nicht um den Wirt, den er kaum gekannt hatte, vielmehr bestürzte ihn das übermächtige Gefühl von Hilflosigkeit. Seine Finger verkrampften sich um die Schnüre des Bündels, und er dachte an den Gegenstand, den er bei sich trug. Er hatte sich bereit erklärt, ins Dorf zu gehen, um Lucia eine Freude zu machen. Und nun hatte er möglicherweise gar keine Gelegenheit mehr, ihr das begehrte Stück zu überreichen. Vermutlich hielten sich noch immer Plünderer in der Nähe auf, und wenn man ihn erwischte, war es aus mit ihm. Er würde Lucias strahlende Augen nie wieder sehen. Hätte ich nur mehr Talent darin, mit diesem Ding umzugehen, dachte er, ich würde mich auf die Lauer legen und ein paar dieser elenden Todesreiter erledigen.
Als er über den kleinen Dorfplatz lief, entdeckte er mehrere Pferde. Hatten die Plünderer sie etwa übersehen? Nein, dies waren keine Ackergäule, sondern Reitpferde. Gesattelt und mit kostbar verziertem Zaumzeug versehen, standen sie unter dem Vordach der Dorfkapelle. Paulyn blickte sich um. Es mussten also noch immer Menschen in der Nähe sein.
Der staubige kleine Dreschplatz, über den ansonsten Hühner flatterten und Korn rollte, lag wie ausgestorben vor ihm. Erst als Paulyn sich der Kapelle näherte, vernahm er plötzlich Stimmen. Die Kapelle, kaum mehr als eine Scheune mit breitem Rundbogentor, gehörte zu den wenigen Gebäuden, die vom Feuer verschont geblieben waren. Doch mit dem schwarzen Schiefer, der Turm und Dach bedeckte, wirkte auch sie bedrohlich.
Paulyns Brustkorb zog sich vor Angst zusammen. Er war von Natur aus weder neugierig noch wagemutig, sondern genoss zum Leidwesen seines Vaters vielmehr die Bequemlichkeiten des Stadtlebens; nun aber zog es ihn mit aller Macht auf die alte Kapelle zu. Er musste herausfinden, wer die Fremden waren. Leise pirschte er sich am Turm vorbei, bis er die Bretterwände der Kapelle in seinem Rücken spürte. Die beiden länglichen Fenster, die zum Dorfplatz zeigten, waren zu hoch für ihn, doch wenige Schritte vom Tor entfernt entdeckte Paulyn einige Balken in der Wand, die sich gelöst hatten; der Spalt war kaum größer als ein Spundloch, doch er genügte, um einen Blick ins Innere der schäbigen Kapelle zu erhaschen.
Fünf Männer zählte Paulyn in dem rechteckigen Raum. Mit dem Rücken zu ihm standen sie im Halbkreis um den Altar, einen zugeschnittenen Stein mit überladender Schieferplatte. Das Altartuch war verschwunden, auch fehlten die Kelche und das hölzerne Kreuz, vor dem der Dorfpriester für gewöhnlich die Messliturgie zelebrierte. Ein paar schwache Öllampen und zwei Pechfackeln, die in rostigen Halterungen an der Wand angebracht waren, spendeten ein mattes Dämmerlicht, das mehr verbarg als enthüllte.
«Ihr könnt Euch herausreden, bis Eure Zunge verdorrt», ertönte eine hohe, unangenehme Stimme. Es war die Stimme eines alten Mannes. «Ihr leugnet nicht einmal, dass Ihr wiederholt Gottes Gebote gebrochen habt?», zischte der Greis. «Du sollst nicht töten, heißt es in der Heiligen Schrift. Ihr aber täuschtet mich wie einst das listige Weib Rebekka, das seinem Lieblingssohn dabei half, dem blinden Vater durch Lug und Trug das Recht der Erstgeburt abzutrotzen. Ich muss ebenfalls blind und taub gewesen sein. Wie konnte ich mich nur auf Euer schmutziges Spiel einlassen!»
«Ihr wart weniger blind als vielmehr beseelt von heiligem Eifer, ehrwürdiger Vater», antwortete einer der Männer aus der Runde. Im Gegensatz zu dem aufgebrachten Fisteln des Alten vermittelte seine tiefe Stimme Gelassenheit und Selbstbeherrschung. Auch gab er sich keine Mühe, den spöttischen Unterton seiner Worte zu verbergen. «Ohne Eure Unterstützung hätten wir bei der Vertreibung des Bauerngesindels möglicherweise Verluste erlitten. Es war klug von Euch, uns nicht daran zu hindern.» Der Mann lachte humorlos auf; das wütende Schnauben des Alten überging er.
Paulyn stockte der Atem. Verdutzt zog er seinen Kopf zurück und dachte nach. Die Stimme des Mannes, der soeben die Brandschatzung gestanden hatte, kam ihm bekannt vor, aber ihm fiel nicht ein, wo er sie schon einmal gehört hatte. War es in Trier gewesen? Er musste es herausfinden. Paulyn hielt sein Ohr noch näher an die Ritze in der Bretterwand.
«Ihr habt meinen Sinn für Gerechtigkeit und meine Treue zum Heiligen Vater auf schändliche Weise ausgenutzt», schimpfte der alte Mann weiter. Beschwörend beugte er sich über den Altar, wobei ihm sein langes, weißes Haar über die Schultern fiel. «Ihr hattet mir versprochen, dass keiner der Dorfbewohner zu Schaden kommen würde. Und nun klebt das Blut des Schankwirts an Euren Händen …»
«Der Kerl war ein verdammter Narr», mischte sich nun ein anderer Mann in das Gespräch ein. «Kaum dass ich seine verwanzte Schenke betreten hatte, ging er mit seinen Riesenpranken auf mich los wie ein Tobsüchtiger. Um ein Haar hätte er mir den Adamsapfel zwischen zwei Fingern zerquetscht. Bei Gott, was hätte ich denn Eurer Meinung nach tun sollen, um ihn loszuwerden? Einen Krug Schwarzbier bestellen?» Die Männer lachten.
«Beleidigt mich, aber wagt es nicht, in meiner Gegenwart den Namen des Herrn zu lästern», zischte der alte Priester. Erschöpft stützte er sich mit der Hand auf den Altarstein, bevor er sie gegen den Wortführer der Runde erhob. «Wir hatten eine Abmachung, die Ihr mit Eurem heiligen Eid besiegelt habt!»
«Sehr richtig, und ich werde mich auch weiterhin bemühen, ihn einzuhalten.»
Der Mann, dessen Stimme Paulyn vertraut vorkam, schob einige der Umstehenden zur Seite und trat so dicht an den Greis heran, dass ihre Körper im Dämmerlicht zu verschmelzen schienen. Paulyns Herz begann schneller zu schlagen. Er konnte das Gesicht des Wortführers zwar noch immer nicht erkennen, sah aber, dass seine Schultern breit, die Arme muskulös waren. Er trug teure Kleidung aus taubengrauem flämischem Tuch, dessen eingewebte Silberfäden im Zwielicht wie frischer Tau glitzerten. Auf den gebauschten Ärmeln seines Wamses zeichneten sich rote Stickereien ab, die seidig schimmerten. Am Hüftgürtel hing ein Dolch, der in einer blutroten Lederscheide steckte.
Behutsam legte der Unbekannte nun seinen Arm um die knochigen Schultern des Alten und erklärte dann in freundlichem Ton: «Die Sache mit dem Schankwirt war in der Tat ein Lapsus gladii, eine bedauerliche Entgleisung des Schwertes, für die ich meinen Dienstmann bereits zurechtgewiesen habe. Er wird für seine üble Stümperei keinen Heller von mir sehen. Wir beide aber sollten uns darüber nicht entzweien. Bedenkt, dass wir ein gemeinsames Ziel vor Augen haben.»
«Ein gemeinsames Ziel?» Der Alte hörte sich skeptisch an.
«Aber gewiss doch. Wir wollen dem Auserwählten des Papstes endgültig zu seinem Recht verhelfen. Ulrich von Manderscheid ist ein Ketzer. Niemals darf er Bischof von Trier werden. Seine Herrschaft wäre ein großes Unglück für das gesamte Erzbistum, ja sogar für das Reich. Schaut Euch den Krieg in Frankreich an, der schon seit Jahren tobt und kein Ende zu nehmen scheint.»
«Zunächst einmal wäre Graf Ulrichs Triumph ein Unglück für Eure Geldbörse!» Der Pfarrer entzog sich der Umarmung und fuhr mit seinen dürren Fingern über die Soutane, als müsste er das Tuch von Schmutz befreien. «Ich habe nie daran geglaubt, dass Ihr den ehrwürdigen Bischof Raban aus purer Frömmigkeit unterstützt. Der Manderscheider hat es abgelehnt, Eure Taschen zu füllen, Burgund und Luxemburg sind in sich gespalten. Nun schlagt Ihr Euch eben auf die Seite des neuen Herrn.»
«Ich schlage mich auf die Seite dessen, der aus einem Streit mit möglichst wenig Narben hervorgeht, ehrwürdiger Vater. Hierin folge ich lediglich dem Beispiel unserer heiligen Mutter Kirche. Glaubt Ihr denn allen Ernstes, der Papst hätte jemals aus einem anderen Beweggrund heraus gehandelt als aus politischem Kalkül? Darf ich Euch an das erinnern, was geschah, als Ulrich von Manderscheid und Jakob von Sierk vor zwei Jahren nach Rom zogen, um Martin V. in ihrem Streit um das Bistum um eine Entscheidung zu bitten? Der Papst zögerte keinen Augenblick, beide Männer abzusetzen und seinen eigenen Günstling Raban mit dem Erzbisturn zu belehnen. Für ihn spielte es keine Rolle, dass Jakob von Sierk die Bischofswahl gewonnen hatte. Kurzerhand erklärte er die Wahl des Domkapitels für ungültig und ließ die beiden Streitparteien in Frieden ihres Weges ziehen.»
«Der Heilige Vater ist der Stellvertreter unseres Herrn und niemandem Rechenschaft schuldig», krächzte der alte Priester kraftlos, wofür er von den Umstehenden von neuem höhnisches Gelächter erntete.
«Spottet nur. Im Fegefeuer wird sich Euer Lachen in Heulen und Zähneknirschen verwandeln!»
«Ich fürchte, das Konzil zu Basel teilt Eure Meinung nicht ganz», erwiderte der Anführer der Männer. «Papst Martin V. weiß nur zu gut, dass er in Rom zahlreiche Feinde hat und daher starke Verbündete braucht, die ihn in seinem Kampf gegen das Konzil unterstützen. Raban von Helmstadt kommt ihm dabei wie gerufen. Seine politischen Verbindungen und verwandtschaftlichen Beziehungen zu den adeligen Häusern des Reiches werden dem Papst reichen Nutzen bringen, und sobald er Raban zum Kurfürsten gemacht hat, wird der auch ein Auge auf die Unternehmungen des Königs werfen.»