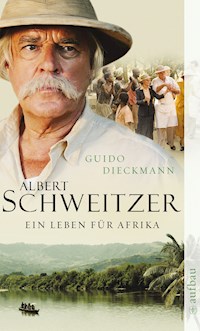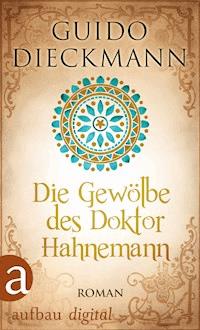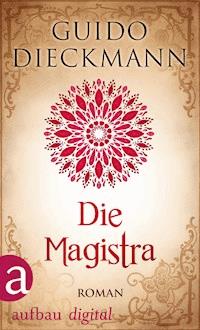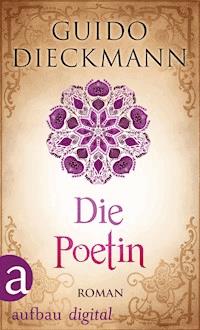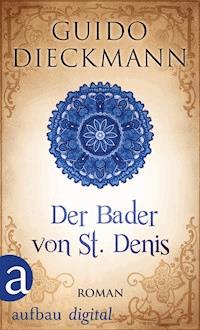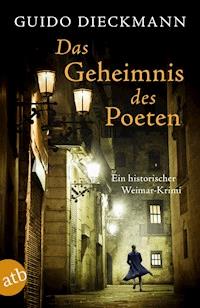8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein mächtiger Dom birgt ein gefährliches Geheimnis. Bamberg im 13. Jahrhundert. Kathedralen gelten als prachtvolle Tore zum Himmel, deshalb will der junge Lukas an der Vollendung des Domes mitwirken. Mit einem gefälschten Zeugnis schafft er es tatsächlich, als Steinmetz angestellt zu werden. Doch schon bald muß er fliehen und rettet sich auf eine nahe Burg. Von der Hausherrin erhält er den Auftrag, ein Reiterstandbild für den Dom zu erschaffen. Mit größtem Eifer macht er sich ans Werk - bis der erste Mordanschlag auf ihn verübt wird ... Guido Dieckmann, der Autor des Bestsellers "Die sieben Templer", erweckt eine der spannendsten Epochen der deutschen Geschichte zum Leben und beschreibt zugleich, wie der Bamberger Reiter, das geheimnisvollste Kunstwerk des Mittelalters, entstand.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 570
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Informationen zum Buch
Ein mächtiger Dom birgt ein gefährliches Geheimnis
Bamberg im 13. Jahrhundert. Kathedralen gelten als prachtvolle Tore zum Himmel, deshalb will der junge Lukas zusammen an der Vollendung des Domes mitwirken. Mit einem gefälschten Zeugnis schafft er es tatsächlich, als Steinmetz angestellt zu werden. Doch schon bald muß er wieder fliehen und rettet sich auf eine nahe Burg. Von der Hausherrin erhält er den Auftrag, ein Reiterstandbild für den Dom zu erschaffen. Mit größtem Eifer macht er sich ans Werk – bis der erste Mordanschlag auf ihn verübt wird.
Guido Dieckmann, der Autor des Bestsellers »Luther«, erweckt eine der spannendsten Epochen der deutschen Geschichte zum Leben und lüftet zugleich auf seine Weise, wie der Bamberger Reiter, das geheimnisvollste Kunstwerk des Mittelalters, entstand.
Guido Dieckmann
Die Nacht des steinernen Reiters
Roman
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Dramatis Personae
Prolog
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Einundzwanzigstes Kapitel
Epilog
Nachwort des Autors
Über Guido Dieckmann
Impressum
Wem dieses Buch gefallen hat, der liest auch gerne …
Dramatis Personae
Lukas
Findelkind unbekannter Herkunft; unter Leibeigenen aufgewachsen, lebt nun als begabter Steinmetzgeselle und Bildhauer in Bamberg; Schöpfer des berühmten »Bamberger Reiters«.
Norbert
Steinmetz; arbeitet auf der Bamberger Dombaustelle.
Gisela
seine Frau
Harras
sein Sohn, ebenfalls Steinmetz.
Justina
Tochter eines ruinierten Weinhändlers; hält sich mit geschickten Fälschungen über Wasser und soll gegen ihren Willen verheiratet werden.
Dietlinde
ihre Schwester; Laienpflegerin im Spital des Heiligen Theodor zu Bamberg
König Philipp
Sohn Kaiser Friedrich Barbarossas;
von Schwaben*
wurde 1208 in Bamberg Opfer eines Mordanschlags.
Bischof Ekbert von
Bischof von Bamberg; Onkel der Land-
Andechs-Meran*
gräfin Elisabeth von Thüringen, für deren Heiligsprechung er sich einsetzt.
Magister Hugo
Kleriker zu St. Gangolf und Schreiber
von Donndorf
des Bischofs
Salomann
wohlhabender Kaufmann und Stifter; führt die städtischen Kaufleute in die Auseinandersetzung um Unabhängigkeit und Privilegien.
Beate
seine Braut; Schwester Dietrichs von Haselach. Nach ihrem Umzug nach Bamberg beginnt sie, gefährliche Fäden zu spinnen.
Lampert
Salomanns Verwalter; möchte selbst Kaufmann in Bamberg werden.
Emma
Lamperts Tochter aus erster Ehe; lebt in der Obhut von Ordensfrauen.
Julius
Salomanns Koch aus Würzburg; freundet sich mit Lukas an und schwärmt für gewürzten Mandelschaum, gebratenes Rebhuhn und süßen Wein.
Grete
Magd in der Schenke »Zum Haupt«; merkt sich die Gesichter ihrer Gäste.
Werner von Rottweil
undurchsichtiger Baumeister; vermittelt Lukas einen verhängnisvollen Auftrag.
Graf Rüdiger von Rabenstein-Morsch
Erbe der Burg Rabenstein*
Theodora
seine Mutter; im Dorf als Hexe und »Mondreiterin« gefürchtet.
Ägidia
Kammerfrau und Vertraute der Burgherrin Theodora
Gernot
Waffenmeister auf Burg Rabenstein
Nurith
jüdische Ärztin und Hebamme in Bamberg; Justinas Freundin.
Rabbi Samuel
genannt Babenberg*; Nuriths Vetter und Vorsteher der kleinen Bamberger Judengemeinde.
Matthäus
auch Hagen genannt. Locator, der in fürstlichen Diensten für die Auswanderung Bamberger Bürger nach Siebenbürgen wirbt.
Ethlind
seine Gemahlin
Gottfried
beider Sohn
Vater Konrad
Abt des Klosters St. Michael
Viro
Mönch
Wipold
Mönch
Udo Brandeisen
Domherr
Raidho
der »Betbruder«; haust als wandelndes Orakel auf der Dombaustelle.
Lothar
Stadtknecht; sorgt im Auftrag Salomanns in den weltlichen Bezirken der Inselstadt für Ordnung.
Und ein rätselhaftes Standbild aus Stein, genannt der »Bamberger Reiter«*.
Sämtliche mit * gekennzeichneten Personen, Ortsnamen, Gebäude oder Kunstwerke im Roman sind historisch nachweisbar.
Prolog Domburg zu Bamberg, XI. Kal. Jul. MCCVIII (Juni 1208)
»Es ist soweit, Herrin. Er möchte Euch sehen!«
Thea wirbelte auf dem Absatz herum; sie erschrak bis in die Knochen, als der junge Mann so unvermittelt hinter ihr in der Kammer stand. Obwohl sie bereits angekleidet war, griff sie nach einem pelzverbrämten Umhang und sandte einen beunruhigten Blick hinüber zur Pforte. Die Tür zum Korridor war nur angelehnt. Ein Page mußte die quietschenden Angeln mit Tran oder Gänsefett geschmiert und weiche Schaffelle über die knarrenden Dielen gelegt haben. Ihr fiel ein, daß sie selber sich erst am Tag zuvor über die unheimlichen Geräusche auf den Gängen der bischöflichen Hofhaltung beklagt und ihre Kammerfrau beauftragt hatte, etwas dagegen zu unternehmen. Wie es schien, war ihr Befehl ohne Widerspruch ausgeführt worden, ein Umstand, der ihren Vater zweifellos mit Genugtuung erfüllt hätte. Das Wort seines Geschlechts galt wieder etwas im Reich.
Nun aber verspürte Thea Angst. Sie wich bis vor die Säulen des Kamins zurück, in dem das letzte Feuer bereits vor Wochen erloschen war. Der Geruch, der ihr von verkohlten Holzscheiten und trockenem Laub aus der geschwärzten Öffnung entgegenschlug, reizte ihren Magen so sehr, daß ihr schwindelte. Seit ihrer Ankunft auf dem Domberg litt sie unter Schweißausbrüchen, die ihren Körper wie eine eisige Hülle umgaben; unruhige Träume, Ahnungen und immer wiederkehrende Krämpfe im Bauch bescherten ihr manch qualvolle Nacht. Ob dies wohl an dem schweren Wein lag, den man ihr hier zu trinken gab? Er stieg so leicht zu Kopf.
Der junge Bote leierte seine Nachricht herunter, als müßte er sich einer lästigen Pflicht entledigen. Doch er schien es nicht besonders eilig zu haben, Theas Kammer zu verlassen. Im Gegenteil. Ungeniert wanderten seine Blicke über das Mobiliar der Kemenate, die gepolsterte Sitznische, den Wandbehang mit Tiermotiven und die verspielten bronzenen Kerzenhalter. Als er die zerwühlten Laken auf dem Bett bemerkte, hob er eine Augenbraue und grinste.
Ob er meine Pläne kennt, überlegte Thea. Ihre Züge versteinerten, als sie bemerkte, wie aufmerksam der Bursche sie musterte. Er hat mich beobachtet und das zufriedene Gesicht meines Vaters gesehen, als wir in der Burg des Bischofs Einzug hielten. Jedermann weiß, daß diese Räume für den König vorbereitet wurden. Morgen früh wird er seinen Kameraden in der Waffenkammer berichten, daß er mich in die Enge getrieben hat wie ein waidwundes Reh. Mein Gott, und ich kann nichts, absolut nichts dagegen tun. Wut stieg in ihr auf.
»Wie lange dient Ihr dem Truchseß von Waldburg eigentlich schon als Edelknappe?« fragte sie, nachdem sie sich halbwegs gefangen hatte. Sie versuchte, ihrer Stimme einen strengen Unterton zu verleihen, wie sie ihn von ihrer Mutter kannte, wenn diese im Begriff stand, eine faule Magd auszuschimpfen. Doch ihre Bemühungen schlugen fehl, sie klang eher verängstigt als selbstsicher.
»Warum interessiert Euch das?« gab der Edelknappe lakonisch zurück, ohne sich zu einer Antwort aufzuraffen. Thea atmete tief durch. Sie fand, daß er erstaunlich groß und muskulös war. Im Schein der tönernen Schalenlampe glühte sein feuerrotes Haar beinahe dämonisch.
»Weil Ihr offensichtlich noch nicht gelernt habt, wie man sich in der Kemenate einer Dame benimmt«, erwiderte sie schließlich. Um Haltung bemüht, nahm sie den Umhang, den sie sich im ersten Schrecken um die Schultern gelegt hatte, wieder ab und faltete ihn umständlich zusammen. »Euer Herr sollte Euch einmal den Unterschied zwischen jugendlicher Neugier und aufdringlicher Frechheit erklären. Soweit mir bekannt ist, werdet ihr Knappen doch vor der Schwertleite auch in den höfischen Tugenden unterrichtet und sollt …«
Thea errötete, noch bevor sie den Satz beendet hatte; der Begriff »höfische Tugend« kam ihr in diesem Augenblick nur schwer über die Lippen, mehr noch, er schmeckte schal wie kalt gewordenes Essen. In den Augen der Welt galt ihr Handeln in der Burg als Hurendienst, ein Ausdruck schmählichster Verworfenheit, den auch ihre regelmäßigen Beichtgänge nicht minderten. Ob dieser Makel nun für alle Zeiten an ihr haftenbleiben würde? Warum war der Weg der Liebe nur immer von brennenden Nesseln gesäumt? Sie liebte den Mann, der sie nach Bamberg eingeladen hatte, doch aufrichtigen Herzens. Er wiederum verehrte sie wie ein Minnesänger eine edle Dame, nannte sie seine Göttin Venus und versprach, Minnelieder für sie zu dichten. Davon abgesehen konnte sie vor jedem Femegericht schwören, daß sie sich ihm weder aufgedrängt noch ehrlos hingegeben hatte. Sie, Thea von Rabenstein, war die Tochter eines Ritters aus edelfreiem Geschlecht und keine dahergelaufene Viehmagd.
»Ihr scheint mir viel von Rittern und ihren Tugenden zu verstehen, Herrin«, sagte der junge Mann mit gutmütigem Spott; er deutete eine leichte Verbeugung an, die aber nicht eben respektvoll wirkte.
»Ich weiß, daß die Strafen für unverschämte Schildknappen in Bamberg nicht milder ausfallen als in Waiblingen oder Würzburg. Ihr wollt doch wohl nicht beim nächsten Turnier auf der Schranke reiten, oder?«
Er lachte sie aus wie ein ungezogenes Kind. Seine Gegenwart war ihr unangenehm, doch seltsamerweise kam sie nicht auf die Idee, ihren Vater oder die Wache zu Hilfe zu rufen. Statt dessen überlegte sie, ob der Jüngling, der gewiß schon viele Mädchen gekannt hatte, wohl enttäuscht von ihr war. Welch ein Jammer, dachte sie niedergeschlagen, warum habe ich auch auf meine Magd gehört und den unscheinbaren gelben Surkot über das Kleid gezogen.
Im Unterschied zu den Edeldamen, die im Gefolge des mächtigen Herzogs von Burgund nach Bamberg gereist waren, um den Hochzeitsfeierlichkeiten der jungen Beatrix mit dem Neffen des Bischofs beizuwohnen, trug Thea nur einen einfachen Kamm aus Elfenbein im Haar und einen silbernen Kettengürtel um die Hüften. Kostbareres Geschmeide konnte sie sich nicht leisten. Ihr ausgewaschenes Obergewand und der Schleier aus steifem Linnen entstammten den Kleidertruhen ihrer Großmutter. Beides entsprach längst nicht mehr dem bei Hofe herrschenden Geschmack. Dem wertvollen sarazenischen Ohrgehänge, das ihr Vater für sie verwahrte, fehlten zwei Saphire, die öde Stellen hinterlassen hatten. Es war nicht so, daß Thea keinen Wert auf feine Kleider legte, aber unglücklicherweise war ihr Vater, ein unbedeutender Burgherr, dessen Lehen aus drei mehr oder minder ertragreichen Dörfern und einem Stückchen Wald im Ailsbachtal bestand, seit dem letzten Kreuzzug und den zermürbenden Kämpfen zwischen der Partei des Königs und der des verräterischen Welfen nicht mehr in der Lage, ihre Aussteuertruhen zu füllen. Er hatte zu viel Geld in die Ausrüstung seiner Dienstmannen gesteckt. Um ihm zu helfen, hatte Thea vor dem ersten Frost eigenhändig wertvolle Juwelen zu den Würzburger Pfandleihern tragen müssen. Aber dieser Opfergang schmerzte sie nicht; sie hätte alles getan, um ihrer Familie das Gut zu erhalten, auf dem sie die glücklichsten Jahre ihres Lebens verbracht hatte.
Die Burgunderinnen mit ihren golddurchwirkten Schleiern, den winzigen, perlenbestickten Schühchen und den weiten, mit Pelz gefütterten Ärmeln, die über den Boden schleiften, sobald sie sich nur bewegten, blieben von Sorgen dieser Art verschont. Sie schienen Thea überhaupt einer anderen Welt anzugehören: einem Stall gackernder Hühner, die von umherschleichenden Füchsen keine Ahnung hatten.
Sie hatte auf dem Söller gestanden, daneben ihr Vater und dessen Freunde. Durch einen Fensterspalt beobachtete sie, wie Edelleute in Festtagsgewändern, Kanoniker mit feierlichen Mienen und die Frauen aus dem Gefolge des Andechsers miteinander um die Pfalzkapelle St. Andreas und die Gebäude des Stiftsbezirks herumspazierten. Ihre bleichen Gesichter versteckten sie unter viel zu großen Hauben vor der Sonne, denn die Tage waren heiß und drückend. Unter den Geladenen befanden sich höchst klangvolle Namen: Bischof Konrad von Speyer, gefolgt von einen guten Dutzend Minnedichter, die aufdringlicher waren als ein Schwarm Stubenfliegen. Außerdem Markgraf Heinrich von Istrien, der die Gastfreundschaft seines Bruders, des Bamberger Bischofs, oft wochenlang in Anspruch nahm.
Thea seufzte tief, als sie an ihre eigene Stellung unter den Mächtigen des Reiches dachte. Es verband sie nichts mit den vermögenden Töchtern des Hochadels. Kaum eine der Fürstinnen hatte sich dazu herabgelassen, die Rabensteinerin auch nur eines Blickes zu würdigen. Nur die kleine Kunigunde, eine jüngere Tochter des Königs, die mit ihren entzückenden blonden Zöpfen und den Zahnlücken wie ein frecher kleiner Engel aussah, hatte ihr auf dem Weg zur Badestube zugelächelt.
Sie verdrängte die unguten Gefühle, die sich in ihr regten und gab sich Mühe, an die kommenden Stunden zu denken. Ihr Vater hatte ihr eingeschärft, worauf es zu achten galt, sobald der König ihr endlich Gehör schenkte. Langsam drehte sie sich um. Der dreiste Bursche hatte es offenbar aufgegeben, sie anzustarren. Gott war es gedankt. Mit einer überraschend galanten Handbewegung lud er sie ein, ihm auf den Korridor zu folgen. Während sie sich an ihm vorbeidrückte, arbeitete es in ihrem Kopf fieberhaft. Sie mußte herausfinden, was der Knappe über sie und ihren Vater wußte. Keinesfalls würde sie zulassen, daß ihre Anwesenheit in den Räumen des Königs von Knappen und dem Gesinde breitgetreten wurde. Hier oben in der Domburg des Bischofs, soviel hatte sie bereits beim Anblick der hohen, befestigten Mauern gespürt, gab es niemanden, der ihr vertrauenswürdig erschien. Die hohen, betont schmucklosen Wände des Bischofssitzes bekamen Augen und Ohren, sobald ein Mädchen wie sie auch nur die Stimme erhob.
»Hier entlang, Herrin! Das Festmahl ist bereits in vollem Gange. Aber mein Herr zog es vor, Euch die langweiligen Reden des Bischofs zu ersparen.«
Thea verzog verärgert den Mund. So, er zog es also vor, sie nicht zu langweilen. Doch was den Herrn des Knappen auch immer bewegen mochte, er hatte es nicht für nötig befunden, sie zu fragen, ob sie an dem festlichen Bankett teilnehmen wollte. Thea bezweifelte, daß es in der Residenz des Herrn von Andechs, der mit seinem bereits in jungen Jahren schütteren Haar ältlich und verbraucht wirkte, ausgelassen zuging, aber es ärgerte sie dennoch, daß ein fremder Edelmann das Recht für sich in Anspruch nahm, über ihren Kopf hinweg Entscheidungen zu treffen. Er hätte sich selbst zu ihr bequemen können, anstatt diesen Rüpel von einem Knappen zu schicken. Oder hatte er etwa auf besonderen Befehl des Königs gehandelt?
Der Weg hinauf zur Galerie, von deren Balustrade man einen guten Ausblick über den Saal des bischöflichen Palastes genoß, war nur kurz. Dennoch kam er ihr nun deutlich länger vor als am Tag ihrer Ankunft. Er wand sich über mehrere ausgetretene Stufen und schmale Gänge dahin, aus deren Enge ihr nicht der Duft von gebratenen Rebhühnern, Wildschweinen und gesottenen Würsten in Butter entgegenschlug, sondern der Gestank schmutzigen Strohs. Fragend blickte sie sich um. Der Knappe des Herrn von Waldburg hatte die Gugel seines gebleichten Wamses über den Feuerschopf gestülpt und leuchtete den Boden mit einer brennenden Pechfackel ab. Inzwischen war es dunkel geworden. Hier und da hatten sich einige der Bodenplatten gelöst, so daß man immer in der Gefahr war zu stolpern.
»Darf ich fragen, wohin Ihr mich führt?« fragte das Mädchen nach einer Weile. Sie war außer Atem, ihre Stimmung strebte einem Tiefpunkt entgegen. »Einen umständlicheren Weg zur großen Halle habt Ihr wohl nicht gefunden!« Sie unterdrückte das Zittern in ihrer Stimme, vermutete jedoch, daß es ihrem Führer nicht entgangen war. Der lange Kerl hatte Ohren wie ein Jagdhund. Angst stieg in ihr auf. Durch die hallenden, von massigen Säulen getragenen Gänge, deren hohe, gerundete Fensteröffnungen kaum Licht einließen, heulte der Wind. Wenn der Knappe sie nun hier, in einem finsteren Winkel, aufs Stroh zog? Ihr Gewalt antat?
»Der König ist in Gefahr«, erwiderte der Knappe unvermittelt. Er blieb stehen, wandte sich zu ihr um und hielt ihr die brennende Pechfackel vor das Gesicht. Seine Augen funkelten ebenso grell wie die tanzende Flamme in seiner Hand. »Er sitzt in einer Schlangengrube und spielt mit den Vipern, die ihn vernichten wollen!«
»Was faselt Ihr da für einen Unsinn?« keuchte sie entsetzt. »Seid Ihr betrunken? Ich verlange, daß Ihr meinen Vater oder einen unserer Diener holt. Auf der Stelle …«
»Dafür bleibt keine Zeit mehr!« Plötzlich schnellte seine linke Hand hinter dem Rücken hervor und packte Thea so hart am Arm, daß sie keuchend aufschrie. Nicht vor Schmerz, denn merkwürdigerweise war sein Griff nicht nur eisern, sondern auch gefühlvoll. Trotzdem war sie wütend genug, ihm mit der Hand ins Gesicht zu schlagen. »Wer bist du wirklich, Bastard?« zischte sie ihn feindselig an. »Ich werde dich auspeitschen lassen. Was, zum Henker, willst du von mir?«
Der junge Mann ließ ihren Arm so abrupt los, als hätte er sich an einem glühenden Eisen verbrannt. »Mein Name ist Ludwig von Morsch. Wie Ihr richtig vermutet habt, stehe ich im Schilddienst des Herrn von Waldburg.«
»Ja, aber …«
»Schweigt nun, und hört mich an! Wir haben Grund zu der Befürchtung, daß das Leben des Königs in Gefahr ist. Er soll noch in dieser Nacht ermordet werden, und Ihr, mein Kind, seid hier in der Bamberger Pfalz momentan die einzige Person, die ihn davon überzeugen kann, sich in seine Gemächer zurückzuziehen und niemanden mehr einzulassen! Seht Ihr die Treppe hinter dem großen Wandbehang? Sie führt zu einer Tür, durch die man die Halle betreten kann, ohne sogleich von jedermann entdeckt zu werden.«
Thea wurde übel; sie hatte plötzlich das Gefühl, die Wände rückten auf sie zu wie lebendige Wesen. »Wenn das, was Ihr behauptet, wahr ist … Wie kommt Ihr darauf, daß ausgerechnet ich dem König helfen könnte?«
Er hob schweigend die Schultern, aber im Grunde erwartete sie keine Antwort von ihm. Es war müßig, ihr Geheimnis länger zu leugnen. Sie liebte den König, und dieser Knappe hatte die zerwühlten Laken in ihrem Schlafgemach richtig gedeutet.
»Wir sind hier in der civitas Dei«, stieß Thea hervor, »einer bischöflichen Pfalz. Welcher Mann wäre so vermessen, unter den Augen des Bischofs ein so entsetzliches Verbrechen zu begehen?«
»Und wenn der ehrwürdige Bischof seine Augen schließen würde? Wenigstens für die Dauer eines Flötenspiels?«
Thea stieß einen spitzen Schrei aus. Mit raschen Schritten stürzte sie an dem Knappen vorbei, auf die Wendeltreppe zu. Sie drehte sich nicht mehr um, konnte aber am Geräusch seiner weichen Wildlederstiefel erkennen, daß er ihr die Stufen hinabfolgte.
»Aber die Schlachten sind geschlagen«, rief sie und zuckte zusammen, als das Echo ihrer Worte von den kahlen Mauern widerhallte. »Mein Vater hat mir erzählt, daß König Philipp einen einjährigen Waffenstillstand mit dem Welfen ausgehandelt hat. Sogar der Papst hat Philipps Thronanspruch für rechtens erklärt und sich von dem Braunschweiger losgesagt. Es wäre ein Frevel, ihn nun anzugreifen. Schließlich geschieht es nach Gottes weisem Ratschluß, daß Philipp für seinen unmündigen Neffen Friedrich über das Reich herrscht.«
»So wie es Gottes Ratschluß entsprach, daß der König diese Byzantinerin heiratete, die ihm zwar hübsche Töchter, aber keinen einzigen Erben gebar?«
Thea schwieg. Wie sollte sie auch einen klaren Gedanken fassen, wenn das eigene Herz wie ein Schmiedehammer gegen die Rippen klopfte? Am Fuß der Treppe angekommen, duckte sie sich mit dem Rücken gegen einen steinernen Rundbogen und atmete tief durch. Alles, was der Knappe ihr erzählte, klang so unvernünftig, so grotesk, daß sie beinahe gelacht hätte. Wahrscheinlich wollte er ihr nur Angst einjagen, weil er hinter das Geheimnis ihrer Liebschaft gekommen war. Aus dem angrenzenden Raum drang ohrenbetäubendes Getöse. Sie vernahm lautes Gelächter, weinselige Schreie und verzerrte Flötenklänge. Das Bankett schien nunmehr seinem Höhepunkt entgegenzustreben. Kurz entschlossen raffte Thea ihren Rock, schob den Vorhang zur Seite und schlüpfte in den Saal.
Ein Dunst von rauchiger Wärme schlug ihr entgegen, als sie sich hastig nach ihrem Vater und den Männern aus Rabenstein umblickte. Unter der zechenden Schar von Edelleuten, Pagen, Musikanten und Wachsoldaten kam ihr jedoch kaum ein Gesicht bekannt vor. Ihre Verwandten waren nicht auszumachen. Irgendwo mußten sie doch stecken. Aber wo? Mit zusammengebissenen Zähnen fuhr Thea fort, die Reihen abzusuchen. Sie durfte nicht trödeln.
Die Halle des Bischofs war so weiträumig, daß der bescheidene Wohnraum, der Rittersaal ihres Vaters, dreimal Platz darin gefunden hätte. Dutzende von Fackeln in bronzenen Haltern, Öllämpchen auf den Stufen der breiten Freitreppe und feine Wachskerzen, die in mit Wasser gefüllten Schalen auf den Tafeln und Bänken standen, tauchten die Halle in ein seidig schimmerndes Licht. Die Tische, an denen die Fürsten und Ritter tafelten, waren auf Geheiß des Bischofs kreuzförmig und nach Osten weisend angeordnet worden, so daß nur in der Mitte der Halle ein freies Fleckchen übriggeblieben war. Dort, auf den mit frischen Binsen und duftenden Wiesenblumen bestreuten Steinplatten, jonglierten vier Gaukler mit Messern. Ein dürrer, farbenfroh gekleideter Spielmann, auf dessen Schulter ein mageres Äffchen saß, begleitete das Schauspiel auf seiner Drehleier.
Der König, ein gutaussehender, blonder Mann, räkelte sich in einem Nebengemach auf einem mit kostbaren Pelzen bedeckten Ruhelager. Er hatte sich vom lärmenden Trubel der Hofgesellschaft zurückgezogen, um von seinem Bader einen Aderlaß vornehmen zu lassen. Nun aber schien er sich zu langweilen. Thea konnte durch die Säulen hindurch beobachten, wie er mit der bronzenen Spange seines weiten Mantels spielte, die Glieder streckte und schließlich herzhaft gähnte. Im nächsten Moment sprang ein bärtiger Hüne mit einer goldenen Kanne die Treppenstufen hinauf, um ihm den Becher zu füllen.
»Wer ist dieser Mann?« fragte sie Ludwig, der reglos im Schatten des Vorhangs stand. »Kennt Ihr ihn?«
Der Knappe nickte. »Der Sohn eines reichen Kaufmanns aus Markgröningen. Er liefert der bischöflichen Pfalz heißbegehrte Waren, die wegen der Überfälle auf Handelszüge im Schwäbischen momentan schwer zu bekommen sind. Daher geht er in der Domburg ein und aus. Warum aber ausgerechnet er heute den Mundschenk spielt, kann ich mir nicht erklären. Euer König scheint es mit den Erzämtern nicht so genau zu nehmen. Sein Großvater, der edle Barbarossa, war da ganz anders.«
»Und wenn Philipps Wein vergiftet ist?« gab Thea erschrocken zurück. »Herr im Himmel, was soll ich tun? Ich kann doch nicht unaufgefordert zu ihm laufen und ihm den Kelch aus der Hand schlagen.« Mit weit aufgerissenen Augen verfolgte sie, wie der König die Hand nach dem Pokal ausstreckte und ihn langsam an die Lippen führte. Er nahm einen tiefen Zug; seine vollen Wangen färbten sich blutrot. Dann hustete er und rang nach Atem.
Ludwig von Morsch schüttelte unmerklich den Kopf. »Das glaube ich nicht, Herrin. Seht nur, der Wittelsbacher trinkt aus derselben Kanne.«
»Der Wittelsbacher?«
»Pfalzgraf Otto«, erklärte der Knappe. »Der breite Kerl mit dem gestutzten Kinnbart und dem schlecht sitzenden, mit Münzen bestickten Kettenhemd. Kommt wohl gerade vom Turnierplatz, wo er seinen Knappen die Hölle heiß gemacht hat. Ein unfreundlicher Bursche, aber es gibt wohl keinen zweiten Mann im Reich, der sein Schwert so sicher zu führen weiß wie er.« Ludwig verzog die Lippen. »Herrin, wir sollten nun keine Zeit mehr verlieren.«
»Diesmal gebe ich Euch recht«, zischte Thea. »Tut endlich etwas!«
Ludwig hob die Hand, um seinem Herrn, Truchseß Heinrich von Waldburg, ein Zeichen zu geben. Dies war inmitten des Getümmels nicht einfach, doch nach mehrmaligem Winken gelang es ihm, mit dem königlichen Ministerialen Blickkontakt aufzunehmen. Der Truchseß, ein dunkelhaariger Mann mit schmalen Lippen, saß links neben dem König, gleich neben dem Kanzler. Sein Alter war schwer zu schätzen, doch er verfügte über die Ausstrahlung eines Mannes, der nichts, was er tat, jemals dem Zufall überließ. Den Wink seines Knappen verstand er auf Anhieb. Thea bemerkte, wie er zu ihr und Ludwig hinüberschaute, kurz zögerte und schließlich nickte. Dann neigte er den Kopf in die Richtung des Königs und begann verstohlen, auf den jungen Monarchen einzureden. Thea sah erleichtert, wie sich die Miene des Königs aufhellte. Seine Göttin Venus war eingetroffen. Amüsiert schenkte er Thea einen knappen, aber feurigen Blick.
Mit pochendem Herzen verfolgte sie, wie er seine Hand über den Pokal legte und den Mundschenk mit einem jungenhaften Augenzwinkern fortschickte. Danach machte er Anstalten, sich zu erheben.
»Dem Heiligen Rochus sei gedankt«, seufzte Thea. »Er kommt zu uns. Wenn König Philipp erst einmal sein Gemach verlassen hat, kann ihm doch nichts mehr zustoßen, oder? Eure Männer werden ihn doch auf dem Weg in meine Kemenate beschützen?«
Ludwig von Morsch war nervös, seine Hände krallten sich in den blauen Samt des Vorhangs. Plötzlich bemerkte Thea, daß der junge Mann zwar einen breiten Gürtel mit Nieten über dem roten Lederwams trug, an der Hüfte jedoch keine Waffe zu sehen war. Auch sein Herr, der Truchseß, hatte sein Schwertgehänge abgelegt, wie es dem Brauch entsprach. Die glänzende Waffe lag zu seinen Füßen zwischen den hohen Schragen.
»Der König glaubt nicht, daß sein Leben in Gefahr ist, Herrin.« Ludwig sagte es in einem verächtlichen Tonfall. »Er hat sogar seine Leibtruppen entlassen, damit sie sich vor ihrem Aufbruch nach Thüringen noch einmal ordentlich in den Schenken austoben können! Es wird schwer werden, ihn …«
Die unvermittelt einkehrende Stille im Festsaal ließ Ludwig von Morsch jäh verstummen. Irritiert reckte er den Hals, um den Grund für den Stimmungsumschwung auszumachen. Unter den jonglierenden Gauklern war es offenbar zu einem Zwischenfall gekommen. Ein dicklicher Mann hockte wimmernd auf dem Boden und rieb sich mit schmerzverzerrtem Gesicht das Bein. Aus einem kleinen Kratzer am Oberschenkel quoll Blut. Es tropfte auf die Steinplatten. Bevor der bischöfliche Zeremonienmeister sich einmischen konnte, sprang der Wittelsbacher Pfalzgraf auf und bedachte das Gauklervolk mit wüsten Schmähungen. In rüdem Ton befahl er den Leuten, ihrem unfähigen Kameraden auf die Beine helfen und sich davonzumachen. Einige der Gäste, die dem schweren Wein bereits stark zugesprochen hatten, unterstützten die Aufforderung des Grafen mit Beifallrufen. Nur der müde Spielmann und sein Äffchen durften bleiben. Der Mann mußte den Anwesenden aufspielen. Mit verkrampfter Fröhlichkeit bearbeitete er seine Schellen.
Ein hämisches Lächeln legte sich über das breite, bärtige Gesicht des Pfalzgrafen, als er die Stufen zum Lager des Königs hinaufschritt. Er verbeugte sich so tief, daß die Gold- und Silbermünzen auf seinem Kettenhemd klirrten. Dann bat er Philipp um die Gunst, einige seiner berühmt gewordenen Kunststücke mit dem Schwert vorführen zu dürfen.
Theas Augen wanderten unruhig von der hochgewachsenen Gestalt des Königs zu der gedrungenen des Wittelsbachers hinüber. Sie begriff nicht, was dort oben vor sich ging. Pfalzgraf Otto ließ sich von einem Knappen sein Schwert, einen Helm und einen kostbar verzierten Gürtel reichen. Der Truchseß blieb unschlüssig.
»Was, zum Teufel, führt der Mann im Schilde?« stöhnte Ludwig von Morsch und schüttelte verärgert den Kopf. »König Philipp sollte längst in Euren Gemächern sein.«
»Natürlich sollte er das, aber …« Thea war zu aufgeregt, um ihren Satz zu beenden. Wie gebannt starrte sie auf die hünenhafte Gestalt des Ritters im goldenen Kettenhemd, der nun breitbeinig in der Mitte des Saales stand und sich von einigen Pagen Wachskerzen zuwerfen ließ. Sie beobachtete, wie der Pfalzgraf einen Ausfallschritt machte, sich wie ein Tänzer um die eigene Achse drehte und die erste Kerze der Länge nach zerteilte, noch bevor sie den Boden berührte. Nicht eine einzige Kerze entging der Schärfe seines Schwertes. Der Bischof und seine Gäste spendeten begeistert Beifall, sogar der dicke Herzog von Burgund, der den Weinvorräten seines Gastgebers stark zugesprochen hatte, schien plötzlich wieder hellwach zu sein.
Pfalzgraf Otto ließ sich indes von keinem der Zurufe ablenken. Herablassend stolzierte er zwischen den kreuzförmigen Schragentischen umher, während er aus den Augenwinkeln bereits die nächsten Geschosse fixierte. Diesmal handelte sich um einen gebratenen Hahn, der ein Krönchen aus bunten Federn trug. Die Menge klatschte vor Vergnügen in die Hände, als der Ritter auf eine der Bänke sprang und den Hahn mit einem einzigen gezielten Hieb köpfte. Das gebratene Federvieh flog in hohem Bogen durch die Halle, seine Flügel und das Krönchen landeten zwischen zwei ältlichen Stiftsdamen, die kreischend ihre Ärmel vors Gesicht schlugen.
Das einsetzende Gelächter war ohrenbetäubend. Der Wittelsbacher sprang nun behende von der Bank auf die Tafel, trat mit dem Fuß Kannen und Schalen zur Seite und spaltete eine fünf Pfund schwere Kerze, ohne sich umzudrehen.
Thea ließ sich auf eine Steinbank sinken. Ihr war kalt; in ihrem Magen begann es schon wieder zu rumoren. Da bemerkte sie, wie der König seinen Mantel zusammenraffte und sich von den umsitzenden Herren verabschiedete. Sie atmete erleichtert auf. Endlich! Endlich hatte er genug von der Gaukelei und zog sich von der lärmenden Gesellschaft zurück. Er wollte sie sehen, und sie würde ihn in Sicherheit bringen, bis seine Soldaten von ihrem Ausflug in die Stadt zurückgekehrt waren. Eilig erhob sie sich von der kalten Bank und überlegte, ob es sich geziemte, die Halle vor dem König zu verlassen.
Im nächsten Augenblick brach das Unheil über sie herein. Thea sperrte die Augen auf; die Zeit gerann zu einem einzigen Moment des Grauens. Sie wollte winken, dann schreien, um den König zu warnen, aber nicht der leiseste Laut kam über ihre Lippen. Sie verstummte, war wie geknebelt. Alles, was sie wahrnahm, waren zwei grünlich funkelnde Augen, die langsam auf sie und den König zuhielten. Ein verrutschtes Kettenhemd aus vergoldetem Draht; ein keck gestutzter Kinnbart.
Pfalzgraf Otto stand keine Handbreit vor dem König, um sein Lob für die Darbietung entgegenzunehmen. Er rief seinem Gegenüber etwas zu, doch Philipp war zu überrascht, um ihm zu antworten. Der Wittelsbacher blickte einen Atemzug lang reglos auf den anderen hinunter; sein Gesicht schimmerte wächsern, die Augen stachen hervor wie kalter Marmor. Philipp wandte sich mit einem schiefen Lächeln ab und warf sich ein Ende seines weiten Mantels über die Schulter. Ehe ihm die Umstehenden den Weg zum Ausgang der Halle freigeben konnten, hob der Pfalzgraf langsam, beinahe bedächtig sein Schwert und zog es Philipp mit einem triumphierenden Schrei durch die Kehle.
Einen Moment lang herrschte lähmendes Schweigen.
Der König bäumte sich auf seinem Lager auf; die Augen traten ihm aus den Höhlen. Fassungslos öffnete er den Mund, als wolle er um Hilfe rufen. Doch es war zu spät; alles, was er hervorbrachte, gerann in einem heißen Blutschwall, der wie eine Fontäne über sein Kinn sprudelte. Philipp sank zurück und begann zu keuchen wie ein Ertrinkender. Mit zittrigen Fingern tastete er nach der Hand des Wittelsbachers, die das Schwert in der blutenden Wunde wendete. Dann brach er ohnmächtig zusammen.
In diesem Moment begriffen die Zuschauer, daß sie Zeugen eines tödlichen Schauspiels geworden waren. Laute Schreie des Entsetzens ertönten aus der Halle. Schalen und Kelche fielen zu Boden und zersprangen klirrend. Zwei Frauen übergaben sich an Ort und Stelle.
Otto von Wittelsbach wischte sein Schwert an einer der königlichen Tücher sauber. Dann wandte er sich den am Tisch sitzenden Männern zu. Dabei grinste er, als erwarte er noch immer ihren Beifall. Die Ärmel seines Gewandes waren blutbesudelt, doch dies schien ihn ebensowenig zu bekümmern wie der Tumult im Saal. Mit einer hastigen Gebärde trennte er zwei der Silbermünzen vom Brustteil seines Wamses und warf sie auf den noch zuckenden, blutüberströmten Leib seines Opfers.
»Nein«, riefen Thea, Ludwig von Morsch und der erschütterte Truchseß wie aus einem Mund. Heinrich von Waldburg sprang auf, ergriff sein Schwertgehänge und rannte brüllend hinter dem Mörder seines Herrn her, während sich die Bischöfe von Bamberg und Speyer furchtsam in den Schatten einer Fensternische zurückzogen.
»Beim Haupt des Herrn, schafft endlich das Mädchen hier raus, Ludwig«, rief Heinrich von Waldburg seinem Edelknappen zu. Dann stürzte er sich auf den Pfalzgrafen. Otto teilte bereits mit bluttriefender Schneide aus. Krüge und Kerzenhalter flogen ihm entgegen, aber der Wittelsbacher wich um keinen Zoll zurück. Er verharrte wie ein Raubtier, das zum Sprung ansetzt, bereit, jedermann zu zerreißen, der sich in seine Nähe wagte. Wenig später erklang auch schon das metallische Geräusch zweier sich kreuzender Klingen; die beiden Männer führten sie gegeneinander auf Leben und Tod.
Thea eilte mit wehenden Gewändern auf das Nebengemach jenseits der hohen Säulen zu. Die Gefahr, in der sie schwebte, kümmerte sie nicht; sie wollte nach König Philipp sehen. Ludwig jedoch lief ihr nach, legte seinen Arm um ihre Schultern und drängte sie zurück.
»Laßt mich los«, flehte sie weinend. »Ich muß wissen, ob er noch lebt. Ich muß ihm doch sagen, daß …«
»Ihr wollt ihm sagen, daß Ihr ein Kind erwartet, nicht wahr?« Ludwigs Hand war trotz des schwülen Sommerabends kalt wie Eis. Er bemerkte, daß Thea in ihrer Hast mehrmals über den bestickten Saum ihrer Schleppe stolperte und gegen den rauhen Stein schlug. Aber er gönnte ihr keine Rast; unerbittlich schob er sie die Stufen der Wendeltreppe hinauf, die zu den Frauengemächern führte. Tief unter ihr heulte ein Burghorn auf. Die wenigen Wachsoldaten des Andechsers, die zur Burgmannschaft gehörten, stürmten aus ihren Waffenkammern und hielten eilig auf den Saal zu, um ihren Dienstherrn, den Bischof, zu verteidigen.
»Ihr könnt ihm nicht mehr helfen, Jungfrau Thea«, sagte Ludwig von Morsch. »Der König ist tot!«
»Wie könnt Ihr es wagen?« Thea befreite sich von Ludwigs Hand. »Tot? O nein, er ist nicht tot, er …« Tränen der Verzweiflung erhitzten ihre Wangen, als sie noch einmal auf die Pforte zur Halle zurückblickte. Ihr gelbes Surkot war durchgeschwitzt, auf der Zunge spürte sie den bitteren Geschmack von Galle. Inmitten des Geschreis und Waffenlärms war ihr mit einemmal, als vernehme sie ein donnerndes Rauschen, das sich in gleichmäßigen Schüben in den Gängen der Domburg ausbreitete. Das Geräusch hörte sich an wie der Flügelschlag eines gewaltigen Raubvogels.
»Habt Ihr das gehört, Ludwig?« fragte Thea tonlos. Ihre Blicke glitten suchend über den rotweißen Sandstein der Nischen und Säulen. »Diese Schwingen? Als ob sie die Seele des Königs davontrügen?«
Ludwig von Morsch räusperte sich betreten. »Ich bringe Euch in Eure Kemenate und kehre dann in die Halle zurück, um meinem Herrn beizustehen! Sollte ich Euren Vater dort antreffen, werde ich ihn bitten …«
»Heinrich von Waldburg ist diesem Pfalzgrafen unterlegen, nicht wahr, Ludwig?«
»Herrin …«
»Nein«, unterbrach ihn Thea energisch. »Er wird ihn nicht aufhalten. Ihr selbst sagtet doch, daß der Wittelsbacher ein Meister des Schwertkampfs ist. Euer Truchseß wird den Mörder nicht bestrafen, die gemeine Tat dieses Wahnsinnigen nicht aufklären. Es wird keine Sühne geben und das unglückselige Kind, das ich unter meinem Herzen trage, wird sein Leben als Bastard fristen.« Sie lachte schrill auf, es klang, als zerbräche irgendwo Glas. »Falls die Feinde des Königs es nicht vorher ebenfalls erschlagen.« Über ihre eigenen Worte erschrocken, legte sie eine Hand vor ihren Leib, mit der anderen bekreuzigte sie sich. »Ihr habt jedenfalls getan, was Ihr konntet«, sagte sie schließlich tonlos. »Ich danke Euch, daß Ihr mir und dem König beistehen wolltet!« Sie schenkte ihrem Begleiter ein scheues Lächeln, dann machte sie kehrt und ließ ihn zurück, ohne sich noch einmal nach ihm umzudrehen.
Ludwig sah der jungen Frau nach, bis sie die Tür zu ihrer Kammer geöffnet hatte und dahinter verschwunden war. Seine eben noch besorgte Miene entspannte sich; ein Lächeln glitt über seine Wangen. Wie es aussah, vertraute sie ihm. Kaum war die schwere Eichentür hinter Thea zugefallen, neigte er den Kopf und spuckte auf die strohbedeckten Platten.
Die kleine Hure Thea von Rabenstein erwartet also ein Kind, überlegte er, das Kind eines Toten. Womöglich war es Philipp dieses eine Mal sogar geglückt, einen Knaben zu zeugen. Die Rabensteiner Ritter waren unbedeutend, aber fruchtbar; ihre Weiber gebaren häufig Söhne. Natürlich war der Kleine illegitimer Herkunft und somit ein Bastard. Andererseits floß in seinen Adern das Blut eines der größten und mächtigsten Kaiser des heiligen Abendlandes.
Der Blut der Staufer.
Ludwigs Hände bebten vor Erregung, als er den Wert des Faustpfandes erkannte, welches ihm das Schicksal unerwartet in die Hände gespielt hatte. Er mußte nur noch dafür sorgen, daß Theas Fehltritt mit dem König so lange verschwand, bis er entschieden hatte, ob das Kind seinen Plänen nützlich sein konnte. Und er wußte auch schon, wie er es anstellen würde.
Ludwig von Morsch streifte sich seine schweren, ledernen Fäustlinge über. Dann kehrte er in die Halle zurück, um bei der Erhebung und Aufbahrung des toten Königs zu helfen. Von nun an galt es, wachsam zu sein und sich in Geduld zu üben. Wenn es nicht anders ging, auch ein Menschenleben lang. Denn die Staufer, soviel wußte er, hatten ein gutes Gedächtnis.
Erstes Kapitel Bamberg, im Frühjahr 1235
Die Schenke Zum Haupt, ein verwinkeltes Fachwerkhaus an der Straße, die zum Kaulberg hinaufführte, war bei schlechtem Wetter meistens besonders gut besucht.
Ein heftiger Sturmwind, Regen und Hagel hatten die Handwerker und ihre Gesellen von der nahen Dombaustelle in die Stadt getrieben, wo sie nun die Wärme und Behaglichkeit des Gasthauses genossen. Der unerwartet frühe Feierabend freute vor allem die jüngeren Männer, denn sie hatten bereits im Morgengrauen bei empfindlicher Kälte auf den Gerüsten gestanden oder hatten schwere Steinquader auf die Baustelle geschleppt. Die Zeiten waren hart, Lohn und Verpflegung kärglich, die Meister und Gesellen streng. Eingehüllt vom Dunst der Kochstelle, schüttelten sich die jungen Burschen nun die Regentropfen aus den Haaren und schnupperten heißhungrig in Richtung des dampfenden Kessels. Ein verlockender Duft von gekochter Blutwurst mit Kraut und Wacholder breitete sich im Schankraum aus. Ohne Umschweife besetzten die Männer die Bänke, die der Feuerstelle am nächsten standen, und streckten Grete, der Schankmagd, die soeben die Wirtsstube betreten hatte, erwartungsvoll ihre Becher entgegen.
Grete, eine spindeldürre Frau von etwa vierzig Jahren, stapfte mit sauertöpfischer Miene zwischen dem trägen Mannsvolk umher und füllte die Becher mit dünnem, heißem Bier, das schneller in den durstigen Kehlen verschwand, als sie es auszuschenken vermochte. Dabei konnte sie nicht umhin, das garstige Wetter zu verwünschen, das die ganze Stadt in einen undurchdringlichen Schleier aus Nebel und grauen Wolken hüllte. Eigentlich hatte die alte Mathilde, Gretes Dienstherrin, ihr einen freien Abend versprochen. Grete hatte vorgehabt, sich am Halsgraben mit einem Knochenhauer zu treffen, der seit geraumer Zeit um sie herumstrich und ihr Avancen machte. Nun aber würde sie die Schenke nicht verlassen dürfen. Das Unwetter und die überraschend große Gästeschar vereitelten ihr Stelldichein.
Grete sandte einen düsteren Blick zu den schmalen, mit Ziegenhaut verhängten Fensteröffnungen neben dem Rauchfang. Die hölzernen Läden klapperten im Wind gegen die Hauswand, als wollten sie mit ihr sprechen. Wahrscheinlich würde das Brennholz nicht ausreichen; sie mußte wohl oder übel zum Schuppen hinüber. Und die alte Mathilde lag oben in ihrer zugigen Kammer, Brust und Bauch mit Gänseschmalz und Teufelsbiß eingeschmiert, und hustete sich die Seele aus dem Leib. Bei Gott, was für eine Nacht würde dies noch werden!
Unvermittelt wurde die Tür geöffnet, und eine lärmende Gruppe von Männern betrat die Schenke. Es waren die Vertreter der Bildhauer und Steinsetzer, die am längsten in ihrer Bauhütte ausgeharrt hatten, um die halbfertigen Figuren sowie die Ziersteine für den Dom vor dem Regen in Sicherheit zu bringen. Nun aber stolperten sie krakeelend durch den Raum, vorbei an den besetzten Tischen der Gäste, und erschreckten Mathildes Hühner, die auf dem Boden vor dem Ausschank nach Brosamen pickten. Ihre Stiefel verteilten eine Spur von feuchtem Laub, Morast und Straßenkot auf dem festgestampften Lehmboden. Grete schnaubte. Sie warf den Männern einen mißbilligenden Blick zu und stemmte die Hände in die Hüften. Nun würde sie bis Mitternacht beschäftigt sein, um die Bänke sauber zu wischen und das schmutzige Stroh gegen frisches auszuwechseln. Und das bei dieser Feuchtigkeit, die einem Gicht und Fieber in die Knochen trieb. Als sie sich mit keifender Stimme bei den Handwerkern beklagte, kam ein schlanker Bursche auf sie zu, kniff sie übermütig in die Wange und erkundigte sich mit einem entwaffnenden Lächeln, ob er ihr später beim Aufräumen behilflich sein durfte.
»Das wäre ja noch schöner«, brummte Grete halbwegs versöhnt. Obgleich ihr das Getue des Jünglings peinlich war, mußte sie zugeben, daß seine Aufmerksamkeit ihr guttat. Allzu viele Gelegenheiten, unter die Haube zu kommen, gab es für ein altes Mädchen wie sie nicht mehr.
»Nun, was sagst du?«
»Was soll ich schon dazu sagen?« Grete hob die Schultern. »Männern, die mit Fäustel und Hammer auf Steinblöcke einschlagen, vertraue ich bestimmt nicht meine guten irdenen Krüge an.« Sie machte einen Schritt zur Seite und musterte den Burschen eingehend. Er und seine Zunftgenossen kehrten regelmäßig bei ihr in der Schenke ein. Zumeist ließen sie sich schäumendes Dunkelbier bringen und trieben derbe Scherze mit ihren Lehrjungen, bis die Knaben sich mit verheulten Gesichtern in einen Winkel flüchteten. Manche der Gesellen konnten sogar gewalttätig werden, wenn sie sich gereizt oder verspottet fühlten.
Der junge Mann, der Grete angesprochen hatte, war ihr noch nie unliebsam aufgefallen. Und dies war sein Glück, denn die Magd hatte ein gutes Gedächtnis und merkte sich jedes Gesicht, jede Geste und jede Bemerkung, die in der Schenke die Runde machte. Der Steinmetz, befand sie sachkundig, war ein hochgewachsener, freundlicher, jedoch reichlich wortkarger Kerl von gut zwanzig Jahren. Einer von der linkischen Sorte, die in ihre Arbeit verliebt waren und selbst am späten Abend nicht von ihrem Tagwerk lassen konnten. Eines Nachts hatte sie ihn dabei ertappt, wie er mit einem Messer merkwürdige Skizzen auf den Schanktisch gemalt und dann darüber gegrübelt hatte, bis das Binsenlicht an der Wand erloschen war.
»Bist du nicht Lukas, ein Schützling von Meister Norbert aus der schmalen Gasse, die zur Martinskirche führt?« fragte sie.
Der Geselle zog seine zerknautschte Filzkappe vom Kopf und beantwortete die Frage mit einem spöttischen Augenaufschlag. Wenngleich seine Schultern und Oberarme auch nicht so muskulös waren wie die vieler seiner Zunftgenossen, wirkte er im Schein der Lampe doch gesund und kräftig. Sein schulterlanges Haar war noch feucht und legte sich in bezaubernden, kupferfarbenen Locken um Schläfen und Wangen. Kein Wunder, daß so manche Jungfrau in der Stadt heimlich die Augen verdreht, wenn sie ihn über den Domplatz laufen sieht, dachte Grete. Ihr Blick fiel auf die Hände des jungen Mannes. Sie waren mit einer Schicht feinen, weißen Staubes überzogen, der im müden Schein der Talglampe funkelte wie ein Himmel voller Silbersterne. Nicht minder glitzerte die blanke Münze, die der Bursche als Amulett an einer festen Lederschnur um den Hals trug. Das Metallstück war aus feinem Silber gearbeitet und im Grunde viel zu kostbar für einen einfachen Gesellen. Angeblich besaß er Münze und Kettchen bereits seit frühester Kindheit. Man erzählte sich, daß er diesen Schmuck niemals, nicht einmal in der Badestube abnahm.
»Laß es gut sein, Bursche«, sagte Grete nach einer kurzen Weile lächelnd. »Ich kenne euch Gesellen nur zu gut. Ihr habt nichts als Unfug im Kopf und würdet mir beim Aufräumen den halben Weinkeller leer saufen. Außerdem muß ich nach dem Schmorfleisch im Kessel sehen!« Sie machte kehrt, um sich hinter den Schanktisch zurückzuziehen.
»Bringst du mir und meinem Meister einen Krug von eurem berühmten Hangwein an den Tisch?« rief ihr Lukas treuherzig hinterher. »Dann kommen wir erst gar nicht in Versuchung, deinem Keller einen Besuch abzustatten.«
Die Frau drehte sich um und legte die Stirn in Falten. »Wein an einem blanken Werktag?« Sie schüttelte beinahe beleidigt den Kopf. »Gibt’s nicht im Haupt, das solltest du eigentlich wissen, Lukas. Bist schließlich schon ein paar Jährchen bei uns in der Stadt. Oder habt ihr etwas zu feiern? Einen Namenstag vielleicht? Wer ist denn der dunkelhaarige Kerl am Tisch des alten Norbert?« Sie wies mit ihrem Krug auf einen der hinteren Tische, der vom Schein des Kerzenrads, das an der Decke hing, nur zur Hälfte beleuchtet wurde. »Ich hoffe, er gehört nicht zu den vornehmen Welschen, die der Bischof uns auf den Hals gehetzt hat, um die Bamberger Handwerker noch mehr zu demütigen.«
Lukas winkte lachend ab. »Wahrscheinlich spielen sie nur eine Runde zusammen. Mein armer Meister kann seine Finger nicht von den Würfeln lassen. Dreimal hat man ihn wegen dieser Schwäche schon vor die Zunftmeister geladen.«
Während Grete in den Vorratskeller hinunterstieg, um ein Faß anzustechen, kehrte Lukas gedankenverloren an seinen Platz nahe der Feuerstelle zurück. Einen freien Schemel fand er nicht mehr, daher lehnte er sich mit dem Rücken gegen die Stützbalken. Entspannt ließ er die Atmosphäre des Ortes auf sich wirken. Er liebte die Nische, weil sie warm war und die Feuchtigkeit aussperrte, die ansonsten überall durchs Mauerwerk drang. Auf hohen hölzernen Stangen hatte Grete Bündel von Heil- und Gewürzkräutern zum Trocknen aufgehängt; sie verströmten einen aromatischen Duft nach Wald und Wiese und nahmen dem Qualm der Feuerstelle seine beißende Schärfe. Außerdem konnte Lukas hier den Worten des Fremden, der beim Norbert saß, am besten lauschen. Er kannte den Mann nicht, vermutete aber, daß er nicht dem französischen Bautrupp angehörte, sondern mit dem Kaufmannszug aus dem Osten in die Stadt gekommen war. Die wappengeschmückten Wagen waren ihm bereits am Tag zuvor aufgefallen, als er jenseits des grünen Walles auf eine verspätete Lieferung aus dem Steinbruch gewartet hatte.
Lukas konnte sich ein spöttisches Lächeln nicht verkneifen. Der alte Norbert war ein lammfrommer Mann, der selbst am meisten darunter litt, wenn er Lehrjungen und Gesellen tadeln mußte. Mit einem der auswärtigen Baumeister hätte aber selbst er nicht so friedlich beisammen gesessen, da die Spannungen zwischen den Bambergern, die an dem einst durch eine Feuersbrunst zerstörten Dom arbeiteten, und den französischen Bildhauern aus Reims spürbar zugenommen hatten. In die grundsätzliche Auseinandersetzung um Fragen des Stils und der Bauweise hatten sich bald persönliche Befindlichkeiten gemischt. Schließlich war es den Fremden nach hitzigen Wortgefechten gelungen, den greisen Bischof auf ihre Seite zu ziehen. Der französische Baumeister Villard de Honnecourt wohnte auf dessen Burg und ließ sich dort umschwärmen wie ein Edelmann. Einige seiner Anhänger prahlten offen mit ihren geometrischen Kenntnissen, die sie wie kostbare Geheimnisse hüteten. Dieses Gehabe erregte Unmut in der Stadt. Die Bamberger Handwerker weigerten sich, Befehle aus dem Mund eines Mannes anzunehmen, dessen Sprache sie nicht einmal verstanden. In den vergangenen Wochen hatten die Aufseher des Bischofs nicht selten Streitigkeiten schlichten müssen; einmal war es sogar zu Handgreiflichkeiten gekommen, bei der teure Werkzeuge, ein Flaschenzug und auch mehrere Nasenbeine zu Bruch gegangen waren.
Lukas verstand den ganzen Wirbel um die französischen Steinarbeiter nicht. Vor seinem Meister und dessen älteren Gesellen wagte er es nicht zuzugeben, doch er hätte liebend gern mehr über Kunst und Technik der fremden Baumeister erfahren. Die Älteren erzählten hinter vorgehaltener Hand wunderliche Geschichten über die Art und Weise ihrer Konstruktionen. Die Franzosen beherrschten Handgriffe, die in den meisten deutschen Städten noch nahezu unbekannt waren. Ihre Fensterbögen waren nicht breit und gerundet, sondern liefen spitz zusammen; die Figuren, die sie in Reims aus dem Stein schlugen, waren angeblich von großer Schönheit und wirkten so lebendig, daß manche Beobachter bei den heiligen Gebeinen Christi schworen, sie hätten gesehen, wie Statuen die Köpfe geneigt, die Arme erhoben oder ihnen zugeblinzelt hätten. Lukas hielt die Geschichten zwar für abergläubisches Geschwätz, doch was auch immer dahinterstecken mochte, es legte Zeugnis von der Kunstfertigkeit der fremden Bildhauer ab und von ihrem Geschick, kaltem Stein mit ihrem Fäustel Leben einzuhauchen.
Lukas mochte Norbert, der im Gegensatz zu anderen Lehrherrn, die ihre Schüler schlugen und hungern ließen, immer gut zu ihm gewesen war. Der alte Meister hatte in jungen Jahren auf verschiedenen Dombaustellen gearbeitet und seinem Schützling alles beigebracht, was er selber konnte. In fremde Länder war er auf seiner Gesellenwanderung indessen nie gekommen. Vielmehr hatte er eifrig daran gearbeitet, ein Geschäft aufzubauen und seinen Ruf in der Heimatstadt tadellos zu halten.
Im Unterschied zu Norbert war Lukas von glühendem Ehrgeiz beseelt. Trägheit konnte er nicht ausstehen. Seit er in Bamberg lebte, träumte er davon, eines Tages die prächtigen Kathedralen in Frankreich und Rom zu sehen, ihre Grund- und Aufrisse zu studieren und von den mannigfaltigen Erfahrungen der großen Baumeister zu lernen. Er dachte auch an die geheimen Zusammenkünfte in den Hütten der französischen Steinsetzer, an die sonderbaren Zeichen, mit denen sie von ihnen aufgezogene Mauern oder Absätze kennzeichneten, und wünschte sich sehnsüchtig, ihren geometrischen Geheimnissen auf die Spur zu kommen. Doch wie die Dinge im Moment lagen, war daran nicht einmal zu denken. Zwar befand sich seit dem Ende der Fastenzeit mit Villard de Honnecourt ein begnadeter Meister der geometrischen Kunst in der Stadt, aber den einheimischen Handwerkern war der Fremde ebenso suspekt wie seine Helfer. Ihren Zünften fiel nichts Besseres ein, als dem weitgereisten Baumeister das Leben schwerzumachen. Lukas fand dieses Verhalten kleingeistig, er durfte allerdings auf keinen Fall riskieren, die eigene Bruderschaft zu verärgern. Zu mühsam war der Weg gewesen, den er vom ersten Meißelschlag bis zur Aufnahme in die Dombauhütte zurückgelegt hatte. Abgesehen davon, galt es für ihn, ein Geheimnis zu hüten, eine Sache, die mit seiner Herkunft zu tun hatte und in der Stadt besser nicht die Runde machte.
Fröstelnd verschränkte Lukas die Arme vor der Brust. Es war wahrhaftig nicht einfach, sich in Bamberg zu behaupten. Selbst der Wein ließ auf sich warten. Wenn die Arbeit am Dom ebenso schleppend weiterging, würden nicht einmal mehr die Enkel der Handwerker die Einweihung ihres Gotteshauses erleben.
Die dröhnende Stimme des Fremden holte Lukas unsanft aus seinen Gedanken. Der dunkelhaarige Reisende trug eine blaue Tunika aus feingewobener Wolle, deren Kragenteil mit rötlichen Lederaufsätzen in Form von kleinen Zinnen verziert war und von einer wertvollen Brosche gehalten wurde. An seinem rechten Handgelenk prangte ein bronzener Armreif, in den fremdländische Zeichen graviert waren. Er sprach sehr langsam, betonte jedes Wort sorgfältig, als befürchte er, die Männer am Tisch könnten den Sinn seiner Rede mißverstehen. Sein angenehmer, weicher Akzent deutete indessen darauf hin, daß er mit einer fremden, wahrscheinlich südländischen Sprache aufgewachsen war und sich mit dem ungewohnten Dialekt seiner Gesprächspartner schwertat. Hin und wieder stockte er, wenn ihm ein Wort nicht sogleich einfiel. Immerhin gelang es ihm, diese Unsicherheit mit einem einnehmenden Lächeln und temperamentvollen Gesten auszugleichen.
»Madonna, ich begreife nicht, warum sich die Handwerker und Händler zu Bamberg von den geistlichen Herren ausbeuten lassen«, hörte Lukas den Mann sagen. Seine schwarzen Augen blitzten herausfordernd im Schein der Lampe. »Ihr bezahlt bedeutend höhere Steuern als die Nürnberger, seid dafür aber schlechter befestigt und habt nicht einmal das Recht, einen eigenen Stadtrat zu wählen!«
Norbert fuhr sich über den Bart. Seine von braunen Flecken gezeichnete Hand bewegte sich rhythmisch, als schüttelte sie einen unsichtbaren Würfelbecher. »Ist es nicht Gottes Wille, daß ein Mann im Schweiße seines Angesichts das tägliche Brot verdient?« warf er zaghaft ein. »Ich kann Euch nur raten, etwas leiser zu sprechen, Locator. Es ist gefährlich, sich mit unserem Bischof anzulegen. Seine Leute schlafen nie, sie sitzen überall in der Stadt.«
»Es ist auch gefährlich, sich den alten Salomann zum Feind zu machen, Meister«, ergänzte Lukas in gelangweiltem Ton. Er verstand die ganze Aufregung nicht; politische oder religiöse Fragen hatten ihn bisher selten berührt, und den Bischof, der sich seit Menschengedenken in seiner Festung verschanzte, bekamen die Stadtbewohner ohnehin kaum jemals zu Gesicht. Wenn Lukas etwas mit den geistlichen Herren verband, so war es einzig und allein seine Leidenschaft für den Bau des Domes. Die mächtigen Türme der unvollendeten Kathedrale, die unnahbar und erhaben auf die Gassen der Stadt herabsah, hatten ihn in ihren Bann gezogen, kaum daß er zum ersten Mal den Burgberg erklommen hatte.
Lukas unterdrückte ein Gähnen. Er war müde, hatte aber noch keine Lust, nach Hause zu gehen. Statt dessen zog er sein Schnitzmesser aus dem Gürtel und fuhr sich damit unter die schwarzen Ränder seiner Fingernägel. Dafür und für seine vorlaute Bemerkung fing er sich einen tadelnden Blick seines Meisters ein.
»Salomann?« Der Fremde hob argwöhnisch den Kopf. »Von wem spricht Euer Geselle? Ihr sagtet mir doch gerade, es gebe weder Bürgermeister noch Ratsherren in Bamberg.« Lukas fühlte sich geschmeichelt, weil der Fremde ihn offensichtlich für Norberts Sohn hielt. Er öffnete den Mund, um zu einer Erwiderung anzusetzen, aber da erschien auch schon Grete mit einem randvollen Weinkrug in der Hand, den sie augenzwinkernd vor den Männern auf den Tisch stellte. Der junge Steinmetz wartete ungeduldig, bis sie wieder zwischen den Balken des Schankraums verschwunden war. Dann sagte er: »Es gibt hier in der Tat keinen Stadtrat, Herr. Der Bischof und die Stiftsherren, denen fast der gesamte Grund und Boden gehört, wollen den Bürgern nicht einmal erlauben, einen Vogt oder Schöffen zu wählen. Allerdings regt sich gegen diesen Zustand seit langem schon geheimer Widerstand. Wir sind schließlich keine Einfaltspinsel, die sich alles gefallen lassen. Einer unserer Kaufleute, ein Mann namens Salomann, der durch den Pelz- und Tuchhandel reich geworden ist, setzt alles daran, die Privilegien der weltlichen Siedlung gegenüber den Leuten vom Domberg zu verteidigen.«
»Nun ja, Herr Salomann ist vor allem daran interessiert, seine Geschäfte auszuweiten«, meinte Norbert seufzend, während er mit zittrigen Fingern seinen Becher füllte. »Aber mein Geselle hat ganz recht, Herr. Der Kaufmann hat Einfluß in der Stadt. Viele Handwerker, die sich vor dem westlichen Burgtor niedergelassen haben, stehen in Salomanns Schuld, weil er sich mit dem kaiserlichen Landrecht auskennt und weiß, wie man den Bischöflichen begegnet. Wenn Ihr ihn von Euren Plänen überzeugen könntet, würde er Euch vielleicht weiterhelfen.«
»Ja, dann …«
»Macht Euch bloß keine Hoffnungen, mein Freund. Er wird sich nicht überzeugen lassen. Im Gegenteil: Wie mein Geselle schon sagte, der Mann kann recht ungemütlich werden, wenn jemand es wagt, ihm ins Handwerk zu pfuschen.«
Der Fremde hob abwägend die Augenbrauen, was seinen Zügen einen undurchsichtigen Ausdruck verlieh. Mit der linken Hand zog er seinen Kapuzenmantel straffer über der Brust zusammen, die rechte blieb zwischen den Falten des weiten Gewandes verborgen. Seine Blicke wanderten forschend zu den Männern an den Nebentischen hinüber. Die meisten Handwerker und Krämer brüteten stumpfsinnig über ihren Bierhumpen oder lauschten dem Klang einer einzelnen Flöte. Ein paar jüngere Männer hingegen waren auf die Unterhaltung aufmerksam geworden und spitzten neugierig die Ohren.
»Was könnte dieser Kaufmann schon dagegen haben, wenn ein paar Steinsetzer, Weber oder Gewandschneider sich unserem Zug anschließen?« fragte der Dunkelhaarige. Er setzte seinen Becher so energisch ab, daß einige Tropfen über den Rand schwappten. »Ich bin kein Jahrmarktsgaukler, sondern im Auftrag eines der angesehensten Fürsten unterwegs. Mein Herr und der König von Ungarn laden tapfere und geschickte Männer ein, sich mit ihren Familien in den weiten Ebenen Siebenbürgens niederzulassen.« Ohne den warnenden Blick des alten Norbert aufzunehmen, erhob sich der Fremde und stieg auf seinen Schemel. Einen Augenblick lang betrachtete er die Anwesenden abschätzend. Dann klatschte er plötzlich in die Hände, um sich Gehör zu verschaffen. Das Gelächter im Raum verstummte ebenso schlagartig wie das Flötenspiel. Alle Köpfe fuhren herum. Sogar Grete und die Lehrjungen am Feuer reckten die Hälse, um den sonderbaren Reisenden besser sehen zu können.
»Wackere Bürger von Bamberg«, hob der Fremde nun so laut an, daß man ihn selbst im hintersten Winkel der Schenke verstehen konnte. »Mein Name ist Matthäus Hagen. Ich befinde mich nur auf der Durchreise in eurer Stadt. Doch was ich seit meiner Ankunft hier gesehen habe, reicht wohl aus, um mir ein Bild von den Verhältnissen zu machen, in denen ihr lebt. Ihr dürft mir glauben, Leute: Seit ich mit meinem Weib und meinem Sohn als Locator durch die Lande ziehe, kehre ich in vielen Städten und Marktflecken ein, daher weiß ich wohl, wovon ich rede. Ich habe gesehen, daß ihr einen prachtvollen Dom erbaut habt, und das ist wahrhaftig eine ehrenvolle Aufgabe, die euch den Segen der Jungfrau und reichlich Ablaß von Sündenschuld bescheren wird. Gott wird euch eines Tages für eure Frömmigkeit belohnen, daran gibt es keinen Zweifel. Doch wie steht es hier und heute mit euren Rechten und Privilegien? Wohin ich blicke, sehe ich Ländereien, die euch nicht gehören, nämlich Stiftsland. Die geistlichen Herren lassen euch nicht nur an Kirchen, Klöstern und Kapellen schuften. Nein, sie errichten auch Mauern und Wehrtürme, um ihre Besitztümer vor euch zu schützen. Eurer Stadt erlauben sie dagegen nicht einmal eine Befestigung aus Stein. Entlang der Gassen sieht man kaum mehr als schiefe Lehmkaten und Holzbuden. Tritt die Regnitz über die Ufer, überschwemmt sie den Marktplatz, und eure Krämer holen sich nasse Füße.«
Betroffenes Wispern machte sich breit. Lukas hielt den Atem an. Ein Seitenblick auf Meister Norbert verriet ihm, daß der Alte am liebsten im Boden versunken wäre. Schweißtropfen perlten von seiner zerfurchten Stirn. Gewiß bereute er es schon lange, den Fremden ausgerechnet an seinen Tisch geladen zu haben. Eigentlich hatte der Dunkelhaarige einen recht vernünftigen Eindruck gemacht, nun aber begann er, sich um Kopf und Kragen zu reden. Wenn die bischöflichen Soldaten ihn dabei erwischten, wie er das Volk gegen die Chorherren aufhetzte, würde man ihn im besten Falle stäupen und von Hunden aus der Stadt jagen lassen.
»Der Bischof darf die Immunitäten nicht besteuern«, fuhr der Locator mit fester Stimme fort, »also legt er euch Bürgern eine zusätzliche Steuerlast auf, um seine Schatzkammern zu füllen!«
»Schweig lieber, du hergelaufener Strolch!« unterbrach ihn ein dicker Kerl, dessen Wangen bereits vom Bier gerötet waren. Drohend schüttelte er seine Faust. »Unser gnädiger Herr Bischof ist ein frommer Mann. Wir stehen bei ihm in Lohn und Brot, und darum betet er täglich für die Seelen derer, die beim Bau seines Doms helfen! Außerdem kann es uns teuer zu stehen kommen, wenn seine Leute davon erfahren, daß am Kaulberg Aufruhr gepredigt wird!«
»Der Bischof ein Heiliger?« mischte sich ein anderer Gast mit schwerer Zunge in das Gespräch ein. »Daß ich nicht lache! Hast du etwa vergessen, was vor ein paar Jahren oben auf der Burg geschehen ist? Dein sauberer Bischof hat sich vor Angst in die Hosen geschissen, als der Wittelsbacher …« Unvermittelt brach der Trunkenbold ab und senkte brummend den Kopf. Die Ahnung, nicht über gefährliche Dinge zu reden, die längst vom Staub der Zeit begraben wurden, hatte ihn jäh verstummen lassen.
»Wer spricht denn von Aufruhr?« fragte Matthäus Hagen freundlich. »Ich würde niemals dazu aufrufen, gegen die Landesherren aufzustehen. Mein Auftrag lautet lediglich, im Namen Seiner Gnaden des Herzogs von Sachsen ehrliche und strebsame Menschen einzuladen, sich in den fruchtbaren Ebenen Siebenbürgens niederzulassen.«
»Was, zum Teufel, sollen wir schon unter einem Haufen wilder Heiden anfangen?« brüllte der Dicke, der Matthäus schon einmal ins Wort gefallen war. »Uns von ihnen auffressen lassen?«
»Die Weiber dort sollen Köpfe wie Pferdeärsche haben«, trug einer der Lehrlinge zu der Unterredung bei, wofür er von seinen Kameraden Gelächter, von seinem Meister allerdings einen Nasenstüber erntete.
»Es ist ganz einfach, mein Freund. Im Osten habt ihr die Möglichkeit, neue Kirchen zu bauen, und zwar nach einem ordentlichen Stadtrecht, das euch zu Herren macht, nicht zu Leibeigenen. Dort seid ihr euren Stiftsherrn nicht mehr zinspflichtig. In Siebenbürgen erhaltet ihr verbriefte Zunft- und Gilderechte. Nicht zu vergessen das Privileg, Münzen zu prägen und Jahrmärkte abzuhalten. Kein Landmann braucht auch nur einen halben Tag Fron zu leisten, keines eurer Hühner wandert zu Michaeli in die Töpfe der Chorherren.« Er lächelte den Männern an der Feuerstelle zu, die Mund und Augen weit aufsperrten. »Und ihr jungen Burschen könntet Meister sein, ehe ihr euren ersten Nagel in die Balken getrieben habt.«
Die Worte des Fremden verfehlten ihre Wirkung nicht, insbesondere bei den jüngeren Zuhörern schienen sie auf fruchtbaren Boden zu fallen. Lukas bemerkte, wie seine Nachbarn die Köpfe zusammensteckten und aufgeregt miteinander zu flüstern begannen. Andere stellten in anklagendem Ton fest, daß sie unter der Knute des Bischofs ja wahrhaftig lange genug gelitten hatten, und klopften anerkennend mit ihren Bechern auf die Tische, was Grete als Aufforderung verstand, die Krüge aufzufüllen und schleunigst nachzuschenken.
Dann aber machte der Locator des Herzogs einen bedeutungsvollen Fehler. Er glaubte sich mit seiner Rede bereits am Ziel angelangt, dabei hatten seine Worte vom freien Leben im Land Siebenbürgen bestenfalls bewirkt, daß die Bamberger über ihren alten Streit mit den geistlichen Herren nachdachten. Matthäus griff zwischen die Falten seines weiten Gewandes und zog eine verblichene Pergamentrolle hervor, die er mit einem triumphierenden Lächeln in den Schein der flackernden Lampe hielt.
»Wer bereit ist, der Einladung meines Herzogs und des ungarischen Königs zu folgen, darf sich uns anschließen. Aus Rücksicht auf den ehrenwerten Bischof Ekbert haben wir unser Lager nicht hier in Bamberg, sondern einige Meilen flußabwärts in Pettstadt aufgeschlagen. Schaut her, ihr Leute! Setzt eure Zeichen unter die Namen eurer Nachbarn, die sich bereits entschieden haben.«
Lukas und Norbert wechselten unruhige Blicke, während die Worte des Fremden in aufgeregtem Gemurmel untergingen. Wovon sprach dieser Matthäus nur? Seinen Worten zufolge, gab es bereits Bamberger Familien, die im Sinn hatten, sich klammheimlich aus der Stadt zu verdrücken. Handwerker, die den Dombau aufgaben und dem französischen Bautrupp des Bischofs somit das Feld zur Ernte überließen. Ein Sturm der Entrüstung entlud sich über dem Haupt des Locators.
»Wer sind die Verräter, die dir Rattenfänger nachlaufen?« kreischte der fette Zimmermann aufgebracht. Seine Stimme überschlug sich vor Zorn. »Her mit dem Wisch, du Hundsfott, sonst kannst du etwas erleben!« Hastig sprang der Wütende hinter seinem Tisch hervor, geradewegs auf den verdutzten Locator zu. Er versuchte, ihm die Pergamentrolle aus der Hand zu reißen. Der Locator schwang sich mit einem Satz auf den Tisch und wehrte den Zimmermann mit Stiefeltritten ab.
»Komm runter, du eitler Maulheld!« keuchte der Dicke atemlos. »Ich will sofort wissen, wer die Frechheit besitzt, unsere Arbeiter abzuwerben!« Er wandte den Kopf in Richtung der Schankmagd. »Grete, heiz das Feuer an! Wir brennen die Antwort aus ihm heraus!«
Der alte Norbert war kalkweiß geworden. Seine Finger fuhren nervös durch die dünnen grauen Haare. Dann blickte er sich nach seinem Gesellen um und raunte ihm verstohlen zu: »Wird’s bald, Lukas. Steh nicht so dumm herum. Hilf dem Mann!«
Lukas stutzte. Was sollte das nun schon wieder bedeuten? Auf wessen Seite stand sein Meister eigentlich? Er konnte doch nicht von ihm verlangen, daß er sich gegen Freunde und Nachbarn stellte, um einem dieser unbeliebten Werber beizustehen. Zögernd tappte er aus seinem behaglichen Winkel und starrte seinen Meister an.
»Salomanns Knechte kommen die Gasse herauf«, rief ein alter Mann neben ihm mit triumphierender Stimme. Im nächsten Moment wurden die Fensterluken aufgestoßen. Ein eisiger Windstoß fegte einen Strauß von Blättern, Sand und Regen in den Schankraum. Norbert fuhr erschrocken zusammen. »Hilf dem Fremden«, wiederholte er noch einmal, »sonst … sind wir hier für alle Zeiten erledigt!«