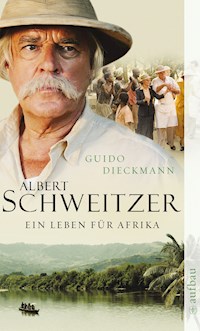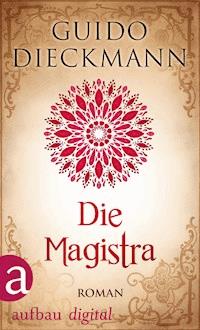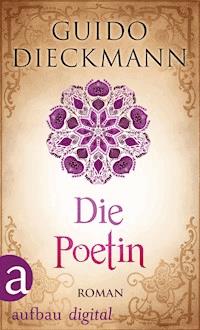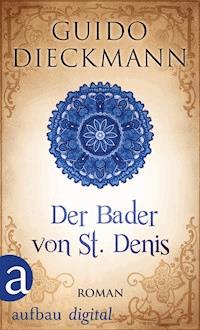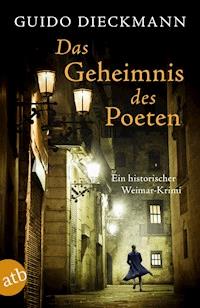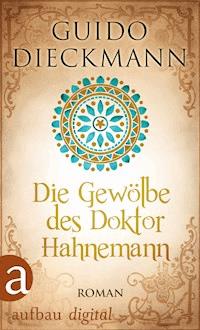
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Alchimist, Scharlatan oder genialer Heiler?
Sachsen im Jahre 1765: Auf der Albrechtsburg träumt der junge Samuel Hahnemann, Sohn eines Porzellanmalers, davon, ein berühmter Arzt zu werden. Schon früh ist er von den dunklen Seiten der Medizin fasziniert. Hahnemann sucht die Nähe zu mystischen Zirkeln und unternimmt alles, um an eine verschollen geglaubte Schrift des Paracelsus zu gelangen. Doch damit ruft er einen geheimen Orden auf den Plan, ihn aus dem Weg zu räumen ...
Der Roman über den legendären Begründer der Homöopathie.
"Eine gut erzählte Geschichte - ein spannender Plot, der mit mehr als einer Überraschung aufwarten kann." Die Rheinpfalz.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 635
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Informationen zum Buch
Alchimist, Scharlatan oder genialer Heiler?
Der erste Roman über den legendären Begründer der Homöopathie
Sachsen im Jahre 1765: Auf der Albrechtsburg träumt der junge Samuel Hahnemann, Sohn eines Porzellanmalers, davon, ein berühmter Arzt zu werden. Schon früh ist er von den dunklen Seiten der Medizin fasziniert. Hahnemann sucht die Nähe zu mystischen Zirkeln und unternimmt alles, um an eine verschollen geglaubte Schrift des Paracelsus zu gelangen. Doch damit ruft er einen geheimen Orden auf den Plan, ihn aus dem Weg zu räumen.
»Eine gut erzählte Geschichte – ein spannender Plot, der mit mehr als einer Überraschung aufwarten kann.« Die Rheinpfalz
Guido Dieckmann
Die Gewölbe des Doktor Hahnemann
Roman
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
Nachwort des Autors
Über Guido Dieckmann
Impressum
Wem dieses Buch gefallen hat, der liest auch gerne …
1. Kapitel Meißen, im Sommer 1765
Das Mädchen erhob sich geräuschlos von der harten Pritsche ihres Notlagers. Jeder einzelne Knochen im Leib tat ihr weh. Sie war müde, und als sie ihr Quartier verließ, träumte sie mit offenen Augen. Den Schatten, der ihr seit dem ersten Hahnenschrei des Tages beharrlich an den Fersen hing, nahm sie nicht einmal aus den Augenwinkeln wahr.
Ohne besondere Eile lief sie die breiten Stufen des Wendelsteins hinunter und überging mit stoischer Gelassenheit die anzüglichen Blicke der Bediensteten, deren Pflicht es war, den Frauen und Mädchen ihren Weg zum Badehaus oder zu den Zisternen im westlichen Burghof auszuleuchten. Die meisten Frauen haßten diese morgendlichen Gänge zur frühen Stunde und das schlaftrunkene Stöhnen ihrer plumpen Begleiter, die ihre engen Kniebundhosen an den Seiten rein zufällig, aber mit regelmäßiger Beharrlichkeit zu schnüren vergaßen. Doch sie hatten keine Zeit, über die schlechten Manieren der Knechte herzuziehen, denn die großen Brennöfen in der Manufaktur mußten noch vor Tagesanbruch angezündet werden.
Charlotte Rebus ignorierte das Getuschel um sie herum. Trotz des Werktages trug sie ein veilchenblaues Kleid mit weißem Spitzenbesatz, und ihre braunen Locken, die sie nur selten unter eine Haube zwängte, glänzten in der gleichen Farbe wie die kostbare Täfelung des ehemaligen Zeremoniensaales. Mit ihren etwas zu groß geratenen Zähnen und den weit auseinander stehenden Augen war sie nicht eigentlich hübsch, doch sie hatte gelernt, ihre Mängel durch ein sicheres Auftreten und ein entwaffnendes Lächeln auszugleichen. Die kühle Anmut ihrer Bewegungen schuf eine unüberwindbare Distanz zu den übermütigen Mägden und Bürgermädchen. Keine von ihnen gesellte sich freiwillig an Charlottes Seite, und nicht nur die intelligenteren unter ihnen ahnten, daß Charlotte zufrieden und erleichtert war, nicht mit ihnen reden zu müssen.
Der Schatten, der Charlottes Spur an diesem heißen Sommermorgen lautlos wie eine Katze folgte, zeichnete sich auf den weiß getünchten Wänden des Treppenhauses als die schmächtige Gestalt des zehnjährigen Samuel Hahnemann ab, der seit einiger Zeit mit Vater und Mutter auf der Burg lebte. Samuel war klein, viel zu klein für sein Alter. Vermutlich nahm gerade deswegen niemand der betriebsam Vorübereilenden von ihm Notiz, und obwohl ihn diese Demütigung an anderen Tagen zur Weißglut trieb, kam es ihm heute gerade recht. Er mußte dem Mädchen heimlich folgen. Charlotte umgab ein Geheimnis. Dreimal war er ihr während der letzten Woche hinterhergeschlichen, doch ebensooft hatte sie ihn abgeschüttelt. Danach war sie mehrere Stunden lang verschwunden gewesen. Dafür gab es nur eine Erklärung: Charlotte hatte einen Weg gefunden, die Absperrungen zu umgehen und heimlich die Burg verlassen.
Neugierig spähte Samuel um die Ecke und sah, wie Charlotte mit einem geflochtenen Weidenkorb voller Grünzeug den Küchentrakt verließ, den Wendelstein zum Schluß aber links liegen ließ. Sie ging also gar nicht zum Badehaus. Das vulgäre Kreischen und Lachen einiger Mägde drang an sein Ohr. Es klang eher boshaft als spaßig und ließ darauf schließen, daß Charlottes Ration wieder einmal mit Abfällen gestreckt worden war. Weithin war bekannt, daß sich die Küchenmägde an den begrenzten Vorräten gütlich taten, auch wenn der Kastellan Seiner Hoheit, des Kurfürsten, von Zeit zu Zeit auf eigene Rechnung Stichproben machte. Doch der junge Kurfürst war weit und außerdem unmündig. Seit dem Tod seines Vaters, Friedrich Christian von Sachsen, regierte der strenge Prinz Xaver das vom letzten Krieg ausgeblutete Land für ihn und hielt sich, den spärlichen Berichten der Kuriere zufolge, seit Wochen schon in Polen auf, um die sächsischen Verzichtserklärungen gegen den neuen polnischen König Stanislaus Poniatowski in die Wege zu leiten. Sachsen war zerfallen. Der Traum, dem Fürstentum die polnische Königskrone Augusts des Starken zu erhalten und Preußen die Stirn zu bieten, waren an den Armeen seines Königs, Friedrich II., in tausend Splitter zersprungen. Nun hieß es, sich mit Elan dem Wiederaufbau des Staates zu widmen, eine Aufgabe, der sich die Mutter des Kurfürsten, Maria Antonie, mit besonderer Hingabe widmete, während der junge Kurfürst unter dem Einfluß seines Onkels Xaver und zahlreicher polnischer Mätressen das Hofleben seines verstorbenen Großvaters zu entdecken schien.
Charlotte muß sich ihrer Sache sehr sicher sein, dachte Samuel, während er seine Verfolgung wieder aufnahm. Im Grunde war die Unbefangenheit des Mädchens sein Glück, denn besonders geschickt stellte er sich auf seiner Pirsch durch die hallenden Gänge und über die ausgetretenen Treppenstufen der Albrechtsburg nicht an. Die Preußen hatten nach dem Frieden von Hubertusburg, im Februar 1763, nicht versäumt, die roten Läufer von den Treppen zu ziehen und ihren Beutekarren einzuverleiben. Seitdem hallten die Schritte der Burgbewohner auf den kahlen, steinernen Stufen wie das Trommeln eines Tambourmajors. Dem Jungen verursachten die lauten Geräusche im Schloß Ohrenschmerzen. Seit dem letzten Winter trug sein schmales Gesicht mit der hohen Stirn und den kleinen grauen Augen eine Blässe, die seine Mutter mit tiefer Sorge erfüllte.
»Bleich wie der Tod war er, noch ehe das große Fieber Meißen erreichte«, hatte er sie eines Abends dem Vater zuraunen gehört, während Christian Hahnemann im flackernden Licht der letzten Kerze seine dünne Suppe gelöffelt hatte. Aber sein Vater hatte nur müde abgewinkt und die Mutter zum Beten geschickt. Der Ausbau der Manufaktur und ihrer Künstlerstube erforderte all seine Kraft. Das Dasein eines Malers, der in diesen Zeiten kaum genug verdiente, um für das tägliche Brot zu sorgen, wurde nicht leichter, wenn Weib und Kinder nörgelten – oder krank wurden.
Den besorgten Blicken seiner Mutter zum Trotz fühlte Samuel sich keineswegs krank. Unten, in der Stadt, hatte er gesehen, wie das gefährliche Fieber auf die Menschen wirkte, wie es von ihren Gliedern Besitz ergriff, als fahre ein unsichtbarer Feuerstrom durch sie hindurch, der sie langsam ausbrannte. Schließlich, als die Seuche nach zwei Wochen noch immer nicht nachlassen wollte, als die Sterbeglocken der Kirchen immer häufiger läuteten und zunehmend mehr Trauerflore an den Wohnungen der Opfer prangten, hatte sein Vater kurz entschlossen Fenster und Türen ihres kleinen Hauses in der Meißener Steingasse vernagelt und sich selbst mit seiner Familie in die Räume der Porzellanmanufaktur auf der Albrechtsburg geflüchtet.
Charlotte Rebus war erst einige Tage später dort angekommen, und warum man die Tore für sie und ihren Vater überhaupt noch geöffnet hatte, blieb dem Jungen ein Rätsel. Und nicht nur ihm ging es so. Die Gerüchte wehten hinter vorgehaltenen Händen von einem Flügel zum nächsten, schneller als die Epidemie, die den Burgberg noch immer nicht erreicht hatte: Die Tochter von Pastor Rebus war sehr krank gewesen. Der Stadtphysikus hatte sie untersucht, behandelt und schließlich aufgegeben. Und doch hatte Charlotte das Fieber überlebt.
Samuel hatte mit hartnäckigem Eifer und ganz wie ein Arzt über Charlottes Fall Buch geführt. Alles, was er die Erwachsenen über den Verlauf ihrer Krankheit hatte reden hören, hatte er auf einigen Bögen dunklen Papiers festgehalten, das er aus der Manufaktur stibitzt hatte. Über die letzten Sätze seines kindlichen Krankenberichts freute er sich besonders: »Demnach muß eine Seuche nicht unweigerlich zum Tode führen«, hatte er geschrieben. »Die Rebus ist mein Beweis, und wenn ich eines Tages Arzt geworden bin, werde ich einen Weg finden, tödliche Krankheiten für immer zu besiegen.«
Ob Charlottes überstandene Krankheit aber mit ihrem täglichen Verschwinden aus der Albrechtsburg in Verbindung stand? Vier Tage war es her, seit ein Bote aus der Residenz des Kurfürsten in Dresden auf den Hof der Porzellanmanufaktur geritten war und die Wachen angewiesen hatte, sämtliche Zugänge vom Dombezirk zur Altstadt, vor allem zu den schmutzigen Lagerhäusern am Markt abzusperren, um in der drükkenden Sommerhitze eine Ausbreitung des tödlichen Fiebers zu verhindern.
Nicht nur an den Aufgängen der beiden Treppentürme, die mit ihren kurfürstlichen Wappen das ohnmächtige Meißen wie zwei grimmige Titanen überragten, hatte der Kurierreiter Wachen postieren lassen. Auch der Platz zwischen den Pferdeställen und dem alten Franziskanerkloster, mit seinem von Unkraut überwucherten Friedhof, war mittlerweile so engmaschig abgeriegelt, daß nicht einmal eine Maus mühelos einen Durchschlupf gefunden hätte.
Aber das Mädchen schienen die neuen Bestimmungen nicht zu interessieren. Unbekümmert passierte sie zwei Wächter, einen ungeheuer dicken Kerl, dessen abgetragene Uniformjacke wie eine Wurstpelle über seinem feisten Leib spannte und der sich unentwegt den Schweiß von der Stirn wischte, sowie einen jüngeren Mann mit Hakennase, der Charlotte zunächst nervös zwinkernd musterte, sie dann aber erkannte und mit einem knappen Kopfnicken in den Korridor zum Ostflügel dirigierte.
Ein bitteres Gefühl der Enttäuschung beschlich Samuel, als er bemerkte, daß Charlotte ihre Schritte zur alten Schloßkapelle lenkte. Offensichtlich hatte er sich getäuscht und das Mädchen hatte gar nicht die Absicht, ihren geheimen Durchschlupf aufzusuchen, um die Burg zu verlassen. Wahrscheinlich schleppte sie nur ihr erhamstertes Grünzeug aus der Küche in die kleine Sakristei neben der Kapelle, die ihrem Vater, dem lutherischen Superintendenten Emanuel Rebus, seit seiner Übersiedlung auf die Albrechtsburg als Quartier diente. Unvermittelt huschte ein Lächeln über sein ernsthaftes Gesicht, als Samuel sich in Erinnerung rief, mit welch leidenschaftlichem Eifer der alte Superintendent sein Quartier gegen die Knechte der Porzellanmanufaktur verteidigte, die dort, in einem Gott geweihten Raum, ihre schmutzigen Säcke mit Kaolin, Feldspat und Quarz lagern wollten.
»Als ob es in ganz Sachsen nichts Wichtigeres mehr gäbe als bemalte Tassen und unzüchtige Figuren für die Kaminsimse Dresdner Kokotten!« hörten die Bewohner der Albrechtsburg zuweilen die näselnde Stimme des Superintendenten durch die zugigen Gänge des alten Gebäudes hallen.
Charlotte blieb unvermittelt vor einer hohen, sich beidseitig zu einem gotischen Spitzbogen verjüngenden Tür stehen. Samuel hatte eben noch Zeit, sich hinter eine achtlos in den Flur geschobene Getreidewaage zu werfen, wobei er sich schmerzhaft die Rippen prellte. Aber kein Laut drang über seine Lippen. Rasch kroch er unter die schmutzige Lederplane, die das ausladende Gerät nur notdürftig bedeckte. Dann beobachtete er durch ein Loch in der Abdeckung, wie Charlotte ihren langen braunen Rock anhob und irgendeinen Gegenstand aus ihrem Strumpfband hervorklaubte. Ihre großen Augen verengten sich und sandten einen argwöhnischen Blick durch die Stille des Flures. Samuel wagte kaum zu atmen. Was führte die Tochter des alten Superintendenten bloß im Schilde? Wenn sie wirklich nur die Kapelle aufsuchen wollte, warum machte sie daraus ein solches Geheimnis?
Charlotte hielt plötzlich einen langen glänzenden Schlüssel in den Fingern und stocherte einige Sekunden lang damit im Schlüsselloch herum.
»Dummes Ding«, zischte Samuel, während sich eine fette Spinne an einem seidenen Faden direkt vor seiner Nase abseilte. Nicht einmal fähig, eine Tür zu öffnen. Aber als er wieder aufschaute, war Charlotte im Innern der alten Schloßkapelle verschwunden.
Der Junge zögerte einige Herzschläge lang, sein Versteck zu verlassen und der Tochter des Superintendenten in die Kapelle zu folgen. Daß sie die Tür nicht von innen verriegelt hatte, hatte er gehört. Allerdings verspürte er wenig Lust, ihrem Vater oder Bruder in die Arme zu laufen. Emanuel Rebus mochte den Jungen, aber sein Sohn Viktor, ein dürrer Zögling der hiesigen Fürstenschule, hatte nie einen Zweifel daran gelassen, daß er Samuel von Herzen ablehnte. Man ging sich aus dem Weg, beäugte sich höchstens argwöhnisch, wenn eine Begegnung überhaupt nicht zu vermeiden war.
Hoffentlich lungert Viktor heute nicht in der Gegend herum, schoß es dem Jungen durch den Kopf. Er würde es von Herzen genießen, wenn man Samuel hier erwischte.
Gleichgültig! Samuel gab Charlotte einen ausreichenden Vorsprung. Drei Minuten etwa, die er allerdings nur abschätzen konnte, weil ihm von seinem Platz aus die dichten Zweige einer Esche die Sicht auf die Turmuhr des Franziskanerklosters versperrten.
Dort, im Schatten der Mauern von St. Afra, wurden die Schüler der Fürstenschule Meißens in die hohen Gefilde der Wissenschaften eingeführt. In ehemaligen Mönchsstuben lernten sie Latein, Griechisch und Naturkunde, alles, was Samuel selbst sich nur in den wenigen freien Stunden, in denen sein Vater ihn nicht in der Manufaktur brauchte, aus heimlich entliehenen Büchern des Superintendenten oder seiner Tochter aneignen durfte.
Ausgerechnet Charlotte und ihr Vater waren es gewesen, die ihn eines Tages in einem Winkel neben dem Hühnerhaus der alten Witwe Schneeberger mit einer Ausgabe von Anna Maria Merians Metamorphosis Insectorum Surinamensium, einem Werk über fremdländische Pflanzen und Insekten, erwischt hatten. Seit dieser Zeit hatte der gutmütige Pastor dem wißbegierigen Knaben mit einer ihm eigenen stoischen Geduld Privatstunden in lateinischer Grammatik, Geographie und Algebra erteilt, wann immer ihm seine geistlichen Pflichten Zeit dafür ließen. Seinem Vater, dem Porzellanmaler, hatte Samuel nichts davon erzählt.
So begeistert der alte Superintendent jedoch über des Jungen rasche Fortschritte, seinen Eifer beim Rezitieren von lateinischen Vokabeln und mathematischen Formeln auch war, so sehr mehrten sich doch seit einigen Wochen auch die Augenblicke, da ihn beim Anblick des kleinen, über die Bücher gebeugten Rückens Zweifel überkamen, ob sein Handeln überhaupt Gott wohlgefällig war.
Pastor Rebus und seinem Sohn lagen Leidenschaft und wissenschaftlicher Eifer fern. Viktor lernte schwer und interessierte sich zum Leidwesen des Superintendenten weit weniger für Bücher als für heimliche Ausflüge ins Marktviertel. Und doch hatte er in seiner jugendlichen Naivität niemals die Glaubensvorstellungen seines Vaters in Frage gestellt. Er ließ sich folgsam im Katechismus der lutherischen Lehre unterrichten, ohne jemals auf die Idee zu kommen, das Gelernte zu hinterfragen.
Der Sohn des Porzellanmalers war anders. Auch Samuel betete vor jeder Stunde, die er gemeinsam mit Rebus vor den Büchern saß, aber der Superintendent wußte, daß seine Gedanken hierbei abschweiften und sich bereits voller Ungeduld auf die nächste Lektion richteten, noch ehe er das Amen gesprochen hatte. Als er es einmal gewagt hatte, seinen Schüler zu fragen, wie er sich denn seinen Schöpfer vorstelle, hatte Samuel Gott als eine magnetisierende Naturkraft beschrieben, die auf den Menschen auf die gleiche Weise einwirke wie auf die vier Elemente oder die Pflanzenwelt. Rebus hatte daraufhin im Zorn gedroht, die Privatstunden augenblicklich einzustellen, ja sogar den Vater des Jungen in der Manufaktur aufzusuchen, wenn Samuel seine üble Eitelkeit nicht sofort bereute.
Der Junge hatte bereut, auf Knien um Verzeihung gebeten und dabei mühelos und mit fester Stimme die Reueformel des 107. Psalms auf hebräisch rezitiert.
Seit diesem Tag fürchtete Emanuel Rebus seinen Schüler, wie ein Wanderer nach einem schwülen Tag einen Gewittersturm fürchtet.
Das Mädchen kam nicht wieder aus der Kapelle. Verflixt, hatte Charlotte ihn etwa doch abgeschüttelt?
Zornig gab Samuel der alten Waage einen Fußtritt. Dann ließ er seine Faust auf die kleine Spinne niedersausen, die sich direkt neben ihm an der Wand niedergelassen hatte. Das zerquetschte Insekt fiel in einem staubigen Gerinnsel aus Putz und Kalk auf die Steinplatten der kahlen Albrechtsburg.
Langsam richtete sich der Junge auf und schlich zum Eingang der Kapelle hinüber. Dort preßte er sein Ohr so fest gegen das kühle Holz, daß es beinahe schmerzte. Aber nicht der leiseste Laut drang zu ihm auf den Korridor hinaus.
Wenigstens ist Charlotte allein, dachte er und drückte vorsichtig auf die geschwungene Klinke.
Der Raum, in dem der Superintendent jeden Sonntag und an vielen Abenden unter der Woche seine Gebetsstunden zelebrierte, wirkte in seiner rechteckigen, von zwei Stützpfeilern getragenen Form kalt und leblos. Nur wenige Strahlen der Morgensonne fanden ihren Weg durch das Bleiglas zweier Fenster, brachen sich ohne jede Ordnung an einer schräg zulaufenden Seitenwand, welche die eigentliche Kapelle von der Sakristei trennte, und bohrten schließlich scheinbar kleine Löcher in den abgetretenen roten Fußläufer vor dem Altar.
Erstaunt schaute sich der Junge im Raum um. Von Charlotte war keine Spur zu entdecken. Die Augen stur auf die tänzelnden Sonnenstrahlen gerichtet, lief der Junge auf den Altar zu. Unter dem roten Läufer knarrten dicke Holzbohlen. Sonderbar, dachte er, wo doch sonst nur Steinplatten den Boden bedecken. Aber er wagte nicht, den Läufer anzuheben, noch immer glaubte er, Charlotte Rebus könne jeden Moment aus irgendeinem Versteck hervorspringen und ihn, den Eindringling, zur Rede stellen.
Es gab keine Verstecke in der Kapelle, nicht die kleinste Möglichkeit für ein knapp vierzehn Jahre altes Mädchen, sich seinen Blicken zu entziehen – und doch war Charlotte hier gewesen und dann verschwunden.
Plötzlich fiel sein Blick auf die Vorderseite des Altars. Eisige Kälte wehte ihm entgegen, wie sie nur aus einer Gruft aufsteigen konnte. Der Junge war verwirrt. Es gab hier doch gar keine alten Gräber, oder etwa doch?
Der Eishauch lähmte ihn einen Herzschlag lang so sehr, daß er am liebsten die Kapelle verlassen und in die Manufaktur zurückgekehrt wäre, um unter der Aufsicht seines Vaters und Meister Schönewinds langweilige Lilienstiele auf öde Untertassen zu klecksen. Doch rasch entschied er sich dagegen. Statt dessen beugte er sich zur Vorderseite des Altars hinunter. Es war ein prächtiger Altar, letztes Relikt einer Zeit, da die alten Markgrafen noch in der Albrechtsburg residiert und hier im Scheine Hunderter von Kerzen ihre Gebete gesprochen hatten.
Aufmerksam betrachtete Samuel die steinernen Ornamente und fragte sich, warum Emanuel Rebus in seinem religiösen Eifer die alten Symbole nicht entfernt oder zumindest mit einem Tuch abgedeckt hatte. Allerdings wußte er auch, daß so etwas streng verboten war. Seit Sachsens Kurfürst August, den man auch den Starken nannte, zum Katholizismus übergetreten war, um den polnischen Thron besteigen zu können, erfreuten sich auch im Kernland der Reformation katholische Klöster, Kirchen und Kunstwerke höchster Aufmerksamkeit des kurfürstlichen Hofes.
Auf dem Altar fand Samuel zwei dicke runde Kerzen, auf deren milchiger Oberfläche sich Dutzende von getrockneten kleinen Wachstropfen abzeichneten. Er kniff die Augen zusammen, um die lateinische Schrift auf dem schmalen Aufsatz entziffern zu können, der sich wie ein eisernes Band um den fein behauenen Stein legte. Aber es war zu finster. So fiel ihm auch das sonderbare Zeichen erst auf, als er sich schon wieder vom Altarstein abwenden wollte, um hinter dem Vorhang der Sakristei nach einem geheimen Durchschlupf zu suchen.
Es handelte sich um ein kleines Rad, das zwischen den steinernen Schnörkeln und stilisierten Blättern und Zweigen kaum zu sehen war. Das Rad hatte die Form eines fünfzackigen Sterns, dessen Linien sich alle ineinander schoben. Verblüfft fuhr Samuel die Rillen mit dem Finger nach. Sie lagen viel tiefer im Stein, als er auf den ersten Blick vermutet hätte. Er wußte, was er vor sich hatte. Ähnliche Bilder zierten die Schubladen in Apotheker Schefflers Offizin am Marktplatz: Es waren Pentagramme – die unverwechselbaren Zeichen aller Schwarzkünstler und Alchimisten.
»Darf man fragen, was du in der Kapelle zu suchen hast, Samuel Hahnemann?«
Die schneidende Stimme traf den Jungen völlig unvorbereitet. Vor Schreck wagte er kaum sich zu bewegen, obschon er genau wußte, daß er nicht vor dem Altar knien bleiben durfte.
»Hahnemann«, hallte es ein weiteres Mal durch den Raum.
Samuel fand es eigenartig, wie fremd einem der eigene Name zuweilen in den Ohren klingen konnte. Man mochte glauben, ein anderer sei gemeint, gar nicht man selbst. Langsam drehte er sich um und blickte in die kalten grauen Augen des jungen Viktor Rebus, Charlottes Bruder.
»Ach, du bist es«, entfuhr es Samuel. Er bemühte sich, den feindseligen Blicken des dünnen Jungen auszuweichen. »Ich … habe nur …«
»Was du hast, interessiert mich nicht, Hahnemann. Du bist in unser Quartier eingebrochen, um Vaters Sachen auszuspionieren. Reicht es dir nicht, daß er täglich seine kostbare Zeit an einen altklugen und hochmütigen Gernegroß verschwendet, der glaubt, schlauer zu sein als sein Magister?« Der Sohn des Superintendenten schnaubte verdrossen. Ohne Samuel aus den Augen zu lassen, nahm er seinen blauen Umhang und das runde Barett ab, das ihn als Zögling der Meißner Fürstenschule auswies, und warf beides auf ziemlich respektlose Weise auf eine der Kirchenbänke.
»Ich könnte dich wegen versuchten Diebstahls melden«, erklärte er und reckte sein dünnes Kinn in die Luft, während Samuel sich verzweifelt bemühte, die Aufmerksamkeit des Pastorensohnes vom Altar mit seinem geheimnisvollen Zeichen abzulenken. Offensichtlich hatte Viktor keine Ahnung vom Geheimnis seiner Schwester. Samuel ahnte auch, warum. Niemals hätte sich Charlotte einem Knaben wie Viktor Rebus anvertraut, auch wenn er zehnmal ihr Bruder und die Hoffnung seines Vaters als Nachfolger im Amte des Superintendenten von Meißen war. Samuel hielt es für das beste, den eingebildeten Popanz nicht zu reizen und statt dessen den Zerknirschten zu spielen.
»Ich wollte nichts stehlen, Viktor«, erklärte er wahrheitsgemäß. »Ich habe lediglich deinen Vater gesucht, um ihn zu bitten, mir eine Stelle aus dem Homer zu erklären!«
»Aus dem Homer? Du siehst dich wohl schon als Gelehrten?« spottete Viktor. »Mein Vater hat uns erzählt, daß du vorhast, eines Tages Medizin zu studieren, um Physikus zu werden. Vielleicht sogar Physikus am Hof des Kaisers in Wien?«
Samuel Hahnemann wurde es gleichzeitig heiß und kalt unter seinem dünnen Kattunhemd. Wütend ballte er die Fäuste in der Tasche seiner abgewetzten Kniebundhose. Warum hatte Pastor Rebus ihn verraten? Ausgerechnet an einen Taugenichts wie Viktor, der nach drei Jahren Unterricht in der höheren Schule das Nibelungenlied im klassischen Griechenland ansiedelte.
In einem Punkt zumindest hatte der Sohn des Superintendenten den Nagel auf den Kopf getroffen. Samuel Hahnemann träumte davon, Arzt zu werden, Kranke zu heilen und unbekannte Heilmittel gegen Seuchen zu finden, von denen die Mediziner und Apotheker des Kurfürstentums nur phantasierten, während sie in ihren Laboratorien standen, analysierten, filtrierten und ohne jeden Erfolg disputierten. Seit Samuel denken konnte, war die Heilkunde sein Lebensinhalt, und sooft die Maler in der Werkstube von seiner Zukunft als Geselle seines geschickten Vaters sprachen, schossen ihm die Tränen der Enttäuschung in die Augen, weil sie seine Zukunft planten, als wären er und seine Wünsche Luft für sie.
»Wirst du es meinem Vater sagen?« fragte Samuel leise.
Viktor Rebus blickte ihn zögernd an. Dann gab er ihm mit der flachen Hand einen Stoß und lächelte herablassend. »Wo denkst du hin, Exzellenz Doktor Hahnemann! Ich habe nicht vor, dich dem Porzellanmaler zum Fraß vorzuwerfen, wenn du es auch verdient hättest.«
Erleichtert seufzte Samuel auf und erwiderte verächtlich das alberne Lachen des dünnen Jungen. Er neigte kurz den Kopf vor dem Gymnasiasten und machte Anstalten, den Raum zu verlassen. Aber Viktor hielt ihn mit einer raschen Handbewegung zurück.
»Nicht so hastig, Samuel Hahnemann!« Viktor lächelte nicht mehr. Seine Lippen zitterten leicht, als er seinen mageren Körper zwischen Samuel und die Kapellentür schob. »Dir ist klar, daß es einer Blasphemie gleichkommt, wenn der Sohn eines kleinen Malers sich in den Kopf setzt, die göttliche Weltordnung ändern zu wollen, nicht wahr?«
»Ich weiß nicht, wovon du redest, Viktor!« Samuel fröstelte plötzlich. Der Altar in seinem Rücken fiel ihm wieder ein. Vermutlich war Charlotte ganz in der Nähe. Sie beobachtete ihn und lachte über ihn und seine dumme Furcht vor Viktor.
»Du wirst meinen Vater nicht mehr für deine lästerlichen Ziele ausnutzen.« Viktor verpaßte ihm einen Stoß vor die Brust. »Wenn du lernen willst, geh doch zu deinem eigenen Vater und sieh ihm zu, wie er Blütenstengel auf Teetassen pinselt!«
Samuel strauchelte und fand in letzter Sekunde Halt an einem der Stützpfeiler. Viktor wußte über alles Bescheid und genoß es sichtlich, ihn in die Enge zu treiben. Samuel mußte sich zurückhalten, um nicht vor Schmerz und Wut über diese Demütigung laut zu weinen.
Lästerliche Ziele! Seit wann war der Wunsch, Heilkundiger, Arzt und Naturforscher zu werden, ein lästerliches Ziel? Rasch drehte er sich auf die Seite, damit Viktor seine haßerfüllten Blicke nicht sehen konnte. Mit Freuden hätte er nun einen Dolch aus dem Gürtel gezogen und ihn in Viktors dürres Gerippe gestoßen.
»Du wirst noch heute meinen Vater aufsuchen und ihm erklären, daß du seinen Unterricht künftig nicht mehr besuchen wirst, verstanden? Sag ihm einfach, du wirst in der Manufaktur gebraucht. Das ist nicht mal gelogen!«
Samuel starrte Viktor an, als hätte der ihm gerade befohlen, sich durch das Fenster mit dem gotischen Spitzbogen zu zwängen und über den Burghof zu fliegen. Die Sonnenstrahlen brachen sich nicht mehr an der Wand, kein Stäubchen tanzte mehr im dünnen Licht über den abgetretenen Fußläufer.
Langsam bewegte sich Samuel Hahnemann auf die Tür zu, die Viktor noch immer versperrte. Viktor schien seinen Sieg voll und ganz auskosten zu wollen. Nach einer halben Ewigkeit trat er endlich zur Seite und ließ Samuel auf den Gang hinausschlüpfen.
»Denk daran, dein Platz ist in der Manufaktur, nicht in der Studierstube, so lautet die Ordnung Gottes«, rief Viktor ihm hinterher. »Ich werde dich im Auge behalten!«
Samuel antwortete nicht. Ohne sich noch einmal umzublicken, stürmte er den Gang entlang und blieb erst stehen, als er sich weit genug entfernt von der Kapelle wähnte. Erschöpft sank er auf eine alte Truhe mit Eisenbeschlägen und ließ seine glühenden Wangen von einem Luftzug kühlen, der aus dem Magazin ihm gegenüber drang. Tief in Gedanken achtete er weder auf die Geräusche aus dem Lager noch auf den Glockenschlag des Domes, und als er sich irgendwann am frühen Nachmittag erhob, hatte er einen Entschluß gefaßt. Er würde vor Viktor Rebus und seinen albernen Drohungen nicht zu Kreuze kriechen. Noch heute nacht würde er sich den Altar mit dem Pentagramm genauer ansehen und Charlottes Geheimnis ergründen.
2. Kapitel
»Hundert Perücken und kein Kopf zum Denken!«
Aufgebracht warf Meister Schönewind die Depesche des Magistrats zu Boden und eilte wie von Rachegeistern getrieben durch die heißen, stickigen Räume der kurfürstlichen Porzellanmanufaktur.
»Wie in drei Teufels Namen sollen wir unsere gewohnte Leistung bringen, wenn wir an allen Ecken und Enden beschnitten werden? Kann mir das einer der Herren sagen?«
Die Modellierer, Former, Brennmeister und Maler, die sich um die lange Tafel im Versammlungsraum geschart hatten, duckten sich unter der Flut der Verwünschungen, die ihr Meister in seiner offenen Wut auf die neuesten Meißener Bestimmungen ausstieß, Bestimmungen, die sich seit dem Sturz des alten Ministers, des Grafen von Brühl, für die Manufaktur nur zum Nachteil ausgewirkt hatten. Einige warfen sich verstohlene Blicke zu und schnitten Grimassen, gaben jedoch acht, daß Schönewind sie nicht bemerkte.
Der Alte redete zuviel. Eines Tages würde der Kurfürst von seinen Launen erfahren, und was ihm dann blühte, konnte sich auch der dümmste Lehrling gut vorstellen. Natürlich hatte der Meister recht, wenn er behauptete, daß die Ausgangssperre der Manufaktur schade. Seit Tagen saßen die Handwerker auf einem Fleck, fegten die Räume aus und warteten auf einen Nachschub an Rohstoffen, der beharrlich ausblieb.
»So schlimm wütet das Fieber eigentlich gar nicht mehr«, meldete sich schließlich ein junger Mann zu Wort, dem Schönewind die Aufsicht über die Brennöfen übertragen hatte. »Ich weiß von verschiedenen Personen, daß es sich auf gar keinen Fall um eine Epidemie handelt. Der Stadtrat trägt nur Sorge um die Sicherheit der …«
»Diese verfluchten Amtsochsen!« unterbrach ihn Schönewind polternd und spähte nach dem offenen Fenster. Sein fleischiges Gesicht war bis zu den Haarspitzen rot angelaufen, und um seine Mundwinkel zuckte es bedenklich. »Nur weil eine Delegation vom Hof durch die Manufaktur geführt werden muß, werden wir gezwungen, unsere gewohnten Arbeitsabläufe zu verändern. Mit dem Fieber, mein Junge, hat das einen Dreck zu tun!«
Einige der Versammelten raunten zustimmend und klopften mit den Fingerknöcheln auf die blanke Holztafel. Der junge Mann griff nach einem Zinnkrug, der in der Mitte des Tisches stand, und goß Wein in rotbraune Tonbecher. Mit einem jovialen Lächeln reichte er Meister Schönewind den ersten Becher, dann verteilte er den übrigen Wein unter die Handwerksgesellen und Porzellanmaler.
Bravissimo, der Junge hat das Zeug zu einem vortrefflichen Speichellecker, dachte Christian Hahnemann, der am unteren Ende der Tafel saß. Der hochgewachsene Maler hatte sich absichtlich aus der Diskussion herausgehalten, obwohl Schönewind zweimal lauernd in seine Richtung geblinzelt hatte, als erwarte er ausgerechnet seinen Kommentar. Aber Hahnemann war nicht zum Disputieren in der Manufaktur. Er war Künstler, Sohn eines Künstlers und – so Gott ihm gnädig war – eines Tages auch Vater eines Künstlers. Wenn sein Sohn nur nicht so viele Flausen im Kopf gehabt hätte …
»Der alte Schönewind hat unrecht«, raunte ihm sein Nachbar, der Maler Wilhelm Berthold, zu. »Prinz Xaver kann nichts von den Lieferschwierigkeiten wissen, und daß der Rat der Stadt die kurfürstliche Abordnung vor dem Fieber bewahren will, ist eher ein Schutz für die Manufaktur. In Polen soll das Gallenfieber halbe Dörfer entvölkert haben. Von sechs Kindern starben vier.«
Hahnemann legte die Stirn in Falten und hieß den Mann mit einer knappen Handbewegung zu schweigen, ehe Meister Schönewind auf sie aufmerksam wurde. Nichts haßte der Porzellanmaler so sehr, wie in Angelegenheiten verstrickt zu werden, die nichts mit seinen Pinseln und Farben zu tun hatten.
»Das Kaolin reicht nur noch für etwa zwei Tage.« Umständlich zog Schönewind ein Stück Papier aus der Tasche seiner abgewetzten Lederschürze, die seine gewaltige Brust wie eine Rüstung umgab. »Hier hab ich es schwarz auf weiß. Der Betrieb am Steinbruch steht still, der Magistrat läßt keinen Hundeschwanz hinaus. Nein, er schickt uns statt dessen seine Büttel auf den Hof und ein halbes Dutzend Wachen hinterher! Schaut sie euch doch mal an, die Kerle mit ihren gelben Fratzen. Wenn die hier nicht die Franzosenkrankheit einschleppen, fresse ich einen Besen.« Verächtlich schleuderte er das zerknitterte Papier über die Tafel. »Ab morgen bleiben die Öfen aus!« rief der Meister mit polternder Stimme. Schweiß stand ihm auf der Stirn. Für einen Herzschlag lang sah es so aus, als würde Schönewind zusammenbrechen, dann aber richtete er sich zu seiner vollen Größe auf, befreite seine Schürze von einigen eingebildeten Quarzkrümeln und verließ dann, von seinem Gesellen gefolgt, den Raum.
Christian Hahnemann überlegte, ob er die Hand nach der amtlichen Bekanntmachung ausstrecken sollte, an deren schmutzigem Ende unübersehbar das wächserne rote Wappen Meißens prangte, entschied sich dann aber dagegen. Es war nicht klug, auf sich aufmerksam zu machen. Nervös blickte der Porzellanmaler zur Werkstattür hinüber. In der Tat hatte der Bürgermeister seit einigen Tagen zwei Stadtwächter zum Dienst in die Manufaktur abkommandiert. Die Anwesenheit der Uniformierten, denen man auf Schritt und Tritt über den Weg lief, zehrte nicht nur an Schönewinds Nerven. Die Wände bekamen hier oben Ohren, gerade wenn man es am wenigsten vermutete.
»Was hast du vor, wenn die Produktion fürs erste unterbrochen wird, Hahnemann?« fragte Wilhelm Berthold, nachdem mit dem Klang der alten Zunftglocke, die Schönewind in einer wurmstichigen Lade aufbewahrte, die Versammlung aufgehoben worden war und die Arbeiter wieder in ihre Werkstätten strömten.
»Ich lasse meine Gesellen weiterarbeiten,« entgegnete der Porzellanmaler mit einem Anflug von Trotz, der seine Stimme jedoch um so unsicherer wirken ließ. Beschwichtigend fügte er hinzu: »Besucher vom Hof kommen schon seit Jahren nach Meißen, um die Manufaktur zu besichtigen oder neue Modelle zu bringen. Hat nicht der Großvater seiner Hoheit unsere Erzeugnisse ›das weiße Gold‹ genannt?«
»Weil er gelbes nicht kriegen konnte, um seinen Mätressen weitere Lustschlösser zu bauen!« bemerkte sein Freund, aber so leise, daß die anderen Maler, die ihre Pergamentrollen mit Skizzen quer über die Nebentische ausbreiteten, es nicht verstehen konnten.
»Ach, weiß der Kuckuck, was diese Leute auf der Albrechtsburg zu tun haben. Auf einige Muster mehr oder weniger kommt es nicht an. Auch wenn Schönewind die Brennöfen verlöschen läßt: Solange wir nicht zum Steinbruch hinaus dürfen, bleibt uns hier immer noch Arbeit für gut drei Wochen. Im übrigen fehlte der letzten Produktion eindeutig Quarz, Wilhelm!«
Hahnemann nahm eines der zierlichen Gefäße vom Regal neben seinem Arbeitstisch, der von Farbtöpfen, Federn, Pinseln und Skizzenpapier übersät war, und hielt dem verdutzten Berthold ein milchig schimmerndes Stück unter die Nase.
»Zu wenig milde im Ton, zu wenig Glanz«, konstatierte er.
»Und warum durften wir Meister Hahnemanns Meinung vorhin im Versammlungsraum nicht hören?« Schönewinds Stimme traf die beiden Porzellanmaler wie ein Keulenschlag.
Christian Hahnemann erschrak so sehr, daß ihm die kleine Vase beinahe aus der Hand geglitten wäre.
»Ich dachte schon, du wärest vielleicht stumm geworden, Christian! Vor einigen Minuten hätte ich deine Unterstützung gebraucht. Aber du ziehst es wohl vor, dich hinter meinem Rücken über meine Anordnungen lustig zu machen!«
»Du weißt genau, daß das nicht stimmt.« Hahnemann schaute sich hilfesuchend nach Wilhelm Berthold um. Aber der Maler hatte sich schon davongemacht. »Ich arbeite seit Jahrzehnten auf der Albrechtsburg. Mein Sohn soll mich eines Tages ablösen, wenn seine Lehrzeit beendet ist, aber nie hat ein Hahnemann sich in die Entscheidungen der Oberen eingemischt. Hast du nicht selbst immer gesagt, daß wir zu kleine Köpfe hätten für die Perücken der Obrigkeit?«
Müde schlug der Porzellanmaler die Augen nieder und hoffte inständig, Schönewind würde endlich verschwinden und ihn wieder mit seinen Pinseln allein lassen. Wo blieb Samuel nur? Nie war der Bengel da, wenn man ihn brauchte. Auf der anderen Seite war es vielleicht besser, wenn er nicht mit ansehen mußte, wie sich der dicke Schönewind vor seinem Vater aufspielte. Christian Hahnemann hätte die Manufaktur leiten können. Anträge von seiten des Magistrats hatte es genug gegeben, schließlich war Hahnemann am längsten von allen auf der Albrechtsburg und kannte sich auch mit der Porzellanherstellung aus. Daß er sich sogar noch an die Zeit kurz nach der Gründung der Manufaktur erinnern konnte und noch die Schüler des Meisters Johann Friedrich Böttger persönlich gekannt hatte, hatte er nie jemandem erzählt. Nicht seiner Frau und schon gar nicht Schönewind, der Hahnemanns langes Zögern zu seinem Vorteil gemacht und letztendlich die Leitung der Porzellanmanufaktur übernommen hatte.
»Und was soll ich der Delegation vom Hof seiner königlichen Hoheit vorführen, wenn die Gesandten morgen in meiner Werkstatt auftauchen?«
Schönewind brummte mürrisch und musterte den Porzellanmaler mit grimmiger Miene. Der alte Hahnemann ist nicht besser als ein Lakai, dachte er bei sich, keinen Mumm mehr in den Knochen. Doch plötzlich tat es ihm leid, daß er seine Wut über die Schwierigkeiten der Manufaktur ausgerechnet an dem Alten ausgelassen hatte. Schweigend beobachtete er, wie der Maler die kleine Vase wieder zurück auf das Regal stellte und statt dessen eine andere, bereits bemalte ergriff. Auf dem kühl glänzenden Porzellan zeichnete sich die Kontur eines ländlichen Gehöftes in zartem Aquamarinblau ab, vor dem sich, mit einigen geschickten Pinselstrichen angedeutet, eine Herde Schafe mitsamt Hirten vor einem blau leuchtenden See tummelte. Pastorale Szenen auf Porzellan waren bei Hofe in Mode gekommen. Für Schönewind blieb es ein Rätsel, wie der alte Hahnemann von diesen Dingen erfuhr, wo er doch kaum jemals die Albrechtsburg verließ, um Modelle zu studieren und neue Anregungen zu sammeln.
Manchen Leuten lag es eben im Blut. Schon der Vater des Alten war Miniaturenmaler in fürstlichen Diensten gewesen und hatte sein Talent an den ältesten Sohn weitergegeben. Und nun war der kleine Samuel an der Reihe. So verlangte es die Tradition. Schönewind schüttelte den Kopf, er durfte sich nicht in nutzlosen Überlegungen verlieren. Dafür war die Lage in Meißen zu ernst. Interessiert beobachtete er, wie Hahnemann, tief in Gedanken versunken, seinen längsten Pinsel aus einem Glas mit einer beißend scharf riechenden alkoholischen Lösung zog, ihn dann mit beinahe zärtlichen Bewegungen zwischen Daumen und Zeigefinger drehte und schließlich vorsichtig in den kleinen Krug mit der kostbaren Goldfarbe tauchte.
Hahnemanns Hand zitterte leicht, als er das Emblem der kurfürstlichen Manufaktur, zwei goldene, sich kreuzende Schwerter, mit sorgfältigen Strichen auf die Unterseite der Vase plazierte. Wie oft hatte er mit diesem Zeichen bereits ein Werk vollendet? Christian Hahnemann erinnerte sich nicht, vermutete aber, daß er das Symbol der beiden Schwerter besser beherrschte als den Schriftzug seines eigenen Namens. Verlegen drehte er sich zu Schönewind um, der wie angewurzelt neben der Werkstattür stand. Hatte der Meister seine bebende Hand gesehen? Warum mußte sie ausgerechnet jetzt zu zittern anfangen, nach hunderttausend Pinselstrichen?
Vielleicht hatte Johanna, seine Frau, nicht ganz unrecht, und er war einfach überarbeitet und der ewigen Zänkereien mit Schönewind müde. Und dann diese verzehrende Hitze in der Manufaktur! Sie drang von den Brennöfen, die mit Unmengen von Holz am Glühen gehalten wurden, bis in den letzten Winkel der Stube.
Mit ungelenken Bewegungen nestelte Hahnemann an der grauen Binde über seinem Hemdkragen, um sich Erleichterung zu verschaffen. So bemerkte er die schmale Hand, die sich auf seine Schulter gelegt hatte, erst, als sie sich behutsam zu bewegen begann. Mit einem Satz sprang der alte Mann auf und starrte mit einem Ausdruck des Entsetzens in die erstaunten Augen seines Sohnes.
»Sehr freundlich, daß du auch mal wieder hereinschaust, verflixter Bengel!« herrschte er Samuel an. »Ich warte schon seit Stunden auf dich! Los, du kannst die Säcke aus der Werkstatt tragen und auf dem Korridor stapeln, ehe wir uns hier noch Hals und Beine brechen!«
»Oder eine Dame der kurfürstlichen Delegation mit ihrer Schleppe darüber stolpert«, krähte ein rothaariger Lehrling von einem der Zeichentische herüber, an dem er sich vergeblich mit einer Anzahl geometrischer Figuren abmühte und dabei einen Tintenklecks nach dem anderen auf das dünne Papier fabrizierte.
Der Rotschopf zwinkerte Samuel aufmunternd zu und wollte den Stift aus der Hand legen, als sein Lehrherr ihn auch schon mit gereizter Miene zurechtwies: »Sieh Er gefälligst auf seine Übungen, Kerl! Wenn ich heute abend auf seinem Bogen wieder so eine Schweinerei wie gestern vorfinde, setzt es ein paar Ohrfeigen!«
Christian Hahnemann schüttelte abschätzend den Kopf. Es wurde wahrhaftig Zeit, daß Samuel den Ernst des Lebens kennenlernte, auch wenn er noch zu jung für eine ordentliche Lehrzeit war. Er mußte erfahren, was es bedeutete, ein Hahnemann auf der Albrechtsburg zu sein.
»Träum nicht, Samuel«, sagte der Porzellanmaler leise, während er dem Jungen seine Arbeit zuwies. »Quarzsand links, Feldspat und Alabaster rechts neben den Abgang!« Erst spät fiel ihm auf, wie schweigsam und abwesend sein Sohn heute war. Irgend etwas ging dem Jungen im Kopf herum, und Christian Hahnemann war trotz seiner Weltfremdheit nicht so naiv zu glauben, daß Samuel an Pinsel und Malfarben dachte.
In der Nacht schlich sich Samuel aus der engen Stube, die Meister Schönewind der Familie seines ältesten Porzellanmalers als Notquartier hatte zuweisen lassen. Samuel hatte gewartet, bis sich seine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten. Aus dem Winkel mit dem alten Kohleofen knackte es in regelmäßigen Abständen. Nach dem anhaltenden Regen des vergangenen Tages hatte es stark abgekühlt. Außerdem behauptete Frau Hahnemann steif und fest, daß die Kammer feuchte Wände habe und man den Schwamm bis durchs Mauerwerk riechen könne.
Erst als Samuel die schwere Eichentür im Rücken spürte, wurde ihm bewußt, daß es kein Spiel war, was er vorhatte. Er lebte in der Geborgenheit einer Familie, die ihn trotz ihrer Strenge liebte, und war dennoch bereit, davonzulaufen. Fort aus der Albrechtsburg, fort aus Meißen und fort von …
Ein Gefühl bitterer Übelkeit kroch ihm in den Magen, als ihm der feine Geruch des Lösungsmittels in die Nase stieg, das an den Kleidern seines Vaters haftete. Oder lag es vielleicht doch an etwas anderem? Die Tränen kamen völlig unvorbereitet, und Samuel erschrak. Er hatte sich doch alles gut überlegt, warum also jetzt die plötzliche Sehnsucht nach der warmen Strohschütte, die so wunderbar duftete? Noch immer starrte Samuel zu seinem Lager hinüber. Waren seine Nerven überreizt, oder hörte er tatsächlich das Stroh knistern?
Es war Wahnsinn, konnte einfach nicht gutgehen. Ein elfjähriger Junge rannte seinen Eltern nicht davon, nur weil er Maler und nicht Arzt werden sollte. Ärzte gab es genug, aber keine gescheiten, wie sein Vater nie müde wurde zu behaupten. Ärzte sind Gaukler. Sie versprechen dir das Blaue vom Himmel herunter, wenn du sie wegen deines Reißens im Rücken oder Gicht in den Fingerknochen um Rat fragst. Und was geschieht dann? Nichts geschieht, außer daß der Arzt sich seinen Beutel füllt und schleunigst das Weite sucht. Warum hatte der alte König von Preußen seine Leibärzte zum Teufel gejagt? Weil sie in ihrer gelehrsamen Herrlichkeit mehr Friedhöfe gefüllt hatten als er in drei Schlesischen Kriegen zusammen.
Samuels Blick fiel auf das Regal an der Wand über seinem Lager. Zwischen einigen Schalen, Krügen und Pinseln ragte eine schlanke Holzfigur empor. Samuels Großvater hatte sie kurz vor seiner Geburt geschnitzt und bunt bemalt. Sie stellte einen Soldaten mit hohem Hut und Waffenrock dar. Obwohl die blaue und weiße Farbe auf dem Holz schon nahezu abgeblättert war, liebte Samuel die Figur und war traurig, sie zurücklassen zu müssen. Doch er hoffte, daß Vater und Mutter sein Weglaufen so nicht gleich erraten würden.
»Es tut mir leid, Soldat«, flüsterte er hilflos. »Aber was soll ich tun? Wenn ich bleibe, steckt Vater mich zu seinen Lehrlingen und Gesellen in die Manufaktur. Er wird niemals erlauben, daß ich auf die Schule gehe. Und Pastor Rebus kann mir nicht mehr beistehen, sonst macht Viktor mir das Leben zur Hölle.«
Samuel hielt inne und versuchte, in den sorgfältig ausgearbeiteten Zügen des geliebten Spielzeugsoldaten so etwas wie Verständnis oder Anteilnahme zu erkennen. Doch die Augen des hölzernen Dragoners blickten kalt und starr an seinem kleinen Besitzer vorbei.
Von einem der Kistenbetten hinter dem Vorhang drangen plötzlich Geräusche an Samuels Ohr. Seine Mutter hustete und keuchte. Jeden Moment konnte sie erwachen und nach dem Tonkrug mit Wasser tasten, den sie sich jeden Abend füllte. Samuel stockte der Atem, seine Hände schwitzten. Sie würde ihn entdecken, vollständig angezogen und ein Bündel auf den schmalen Rücken gebunden.
Samuel wagte nicht, sich zu rühren. Eigentlich liebte er seine Mutter, und das letzte, was er sich wünschte, war, sie zu verlassen. Ihre müden Augen, das seltene Lächeln auf dem abgezehrten Gesicht, vor allem aber die langsam faltig werdenden Hände, die unglaublich kräftig zupacken konnten, gaben Samuel ein Gefühl der Sicherheit. Was er hingegen nicht liebte, war das Schweigen, das für gewöhnlich auf ihren Lippen lag und irgendwie krank auf ihn wirkte.
Niemand bemerkte, wie Samuel die Tür öffnete und mit seinem Bündel und einem Umhang seines Vaters über dem Arm, der so lang war, daß er auf dem Steinboden den Staub aufwirbelte, auf den Korridor hinaustrat. Leblose Stille hüllte ihn dort ein und, was noch schlimmer war, Eiseskälte.
Es ist dieselbe Art von Kälte wie vor dem Altar in der Kapelle, überlegte Samuel. Er mußte zum Westflügel und von dort über die Galerie zur Kapelle. Die Galerie wurde in der Regel nicht bewacht. Auf Zehenspitzen hastete er den Gang entlang, ohne sich noch einmal nach der Kammer seiner Eltern umzudrehen.
Die Kälte begleitete den Jungen bis vor die Tür der Kapelle. Auch dieses Mal war die Tür nicht verschlossen. Samuel wußte nicht, warum, aber aus irgendeinem Grund hatte er es auch nicht anders erwartet. Dennoch zögerte er. Er dachte an den Altar mit dem sonderbaren Pentagramm und fühlte sich unbehaglich. Ob die Kapelle wirklich ein Weg in die Freiheit war?
Samuels Hand zitterte leicht, als er die Tür aufdrückte und sich durch einen schmalen Spalt ins Innere der Kapelle schob. Der Raum wirkte in der Dunkelheit viel größer als in seiner Erinnerung. Die beiden tragenden Säulen türmten sich wie Eichenstämme vor ihm auf und gaben nur eine Andeutung des ausladenden Steinklotzes, dem sich der Junge mit klopfendem Herzen näherte.
»Verflixt«, entfuhr es ihm, als er bemerkte, daß er seinen selbstgetöpferten Leuchter mit den drei Wachsstummeln nicht eingepackt hatte. Er legte sein kleines Bündel auf eine der Kirchenbänke und schlug den Saum seines langen Umhangs zurück, um die Hände frei zu haben. Dann tastete er die Oberfläche des grob behauenen Steines ab. Ohne Erfolg! Die beiden dicken Opferkerzen auf dem Altar waren verschwunden. Wie sollte er nun das kleine Drehrad mit dem eingeritzten Pentagramm wiederfinden?
Samuel faßte den Stein ins Auge und ging dann vor ihm in die Hocke. Die Kälte strich über seine Fußsohlen wie eine unsichtbare Hand. Hastig ließ er seine Finger weiter über die Vorderseite des Altars wandern. Er mußte sich beeilen. Die Kälte zog höher, erreichte seine Unterschenkel und lähmte ihn wie der Biß einer giftigen Schlange. Draußen, vor der Burg, war ein heftiger Wind aufgezogen. Der Junge konnte hören, wie er durch das Laub der alten Esche rauschte und ihre dicken Äste und Zweige gegen die Fenster der Kapelle peitschte. Die Geräusche zerfetzten die Stille, ja, sie schienen einen Herzschlag lang gar den Kälteschub durch Samuels Körper aufzuhalten, und dann huschte plötzlich ein dünner, bläulich glänzender Faden aus Licht quer über den Altar. Samuel Hahnemann riß die Augen auf. In der Kapelle herrschte noch immer Finsternis, und doch schienen gebündelte Lichtstrahlen in den Stein einzudringen. Vor den hohen Spitzbogenfenstern säuselten die Blätter der Esche im Wind. Der Junge lauschte und begriff. Der Sturm wurde heftiger, es regnete, und doch schien der Mond hell und klar.
Das Licht des Mondes traf auf den Stein, sooft der Wind das dichte Laub der Esche zur Seite schob, stellte Samuel fest. Fasziniert verfolgten seine Augen das Licht, das sich auf einen einzigen Punkt zu konzentrieren schien. Es fiel, leicht gebrochen, durch ein Glasfenster, auf dem in zarten Blautönen die Gestalt des Evangelisten Johannes über die dunklen Kirchenbänke schwebte. Samuel kannte die Figur genau. Pastor Rebus hatte nicht versäumt, ihm von dem Lieblingsjünger des Herrn zu erzählen, der bis zur Wiederkunft seines Meisters auf der Erde verweilen sollte. Hier in der Schloßkapelle hatte ein unbekannter Künstler den Evangelisten mit einem aufgeschlagenen Buch in der Hand abgebildet, auf dessen Innenseite die Jahreszahl 1604, offensichtlich das Stiftungsdatum, deutlich zu erkennen war.
»Das Buch«, keuchte Samuel und sprang auf. Das Licht fiel direkt durch das aufgeschlagene Buch in der Hand des Apostels. Dem Jungen stockte der Atem vor Aufregung, und einen klammen Augenblick lang fragte er sich, ob er nicht vielleicht doch träumte und jeden Moment auf seinem Strohlager in der elterlichen Kammer erwachen würde. Aber es war kein Traum.
Langsam drehte sich Samuel wieder zum Altar um und entdeckte das Pentagramm inmitten eines hell leuchtenden Lichtkegels. Die Ornamente, welche die Innenflächen der spitzen Winkel auskleideten, schienen ihn aus tiefen Augenhöhlen anzugrinsen, doch er beachtete sie nicht. Der Altar war das Werk eines Genies, das die Wissenschaften kannte, nicht die Falle eines dämonischen Zauberers. Irgendwo auf der flachen Vorderseite der Gravur mußte es einen Hebel geben.
Einige Sekunden hockte Samuel regungslos vor dem Altar. Er bemerkte nicht, daß das Rauschen des Windes verstummt war und keine Regentropfen mehr gegen das dünne Glas der Fenster trommelten. Das Licht war verschwunden, und mit der Dunkelheit kehrte die Kälte des eisigen Fleckes zurück.
Ohne zu überlegen, holte Samuel aus, warf seinen schmächtigen Körper zurück und hieb mit einem Aufschrei seine Faust gegen die grinsenden Augenhöhlen. Ein schneidendes Schleifgeräusch beantwortete seine Tat. Die Erschütterung fuhr dem Jungen so stark durch den Leib, daß er sogar seine vor Schmerz pochende Hand vergaß. Schaudern mischte sich mit gespannter Erwartung. Der Altar schwang zur Seite wie ein Kuckuck, der an einer Feder aus der Tür seiner Uhr sprang. An der Stelle, wo Samuel gestanden hatte, gähnte ihm ein tiefes Loch entgegen. Der Junge fuhr sich mit der Zunge über die schmalen Lippen. Das war es also – Charlottes Geheimnis. Auf diesem Weg schlich sie sich aus dem Schloß, wann immer ihr danach war. Er hatte den Durchschlupf gefunden, der ihn aus der Burg führen würde.
Hinter der Tür zur Sakristei, wo Emanuel Rebus mit seinen Kindern hauste, blieb alles still. Sie sind nicht aufgewacht, dachte Samuel erleichtert und ließ seinen Blick zwischen Tür und Geheimgang hin und her wandern. Die Eiseskälte hatte seine Hüften erreicht, und plötzlich kam Samuel sein ganzes Unternehmen mehr als töricht vor. Auch wenn der Superintendent und seine Kinder ihn nicht gehört hatten, würde zumindest Charlotte in wenigen Stunden seine Spur entdecken. Seine Flucht war demnach zum Scheitern verurteilt. Sollte er es wagen und sich dem finsteren Gang, der tief in das Felsgestein hinabzuführen schien, auf Gedeih und Verderb anvertrauen? Und was, wenn er ausglitt und sich den Hals brach?
Samuel atmete einige Male tief durch, doch die Furcht begleitete ihn wie ein übler Geruch. Dann bückte er sich und knotete sich den langen, staubigen Umhang seines Vaters um die Schultern.
Vorsichtig zwängte er sich durch die Spalte zwischen den steinernen Bodenplatten. Krampfhaft suchten seine Hände nach einem Halt, während er sich, verfolgt von der Eiseskälte, tiefer und immer tiefer hinabließ. Noch immer hatten seine Füße die Stufen nicht erreicht. Viel zu spät bemerkte er, daß er sein Bündel mit Habseligkeiten auf einer der Kirchenbänke vergessen hatte.
Nach einer halben Ewigkeit fühlte Samuel festen Grund unter seinen Füßen. Erstaunt registrierte er, daß es wärmer wurde. Seine verkrampften Glieder entspannten sich. Ungläubig suchten seine Augen die Öffnung, hoch über seinem Kopf. Er konnte sie nicht mehr erkennen. Sie war ebenso verschwunden wie der Eishauch des kalten Fleckens, der ihn in die Ungewißheit hinabgetrieben hatte.
Die spröden Felswände waren feucht. Beinahe schien es Samuel, als absorbierten sie eine dicke, säuerlich riechende Flüssigkeit, die in langen, zähen Fäden, fast geräuschlos auf den Boden tropfte. Zahlreiche Geflechte von Moosen und Pflanzen, die der Junge in dem schwachen Licht nicht erkannte, wucherten wie sorgfältig geknüpfte Schlingen aus dem rauhen Felsgestein.
Samuel tastete sich weiter und bemühte sich, die Risse im Gestein in seiner Phantasie nicht zu drohenden Gespinsten werden zu lassen. Je tiefer ihn die Stufen führten, je vorsichtiger im Geiste er die Entfernung von einem Absatz zum nächsten maß, desto mehr steigerte sich das Gefühl der Beklemmung in seiner Brust. Schließlich ging er gar dazu über, mit sich selbst zu sprechen, um die heimtückische Stille des scheinbar endlosen Schlundes zu brechen. Er rezitierte den Anfang der Odyssee und der Ilias auf griechisch, wie Rebus es ihn gelehrt hatte, und konjugierte lateinische Verben, bis er sich beim Übergang vom Plusquamperfekt des Verbs laborare zum Passivum verhaspelte und nicht einmal merkte, daß mit einemmal seine Stimme nicht mehr als einzige durch den grottenartigen Abgang hallte.
Der Junge blieb stehen und blickte sich langsam um. Die Stufen hinter ihm verschwanden in einem undurchschaubaren Moor aus fetter Schwärze. Keine Menschenseele war zu sehen, und doch hörte er ganz deutlich das Gemurmel verhaltener Stimmen, einer hellen und einer dunkleren.
Vorsichtig beugte er sich hinüber zu dem Mauerwerk und preßte sein Ohr an die Felswand. Der aromatische Duft der Moose und Wucherpflanzen stieg ihm in die Nase und schien seine Sinne zu stimulieren. In dem Treppenschacht wurde es heller. Die Pflanzen tauchten ihre öde Umgebung in einen grünen, seidig schimmernden Glanz.
Sie müssen zu zweit sein, überlegte Samuel. Zwei Personen, vermutlich ein Mann und eine Frau. Wenn ich doch nur verstehen könnte, was sie sich auf der anderen Seite zuraunen.
Zwei Hände schnellten aus der Finsternis.
Dürre, verkrüppelte Finger legten sich wie fünf eisige Haken auf Samuels Mund. Eine weitere Hand umschlang seinen Bauch, und ehe sich der Junge versah, wurde er auch schon von dem Unbekannten über den kalten Steinboden geschleift.
Samuel hörte noch das metallische Geräusch eines Schlüsselbundes an seinem Ohr, dann schwanden ihm die Sinne.
3. Kapitel
»Warum hast du ihn gleich zu Boden geschlagen, du alter Narr? Du solltest nur dafür sorgen, daß der Junge den Mund hält und nicht die halbe Albrechtsburg auf uns aufmerksam macht!« Charlotte Rebus schürzte die Lippen und funkelte den alten Mann wütend an, der Samuel wie ein Bündel erlegter Rebhühner hinter sich her zerrte.
»Nu, das hab ich doch wohl getan, nicht wahr, Jungfer?« Ächzend ließ der Alte seine Last auf ein paar alte Pferdedecken niedersinken, die aufgestapelt in einem Winkel des weiträumigen Kellergewölbes vor sich hin rotteten. »Hab den Kleinen nicht geschlagen. Wollte ihn nur von der Wand weglotsen. Hören Sie denn nicht?« Er packte Charlotte am Ärmel ihres langen, weinroten Kleides und drehte sie mit sanfter Gewalt in Richtung der Eingangspforte.
»Was meinst du? Wenn das wieder ein Trick ist, du alter …«
»Sie klopfen die Wände ab! Der Kleine hat sie zu uns geführt, Jungfer!« Anklagend deutete der alte Mann mit seinem langen, dürren Finger auf den ohnmächtigen Jungen. »Ich wette den Zopf meiner Perücke, daß die beiden nicht wegen des Porzellans in die Albrechtsburg gekommen sind, Jungfer Rebus. Sie wissen, was ich meine, oder?«
Wieder griffen die mageren Finger nach Charlottes Arm, aber das Mädchen entwand sich seinem Griff. Was erlaubte sich dieser Kerl? Wagte er es, ihr zu drohen? Wer war er denn schon? Zacharias, ein ehemaliger Apothekergeselle aus der Mark, den man mit Schimpf und Schande davongejagt und der auf der Flucht vor den Preußen an die Tür des gutmütigen Superintendenten und seiner Tochter geklopft hatte.
Charlotte Rebus betrachtete das Gesicht des Alten, seine streitlustigen Züge um zwei scharfe, listig glitzernde Augen und das wirre graue Haar einer Perücke, die wie der Schein eines längst gefallenen Heiligen von dem knochigen Schädel abstand und ihm noch aus den Ohren zu wuchern schien. Bekleidet war der Alte mit einer abgetragenen Kniebundhose von undefinierbarer Farbe und einem viel zu großen Rock, den sein eigentlicher Besitzer, ein zwei Zentner schwerer Diener aus dem Südflügel, bereits vermissen mußte.
Ich hätte den törichten Kerl niemals einweihen dürfen, schoß es Charlotte durch den Kopf, während sie das Gewölbe nach Wasser und ein paar sauberen Tüchern für den jungen Hahnemann absuchte. Ich habe den Zugang zu den Kellern gefunden, die hierher führten. Es war meine Entdeckung, und die lasse ich mir nicht nehmen. Von niemandem.
Auf der anderen Seite wußte Charlotte, daß kein Bewohner der Albrechtsburg so geschult im Umgang mit Pflanzen und Chemikalien war wie der ehemalige Apothekergehilfe. Unter Umständen war Zacharias der einzige, der ihr die Funktion all der Gerätschaften erklären konnte, die sie hier, tief unter den Räumen der Manufaktur, entdeckt hatte.
Aus dem schattigen Winkel des Gewölbes drang ein klägliches Stöhnen.
»Der Bengel wird wach«, rief der Alte mißmutig und machte eine wegwerfende Handbewegung. »Er wird das Laboratorium sehen, Jungfer. Und was dann? Kinder sind scheußliche Plagen. Von Natur aus aufdringlich wie die schwarze Pest. Und überaus neugierig. Wie sonst hätte der Bengel den Mechanismus am Altar in der Schloßkapelle entdecken können?«
»Er beobachtet mich schon eine ganze Weile«, sagte Charlotte stirnrunzelnd und machte einen Schritt auf den Jungen zu, der noch immer reglos auf der Erde lag. »Du magst etwas von Tinkturen und Latwergen verstehen, mein Freund, aber von Kindern hast du keine Ahnung. Sie können Geheimnisse sehr wohl bewahren, wenn man sie mit Respekt behandelt. Ihr Stolz und Ehrgeiz sind oft größer als bei Erwachsenen, und sie fühlen sich wichtig, wenn man sie ins Vertrauen zieht, wenn sie den Sinn hinter dem Ganzen sehen!«
»Wenn sie den Sinn hinter dem Ganzen sehen«, äffte der kleinwüchsige Mann Charlotte nach und streifte sich rasch ein Paar fleckige Handschuhe über die mageren Finger. »Wir reden hier nicht über die Gassenspiele dummer Gören. Hier geht es um die reine Wissenschaft, die uns einer der größten Männer unseres Jahrhunderts hinterlassen hat.« Verächtlich reckte der Alte sein Kinn und trat nach einer Ratte, die neugierig aus einer dunklen Ecke aufgetaucht war und an den derben Pferdedecken schnupperte.
»In diesem verlassenen Laboratorium könnten Dinge ruhen, die noch ganze Generationen von Gelehrten beschäftigen, es sei denn …«
Der Alte schnappte nach Luft und gab einen ärgerlichen Laut von sich. Seine Augen verengten sich zu Schlitzen, als er bemerkte, daß Samuel längst erwacht war und ihn und Charlotte, auf beide Arme gestützt, verständnislos anblinzelte.
»Nun steh schon auf, Samuel Hahnemann!« sagte Charlotte freundlich und streckte ihre Hand aus, um dem Jungen auf die Beine zu helfen. Mit einer beinahe mütterlichen Geste strich sie ihm über den Kopf, um sich davon zu überzeugen, daß sein Sturz ohne weitere Folgen geblieben war.
»Freund Zacharias hat dich sicher erschreckt, als er dich draußen auf der Treppe erwischt hat. Sonst ist dir nichts geschehen.«
»Noch nicht«, hüstelte der Alte mürrisch, wurde aber von Charlotte mit einem giftigen Blick zum Schweigen gebracht. Samuel verfolgte, wie der Apothekengeselle vor sich hin brabbelnd zu einem gewaltigen Kamin humpelte, der fast die gesamte rechte Seite des sonderbaren Gewölbes einnahm, und sich geräuschvoll auf einem niedrigen Holzschemel davor niedersinken ließ.
Samuel sperrte vor Aufregung Mund und Augen auf. Das Licht einiger halb heruntergebrannter Wachskerzen auf Regalen, Kisten und umgedrehten Fässern warf schaurige Schattenbilder an die Wände, auf denen er schwache Zeichnungen und mit dürftigen Strichen angedeutete Symbole ausmachen konnte.
Charlottes mißtrauische Blicke brannten dem Jungen förmlich auf der Haut. Im flackernden Schein der Kerzen wirkte die Tochter des Superintendenten in ihrer roten Robe wie ein geisterhaftes Wesen oder wie die Priesterin eines Heiligtums, das es gegen Eindringlinge zu verteidigen galt; Eindringlinge, wie er einer war.
»Was tut der alte Mann da?« fragte Samuel schließlich, um das unangenehme Schweigen zu brechen. Schlagartig verfinsterte sich Charlottes Miene. Mißtrauisch packte sie Samuel an den Schultern.
»Du fragst zuviel, Junge. Das hat schon so manchem das Genick gebrochen. Wie, in drei Teufels Namen, kamst du auf die Idee, uns zu folgen?«
»Ich bin euch nicht gefolgt!« rief Samuel trotzig, aber er ahnte, daß er Charlotte nicht täuschen konnte. Sie war nicht so einfältig wie ihr Bruder Viktor, dem man Demut vorheuchelte, während man sich insgeheim über seine Dummheit lustig machte.
»Lüg mich nicht an, du kleiner Schnüffler. Sonst überlasse ich dich Freund Zacharias, dem es Vergnügen bereiten würde, sich mit dir zu beschäftigen.«
Diese Drohung verfehlte nicht ihr Ziel. Kleinlaut berichtete Samuel, wie er Charlotte bis zur Kapelle verfolgt und sich dann in den Kopf gesetzt hatte, sie müsse einen geheimen Fluchtweg aus der Albrechtsburg gefunden haben. Er verschwieg nicht einmal seine unerfreuliche Begegnung mit ihrem Bruder Viktor.
»Ist es denn gegen die Natur des Menschen, Erfindungen und Entdeckungen zu machen?« fragte er am Ende seiner Erzählung.
Von der seltsamen Apparatur über dem Kamin schallte ein ironisches Schnauben zu ihnen herüber.
»Natürlich ist es wichtig, Fragen zu stellen«, sagte Charlotte eine Spur versöhnlicher und rieb sich mit der linken Hand über ihren rechten Unterarm. »Glaubst du etwa, du wärest der einzige, dem die Tore der höheren Schule verschlossen sind? Vielleicht gibt es noch andere Menschen, die davon träumen, die Rätsel der Natur zu ergründen, herauszufinden, warum es Krankheiten gibt und warum einige an diesen sterben, während andere sie überleben.«
»Du weißt …?«
»Daß du alles daran setzt, die Schule zu besuchen, um später die Heilkunde zu studieren?« unterbrach ihn das Mädchen, und ein kurzes Lächeln huschte über ihr Gesicht. »Seit dem Tag, als Vater und ich dich beim Studium der alten Botanikfolianten gesehen haben. Ich glaube, mein Vater hat es sich in den Kopf gesetzt, deine Seele zu retten, Junge!«
»Wie meinst du das, meine Seele retten?« wollte Samuel wissen und fuhr sich nervös mit der Hand durch sein dünnes blondes Haar.
»Nun, es gibt Gifte der Natur, Substanzen, die harmloser aussehen, aber tödlicher wirken als Schierling, Stechapfel oder was du sonst noch kennen magst, Samuel Hahnemann. Es sind Ideen und Fabeln, die außer Kontrolle geraten und sich nicht nur in den Verstand, sondern auch ins Herz einschleichen. Beherrschst du sie, ist es gut, aber beherrschen sie dich, bist du verloren.«
Samuel versuchte, Charlottes tiefem Blick standzuhalten, ohne jedoch den alten Zacharias in seiner weiten Livree aus den Augen zu verlieren, der nun an seinem Ofen begann, mit einem ledernen Blasebalg ein gewaltiges Feuer zu entfachen.
»Ich fürchte, ich verstehe immer noch nicht, was du eigentlich meinst, Charlotte!« stammelte Samuel, vom zischenden Lodern der sich wütend aufbäumenden Flammen hypnotisiert.
Das Mädchen warf seine widerspenstigen Locken zurück und zwinkerte dem Jungen herausfordernd zu. »Komm mit, Samuel Hahnemann. Schau es dir an!« Sie lud den Jungen mit einem angedeuteten Nicken ein, ihr durch das Gewölbe zu folgen.
Ähnlich wie die Kapelle war auch das Gewölbe rechteckig geschnitten und wurde von massiven Steinsäulen getragen. Von jeder der vier Seiten zweigten wiederum Nischen ab, die so geräumig waren, daß riesige Schränke aus Eichenholz mühelos darin Platz fanden. Der größte war etwa vier Meter hoch und von oben bis unten rot angemalt. Er besaß gewundene, von Goldefeu umrankte Säulen und schwere Giebelansätze, welche sternförmige Embleme trugen. Das Gebälk war mit dem kurfürstlichen Wappen geschmückt Einige der zahlreichen Schubladen des Schrankes waren mit Landschaftsmalereien verziert worden, so daß man den Eindruck einer regelrechten Galerie gewann. Die obersten waren geöffnet und verströmten den kräftigen Geruch verschiedener Kräuter und scharfer chemischer Substanzen. Samuel lief es kalt den Rücken herunter, als Charlotte die Aufschriften der Laden mit ihrer Kerze beleuchtete. Armsünderfett, Knochenmehl, Hirnschalenmoos, Engelstrompete, Alraunen und Mumiendestille stand darauf zu lesen. Das Mädchen verzog keine Miene, während es Samuel die Kerze in die Hand drückte und die Schubladen sorgfältig verschloß.
»Ärzte früherer Generationen glaubten an die Heilkraft der Menschensubstanz«, erklärte sie mit leiser Stimme. »Sie glaubten, daß ein aus einem gesunden Menschen gewonnenes Destillat das Allheilmittel gegen jede Krankheit sei, ein sogenannter Theriak. Da man aber eines kranken Menschen wegen keinen Gesunden töten durfte, mußte man sich mit Ersatzmit