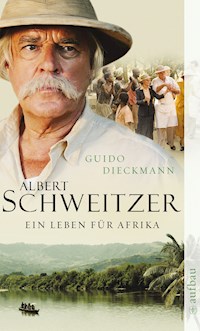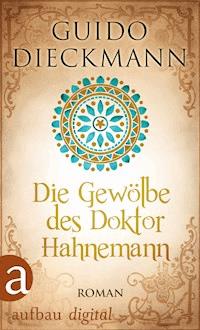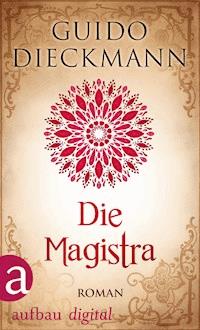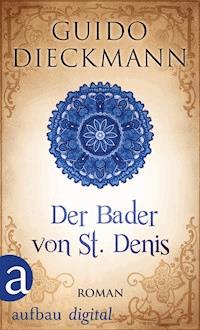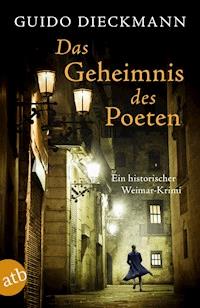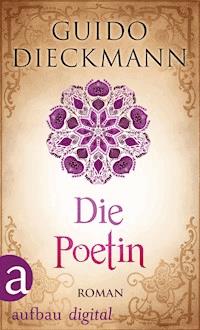
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die wahre Geschichte der Dichterin Nanetta Schildesheim.
Deutschland, Spätsommer 1819: Mit Frau und Tochter reist der Tuchhändler Joseph Schildesheim nach Heidelberg. Tochter Nanetta, frühreif und wissensdurstig, fällt es schwer, den Verlockungen der Heidelberger Altstadt fernzubleiben. Sie träumt davon, es ihrem heimlichen Brieffreund Harry Heine gleichzutun und ihre Gefühle in Versen auszudrücken, statt als Jüdin ein zurückgezogenes Leben zu führen. Heidelberg aber ist in Aufruhr. Nach dem Mordanschlag auf den Dichter Kotzebue im benachbarten Mannheim sehen die aufgebrachten Studenten nahezu in jedem Fremden einen Spion. Und plötzlich wird auch Nanetta verdächtigt, eine Agentin zu sein ...
Ein aufregender Roman, der auf einer wahren Begebenheit beruht: Guido Dieckmann (1968 in Heidelberg geb.) ist ein direkter Nachfahre Nanetta Schildesheims. Ein erst spät in einem russischen Archiv entdeckter Brief Heinrich Heines veranlasste ihn, Familiendokumente zu erforschen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 420
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Informationen zum Buch
Die wahre Geschichte der Dichterin Nanetta Schildesheim.
Deutschland im Spätsommer 1819: Mit Frau und Tochter reist der Tuchhändler Joseph Schildesheim nach Heidelberg. Tochter Nanetta, frühreif und wissensdurstig, fällt es schwer, den Verlockungen der Heidelberger Altstadt fernzubleiben. Sie träumt davon, es ihrem heimlichen Brieffreund Harry Heine gleichzutun und ihre Gefühle in Versen auszudrücken, statt als Jüdin ein zurückgezogenes Leben zu führen. Heidelberg aber ist in Aufruhr. Nach dem Mordanschlag auf den Dichter Kotzebue im benachbarten Mannheim sehen die aufgebrachten Studenten nahezu in jedem Fremden einen Spion. Und plötzlich wird auch Nanetta verdächtigt, eine Agentin zu sein.
Ein aufregender Roman, der auf einer wahren Begebenheit beruht: Guido Dieckmann (1968 in Heidelberg geb.) ist ein direkter Nachfahre Nanetta Schildesheims. Ein erst vor kurzem in einem russischen Archiv entdeckter Brief Heinrich Heines veranlaßte ihn, Familiendokumente zu erforschen.
Guido Dieckmann
Die Poetin
Roman
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
Epilog
Nachwort
Über Guido Dieckmann
Impressum
Wem dieses Buch gefallen hat, der liest auch gerne …
Und ich sah in der rechten Hand dessen,
der auf dem Thron saß, ein Buch,
beschrieben von innen und außen, versiegelt
mit sieben Siegeln.
Und ich sah einen starken Engel, der rief
mit großer Stimme: Wer ist würdig, das
Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen?
Offenbarung 5,1-2
Prolog Düsseldorf, 12. August 1819
Harry kam spät zurück. Zu spät, denn über den Dächern dämmerte es bereits, und die letzten Glockenschläge des nahen Kirchturms verhallten in den schattigen Winkeln der Höfe, als er die wenigen Stufen zu der abgegriffenen Haustür aus Eichenholz hinaufstolperte, die in den Flur seines Vaterhauses führte. Zu dieser Stunde war die Tür zum Laden für gewöhnlich längst fest verschlossen.
Ein polterndes Geräusch wie von Fässern oder Kisten, die aneinander schlugen, dröhnte über die Straße. Harry neigte ein wenig den Kopf und sah, daß ein beladenes Fuhrwerk mit zwei ausgemergelten Schindmähren im Gespann die Bolkerstraße hinunter zog. Offensichtlich wollte trotz der vorgerückten Abendstunde ein Handelsknecht mit seiner Ware auf die andere Rheinseite übersetzen. Harry hielt inne. In der Regel waren es nur Kurierreiter, die nach Sonnenuntergang noch die beiden stämmigen Fährmeister behelligten, um auf ihrem Weg die streng kontrollierten Brücken zu meiden. Die Fährmeister hingegen waren so verschwiegen wie das grob gezimmerte Holz ihrer klobigen Flöße, und auch ihre Gesellen standen in dem Ruf für ein paar Groschen die Taue zu kappen und Ohren und Augen zu verschließen.
»Verdammtes Provinznest«, brummte der blonde junge Mann, während er endlich den schweren Schlüssel im Schloß herumdrehte. Dabei liebte Harry Düsseldorf und den Rhein über alles. Hier, im Schatten der altehrwürdigen Neanderkirche, war er aufgewachsen, und in dem Kämmerchen im rückwärtigen Teil des alten Handelshauses, hoch über der schmalen Gasse, die im Sommer so unerträglich nach Pferdemist und Fisch stank, hatte er seine ersten, holprigen Verse zu Papier gebracht.
Als Harry den schmalen, dunklen Korridor seines Elternhauses betrat, bemerkte er sofort, daß irgend etwas nicht in Ordnung war. Keine Stimmen im Salon, nicht eine einzige Lampe brannte im Eingangsbereich.
Harrys Blick fiel auf die dicken Ballen von Kattun, Leinen und Manchester, die unordentlich neben der Treppe zum ersten Stock aufgeschichtet waren. Den Manchester importierte sein Vater trotz der hohen Einfuhrzölle seit Jahren direkt aus dem Norden Englands. Aber da lagerten auch mehrere fest zugeschnürte Säcke mit französischer Aufschrift. Offensichtlich war eine neue Lieferung eingetroffen. Warum hatte der Vater die Ballen nicht ins Kontor schaffen lassen?
Verwundert schüttelte Harry den Kopf. Die Tür zum Laden war nur angelehnt; ein aufdringlicher Geruch nach Branntweinessig drang ihm in die Nase. Angewidert legte er die Stirn in Falten. Er kannte den Geruch zur Genüge, schließlich hatte er in Hamburg selbst einen Laden mit Manufakturwaren geführt. Aber die elende Klitsche war bankrott gegangen, Gott war es gedankt!
Das Handelskontor war verlassen. Das hohe Stehpult, an dem sein Vater die Bücher zu führen pflegte, ragte einsam und ein wenig verloren aus dem Zwielicht der spärlich eingerichteten Stube empor. Plötzlich bemerkte Harry, woher der strenge Geruch des Reinigungsmittels kam. In einem Winkel des Raumes kauerte Teresa, die Magd seiner Eltern, auf allen vieren und bearbeitete die zerkratzten Holzdielen mit Schwamm und Scheuerlappen.
Eine Zeitlang stand Harry regungslos unter dem Türsturz und widerstand dem Drang, der drallen Magd einen Klaps auf ihr wippendes Hinterteil zu geben. Statt dessen klopfte er nur lässig dreimal an den Türrahmen.
»Sieh an, Teresa! Du rückst ja unseren Dielen zu Leibe, als wollest du ihnen mit deinem Essig jene reine Unschuld wiedergeben, die du selbst schon vor langer Zeit verloren hast!«
Harry liebte es, Teresa zu necken, auch wenn er bedauernd einsehen mußte, daß sie längst keine ebenbürtige Partnerin für sarkastische Wortwechsel mehr war.
Wütend funkelte Teresa den Sohn ihres Dienstherrn an, entschied sich aber dafür, nicht auf seine Provokation einzugehen. Als achtes Kind eines trunksüchtigen Gerbers war Teresa froh, wenigstens bei den »Bolkerjuden« ein Auskommen gefunden zu haben.
»Was ist hier eigentlich los, du dummes Ding? Sind die Herrschaften etwa schon abgereist?«
Die Magd tauchte ihren Schwamm so heftig in den Eimer, daß das Wasser über ihren Rock spritzte.
»Ja, schon vor Stunden! Der alte Tuchhändler hat kein Blatt vor den Mund genommen. Sagte, er ließe sich keinen Ausschuß andrehen. Sieht so aus, als hielte er nicht allzuviel vom Hause Heine!« Zufrieden beobachtete Teresa, wie Harry vor Ärger errötete. Dann zog sie sich an der Tischkante hoch und baute sich in voller Gestalt vor ihm auf.
»Das ist unmöglich. Sie können nicht abgereist sein. Ich hatte mit Mademoiselle Nanetta zu reden!«
»Aber vielleicht wollte sie nicht mit Ihnen reden«, entgegnete die Magd und wischte sich die Hände am Rock ab. Schadenfroh lächelnd schob sie sich an Harry vorbei auf den Korridor. Dieses eine Mal hatte sie ihm das freche Maul gestopft. Sollte der verwöhnte Träumer, der sich für einen großen Poeten hielt, doch seine Eltern fragen, warum der alte Schildesheim mit Frau und Tochter so überstürzt das Weite gesucht hatte.
Ein Hauch von schlechtem Gewissen überfiel Teresa allerdings doch, als sie den zerknitterten Brief in ihrer Schürzentasche spürte. Das sonderbare Herforder Mädchen hatte ihn für Harry geschrieben, als im Hof bereits die Kutsche beladen wurde. Ärgerlich tastete Teresa nach dem Schreiben und seufzte. Um nichts in der Welt würde sie heute abend noch einmal das Kontor betreten.
Hastig schaute sie sich im Korridor um, dann zog sie mit einer schnellen Bewegung den verräterischen Brief aus der Schürze und schob ihn unter einen ausladenden Ballen Manchester.
Harry stand am Fenster des Kontors. Mit Daumen und Zeigefinger lüpfte er die verstaubte Gardine und starrte in die Dunkelheit. Ob Nanetta und ihre Eltern noch rechtzeitig eine Herberge gefunden hatten? Die Zeiten waren unsicher.
»Sie kann nicht ohne Nachricht abgereist sein!« sagte er laut zu sich selbst. »Warum bloß habe ich mich nicht beeilt?«
Endlich ließ er die Gardine sinken. In der untersten Schublade des Stehpultes lag, fein säuberlich zusammengerollt, eine alte Landkarte. Schon als Kinder hatten Harry und seine Geschwister mit ihr gespielt. Sie stammte noch aus jener Zeit, als der Vater im Gefolge des Prinzen Ernst von Cumberland Proviantmeister gewesen war. Bis Flandern und Brabant hatte der kleine Jude das Heer seines Prinzen begleitet.
Harry zog die Karte heraus, schüttelte den Staub ab und hängte sie schließlich an einen Haken gegenüber der Tür. Dann nahm er eine Stecknadel aus der Lade, in der die Eltern allerlei Kleinkram aufbewahrten. Während er die Karte auf und abwanderte, fühlte er sein Herz schneller schlagen. Gehetzt strich sein Zeigefinger über das brüchige Pergament und glitt langsam das Rheintal hinab, bis er den Neckar erreicht hatte. Dort hielt er inne.
Verstohlen lauschte Harry, ob auf dem knarrenden Korridor Schritte zu hören waren, aber alles blieb still. Dann stieß er eine Stecknadel auf einen kleinen, nur noch schwach schimmernden roten Punkt im Süden des Landes: Heidelberg.
1. Kapitel
Eine ganze Schar zerlumpter Straßenkinder jagte schreiend über das holprige Kopfsteinpflaster, als der fremde Postillion seine Kutsche durch das breite Heidelberger Stadttor lenkte. Obwohl die beiden Rappen ihr Tempo bei der Einfahrt nur unwesentlich gemindert hatten, nahm einer der waghalsigeren Jungen plötzlich Anlauf und schwang sich an der Rückseite des Wagens in die Höhe. Mit einem triumphierenden Blick auf seine brüllenden Spielkameraden ließ er sich auf dem Dach mitschleppen und strich mit seiner kleinen, schmutzigen Hand über das heiße, glatte Holz. Der Kleine vergaß in seiner Verzückung sogar die Kameraden, die ihm nachplärrten und ihrerseits versuchten, die Kutsche mit dem seltsamen Adlerwappen zu erklimmen. Aber da wurde der Postillion, ein wahrer Hüne mit Bart und Dreispitz, auf die wilde Schar aufmerksam und machte dem Treiben auf rüde Art ein Ende. Sein stärkstes Argument, eine drei Ellen lange Peitsche, überzeugte auch den Straßenjungen auf dem Kutschendach, sein Heil rasch in der Flucht zu suchen. Das Surren des Lederriemens zerschnitt die Luft wie ein Messer, doch ehe es den rückwärtigen Teil des Fahrzeugs erreichte, hatte sich der Junge auch schon elegant an der Seite des Daches abgerollt und war im staubigen Straßengraben verschwunden.
Im Innenraum der Postkutsche herrschte schläfriges Schweigen. Gewiß hatte man das Getrampel nackter, kleiner Füße auf dem Holz vernommen, aber keiner der Reisenden empfand zu dieser Stunde auch nur die geringste Neigung, sein Gefühl von Erschöpfung zu überwinden und sich aus dem Fenster zu beugen.
Dichte, grüne Samtvorhänge verdunkelten vier hart gepolsterte Sitzplätze, auf welchen die Passagiere, ein schwarz gekleideter Mann mit Brille und grauem Bärtchen, eine dunkelhaarige Frau mittleren Alters und ein junges Mädchen kauerten.
Spitz wie ein Gänsekiel brach ein Sonnenstrahl durch eine Ritze in die Kutsche ein und ließ sich direkt auf dem Haaransatz der schwer atmenden, älteren Frau nieder.
Das Mädchen, ein aufgewecktes, dunkelgelocktes Geschöpf mit großen, ein wenig unstet wirkenden Augen, hatte den Vorhang ohne Vorwarnung zur Seite geschoben, um einen ersten Blick auf die fremde Stadt mit den hohen Türmen zu erhaschen, in der es mit seinen Eltern die nächsten Wochen verbringen sollte.
»Nanetta, muß das sein?« wies ihre Mutter sie nervös zwinkernd zurecht. Der Sonnenstrahl wanderte von der Nasenspitze das schmale, blasse Gesicht der Frau hinauf.
Nanetta konnte sich ein Lachen nicht verkneifen. Die Mutter gab ein wirklich komisches Bild ab. Ihr schwarzes, strenges Kleid mit dem zarten Spitzenbesatz klebte auf ihrer Haut. Die Haube war seit einem Schlagloch bei Philipsburg, das der Kutscher recht unsanft umfahren hatte, verrutscht und wirkte auf Nanetta nun eher wie der Hut eines preußischen Grenadiers.
Die Vorstellung ihrer Mutter im Soldatenrock ließ Nanetta ein zweites Mal lächeln. Gar so abwegig war der Gedanke hingegen nicht. In ihrer Heimatstadt, dem westfälischen Herford, das seit dem Wiener Kongreß vor vier Jahren zum Königreich Preußen gehörte, wurde Nanettas Mutter von vielen Bürgern wegen ihrer spitzen Zunge gefürchtet. Ihr Talent, richtige Dinge am falschen Fleck auszusprechen, hatte die Familie mehr als einmal in heikle Situationen gebracht. Nanetta erinnerte sich noch genau an den Tag, als ihre Mutter mit wehender Schürze und die Elle des Vates schwingend, den Passerelle, einen napoleonischen Soldaten und notorischen Hühnerdieb, quer durch ihren Gemüsegarten am Lübberwall gejagt hatte.
Nanetta hatte sich oft gefragt, wem die Mutter mit ihrer Tat die größere Angst eingejagt hatte: dem Franzosen, ihrem entsetzten Vater oder dem armen Federvieh, das aufgeregt zwischen den Mohrrüben umhergeflattert war und nicht ahnen konnte, daß es den ganzen Wirbel verursacht hatte.
Glücklicherweise gehörte jene wilde Besatzungszeit der Vergangenheit an. Die Schlacht von Waterloo lag vier Jahre zurück, und der französische Kaiser war auf irgendeine felsige Insel unter britischer Oberhoheit verbannt worden.
Nanetta streckte den Kopf aus dem Kutschenfenster. Die Luft im Innenraum hing stickig und verbraucht über den abgewetzten Polstern.
Seit einigen Minuten führte ihre Fahrt an einem Fluß entlang. Grünlich glitzernd rann das Wasser abwärts, wand sich unter prächtigen Brücken hindurch einem Reservoir entgegen. Man konnte den Strom kaum hören. Ein wenig enttäuscht dachte Nanetta an den Rhein zurück. In Düsseldorf hatte sie sich in die ungezügelte Wildheit der schäumenden Stromschnellen verliebt und sogar ein Gedicht über sie geschrieben.
Hier und dort entdeckte sie unförmige Frauen mit roten Gesichtern. Wäscherinnen stiegen mit geflochtenen Binsenkörben die Böschung zum seichten Flußufer hinunter. Einige Kinder planschten ausgelassen im Wasser herum, wurden aber von den Waschfrauen energisch zur Ordnung gerufen. Nanetta lehnte sich wieder in die Kissen zurück. Wie gut konnte sie sich in die tobenden Kinderherzen hineinversetzen. Ihr selbst war es als Kind nicht anders ergangen. Ermahnungen über Ermahnungen.
»Wasser hat keine Balken«, mahnte ihr Vater zuweilen. »Meide unbekannte Gewässer, ob See oder Fluß! Du kannst nicht damit rechnen, daß eine hilfsbereite Seele in der Nähe ist, die dir in der Not beispringt!« Auch die Mutter fürchtete sich vor dem nassen Element und pflegte zu Hause wie ein Pfau zu schreien, wenn Nanetta im Sommer nur ihre bloßen Füße in den Bach am Lübbertor tauchte, um den Schönfärbern ihrer Nachbarschaft bei ihrem bunten Gewerbe zuzuschauen.
»Was ist das für ein Fluß, Papa?« fragte Nanetta interessiert. »Das ist doch nicht mehr der Rhein, oder?«
»Natürlich nicht, Nanetta, Gott sei Dank liegt das Rheintal hinter uns. Durch Heidelberg fließt bekanntlich der Neckar.«
Unwirsch brummte Joseph etwas in seinen Bart, das Nanetta zwar nicht verstand, sich aber wohl denken konnte. Ihr Vater mochte nicht an die gescheiterten Verhandlungen in Düsseldorf erinnert werden. Was erlaubten sich diese rheinländischen Grünschnäbel? Hatten sie geglaubt, ihn über den Tisch ziehen zu können? Mit französischem Wollstoff? Wo doch jede Krämerseele landauf, landab wußte, daß insbesondere dieser Stoff nicht von der Akzise befreit war.
Joseph Schildesheims Handelsreisen hatten ihn bereits in frühester Jugend kreuz und quer durch Europa geführt. Er hatte Pelze und Honig in Rußland und Polen gekauft und in Holland und Deutschland verkauft. Einmal wäre er fast über den Ozean nach Amerika gesegelt, aber dann hatte er seine Frau kennengelernt, die ihm auf ihre ganz spezielle Art die Reiselust ausgetrieben hatte.
Nanetta wußte von den legendären Handelsfahrten ihres Vaters nur aus seinen spärlichen Erzählungen am heimischen Kaminfeuer. Seit ihrer Geburt hatte er die kühlen Gewölbe seiner Tuchhandlung kaum mehr verlassen. Nanetta hatte sich oft gewünscht, es wäre anders gewesen. Aber es war ihr in all den Jahren nur selten gelungen, sich der erdrückenden Obhut des Alten zu entziehen. Warum er der Reise nach Heidelberg zugestimmt und darauf bestanden hatte, Frau und Tochter mitzunehmen, blieb nicht nur Nanetta ein Rätsel.
»Wenn du es schon nicht mehr aushalten kannst, die Läden zu begaffen, so zieh wenigstens den Vorhang ganz zur Seite. Heidelberg ist eine wunderschöne Stadt!« sagte der Vater. Es klang beinahe wie ein Befehl. Ihre Mutter, die nie zuvor am Neckar gewesen war, nickte zu seinen Worten. Eigentlich pflichtete sie dem Alten immer bei, aber Nanetta wußte, daß sie seine Meinung insgeheim oft nicht teilte.
Mit ein paar raschen Griffen brachte Johanne Schildesheim ihre Haube und die zerknitterte Kleidung ein wenig in Ordnung. Hoffentlich mußte sie in diesem Zustand nicht allzuweit zu Fuß gehen.
Was Heidelberg betraf, so hatten die Eltern allerdings recht. Prächtige Patrizierhäuser mit hohen Giebeln und Balkons zogen gemächlich an ihnen vorüber. Auf manchen der Balustraden lehnten sich geputzte junge Mädchen gegen das zierliche Geländer und schauten neugierig auf das Straßentreiben hinab. Nanetta staunte über die Kirchen und die Läden mit ihren blitzenden Kupferschildern, rund um den Marktplatz. An der Südseite einer besonders großen Kirche am Platz drängten sich Dutzende von Bretterbuden, vor denen Marktschreier Kuchen, bunte Bänder, aber auch Gänse und Fische anpriesen. Ihr eigentümlicher Dialekt klang recht seltsam und ungewohnt. Zwei Weiber keiften sich lautstark vor einer der Buden an, ihre Gesichter waren rot und geschwollen. Nanetta verstand nicht, worum es bei ihrem Streit ging, vermutete aber, daß beide sich um die selbe Ware balgten.
Am interessantesten erschien ihr jedoch die Vielzahl verwinkelter Gassen, die vom Markt in die Altstadt abzweigten. Zwischen ihren groben Pflastersteinen wucherte grünes Moos. Frauen saßen auf den Steinstufen ihrer Häuser und rupften Hühner und Gänse. Die Federn warfen sie auf die Gasse. Wohin würden diese Gassen wohl führen? Nanetta hätte es gern auf der Stelle erkundet, ein scheuer Blick auf die gekrümmte Gestalt des Vaters genügte indes, ihren Wunschträumen Einhalt zu gebieten.
»An jeder Straßenecke Weibsleute und eine Schenke,« brummte Schildesheim verächtlich, »weiß Gott, die Welt hat sich wirklich nicht verändert!«
Ein deftiger Geruch von Gebratenem mit Zwiebeln wehte aus den Gastwirtschaften durch die offenen Fenster der Postkutsche.
»Mutter, wann können wir endlich etwas essen? Ich habe Hunger«, nörgelte Nanetta in der aussichtslosen Hoffnung, der Vater könne sie zur Feier ihrer Ankunft in eine der verlockenden kleinen Gastwirtschaften mit den bunten Türen und schmiedeeisernen Schildern einladen.
»Eine Weile wirst du dich schon noch gedulden müssen«, antwortete die Mutter und gähnte. »Ich glaube nicht, daß der Gasthof zum Ochsen koschere Mahlzeiten anbietet. Ein Mädchen im heiratsfähigen Alter sollte längst wissen, daß unser Glaube uns nur den Genuß von Geschächtetem erlaubt. Das ist eines der Gesetze, die der Herr seinem Propheten Moses am Horeb gegeben hat!«
»Warte, bis wir bei Elias und den Oppenheimers im Rosenblattgässchen sind,« mischte sich der Vater ein, »dort erwartet uns heute abend ein festliches Sabbatmahl!«
Bei der Einstimmung aufs Abendessen lief dem Vater offenbar selber das Wasser im Mund zusammen. Wenn der vermaledeite Kutscher sich bloß ein wenig mehr beeilen würde! Die Sonne ging bald unter, und sobald es dunkel wurde, begann der Sabbat, der wöchentliche jüdische Ruhetag zu Ehren des Herrn.
Joseph Schildesheim hatte sich schon als kleiner Junge streng an die Gesetze seiner Väter gehalten. Aber gerade heute mochte er um nichts in der Welt zugeben, wie sehr er diesem Sabbatabend entgegenfieberte. Nach endlosen Monaten würden sie Elias wiedersehen, den guten Sohn und Bruder, der Herford verlassen hatte, um an der alten Universität zu Heidelberg Medizin zu studieren. Joseph seufzte. Noch immer konnte er es nicht fassen, seinen Sohn an die Wissenschaft verloren zu haben. Und dabei hatte er sich fest vorgenommen, Elias’ Entscheidung gegen das Geschäft zu verstehen und allen Ärger zu vergessen. Aber wie sollte ein Mann vergessen, daß der eigene Sohn ihn in seinen eigenen vier Wänden beschimpft hatte. Daß er ihn eigensinnig und stur genannt und danach gedroht hatte, sich den preußischen Soldaten anzuschließen, deren Regimenter überall im Mindener Land biwakierten.
Erst angesichts dieser drohenden Schande war Joseph bereit gewesen einzulenken. Wenn der stolze Junge auch keine Neigungen verspürte, den väterlichen Stoffhandel weiterzuführen, an die Soldaten wollte Schildesheim den einzigen Sohn auf keinen Fall verlieren. Schon so mancher junge Jude hatte im Zuge des unbändigen Militärlebens, des plötzlich erwachenden Dranges nach Unabhängigkeit, nicht nur Heim und Herd, sondern auch Rabbi und Synagoge vergessen.
So blieb dem Vater nichts weiter übrig, als erleichtert aufzuatmen, als Elias dem Vorschlag der Mutter folgte, ein Medizinstudium in Heidelberg zu beginnen.
Gute Ärzte wurden in diesen Zeiten mehr denn je gebraucht. Der letzte Krieg hatte tiefe Wunden geschlagen; überall im Land lagen Krankheit und Elend offen zutage. Auf ihrer Reise an den Neckar waren die Schildesheims oft an brachliegenden Äckern und verwahrlosten Gehöften vorbeigekommen, durch deren leere Fensterhöhlen der Wind pfiff und vor denen ausgemergelte, zerlumpte Gestalten die Hände nach Almosen ausstreckten. Fast alle diese Bettler, zumeist Veteranen der Napoleonischen Kriege, kleideten sich in bunt zusammengewürfelte Reste verschiedener Uniformen. Hunderte von jungen Burschen, die das Handgeld als Söldner ihren prügelnden Lehrherren vorgezogen hatten, lungerten auf den staubigen Landstraßen und in den Wäldern herum. Räuberbanden entstanden allerorts und versetzten arglose Reisende in höchste Panik. In Friedberg und Bockenheim wüteten zudem seit Wochen die Blattern. Aber die Hospitäler waren hoffnungslos überfüllt. Ebenso die Klöster und Stifte, die sich aus Barmherzigkeit den Gezeichneten in großer Zahl geöffnet hatten, um Mildtätigkeit zu praktizieren.
Eine medizinische Laufbahn hingegen, wie sie Elias Schildesheim anstrebte, zählte zu den wenigen, die 1819 sogar jungen Juden eine gewisse Zukunftsaussicht versprachen. Mochten Juden auch Staatsrecht und klassische Sprachen studieren, Anstellungen bei Hofe oder die Zulassung als Advokat blieben ihnen in den deutschen Staaten auch nach den Befreiungskriegen und den zaghaften Versuchen einer Emanzipation weitgehend verwehrt.
Schuld an den herrschenden Verhältnissen trug allein die groteske Zersplitterung Deutschlands in zahllose Kleinstaaten, Königreiche, Fürstentümer und Markgrafschaften. Noch in Herford hatte Elias seine Schwester Nanetta über die grotesken Resultate des Wiener Kongresses in Kenntnis gesetzt. Europa war ein Flickenteppich geworden. So nannte es Elias wenigstens. Die Reise der Schildesheims von Westfalen nach Heidelberg hatte Nanetta nun zum ersten Mal hautnah über diesen Flickenteppich geführt.
An jeder neuen Staatsgrenze hatte sich eine ähnliche, lästige Prozedur ereignet: aussteigen, Papiere und Beglaubigungsschreiben vorlegen, die Taschen und Koffer öffnen. Am Tag zuvor hatte die Mutter im Hessischen sogar zehn Gulden Zoll auf drei Kleider zahlen müssen, die der Zöllner trotz eindeutig abgewetzter Ärmel als Handelsware eingestuft hatte.
»Ihr Juden handelt doch seit eh und je mit Lumpenzeug!« hatte der Uniformierte ihnen nachgerufen, während er die Zollschranke hinaufkurbelte.
Nanetta hatte bislang noch nicht oft erfahren müssen, was es bedeutete, in diesem Land eine Jüdin zu sein. Offenbar verstand man in der Heimat etwas völlig anderes darunter als in der Fremde.
In Herford die Tochter des Juden Joseph Schildesheim zu sein hieß vor allem, den Worten der Älteren zu folgen, die wiederum den Worten des Rabbiners folgten, der die Stadt regelmäßig besuchte. Aber wessen Worten folgte der Rabbiner? Und der Bürgermeister? Und die Fürstäbtissin? König Friedrich Wilhelm III. war weit, und seine Ministerialen wirtschafteten nur zu gerne in die eigenen Taschen, gerade in den neu gewonnenen Gebieten, zu denen nicht nur die Rheinprovinzen, sondern auch Westfalen zählte.
Fragen dieser Art beschäftigten Nanetta recht häufig. Gleichgültig, ob sie ihrer Mutter bei den Vorbereitungen für den Sabbat half oder auf der Empore der kleinen Herforder Synagoge am Gehrenberg hockte, immer begleitete sie jene verhängnisvolle Neigung zum Widerspruch. Aber auch wenn sie sich heimlich aus dem Haus stahl, um mit dem Nachbarsjungen, einem Bäckerlehrling, auf die Apfelbäume vor der Stadt zu klettern, konnte und wollte sie sich nicht damit abfinden, das zu glauben, was die Alten ihr nur zu gerne vorhielten: daß sie als Tochter Evas einem unterlegenen Geschlecht angehörte, daß sie deshalb kein Anrecht auf höhere Bildung hatte und daß es ihre Aufgabe war, ihren Eltern und später ihrem Ehemann zu gehorchen und ein behagliches Heim zu bereiten. Nanetta hatte stets darüber gelacht und sich mit ihren Büchern und Schreibfedern auf den einsamen Dachboden zurückgezogen, ohne jedoch zwischen vergilbten Stoffballen, zerbeulten Möbeln und leeren Säcken jene unsichtbaren Mauern zu durchbrechen, die sich zwischen sie und ihren Durst nach Wissen schoben.
Nun aber befand sie sich im Großherzogtum Ludwigs von Baden. Die Menschen schienen hier anders zu sein als in Westfalen. Urtümlicher vielleicht und weniger preußisch. Ob sich aber in einer Stadt wie Heidelberg Antworten auf ihre Fragen finden ließen? Nanetta beschloß, sich vorläufig in Geduld zu üben, den Vater nicht zu sehr zu reizen und die vor ihr liegenden Tage mit dem Bruder zu genießen.
2. Kapitel
»Daß du dich ja nicht wieder von Papa und mir entfernst und durch die Altstadt streifst, wie in Frankfurt!« erklärte Johanne Schildesheim, als die Kutsche das Getümmel des Marktplatzes hinter sich gelassen hatte.
Die dunklen Gassen, die windschiefen, ziegelgedeckten Häuser, über deren Türen Laternen oder leicht verrostete Wirtshausschilder im Abendwind schaukelten, schienen nicht nur Nanettas Phantasie anzuregen. Johanne wußte genau, was das Glimmen in den Augen ihrer Jüngsten zu bedeuten hatte. War sie als Mädchen denn anders gewesen? Weniger neugierig? Aber das 18. Jahrhundert mit all seiner Dekadenz und sorglosen Leichtlebigkeit war vorüber. Nanetta hatte es doch gar nicht mehr erlebt. Was wußte sie denn von den Gefahren einer Überlandfahrt?
Vor ihnen schleppte ein bärtiger Mann mit Weste und abgegriffenem Dreispitz auf dem Kopf einen unförmigen Sack über das Pflaster. Ein Köhler aus den Wäldern rund um die Stadt, meinte Joseph desinteressiert.
Aus der Pforte eines Eckhauses huschte der schwarze Schatten eines jungen Mannes um die Ecke, während der Saum eines rüschenbesetzten, langen Kleides flink in die Dunkelheit des Torbogens zurückwich.
Nanetta fragte sich, ob Elias hier in Heidelberg auch ein Mädchen gefunden hatte, das er in lauen Sommernachtsstunden heimlich zu Hause besuchte, um ihr Gedichte vorzulesen oder sich an ihren weiblichen Rundungen zu erfreuen.
Nanettas Bruder war schon mit fünfzehn Jahren ein gutaussehender, kräftiger Bursche gewesen. Es gab nur wenige Mädchen in Herford, die unter den durchdringenden, schwarzen Augen des jungen Mannes, seinem melancholischen Lächeln, nicht wenigstens für eine kurze Weile dahingeschmolzen wären.
In den wenigen Monaten, die Elias im Kaufladen des Vaters gearbeitet hatte, hatte der alte Schildesheim erstaunt festgestellt, daß sich die tägliche Kundenzahl nahezu verdoppelt hatte, während der Umsatz stets konstant geblieben war.
»Kein Wunder«, hatte Johanne mißmutig gemeint. »Die Gören kommen nur in deinen Laden, um von unserem Sohn bedient zu werden. Er schleppt die teuersten Ballen vom Speicher, verteilt Komplimente, und alles, was diese Schicksen letztendlich kaufen, sind bunte Stecknadeln!«
»Gott Abrahams, der Junge muß aus dem Haus, bevor er mich völlig ruiniert«, hatte der Alte händeringend ausgerufen und seinen Segen für das Studium des umschwärmten Sohnes nicht länger verweigert. So hatte er vor den Ältesten seiner Gemeinde wenigstens nicht das Gesicht verloren.
Nanetta schwelgte noch in ihren bunten Erinnerungen an Elias’ letzte Tage in der westfälischen Heimat, als ihre Mutter sie auch schon derb in die Gegenwart zurückrief.
»Dein Vater redet mit dir, und du schaust auf deine Handschuhe. Siehst du denn sein Gesicht in deinen Handschuhen?«
»Entschuldige, Mutter. Ich habe ja verstanden. Keine Ausflüge in die Stadt und keine Kontakte zu Christenjungen. Keine streunenden Hunde, keine bettelnden Meisen …«
Plötzlich spürte Nanetta eine schier lähmende Müdigkeit. Nur noch mit Mühe hielt sie die Augen offen. Aber da schwang der Postillion auch schon sein Horn und gab das lang ersehnte Zeichen. Die Postkutsche hielt vor einem hohen, schmalen Gebäude mit vielen winzigen Fensteröffnungen: dem Haus der Familie Oppenheimer in Heidelberg.
Eine Linde verdeckte die von altem Fachwerk durchzogene Vorderfront des Gebäudes zur Hälfte. Nanetta bemerkte ein großes, in das weiche Holz geschnitztes Herz und fragte sich seufzend, wer wohl auf diese Weise einst seiner Liebe oder Sehnsucht Ausdruck verliehen haben mochte. Im vorderen Teil des Anwesens, vom Wohnhaus durch einen schattigen Innenhof getrennt, befand sich die Buch – und Papierwarenhandlung des Hausherrn, Samuel Oppenheimer. Zwei kleine, rot gestrichene Fensterläden umrahmten sein staubiges Schaufenster, das mit schweren Büchern, Landkarten und Kupferstichen vollgestopft war.
Erst als Schildesheim die Tür des Wagens öffnete, stakste ein langer, dürrer Knecht wie auf Stelzen auf das Tor seines Dienstherrn zu und stieß es mit einer knappen Bewegung seiner langen Arme zu beiden Seiten auf. Durch das Holztor, das den Buchladen vom Nachbarhaus trennte, gelangten die Ankömmlinge auf einen riesigen Innenhof, in dessen Mitte ein mit Efeu bewachsener Springbrunnen sanft vor sich hin plätscherte. Die Hofseite des Grundstücks erlaubte den Schildesheims einen Blick auf zahlreiche kleinere Werkstätten und Scheunen, die sich eng wie ein Gürtel um die Buchhandlung anschlossen. Ihre Front war voll von Weinranken, unter deren grünen Blättern das saftige Obst drall und schwarz dem Sonnenlicht entgegen blinzelte. In wenigen Wochen kann Oppenheimer eine reiche Ernte einbringen, dachte Schildesheim ein wenig neidisch. Die Kurpfalz galt bis in seine Heimat als vortreffliches Weinbaugebiet, und auch wenn der Stoffhändler sich nicht allzu viel aus alkoholischen Getränken machte, liebte er es, seinen Gästen an Pessach oder Yom Kippur einen köstlichen Tropfen vorsetzen zu können …
»Ein schönes Haus, nicht wahr, Joseph?« bemerkte Johanne anerkennend, nachdem ihr der schweigsame Postillion mit mürrischer Miene aus der Kutsche geholfen hatte. Aber ihr Mann fand keine Zeit zu antworten.
Die Haustür wurde aufgestoßen, und ein junger Mann im schwarzen Gehrock, das obligatorische runde Käppchen auf den dunklen Locken, lief eilig die Treppen hinunter, um die Ankömmlinge zu begrüßen.
In gemessenem Abstand folgten ihm ein ältlicher, hagerer Mann in einem dunkelblauen Rock mit weißem Seidenschal, eine rundliche, viel jünger wirkende Frau, die eine übertrieben aufgetürmte Perücke trug, und endlich ein unscheinbares kleines Mädchen, dem die Neugierde auf die fremden Besucher von den großen, runden Augen abzulesen war.
Elias Schildesheim selbst erschien größer und erwachsener, als Nanetta ihn in Erinnerung hatte. Sein etwas zu kurz geratener Oberkörper über den langen, schlanken Beinen war muskulös geworden. In seine Stirn gruben sich jedoch zahlreiche feine Linien, die um so deutlicher zutage traten, wenn er das Gesicht zu einem Lächeln verzog. Er wirkte müde und erschöpft. Dennoch begrüßte er seine Familie so herzlich, daß die Mutter, der sein augenscheinlich schlechter Gesundheitszustand nicht entgangen war, sich sofort ablenken ließ.
»Ich freue mich, daß ihr endlich hier seid,« sagte der dunkelhaarige Student ein wenig hölzern. Dann umarmte er zaghaft, beinahe ein wenig scheu seine jüngere Schwester.
Nanetta zögerte. Elias’ Stimme war um einige Nuancen dunkler geworden und ähnelte, besonders in der Art und Weise, wie er bestimmte Wörter betonte, in auffallender Weise der seines Vaters. Einen Bart wie Joseph Schildesheim trug er allerdings nicht. Wie die meisten Studenten Heidelbergs zog er es vor, sich nach der neuesten Mode das Gesicht glatt zu rasieren.
»Liebe Eltern, Nanetta, ich möchte euch die Oppenheimers vorstellen,« besann sich Elias auf seine guten Manieren. »Sie waren sehr gut zu mir in den … nun, in den vergangenen Monaten.«
Verlegen lächelnd folgten Joseph und Johanne ihrem Sohn die schmalen Stufen zum Wohnhaus hinauf. Vor der Tür stand die Familie Oppenheimer, noch immer unbeweglich wie ein Fels in der Brandung und auf eine eigentümliche Weise distanziert.
»Willkommen in Heidelberg, mein Freund«, begrüßte endlich der Hausherr seine Gäste, »wir haben Sie schon vor Stunden erwartet.« In der näselnden Stimme des hageren Mannes schwang ein leiser Tadel mit. Obwohl Oppenheimer deutsch sprach, glaubte Joseph, einen fremden Akzent wahrzunehmen. Frau Oppenheimer schwieg weiterhin beharrlich. Erst als sich Joseph stockend für die Verspätung wegen der schlechten Straßen und lahmen Gäule entschuldigt hatte, gab das Ehepaar schließlich den Weg in einen breiten Hausflur frei.
»Es war nicht unsere Absicht, in den Schabbes hineinzureisen, Meister Oppenheimer,« sagte Johanne, die der langatmigen Erklärungen ihres Mannes müde geworden war. Verwundert schaute sie Joseph an. Sein Blick ruhte auf den staubigen Schuhspitzen, seine Stimme war leiser und unterwürfiger als sonst.
Nanetta erkannte indes des Vaters »Handelsstimme«. Wann immer eine Person höheren Standes, eine Dame von Adel oder der Bürgermeister persönlich die Tuchhandlung Schildesheim betrat, änderten sich nicht nur Josephs Gesichtsausdruck und sein Tempo beim Abmessen der gewünschten Stoffe; auch seine Ausdrucksweise und der Tonfall, in dem er seine Kundschaft bediente, paßten sich ihrer jeweiligen Bedeutung für sein Geschäft an.
Sie staunte allerdings, daß ihr Vater dem Hauswirt seines Sohnes soviel Ergebenheit zollte. Seit Jahren saß er nun schon im Herforder Synagogenrat, und mit keinem seiner Glaubensgenossen hatte der Alte jemals anders geredet als in jenem typischen, jiddischen Dialekt, den die Israeliten in Preußen als kostbarstes Erbe ihrer alten Kultur ansahen und kompromißlos pflegten.
Auch Nanetta war mit Jiddisch aufgewachsen, aber ihr Verhältnis zu der Sprache ihrer Eltern hatte sich im Laufe der Jahre und mit ihrer zunehmenden Liebe für die deutsche Poesie deutlich gewandelt.
Elias’ einzige kindliche Opposition gegen den gestrengen Vater war sein heimliches Bestreben gewesen, seiner aufmüpfigen kleinen Schwester den korrekten Umgang mit der deutschen Sprache in Wort und Schrift zu lehren, ohne zu ahnen, daß er mit seinen zunächst harmlosen Schulstunden in dem wissensdurstigen Kind ein Feuer entfacht hatte, das ihm selbst weitgehend fremd war. Als einziger Jude in Herford hatte er gegen Josephs stummen Widerstand hin das Gymnasium in der Brüderstraße besucht und sogar Latein- und Griechischstudien betrieben, aber sein Verständnis für die Heldentaten eines Odysseus oder die Metamorphosen eines Ovid blieb immer begrenzt und oberflächlicher Natur.
Nanetta hingegen, die als Frau und Jüdin nicht einmal bis zur Aula der geheimnisumwitterten Lateinschule vorgedrungen war, hatte den Bruder seit jenem verhängnisvollen Tag, da ihm unbedachterweise das erste Wort Latein entwichen war, so lange gequält, bis er dem neugierigen Kind schließlich versprochen hatte, es jeden Tag nach dem Unterricht in einem Kornfeld vor der Stadt zu treffen und die Lektionen vom Vormittag noch einmal vor ihm lebendig werden zu lassen.
Zu jener Zeit hatte sich Nanettas tiefe Leidenschaft für Bücher längst herausgebildet. Gierig verschlang sie seitdem alles, was ihr an Literatur unter die Augen kam; heimlich, stets in der Furcht, der Vater könnte sie überraschen und ihr mit seiner hölzernen Elle, die im Laden stets auf der Registrierkasse lag, jenen »nutzlosen Müßiggang« austreiben, der jüdische Mädchen nur frech und faul werden ließ.
Nachts, wenn sich die Eltern in ihre Stube zurückgezogen hatten, begann Nanetta schließlich, bei trübem Kerzenlicht Dramen zu lesen, Geschichten zu schreiben und poetische Formeln für ihre umfangreiche Korrespondenz zu suchen.
In ihren kleinen Erzählungen und Gedichten spielte Nanetta selbst oft eine tragende Rolle. Aber in jener fremden Welt, die sie beschrieb, war sie nicht Tochter eines Stoffhändlers aus der preußischen Provinz. Sie war auch nicht die Schwester des angehenden Arztes Elias.
Unter ihren zunächst ungelenken Federstrichen erwachten Könige und Fürsten zum Leben, Mädchen, die unerhörterweise Schulen besuchten und ohne Begleitung fremde Länder bereisten. Frauen, die nicht verehrt und umschwärmt wurden, weil sie hübschen Porzellanpuppen glichen, die sich gepflegt im Hintergrund hielten, sondern ihres sprühenden Geistes wegen. Meistens endeten Nanettas literarische Träume im Hafen einer bürgerlichen Ehe. Ihr Stil mochte außergewöhnlich sein, als Aufrührerin gegen bestehende Ordnungen begriff sie sich deshalb noch lange nicht. Von Erziehung und Bildung konnte Nanetta wohl träumen, aber der Anspruch, daß eine Frau und Jüdin zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Deutschland ihre Erfüllung im Broterwerb suchen sollte, empfand sie, nicht anders als ihre Mutter und die meisten weiblichen Verwandten in Preußen, als unrealistisch und fremd. Doch wenn dem wirklich so war, warum suchten Nanetta dann immer öfter seltsame Ahnungen heim, Visionen, die sich in Ängsten vor der Zukunft niederschlugen, in denen sie sich als große Dichterin sah und die sie nicht zu erklären, noch zu kontrollieren wußte?
Die kühle und schattige Wohnstube der Oppenheimers hielt, was das Äußere des Hauses versprach. Kostbare persische Teppiche in leuchtenden Farben bedeckten die blank gescheuerten Dielenbretter. Eine silberne Schabbeslampe, nach italienischem Vorbild reich verziert, beleuchtete bereits eine mit weißen Tüchern festlich gedeckte Tafel, an der die Schildesheims ihre Plätze einnahmen.
Mehrere junge Mägde eilten dienstbeflissen zwischen Küche und Wohnstube hin und her, schleppten flache, silberne Waschbecken mit warmem Wasser und sauberen Servietten herbei und zündeten nacheinander alle auf den Schränken und Tischen stehenden Kerzen an, bis es im Raum keine einzige finstere Stelle mehr gab. Ein einladender Duft nach Hühnersuppe, frischem Brot und allen möglichen Gewürzen schwang durch die Luft.
Joseph wandte sich verwundert um. Vermutlich waren die am Sabbatabend so emsig arbeitenden Hausmägde Christinnen. In reichen jüdischen Häusern kam es nicht selten vor, daß man sich christliches Hauspersonal hielt, das an Freitagabenden Feuer machte oder Wasser aus dem Brunnen schöpfte.
Auch die treue Dienstmagd, die seit vielen Jahren im Hause der Schildesheims diente, war christlichen Glaubens und störte Joseph in keinster Weise, da sie nie über ihre Religion sprach und darüber hinaus nur höchst selten die alte Kirche neben der Wolderuskapelle am Münsterplatz besuchte.
Elias kam spät zu Tisch. Er war bleich, und erst im Licht der vielen Lampen und Kerzen bemerkte Nanetta, wie tief seine Augen in ihren Höhlen lagen. Allem Anschein nach hatte es auf dem Korridor einen lautstarken Disput zwischen ihm und Frau Oppenheimer gegeben, aber weder Joseph noch seine Frau hatten es gewagt, in dem fremden Haus hinauszutreten und sich einzumischen. Johanne musterte ihren Sohn fragend, aber sie schwieg und widmete sich statt dessen dem feinen Silberbesteck, das vor ihr auf dem Tisch ausgebreitet wurde.
Nanetta spürte, daß mit Elias und diesem seltsamen Haus irgendwas nicht stimmte. Warum sprach er kein einziges Wort mit ihr, und warum wich er ihren Blicken aus? Statt dessen starrte er mit düsterer Miene auf die silbernen Becher, die der Hausherr mit Rotwein füllte.
»Baruch atoh Adonaj, elohenu melech haolam, hamozi lechem min’haarez«, sang Oppenheimer mit melodischer Stimme. »Gesegnet seiest du, Herr unser Gott, König der Welt, der du das Brot aus der Erde wachsen läßt.« Die hebräischen Worte des Segens über die beiden Berches klangen Nanetta wohltuend und vertraut. Träumerisch folgte sie Oppenheimers Worten:
»Gepriesen seiest du, Herr unser Gott, König der Welt, der du uns die Frucht des Weinstocks geschenkt hast.«
Nanetta behielt das Stückchen Zopfbrot, das Mirjam Oppenheimer ihr zwinkernd zugeschoben hatte, ein wenig länger im Mund als gewöhnlich, um die feierliche Atmosphäre der Zeremonie voll auszukosten. Wenn sie nun die Augen schloß, glaubte sie beinahe zu Hause in Herford zu sein. Sie saß auf ihrem geschnitzten Stuhl, der Mutter gegenüber. Der bequeme Stuhl war mit dem Kissen gepolstert, dessen Bezug das Mädchen einst selbst gestickt hatte. Die westfälischen Nächte waren kühl, offensichtlich kühler als die in Heidelberg. Noch immer glühte Nanetta wie im Fieber. Sie stellte sich vor, wie die alte Magd die schmale Stiege hinaufstolperte, in den Händen das Tablett mit den weißen Tellern, den Tassen und …
»Nanetta, hör auf zu träumen und mach gefälligst deine Augen wieder auf! Es gehört sich nicht, in Gegenwart seiner Gastgeber einzuschlafen!« Joseph Schildesheim rollte ungnädig mit den Augen. Längst hatte er gemerkt, daß der Buchhändler und seine Frau ihn ein wenig belächelten. Seine Tochter sollte ihnen keinen Grund für ihren leisen Spott geben. Wer waren die beiden Oppenheimers überhaupt? Untertanen eines Großherzogs, an dessen Thron noch immer der Makel haftete, von Napoleons Gnaden aufgerichtet worden zu sein. Aber Oppenheimer war nicht rechtlos und verkehrte offensichtlich sogar mit den Professoren der Universität.
Joseph hingegen war Bürger eines Staates, dessen König den Juden seit sieben Jahren zwar auf dem Papier bürgerliche Rechte gewährte, sie aber de facto noch immer von der Gleichberechtigung ausschloß. War nicht selbst der offen verehrte Philosoph Moses Mendelssohn, den die Preußen beinahe liebevoll Herr Moses aus Berlin nannten und dessen Schriften Oppenheimer in seinem Laden verkaufte, noch zu Lebzeiten gezwungen worden, bei der Einreise in die preußische Hauptstadt Zoll für seine eigene Person zu zahlen wie die Bauern für Ochsen und Esel? Und als die Preußische Akademie der Wissenschaften ihn als Ehrenmitglied in ihren Kreis aufnehmen wollte, da verweigerte der König höchstpersönlich seine Einwilligung.
Schildesheim wußte, daß es auch unter den Juden der verschiedenen Kleinstaaten Deutschlands Unterschiede gab, doch war er selten in eigener Person mit diesen Unterschieden konfrontiert worden. Grimmig griff er nach dem langstieligen Glas und spülte das gesottene Huhn mit einigen Tropfen badischen Weines hinunter
»Entschuldigt mich bitte«, unterbrach Elias das Schweigen. »Da ich euch morgen nach der Synagoge gerne Heidelberg zeigen möchte, empfiehlt es sich jetzt vielleicht, den Abend zu beschließen. Ihr müßt nach der langen Reise todmüde sein!«
Nanetta und ihre Mutter, die den Staub der Landstraßen noch immer auf der Haut spürten, erhoben sich sogleich, verabschiedeten sich mit artigen Worten von den Oppenheimers, die am Sabbattisch zurückblieben, und folgten Elias und dem Vater. Oppenheimer klingelte mit seiner Tischglocke. Unverzüglich erschien eine alte Magd mit einer dünnen Kerze in der Hand, um den Gästen ihre Zimmer zuzuweisen. Erleichtert schlossen sich die Schildesheims dem schwachen Schein der flackernden Kerzenflamme an.
Als Nanetta auf das hallende Treppenhaus zurückblickte, bemerkte sie, wie eine andere Magd, ein ziemlich junges Ding mit übergroßer weißer Haube, die kleine Susanna Oppenheimer auf dem Arm in ein Zimmer gleich am Fuße der Treppe trug. Die Tür zu diesem Raum war scharlachrot angestrichen. Erst jetzt fiel ihr auf, daß jede Tür im Hause des Buchhändlers eine eigene Farbe aufwies. Die Palette reichte vom gediegenen Eichenbraun der Wohnstube bis hin zu einem satten Grün der Gesindestube und einem kräftigen Himmelblau an den Schlafzimmertüren.
»Wir sollten unsere Türen zu Hause auch anmalen lassen«, flüsterte Nanetta dem Vater zu. Er hatte der Magd die schwankende Kerze aus der Hand genommen, um seiner Familie einen Sturz auf der steilen Treppe zu ersparen.
»Komm hier bloß nicht auf dumme Gedanken. Es dauerte Wochen, bis die rosa Farbe auf meiner Hauswand nicht mehr durchleuchtete!« Die Hausmagd führte sie durch einen finsteren Korridor, öffnete dann eine Tür und schob sich vor den Schildesheims in die dahinterliegende Kammer.
»Hier wirst du schlafen, Tochter.« Joseph leuchtete mit der Kerze in eine kleine Stube, deren Tür überhaupt keine Farbe mehr hatte. Nanetta zog sich den langen Seidenschal vom Hals, dessen Enden beinahe den Boden berührten, und sah sich in dem Zimmer um. Im Gegensatz zu den prächtigen Räumen im Erdgeschoß war diese Kammer spartanisch eingerichtet. Das Mobiliar war ein bißchen schäbig, von der Tagesdecke auf dem Kastenbett bis zu dem einfachen Eichenschrank, neben dem auf einer Konsole ein weißer Wasserkrug mit deutlich sichtbaren Sprüngen im Porzellan stand. Der Teppich über den knarrenden Dielen war abgenutzt, und das ganze Zimmer roch dumpf und feucht, als wäre es lange nicht mehr benutzt worden. Aber immerhin hatte das Zimmer ein Dachfenster, durch das die Sterne hereinfunkelten. Nanetta lief sofort darauf zu und öffnete es. Gierig atmete sie die kühle Abendluft ein und versuchte, mit zusammengekniffenen Augen die Silhouetten der Häuser zu identifizieren. Schräg über dem Buchladen erhob sich ein breiter, von rauschenden Laubbäumen umsäumter Weg, der hoch über den windschiefen Dächern der Nachbarschaft zu einer gewaltigen Ruine hinaufführte.
»Elias, was ist das? Das Heidelberger Schloß mit dem Ottheinrichsbau im Westen? Es ist ja nur noch eine Ruine! Und die vielen Lichter, die aus den Fenstern der Häuser scheinen. Sie spiegeln sich im Wasser. Sind wir denn so nahe am Neckarufer? Man glaubt sich beinahe in eine Märchenwelt versetzt!«
»Das Schloß wurde Anno 1689 von den Franzosen unter Melac eingeäschert,« antwortete Elias mit nüchterner Stimme. »Damals wütete hier der Pfälzische Erbfolgekrieg. Ich habe dir doch von Melac geschrieben. Erinnerst du dich nicht?«
Nanetta erinnerte sich nur dunkel. Und dabei hatte sie stets jede seiner Lektionen peinlich genau notiert. Schuldbewußt schaute sie ihrem Bruder in die Augen. Die Miene des jungen Mannes verfinsterte sich plötzlich.
»Ihr hättet Herford nicht verlassen dürfen«, sagte er. »Warum mußtet ihr ausgerechnet jetzt reisen, jetzt wo …« Elias schwieg verlegen. Dann schüttelte er den Kopf, warf einen kurzen, gehetzt wirkenden Blick aus dem Fenster in Richtung der alten Schloßruine und verließ, ohne sich von seiner Mutter aufhalten zu lassen, Nanettas Kammer.
»Ihr Sohn ist ein guter Junge, Frau Schildesheim«, drang plötzlich aus dem Dunkel des Korridors die schleppende Stimme Mirjam Oppenheimers an ihr Ohr. »Er gibt nur zuviel auf das Marktgeschwätz des Pöbels. Aber glauben Sie mir, Madame, Elias hat unrecht. Nichts wird Ihnen hier in Heidelberg geschehen. Mein Mann hat gesagt, daß Großherzog Ludwig bald einige seiner Truppen in die Stadt verlegen will. Warum sollten wir uns also Sorgen machen?«
3. Kapitel
Das Lachen und Singen der Studenten war bis auf die Straße zu hören. Eine Wolke aus Tabaksqualm und Bierdunst schlug Friedrich Conrad entgegen, als er das Wirtshaus Zum Goldenen Hecht in der Altstuhlgasse betrat. Der penetrante Geruch von gerösteten Zwiebeln und altem Fett nahm ihm beinahe den Atem. Schon nach kurzer Zeit brannten seine Augen, als hätte er zu lange in ein Pfefferglas geschielt.
Obgleich der große, von vier tragenden Holzbalken gestützte Schankraum vom Licht zahlreicher Kerzen erleuchtet wurde, fiel es Friedrich schwer, in dem Getümmel nicht den Überblick zu verlieren. Dabei gab es kaum ein Mitglied der Heidelberger Studentenschaft, das den Goldenen Hecht und seine Mädchen besser kannte als Friedrich Conrad. Er liebte das Treiben in der Menge, die kreisenden Humpen und die fleischigen Schenkel der Schankmägde, die manchmal unter dem Geheul der Studenten auf die Tische stiegen, ihre weiten Röcke hoben und mit unglaublicher Wendigkeit Münzen in der Schürze auffingen. Bei diesem Schauspiel zeigten die jungen Dinger ihre Beine in einer Weise, die jedem ehrbaren Bürger die Schamesröte ins Gesicht getrieben hätte. Nicht allein dieses frivolen Treibens, sondern auch der niedrigen Bier- und Weinpreise wegen erfreute sich der Goldene Hecht unter den Burschen der Neckarstadt größter Beliebtheit. Aber auch die Obrigkeit hatte während der letzten Monate verstärkt ihr Augenmerk auf die skurrilen Gäste des Wirtshauses gerichtet, ein Umstand, der sich hin und wieder in einer Razzia der Stadtmiliz entlud.
Eine dicke, blonde Magd, die Schürze voller Rotweinflecken, erkämpfte sich resolut einen Weg durch die lärmende Menge, wobei sie mit ihren ausladenden Hüften bei jedem Schritt kleine Stöße austeilte. Auf dem rechten Handteller balancierte sie ein Tablett mit Bierkrügen, deren Inhalt bei jedem ihrer Schritte überschwappte. Übermütig rempelte Friedrich die Magd mit dem Ellenbogen an und lachte schallend, als ihr das Tablett aus der Hand rutschte und sie selbst kreischend in einer Gruppe von Zimmergesellen landete, die das plumpe Mädchen mit wildem Gejohle auffingen.
»Friedrich Conrad ist wieder im Lande!« rief die Magd mit schriller Stimme. »Du verdammter Hurenbock, dir werde ich helfen, eine Dame zu stoßen!« Mit einem ärgerlichen Schnauben versuchte sie, sich der Hände zu erwehren, die sich an ihrem fleckigen Mieder zu schaffen machten. »Ihr sollt mich loslassen, geiles Pack! Alles, was ihr von mir bekommt, ist euer Bier und eine Ladung Dresche. Ich lasse mich nicht von jedem auf den Hintern tätscheln!«
»Aber von dem Friedrich würdest du es dir wohl gefallen lassen, nicht wahr?« rief lauthals ein Lehrling, dem seine Zunftgenossen erst wenige Tage zuvor den goldenen Ring als Zeichen seines Handwerks durchs Ohr gezogen hatten.
»Laßt es gut sein, Freunde«, versuchte Friedrich die jungen Männer zu beruhigen. »Emilie, ich entschuldige mich für den kleinen Stoß! Du bist ein süßes Ding und meine liebste Bierlieferantin!«
»Die vier Biere setze ich auf deine Rechnung, Freund Conrad! Und diese Rechnung wird dein Mütchen empfindlicher kühlen als jede Ohrfeige, das verspreche ich dir!« Mit diesen Worten plagte sich die dicke Magd auf, warf den noch immer grinsenden Handwerksgesellen einen triumphierenden Blick zu und wankte in die Küche.
Im Nebenraum wurde Friedrich stürmisch begrüßt. Wie auf Kommando wurden die Hände mitsamt den Bierkrügen in die Höhe gerissen, um den Kommilitonen willkommen zu heißen.
Friedrich Hieronymus Conrad, einziger Sohn eines Schneidermeisters aus Rastatt, war bei fast allen Heidelberger Studenten äußerst beliebt. Jeder der Burschen wußte, daß Friedrich von der Hand in den Mund lebte. Sein alter brauner Gehrock, eine ehedem saubere Arbeit des Vaters, zeigte bereits seit längerem deutliche Spuren der Abnutzung. Das weiße Hemd war an mehreren Stellen gestopft. Aber am jämmerlichsten sahen die Schuhe des Studenten aus. Sie hatten mehr Löcher als ein Reibeisen.
Trotzdem verbat sich der stolze junge Mann energisch jegliche Einmischung von seiten seiner Kommilitonen. Auch wenn es Abende gab, an denen er in seinem kleinen Dachstübchen in der Ludwigstraße ohne Brot vor den Lehrbüchern saß, wußte er, daß die Zeit des Darbens eines Tages zu Ende sein würde. Friedrichs Traum, als Doktor beider Rechte in die Heimatstadt zurückzukehren und genug Geld zu verdienen, um seinen Vater zu unterstützen, hielt ihn aufrecht. Er zählte nicht die Tage seines jammervollen Studentendaseins, auch nicht die Demütigungen, die er aufgrund seiner Armut zuweilen hinzunehmen hatte, sondern genoß die geistvollen Gespräche mit den Größen der Wissenschaft, die Heidelberg regelmäßig aufsuchten.
Diese Abenteuer waren wie ein Rausch. Sie kitzelten seine Sinne, ließen ihn aber allzu oft unbefriedigt und in einem Zustand der Hoffnungslosigkeit zurück.
Die beiden Studenten, die Friedrich gegenübersaßen, der eine blond gelockt, der andere rothaarig und mit kantigem Gesicht, legten ihre Spielkarten aus der Hand und betrachteten ihren Kommilitonen erwartungsvoll.
»Du kommst geradewegs aus Mannheim, nicht wahr? Bringst du uns Neuigkeiten über den Prozeß?« fragte Johannes Zeisdorf. Der groß gewachsene Wortführer der Studenten beobachtete Friedrich mit wachsender Ungeduld.
Der Prozeß! Das Wort hallte durch den engen Nebenraum der Wirtsstube wie ein Musketenschuß. Unheilvoll dröhnte es in den Ohren all derer, die eben noch bei Bier und Wein ausgelassen Karten gespielt hatten. Reger, ein kleiner Bursche aus dem zweiten Semester, sprang auf einen Blick Zeisdorfs hin auf und ließ die schwere Tür zum Schankraum ins Schloß fallen. Heimliche Beobachter war nun vollkommen unerwünscht.
Seit Monaten schon war der Mannheimer Mordprozeß das vorherrschende Thema unter den Studenten am Neckar. Einige debattierten nur hinter vorgehaltener Hand darüber. Andere wie Johannes Zeisdorf, dessen Degen weitaus öfter zum Einsatz kam als die Ledertasche, in der er seine Lehrbücher der Altphilologie mit sich trug, ließen es sich nicht nehmen, Moritatenlieder und Gedichte über jene unglaubliche Tat zu schreiben, die sich in den späten Märztagen im nahen Mannheim zugetragen hatte.
Es wurde gar gemunkelt, Zeisdorf und sein Flügel der Burschenschaft hielten geheime nächtliche Zusammenkünfte in der Schloßruine ab, bei deren Ritualen sich jeder sittsame Heidelberger Bürger schaudernd auf die andere Seite drehen würde.
Der Grund aller Unruhe war mittlerweile jedermann bekannt. Am 23. März war der Jenaer Student Carl Ludwig Sand in das Mannheimer Stadthaus des Schauspieldichters August von Kotzebue eingedrungen; er hatte einen Dolch aus dem Rock gezogen und den in russischen Diensten stehenden Dichter niedergestochen. Danach, als er erkannte, daß eine Flucht unmöglich war, hatte er sich das Messer eigenhändig in die Brust gerammt. Der Skandal um den verruchten Mordanschlag zog weite Kreise; die Heidelberger Studenten wußten, daß Sands Tat nicht ohne Folgen bleiben würde.
»Verhöre über Verhöre«, antwortete Friedrich. »Keine Möglichkeit an Sand oder an andere direkt Beteiligte heranzukommen. Die Juwelen des Zaren von Rußland werden mit Sicherheit weniger streng bewacht als Carl Ludwig Sand. Einen Advokaten habe ich gestern gesprochen. Er rechnet sich keine großen Hoffnungen für den Damnifikanten aus. Obwohl er nicht bei den Verhandlungen zugegen sein darf, machten seine Ausführungen auf mich einen vernünftigen Eindruck!«
»Vernunft, Vernunft! Wenn ich dieses Franzosenwort schon höre«, knurrte Zeisdorf und schleuderte grimmig seinen Tabaksbeutel auf die schmutzige Tischplatte. Die kleine Narbe links unter seinem Auge schien vor Aufregung rot zu glühen. »Sand ging es um den reinen Geist der Freiheit, ein Gefühl, das jedem Deutschen hoch in der Brust schlagen muß, solange man sich nicht anschickt, es durch sture Räson zu töten. Aus dieser erwachsen doch die Übel, die jetzt über uns gekommen sind: Kriecherei, Gier und Gewinnsucht. Carl Ludwig Sand hat das verstanden. Er entlarvte den Kotzebue als Agitator unmoralischer, unpatriotischer Gesinnung.«
Einige der jungen Männer klopften beifällig auf das blanke Holz des Tisches, als befänden sie sich in einer Vorlesung. Andere jedoch schauten sich erschrocken um, ob nicht ein unwillkommener Lauscher hinter der Tür oder unter dem Fenster stand. In diesen Spätsommertagen lauerten die Polizeispitzel überall. Erst letzte Woche hatte der Dekan drei seiner begabtesten Studenten der Obrigkeit zu Verhören ausliefern müssen, weil sie es gewagt hatten, Kotzebue im Weinrausch einen »Russenknecht« zu nennen.
Auch Friedrich wurde es zunehmend heißer unter dem steifen Kragen. Er kannte Zeisdorfs Ausbrüche, wenn es um den Fall Sand ging. »Eines hat der Sand auf jeden Fall nicht bedacht. Er hat vergessen, daß ein Christenmensch vor Bluttaten zurückschreckt, daß es nicht angebracht ist, sich als angehender Geistlicher in die Staatspolitik zu mischen und einem Menschen den Dolch ins Gekröse zu stoßen!«
»Verdammt, was willst du damit andeuten?« brüllte Zeisdorf und griff nach dem Degen an seiner Seite. »Daß Kotzebue kein Verräter war, sondern Sand, ein Mann, den ich persönlich in Eisenach gesprochen habe und der Deutschland befreien wollte?«
»Befreien?« rief Friedrich und sprang auf. »Vor drei Jahren in Jena erschien er mir eher wie ein Sprücheklopfer!«