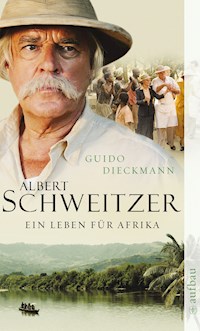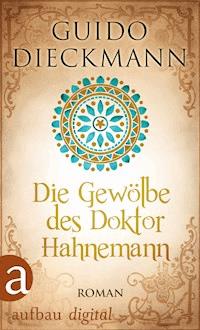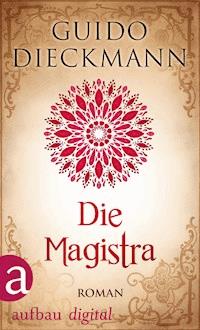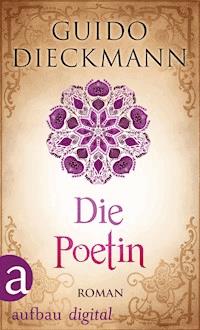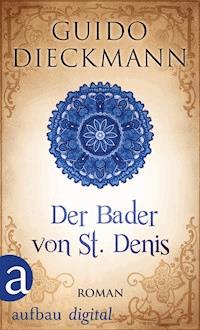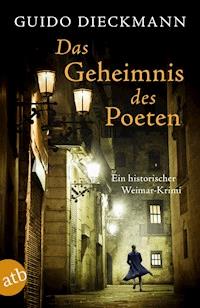7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Würzburg, im 15. Jahrhundert: Eine Intrige verurteilt die Bürgerstochter Regina zu einem Leben als Ausgestoßene. Sie ist dem Tode nahe, als das Gauklerpaar Buntrock sie unter die Fittiche nimmt. Mit ihrer Hilfe entwickelt sich die einstige Klosterschülerin zur Königin der Gaukler, die sich auch auf das Deuten verbotener Runenschriftzeichen versteht. Dies bleibt auch dem Fürstbischof nicht verborgen. Er sendet die junge Frau auf geheime Mission ins Taubertal, wo Meister Tilman Riemenschneider an einem prachtvollen Altar arbeitet. Eine Reihe unheimlicher Vorkommnisse bedroht das Werk des begnadeten Künstlers. Wer hat ein Interesse daran, den Kult um den furchteinflößenden Germanengott Wotan wiederzubeleben, dessen steinernes Abbild an der Creglinger Herrgottskirche angeblich Tränen vergießt? Und wer schreckt nicht einmal vor Mord und Grabschändung in der kleinen Stadt zurück? Bald ist auch Reginas Leben in Gefahr.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 608
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Guido Dieckmann
Die Königin der Gaukler
Historischer Roman
Rowohlt Digitalbuch
Inhaltsübersicht
Prolog
Niklashausen im Hochstift Würzburg, Sommer 1476
Die junge Bürgersfrau zweifelte nicht daran, dass seine Absichten ehrenwert waren. Gebannt lauschte sie seinen Worten, obwohl jedem Folter und Tod drohte, der ihn als Propheten und heiligen Mann verehrte. Doch genau das war er für sie.
Was ist schon der Tod, hatte sie ihn einmal sagen hören. Nichts anderes als der Übergang zu einem Leben in Herrlichkeit. Im Jenseits treffen sich die Liebenden wieder, dort sind sie für immer vereint, und kein Bischof oder Grundherr kann sie trennen.
Es gefiel ihr, wenn er so sprach und ihr dabei mit einem Blick aus seinen tiefblauen Augen zu verstehen gab, dass er ihre geheimsten Gedanken erriet. Auch schmeichelte ihr die Art, in der sie umworben wurde. Dabei hatte er sie nie aufgefordert, seinetwillen ihre Familie und das Leben als Gemahlin eines der einflussreichsten Würzburger Patrizier hinter sich zu lassen. Dass sie es dennoch getan hatte, war in den Augen des Klerus Ketzerei, etwas, wofür sie den Scheiterhaufen und ewige Verdammnis verdiente. Doch daran mochte sie im Augenblick nicht denken.
Große Dinge ereigneten sich in dem unbedeutenden Marktflecken, und die junge Bürgersfrau war glücklich, Zeugin der Geschehnisse zu sein, statt in Würzburg hinter einem Webrahmen zu sitzen oder Heinrichs ständigen Klagen zuzuhören. Sie gab dem heiligen Jüngling ein Stück ihrer Seele und unterstützte ihn, so, wie die meisten Wallfahrer ihre bescheidenen Zelte in Niklashausen aufgeschlagen hatten, um ihn, den sonderbaren Propheten, predigen zu hören. Vierzigtausend waren es seit Beginn des Sommers, und täglich wurden es mehr. Eine wahre Armee.
An diesem Abend hatte sich die Menge früher als sonst zerstreut. Die meisten Pilger waren erschöpft; die Bußübungen und Gebete strengten bei dieser Hitze an. Diejenigen, die es sich leisten konnten, kehrten in den Wirtshäusern der Umgebung ein, doch die meisten Pilger waren arm. Als die Bürgersfrau über den Anger schritt, hörte sie aufgeregtes Gemurmel. Überall wurde über die letzten Prophezeiungen des Jünglings diskutiert, der nicht für die Reichen sprach, sondern für Menschen, die so arm waren wie er selbst und an den Missständen zu zerbrechen drohten, die im Reich herrschten. Die Kirche mit ihren ungebildeten Priestern, weltabgewandten Mönchen und überheblichen Gelehrten war ihnen längst kein Trost mehr, und der Kaiser, der bisweilen versprach, die alte Ordnung im Reich wiederherzustellen, war weit weg.
Woher der Jüngling kam und was für ein Mensch er war, wusste niemand. Einige behaupteten, er sei ein heimatloser Viehhirte, der gelegentlich auf Jahrmärkten und Bauernhochzeiten die Pauke schlug oder mit seiner Fiedel zum Tanz aufspielte. Ein Gaukler, der zum fahrenden Volk gehörte und um den man besser einen Bogen machte. Doch wie wollten diese Lästermäuler erklären, dass er es geschafft hatte, Hunderte, ja Tausende von Anhängern nach Niklashausen zu locken? Längst war die Wallfahrt zu einer Massenbewegung geworden, die den Bischöfen von Mainz und Würzburg den Schlaf raubte. Zunächst hatte der Jüngling noch wie ein einfacher Wanderprediger von einem umgestürzten Waschzuber zur Menge gesprochen, aber inzwischen gab es einfach zu viele, die ihn bedrängten, ihnen die Zukunft zu offenbaren. Die Bürgersfrau, die zu ihrem Schutz eine Mönchskutte trug, wenn sie sich mit ihm gemeinsam zeigte, hatte vorgeschlagen, dass er sich von der Menge zurückzog und nur noch ins Freie trat, um das Feuer vor der Marienkapelle neu zu entfachen. Seine Predigten hielt er nun vom Dachfenster eines Bauernhauses aus, dessen Bewohner beinahe vor Stolz darüber platzten, dass sie einen heiligen Mann beherbergen durften.
Zwei Stunden verbrachte die Bürgersfrau im Lager der Pilger, dann suchte sie ihr Quartier auf, wo sie endlich die verschwitzte Kutte abstreifen und ihr Gesicht mit ein paar Spritzern Wasser erfrischen konnte. In dem Dachstübchen war es stickig und heiß; ein unangenehmer Geruch von altem Stroh und saurer Milch ließ sie husten, dennoch war sie erleichtert, dass ihr Geheimnis auch heute unentdeckt geblieben war. Ein vorsichtiger Blick hinter die schäbigen Bettvorhänge überzeugte sie, dass die beiden Krämerinnen, mit denen sie die Kammer teilte, schliefen.
Verstohlen knüllte sie den rauen, kratzenden Stoff zusammen und stopfte ihn in das Bündel mit ihren Habseligkeiten. Dann setzte sie sich ans Fenster und starrte auf die Überreste der Feuerstelle, die jenseits des Kirchplatzes errichtet worden war. Wie an jedem Abend hatten die Pilger Holz und Opfergaben verbrannt. Auch einige Würzburger hatten sich daran beteiligt, die sie in ihrer Verkleidung nicht erkannt hatten. Sie fragte sich, ob es sich um Spitzel des Fürstbischofs handelte. Oder ob die Männer in Heinrichs Diensten standen und sie suchten. Die Bürgersfrau atmete tief durch. Ihr Mann war jähzornig; vor ihm musste sie auf der Hut sein. Sie selbst stammte aus einer angeseheneren Familie als er, ein Umstand, der sie für seine ehrgeizigen Ziele brauchbar machte. Als ihr eine Magd von Wundern und prophetischen Zeichen erzählt hatte, die sich angeblich in Niklashausen ereigneten, war das für sie wie eine Nachricht des Himmels gewesen, eine Botschaft, die sich nur an sie richtete.
Sie hatte keine Zeit verloren. Da sie damit rechnen musste, dass Heinrich sie ihres hohen Standes wegen nicht mit dem einfachen Volk nach Niklashausen ziehen lassen würde, war sie ihm davongelaufen. Heinrich konnte sie dafür bestrafen. Nicht einmal der Fürstbischof würde ihm das übelnehmen, aber besitzen würde er sie nicht mehr. Von nun an war sie keine Bürgersfrau mehr.
Bewegungslos verharrte sie vor dem geöffneten Fenster und starrte in die stille Nacht hinaus, bis das zu Asche zerfallene Holz und Reisig des Scheiterhaufens in der Dunkelheit nicht mehr auszumachen waren. Plötzlich empfand die Bürgersfrau die Enge ihrer Kammer als bedrückend. Sie musste noch einmal hinaus, an die Luft.
Auf der Gasse war Stille eingekehrt. Nicht einmal aus dem Wirtshaus drangen noch Stimmen. Als sich die Bürgersfrau dem Zeltlager der Würzburger zuwandte, bemerkte sie, dass es leer war. Die Männer hatten sich mitsamt ihren Decken und Zelten aus dem Staub gemacht.
Ich habe es gewusst, dachte sie, als sie durch die nächste Gasse zum Dorfgatter eilte, der einzigen Befestigung, die Niklashausen vor Räubern und wilden Tieren schützte. Zwei bärtige Männer hielten davor Wache, doch sie wussten angeblich nichts von Pilgern aus Würzburg.
Eine düstere Ahnung trieb die Bürgersfrau über den Steg, der den Anger mit dem Kirchplatz verband. Als sie an einem der Reisewagen vorbeikam, stockte ihr plötzlich der Atem. Hinter der Abdeckung des Gefährts erklang eine bekannte Stimme. Sie gehörte einem Soldaten des Würzburger Schlosshauptmanns Konrad von Hutten, der dem Fürstbischof seit Jahren treuergeben war. Der Mann schien wütend zu sein, denn es gelang ihm kaum, leise zu sprechen. Sie blieb stehen; das Herz klopfte ihr bis zum Hals, als sie ihr Kopftuch tiefer in die Stirn zog. Sie überlegte, ob sie es wagen durfte, näher an den Wagen heranzutreten, als der bischöfliche Soldat wieder das Wort ergriff. «Ich habe das Herumsitzen unter all den Betbrüdern satt», brummte er. Das schleifende Geräusch, das seiner Äußerung folgte, ließ darauf schließen, dass er sein Schwert aus der Scheide gezogen hatte. Die Männer waren demnach bewaffnet.
«Warum schlagen wir nicht sofort zu und erledigen das frömmelnde Ketzerpack? Der Fürstbischof wird uns mit Gold überschütten, wenn wir ihm diese peinliche Angelegenheit vom Halse schaffen.»
«Halt dein Maul, dummer Kerl», wies ihn ein anderer Mann zurecht. «Wir holen uns die Ketzerbrut, wenn ich den Befehl dazu gebe. Hast du das endlich kapiert? Eine Abteilung Bewaffneter wartet eine halbe Meile vom Dorf entfernt. Dieser Betrüger und sein Mönchlein mit dem frechen Schandmaul werden schon bald am Galgen zappeln, darauf hast du mein Wort. Aber wir dürfen hier keinen Aufruhr anzetteln. Nicht, solange wir uns inmitten Tausender von Wallfahrern befinden, die bereit sind, ihren Prediger zu beschützen. Der Fürstbischof wünscht kein Blutbad im Angesicht des Marienbildes.» Er lachte bitter auf. «Der alte Narr glaubt inzwischen selbst, dass es Wunder wirken kann.»
«Oder dass es ihm und seiner Herrschaft ein baldiges Ende bereitet», warf einer der anderen Männer prustend ein.
Die Bürgersfrau hatte genug gehört. Diese Kerle hatten offensichtlich vor, ihren Jüngling dem Fürstbischof auszuliefern. Ihn und den Mönch, dessen wahre Identität sie jedoch nicht zu kennen schienen. Sie durften es nie herausfinden, sonst war sie verloren. Im Schutz der Dunkelheit schlich sie zu dem Bauernhaus, in dem der Jüngling schlief.
Die Frau, die ihr die Tür öffnete, war jung und hübsch. Kupferrote Locken fielen ihr keck in die Stirn. Sie trug ein bodenlanges Nachthemd, das sie mit einer Hand anheben musste, um nicht über den Saum zu stolpern. Ihr gewölbter Bauch verriet, dass sie ein Kind erwartete.
«Was gibt’s denn noch so spät? Ich sag dir gleich, wenn du gekommen bist, um unserem Gast auf die Nerven zu fallen, solltest du besser wieder verschwinden.»
Die Bürgersfrau hob die Augenbrauen. «Ich muss euren Gast sprechen», sagte sie eindringlich. «Es geht um Leben und Tod. Wenn du mich nicht auf der Stelle einlässt, wird möglicherweise bald sein Blut an deinen Fingern kleben.»
Der Jüngling hob den Kopf, als er die Bürgersfrau bemerkte. Überrascht sah er aus. Und verlegen. Er schien verwirrt darüber, dass sie das Ordensgewand abgelegt hatte, mit dem sie ihre weiblichen Körperpartien verhüllte, wenn sie sich mit ihm in der Öffentlichkeit zeigte. Doch schnell überwand er seine Verwunderung. Mit einem scheuen Lächeln zeigte er ihr, was er in der Hand hielt. Es war eine Fiedel aus rötlich schimmerndem Birkenholz. Im Unterschied zu der schwangeren Bäuerin, zu der sich nun auch ihr Ehemann, ein hünenhafter Bursche mit zerzaustem schwarzem Haar, gesellte, war er vollständig bekleidet. Der Jüngling schien wenig Schlaf zu brauchen. Es ging das Gerücht um, er verbringe ganze Nächte im Gebet auf seinen Knien.
«Nun, wenn das nicht mein Engel ist», rief er erfreut. «Verzeihst du mir, dass ich die Pauke verbrannt, aber meine Fiedel behalten habe?» Seine vollen Lippen rundeten sich zu einem reumütigen Lächeln, das ihn noch kindlicher wirken ließ als sonst. Mit diesem Blick war es ihm gelungen, Männer und Frauen, Bauern und Ritter für sich einzunehmen.
«Ich weiß, was du sagen willst, meine Liebe», sagte der Jüngling. Noch immer führten seine schlanken Finger den Bogen über die Saiten. «Meine Wirtsleute haben mich auch schon deswegen gescholten. Es ist wahrhaftig nicht gerade ehrenvoll, den Pilgern draußen zu predigen, sie müssten weltlichem Tand entsagen, während ich selbst nachts auf der Fiedel spiele. Aber wie du siehst, bin auch ich nur ein Mensch. Ohne Musik kann ich nicht leben.»
«Ein Gaukler bist du», warf die schwangere Bäuerin ein. «Ein unverbesserlicher Gaukler und Possenreißer. Verbrenn nur Pauke, Flöte und Fiedel, aber für die Menschen deiner Heimat wirst du immer der Pfeifer von Niklashausen bleiben.»
Bestürzt blickte der Jüngling die Frau an. Dann seufzte er. Langsam ließ er das Instrument sinken. «Ihr habt ja recht, ich sollte nicht mehr darauf spielen. Ich darf mich nicht mehr wie ein Gaukler aufführen. Den Gauklern wird nachgesagt, mit dem Teufel im Bunde zu stehen. Ich aber habe die Jungfrau Maria gesehen, so, wie ich euch jetzt vor mir sehe. Es gibt noch viel zu tun, um das ich mich kümmern muss, bevor die Pilger wieder den Heimweg antreten.» Er sprang auf und schlang beide Arme um seine Wirtsleute. «Ich bin froh, dass ihr mich in eurem Haus aufgenommen habt. Ihr schreckt nicht davor zurück, mir die Ohren langzuziehen, wenn ich Dummheiten mache.» Er lachte fröhlich.
«Dein Name?», wandte sich die Bürgersfrau an den breitschultrigen Mann. Ihr war plötzlich, als risse sie das Gelächter des blonden Knaben, der sich wieder auf die Truhe gesetzt hatte, unsanft aus einem tiefen Schlaf. Ein bitterer Geschmack legte sich auf ihre Zunge, dennoch war sie davon überzeugt, dass sie der Bauersfamilie vertrauen konnte.
«Ich bin Bernt, mir gehört der Hof», antwortete der junge Bauer. «Und das da ist Friederike. Aber wer bist du?»
Die Bürgersfrau unterrichtete ihn und die Bäuerin. Während sie sprach, legten sich die Hände der Frau schützend über ihren Bauch. «Dann ist das alles deine Schuld», stieß Friederike hervor. «Wenn du deinem Mann nicht davongelaufen wärst, würden uns jetzt nicht die bischöflichen Soldaten bedrohen, nicht wahr?» Sie wandte sich fragend an ihren Mann, der jedoch stumm blieb.
«Ich habe nichts Unrechtes getan», rief der Jüngling. Offensichtlich begriff er nicht, was es bedeutete, dass Konrad von Huttens Bewaffnete keine hundert Schritte von hier auf ihn lauerten. «Die Wallfahrt zum Gnadenbild der Jungfrau Maria wurde vom Papst in Avignon bereits vor über hundert Jahren genehmigt. Der Mainzer Erzbischof sichert jedem Pilger, der nach Niklashausen zieht, einen Sündenerlass von vierzig Tagen zu. Ich habe nichts anderes getan, als die armen Sünder zur Buße aufzurufen.»
«Du musst fliehen, ehe sie dich verhaften», entschied der Bauer mit einer knappen Handbewegung, die den Jüngling zum Schweigen brachte. «Am besten bringen wir euch noch heute Nacht zur Tauber hinunter, dort liegt ein Boot, das meinem Vater gehört. Friederike, pack ein paar Kleider zusammen.» Er fasste den verwirrten Knaben scharf ins Auge. «Wir haben dich gern unter unserem Dach beherbergt, mein Freund, aber meine Frau ist schwanger. Ich darf sie nicht in Gefahr bringen.»
Die Bürgersfrau musste ihm recht geben. Die Bauern hatten bereits mehr als genug für den Jüngling gewagt.
Es vergingen einige Augenblicke, bevor die Bäuerin wieder erschien. Entgegen der Aufforderung ihres Mannes hatte sie weder Kleider noch etwas zu essen bei sich. Dafür war sie weiß wie ein Leintuch und zitterte. Bernt hob die Augenbrauen.
«Friederike, was ist los?»
Die Bäuerin gab ihrem Mann mit den Augen ein Zeichen, davonzulaufen, doch im nächsten Moment wurde sie auch schon brutal in die Stube gestoßen. Sie schrie auf. Hinter ihr tauchten vier Männer auf, die mit Schwertern und klirrenden Kettenhemden in die Stube stapften.
«Einen guten Abend wünsche ich Euch, edle Frau», rief Konrad von Hutten der Bürgersfrau mit einem höhnischen Grinsen zu. Er hatte sie sofort wiedererkannt.
«Was wollt Ihr von mir? Ich habe Euch nichts zu sagen.»
«Dankt Gott, dass Euer Verwandter, der Fürstbischof, Euch nicht in dieser ärmlichen Aufmachung sehen kann. Er hält nichts davon, wenn sich Angehörige adeliger Familien mit dem Bauernpack verbrüdern. Noch dazu mit Ketzern. Ihn würde glatt der Schlag treffen.»
«Der Schlag wird meinen lieben Vetter treffen, wenn er weiterhin zu viel Wein säuft und sich mit Männern wie Euch umgibt», rief die Bürgersfrau. Sie betonte den Grad ihrer Verwandtschaft, obwohl ihr klar war, dass die Bauersleute sie dafür hassen mussten. Es kostete sie eine Menge Überwindung, bevor sie von Hutten ein falsches Lächeln schenkte.
«Ihr seid also die Base des Fürstbischofs», zischte die Bäuerin hasserfüllt. «Dann habt Ihr uns verraten.» Sie spuckte ins Stroh. «Ich verfluche dich, Weib!»
Die Bürgersfrau spürte einen Stich in der Brust. Sie wollte empört aufbegehren, als ihr Gemahl über die Schwelle der Bauernbehausung trat. Er wirkte abgekämpft, gehetzt, als hätte er Tage im Sattel zugebracht. Vermutlich war er geritten wie der Teufel. Als er seine Frau in der nur schwachbeleuchteten Bauernstube erkannte, ballte er wütend die Fäuste.
Nun ist alles aus, dachte sie. Ich habe verloren. Ohnmächtig musste sie mit ansehen, wie die Waffenknechte, die das Wappen des Fürstbischofs auf ihren Röcken trugen, den Jüngling auf die Beine zerrten und mit Stricken banden. Danach legten sie auch den Bauern und ihr selbst Fesseln an. Ihr Gemahl ließ es geschehen, ohne einzuschreiten.
Von Hutten überragte den Jüngling um mehr als zwei Handbreit. «Du bist also der Ketzer, der es gewagt hat, unseren gnädigen Fürstbischof zu verspotten und seine Verwandte zu verhexen. Wo steckt dieser Mönch, der sich immer in deiner Nähe aufhielt, wenn du zum Ungehorsam gegen die Obrigkeit aufgerufen hast? Meine Späher haben mir berichtet, dass er Niklashausen nicht verlassen hat. Also hält er sich noch irgendwo verborgen. Ist er dein Dämon? Dein Schatten? Hast du ihn durch teuflische Kräfte in Luft aufgelöst?»
Der Jüngling gab keine Antwort. Er schwieg auch noch, als von Hutten ihn schlug.
Die Bewaffneten stießen ihre Gefangenen aus dem Haus. Den Bauern steckten sie einen Knebel in den Mund, um sie am Schreien zu hindern.
Vor einem Schuppen befahl man der Bürgersfrau und den Bauern zu warten. Es lag auf der Hand, dass sie das Dorf nicht wiedersehen würden. Die Bürgersfrau konnte die Blicke der jungen Bäuerin nicht lange ertragen. Mit aller Kraft zerrte sie an den Fesseln, die ihr immer tiefer ins Fleisch schnitten. Endlose Augenblicke später sah sie ihren Mann. Heinrich hatte die Fiedel des Jünglings bei sich.
«Er möchte, dass du sie bekommst. Am liebsten hätte ich das lästerliche Ding auf seinem Kopf zertrümmert und den Bogen durch beide Ohren geschoben.»
Sie holte Luft. «Ich werde von Hutten sagen, dass er unschuldig ist. Der Mönch, den er sucht, ist kein Dämon …»
«Du kannst von Glück reden, dass ich noch rechtzeitig eingetroffen bin, um das Schlimmste zu verhindern», unterbrach sie Heinrich. «Noch weiß der Fürstbischof nicht, dass du hier im Dorf unter dem Pilgervolk warst. Er darf es auch nicht erfahren. Hast du gehört? Es würde uns alle vernichten.»
«Uns alle?»
Heinrich kam ihr so nahe, dass sie sein Barthaar auf ihrer Wange spüren konnte. «Man hat mir erlaubt, mit diesem verdammten Gaukler zu reden, nachdem du draußen warst. Der Narr hat mir geschworen, dass dein Name vorerst in keinem Verhörprotokoll auftauchen wird, vorausgesetzt, ich verwende mich für ihn.» Er zögerte.
«Und weiter? Das ist doch nicht alles.»
Er lachte. «Der Kerl behauptet, die Jungfrau Maria habe dein Flehen erhört. Du wirst doch noch ein Kind bekommen. Mein Kind. Und obwohl ich der Meinung bin, du hättest besser zum Grab des heiligen Jakobus nach Spanien pilgern sollen, glaube ich ihm. Keine Ahnung, warum. Vielleicht hat er mich ja auch verhext.»
Noch während Heinrich sprach, begannen sich ihre Gedanken wie eine Spindel im Kreis zu drehen, doch allmählich fing sie an zu begreifen. Sie hatte den Jüngling warnen wollen. Und nun war er es, der ihr den Strohhalm reichte, an dem ihr Leben hing. Ihr Blick fiel auf die junge Bäuerin, die soeben zu einem Karren geschleppt wurde. Sie hätte der Ärmsten gern noch etwas Tröstendes gesagt, bevor die Männer sie fortbrachten, doch ihr fiel nichts ein.
«Du kommst mit mir», befahl Heinrich, während er sein Messer zückte, um ihre Hände von den Fesseln zu befreien. «Ich schätze, hier wird es bald sowieso ungemütlich werden, also versuche erst gar nicht, dich zu sträuben. Wenn dieses verfluchte Gesindel merkt, dass sein falscher Prophet entführt wurde, könnte es leicht zu Sense und Dreschflegel greifen. Wie man hört, sollen sich ein paar Ritter unter den Pilgern befinden. Du wirst von Hutten ihre Namen verraten.»
Das würde sie nicht tun. Lieber starb sie im Kerker.
«Du wirst jede Buße annehmen, die unser Beichtvater dir auferlegt. Danach kannst du wieder in meinem Haus leben. Aber rechne damit, dass meine Diener und ich dich künftig genau im Auge behalten werden. Du wirst den Ort, an den ich dich nun bringe, nicht mehr verlassen, bis du das Kind zur Welt gebracht hast.»
Sie schwieg beharrlich. Dieses Kind, mochte es geboren werden oder nicht, würde sie für den Rest ihres Lebens daran erinnern, welch große Dummheit sie begangen hatte. Auch wenn es einmal Heinrichs Erbe antreten würde, würde es doch niemals etwas anderes als ein Gauklerkind sein. Sie würde dafür sorgen, dass es die Fiedel des Jünglings spielen lernte.
Würzburg
Kloster der Benediktinerinnen zu St. Afra zwanzig Jahre später
1. Kapitel
Regina Babel lief ungeduldig an der Mauer entlang, die den stattlichen Klostergarten umgab. Im Sommer duftete es hier betörend nach Minze, Kamille und den Rosen, die von Schwester Berthe, der Klosterapothekerin, gezüchtet wurden. Regina ging der älteren Nonne hin und wieder zur Hand, und manchmal bekam sie dafür eine der hübschen Blumen, die in üppigen Stauden an der Mauer wuchsen.
Im Winter war der Garten jedoch alles andere als einladend. Er war still und einsam. Kahle Sträucher und Bäume mit verkrüppelten Ästen, wohin man auch blickte. Alles Leben schien aus ihm verbannt, daran mochte auch der frischgefallene Schnee nichts ändern, der die Beete unter einer dichten Decke begraben hatte.
Regina und die übrigen Mädchen, die im Kloster der Benediktinerinnen von St. Afra Unterricht erhielten, hatten den Schnee von den Fenstern ihrer Kammern aus freudig begrüßt, weil er das erste wirklich Aufregende war, was sich seit Wochen ereignete. Doch mit der weißen Pracht hatten auch Kälte und Krankheit in das zugige Gemäuer Einzug gehalten. Der Frost bahnte sich unbarmherzig seinen Weg durch die nur schwer beheizbaren Räume. Die meisten Nonnen litten unter Husten und waren erschöpft; daher reagierten sie gereizt auf die lebenslustigen jungen Ritter- und Bürgertöchter, die ihnen zur Erziehung anvertraut worden waren. Die Frauen bestraften nun sogar die kleinsten Fehler und Verstöße gegen die strengen Regeln des Klosteralltags. Unter ihrer Härte hatten insbesondere die Mädchen zu leiden, die aus weniger wohlhabenden Familien stammten und die Schwestern nicht mit Geschenken oder Versprechungen milde stimmen konnten.
Regina kuschelte sich tiefer in das warme Wolltuch, das sie vor ihrem Spaziergang um ihre Schultern gelegt hatte. Sie war ein hübsches Mädchen, vielleicht ein wenig zu rundlich. Auch verfügte sich nicht über die vornehme Blässe des Gesichts und das wie Seide glänzende Haar, das adelige Jungfrauen für gewöhnlich auszeichnete. Ihr Gesicht war immer ein wenig gerötet, um die Nase verteilten sich Sommersprossen, die im Winter nur geringfügig schwächer wurden, und ihr Haar war so widerspenstig, dass die Nonnen die Meinung vertraten, Regina sei wohl auch später im Kloster und unter dem schwarzen Schleier am besten aufgehoben. Dessen ungeachtet besaß Regina eine Anmut, um die sie viele ihrer Freundinnen beneideten. Sie war zweifellos begabt; außer der lateinischen hatte sie auch die griechische Sprache mit Leichtigkeit erlernt. Ihre große Leidenschaft galt jedoch nicht dem Auswendiglernen frommer Verse oder den Handarbeiten, sondern der Musik. Sie liebte den Chor der Schwestern und stand klaglos vor dem ersten Tageslicht auf, um den Gesängen in der Klosterkirche zu lauschen.
Regina beobachtete ein paar Amseln, die in einem steinernen Wasserbecken nach Futter suchten. Der Boden der Schale, in der sich etwas Wasser gesammelt hatte, war gefroren. Etwas Essbares war dort gewiss nicht zu finden. Regina verspürte Mitleid mit den hungrigen Tieren und nahm sich fest vor, bei ihrem nächsten Spaziergang ein paar Brotkrumen in die leere Wasserschale zu legen. Das war zwar verboten, aber Regina hatte nicht vor, sich erwischen zu lassen. Wenn der heilige Franziskus den Vögeln gepredigt hatte, so konnte nichts Schlimmes daran sein, ihre kleinen hungrigen Mägen zu füllen.
Als Regina die Kälte nicht mehr ertrug, schlug sie den Weg zur Klosterpforte ein, die jenseits des großen, gepflasterten Hofs lag und mit einem Klingelstrang versehen war. St. Afra besaß auch ein großes Rundbogentor mit einer Einfahrt, die breit genug für einen Pferdewagen war, doch dieses wurde nur selten benutzt. Während der Wintermonate ließ die Äbtissin es sogar verriegeln und nur in der Weihnachtsnacht öffnen. Dann zogen die Nonnen von St. Afra in einer stummen Prozession zum Dom, um mit dem Fürstbischof und sämtlichen geistlichen und weltlichen Würdenträgern der Stadt Würzburg das Hochamt zu feiern.
An der Pforte, die fast hinter einer Weißdornhecke verschwand, klopften nun Tag für Tag Bettler, die ein Almosen erbaten.
Regina sah durch das Fenster des Pförtnerhäuschens und stellte erleichtert fest, dass ihre Freundin Dorothea schon ihren Dienst angetreten hatte. Die Hände der Frau lagen auf einem Tisch und waren andächtig um einen Rosenkranz gefaltet, doch ihr Kopf war auf ihre Brust gesackt, und selbst außerhalb des Pförtnerhäuschens konnte Regina das Geräusch kräftigen Schnarchens vernehmen. Na warte, dachte Regina, als sie heftig gegen die Tür pochte. Die Nonne fuhr mit einem erschrockenen Schnaufen in die Höhe. Verschlafen starrte sie Regina an.
«Hast du dir nicht fest vorgenommen, nie wieder an der Pforte einzuschlafen?», fragte Regina mit einem schadenfrohen Lächeln. Sie mochte Dorothea, die wie sie die Klosterschule besucht, sich dann aber entschieden hatte, den Schleier zu nehmen und die Gelübde abzulegen. Dorothea war eine Nonne aus Überzeugung und hatte den Schritt, in St. Afra zu bleiben, nie bereut. Nun unterdrückte die rundliche junge Frau mühsam ein Gähnen, während sie ihrer Freundin scherzhaft mit dem Finger drohte. «Wenn du der Priorin auch nur ein Sterbenswörtchen davon erzählst …»
«Wofür hältst du mich denn?» Regina hob die Augenbrauen. «Ich bin doch keine Verräterin wie Jutta von Hochstein.»
«Du meinst die Tochter des Ritters von Hochstein?»
Regina schnitt eine Grimasse, indem sie ihre Nase mit dem Zeigefinger nach oben bog. «Wen denn wohl sonst?», näselte sie. «Dieses eingebildete Ding versteht es, sich bei der Priorin einzuschmeicheln, indem sie jede unbarmherzig meldet, die gegen die Regeln verstößt.»
Dorothea schüttelte den Kopf. «Nun, dann kann ich mir vorstellen, dass ihr beide nicht die besten Freundinnen seid. Allerdings hoffte ich insgeheim, du kämest besser mit unserer Priorin aus, nachdem die ehrwürdige Mutter dich ins Gebet genommen hat. St. Afra ist nämlich kein Ort für Müßiggänger, die nur Flausen im Kopf haben.»
Regina seufzte, fühlte sich aber keiner Schuld bewusst. Sie hatte nie den Wunsch gehabt, im Kloster zu leben. Das hatte ihr Vater entschieden, der sie offenkundig nicht um sich haben wollte. Ihre Mutter hatte zu seiner Entscheidung geschwiegen. Während sie noch überlegte, ob Dorotheas Einschätzung wirklich auf sie zutraf, trat sie an die Pforte und schob die Klappe zurück, hinter der sich ein etwa handbreites Guckloch verbarg. Regina hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, hinauszuschauen, sooft sich eine Gelegenheit dazu bot. Hinaus in die wahre Welt, wie sie es nannte. Für die Zöglinge der Klosterschule galt die Regel, dass sie im Schutz der Mauern bleiben mussten, was auch geschah. Nur hin und wieder erlaubte ihnen die Priorin, den Sonntag nach der Messe bei ihren Familien zu verbringen. Sofern diese in der Stadt lebten. Regina, die sich seit ihrem fünften Lebensjahr in St. Afra befand, sah ihre Eltern dennoch nur selten. Das lag nicht daran, dass sie weit entfernt wohnten oder es sich nicht leisten konnten, der Tochter einen Knecht zur Begleitung durch die Straßen der Stadt zu schicken. Reginas Familie gehörte zum Würzburger Stadtadel und war weithin bekannt, ein Umstand, der vor allem ihrem Vater viel bedeutete. Das Haus am Tuchmarkt, in dem der Stadtvogt Heinrich Babel wohnte, gehörte zu den prächtigsten von ganz Würzburg. Vor ihm hatte Reginas Großvater, der Vater ihrer Mutter, dort sein Kontor gehabt. Doch nachdem die Geschäfte immer schlechter gelaufen waren, hatte er sein Haus dem erfolgreichen Schwiegersohn überschrieben und sich in ein bescheideneres Domizil an der südlichen Stadtmauer zurückgezogen. Es hieß, dass er die Ehe seiner Tochter mit dem strengen Vogt nicht billigte, daher setzte er auch nie einen Fuß in sein ehemaliges Haus. Wenn Regina an den meisten Wochenenden im Kloster blieb, so also nicht, weil ihr St. Afra viel bedeutete. Ihr behagte vielmehr die kühle Atmosphäre nicht, die seit dem Auszug des Großvaters am Tuchmarkt herrschte. Reginas Mutter, eine wortkarge Frau, die selten jemand lachen sah, kränkelte seit dem Herbst. Sie verließ ihr Zimmer nur, um die Messe zu hören. Ansonsten blieb sie für sich. Reginas Vater träumte von größerem Einfluss im Hochstift, das seit kurzem von dem kunstsinnigen Fürstbischof Lorenz von Bibra regiert wurde. Der Fürstbischof rief Bildhauer und Maler an seinen Hof und hatte begonnen, die alte, zugige Festung seines verstorbenen Vorgängers, die hoch oben über dem Main lag, in eine feudale Residenz umzubauen. Heinrich Babel arbeitete wie ein Besessener in seiner Kanzlei und hoffte, dem altersschwachen Kanzler des Fürstbischofs bald im Amt nachzufolgen.
«Erspähst du was Besonderes da draußen?», lenkte Schwester Dorotheas kratzige Stimme Reginas Gedanken zurück zum Pförtnerhäuschen. «Oder erwartest du, dass dein Verehrer Tag und Nacht vor der Pforte auf ein Zeichen deiner Gunst wartet?»
Reginas Ohren brannten plötzlich, als hätten sie Feuer gefangen. «Verehrer», hatte die Pförtnerin gesagt und mit ihrer spöttischen Bemerkung ins Schwarze getroffen. In der Tat verbarg sich hinter Reginas täglichen Spaziergängen eine Sehnsucht, die so überwältigend an ihr rüttelte, dass sie sogar die beißende Kälte und den Zorn der Priorin in Kauf nahm. Sie hoffte auf eine Nachricht von dem Mann, mit dem sie sich seit einigen Wochen heimlich traf. Von dem Mann, in den sich Regina unsterblich verliebt hatte.
«Bitte, Dorothea», schmeichelte Regina nun kleinlaut.
«Nein, oh nein!»
«Liebste Freundin, die Zunge soll mir herausfallen und auf der Stelle verdorren, wenn ich dich jemals wieder verspotten sollte …»
«Ha, sei besser vorsichtig mit dem, was du gelobst.» Dorothea gab sich noch ein Weilchen spröde, doch angesichts der bittenden Blicke, mit denen Regina um sie herumschlich, begann der Widerstand der jungen Klosterschwester zu bröckeln.
«Nun gut, dann will ich mal nicht so sein. Der junge Herr von Weikersheim, der dich interessiert, kam heute schon ganz früh ins Kloster gelaufen. Es war noch nicht einmal ganz hell, als er von Schwester Diemut in Empfang genommen und sogleich über die Stiege hinter dem Refektorium zu den Wohnräumen der ehrwürdigen Mutter geführt wurde. Ich wunderte mich, weil doch die anderen Schwestern noch bei der Matutin saßen. Ich konnte ihren Gesang in der Kirche bis zur Pforte hören. Außer mir waren nur Schwester Cordula befreit, die mit einem schweren Fieber im Infirmarium liegt, und natürlich Schwester Berthe, die sich um sie zu kümmern hat. Ach ja, die ehrwürdige Mutter nahm auch nicht an den Gebeten teil, vermutlich geht es ihr noch immer nicht besser. Die Ärmste. Ihre Krankheit bereitet mir große Sorge.» Als Dorothea wieder auf den jungen Mann zu sprechen kam, der an der Pforte um Einlass gebeten hatte, begannen ihre Augen schwärmerisch zu leuchten. Offensichtlich war ihr die Erinnerung an die Begegnung mit Reginas heimlichem Verehrer nicht unangenehm. Regina konnte sich vorstellen, was ihre Phantasie anregte. Mit seinen schulterlangen kastanienbraunen Haaren, der scharfgeschnittenen Nase und dem ordentlich gestutzten Bärtchen sah Hartmut von Weikersheim nicht nur gut aus, er war der schönste Mann, den sie in Würzburg jemals gesehen hatte.
Dorothea darf gern von ihm träumen, befand sie großzügig, denn erstens hatte sie als Nonne Keuschheit und Gehorsam gelobt, und zweitens lag es auf der Hand, dass ein Mann von Hartmuts Format eine unscheinbare Klosterschwester wie sie niemals beachten würde. Etwas an Dorotheas Bericht machte Regina indes stutzig. Warum hatte sich die hochnäsige Priorin persönlich dazu herabgelassen, Hartmut von Weikersheim an der Pforte in Empfang zu nehmen? Soweit Regina bekannt war, hielt er sich nur vorübergehend in Würzburg auf, um eine lange anstehende Familienangelegenheit zu klären. Sie hatte keine Ahnung, wo genau in der Stadt er wohnte, vermutete jedoch, dass seine Verwandten oder Freunde ihm eine Bleibe angeboten hatten. Aber warum führte ihn sein Weg an einem kalten Wintermorgen ausgerechnet nach St. Afra? Und warum bemühte sich Diemut um ihn? Hatte sie etwas zu verbergen, oder wollte sie lediglich vermeiden, dass er von den Nonnen gesehen wurde?
Regina zitterte bei dem Gedanken, die Priorin könnte etwas von dem Briefwechsel erfahren haben, den sie seit Wochen mit dem jungen Mann führte. Von den wenigen Begegnungen außerhalb der Klostermauern ganz zu schweigen. Das Kloster war kein Ort, an dem Geheimnisse lange Zeit überlebten. Zu neugierig waren einige der Nonnen. Von den Mädchen, die hier unterrichtet wurden, und dem Gesinde ganz zu schweigen. Regina nahm sich vor, in Zukunft vorsichtiger zu sein und vor Personen wie Jutta von Hochstein, die sich in St. Afra wie eine Herrscherin aufspielte, auf der Hut zu sein.
Dorothea gelang es schließlich, sie zu beruhigen. «Die Alte weiß bestimmt nichts von deiner Schwärmerei, Kindchen», sagte sie ein wenig gönnerhaft. «Aber vielleicht solltet ihr in Zukunft etwas vorsichtiger sein und euch nach einem anderen Boten umsehen. Schwester Diemut mustert mich neuerdings immer so misstrauisch. Dabei zieht sie ein Gesicht, als verdächtige sie mich, die Zuckervorräte zu plündern.»
Regina lächelte. Es war kein Geheimnis im Kloster, dass die rundliche Dorothea eine große Schwäche für Naschwerk jeder Art hatte. Aber die junge Nonne war auch grundehrlich und hätte sich eher die Zunge abgehackt, als auch nur ein Krümelchen aus den behüteten Vorräten der Klosterküche zu nehmen, das ihr nicht zustand.
«Keine Angst, ich würde niemals zulassen, dass die Priorin dich für etwas bestraft, was ich ausgefressen habe», versprach Regina mit ernster Miene, auch wenn sie sich nicht vorstellen konnte, womit die Stellvertreterin der Äbtissin ihre Freundin noch härter züchtigen konnte als mit der Aufgabe, bei Wind und Wetter an der zugigen Pforte zu hocken und sich mit den Bettlern und Gauklern herumzuschlagen, die um Einlass baten. Regina hätte längst dagegen aufbegehrt und der Priorin die Meinung gesagt. Wie gut, dass sie keine Klosterschwester war, die Frauen wie Diemut von Pinzburg ewigen Gehorsam schuldeten. Eines hoffentlich nicht mehr allzu fernen Tages würde die Priorin oder Jutta von Hochstein ihr nichts mehr vorzuschreiben haben.
«Ich glaube, du überschätzt deinen Einfluss», sagte Dorothea. Die füllige Nonne befeuchtete ihre spröden Lippen. «Ist der alte Kanzler oben auf der Burg inzwischen abgetreten, damit dein Vater ihn beerben kann? Oder braucht dich die ehrwürdige Mutter in ihren Gemächern, damit du ihr auf deiner merkwürdigen Gauklerfiedel vorspielen kannst? Ich frage mich schon seit langem, warum du so an der hängst.»
«Nichts von alldem», sagte Regina kurz angebunden. Auch wenn sie dem Ehrgeiz ihres Vaters nur wenig abgewinnen konnte, mochte sie es nicht, wenn Witze über ihn gerissen wurden. Er war immerhin Stadtvogt von Würzburg und gehörte zu den Vertrauten des Fürstbischofs. Stumm wartete sie, bis Schwester Dorothea ein kleines, mehrfach gefaltetes Blatt Papier unter ihrer Ordenstracht hervorzog und es ihr in die Hand drückte. «Da!»
Regina verschlang die Zeilen mit einem Eifer, der Dorothea belustigte. «Mein Gott, du wirst ja ganz blass um die Nase herum. Schlechte Nachrichten?»
Regina faltete das Papier wieder zusammen und verbarg es sorgfältig unter ihrem Schultertuch. «Ganz im Gegenteil, Dorothea. Wenn wahr ist, was hier steht, werde ich unserem langweiligen Kloster St. Afra bald für immer Lebewohl sagen. Keine Altartücher mehr, die ich besticken muss, kein Unkrautjäten. Und vor allem keine Auseinandersetzungen mehr mit der Priorin. Gibst du mir noch ein letztes Mal den Schlüssel zur Pforte?»
«Du träumst wohl! Niemals!»
«Oh bitte, Dorothea. Nur für ein paar Minuten heute Abend. Ich kann nicht bis zum Sonntag nach der Messe warten. Da bleiben stets nur wenige Minuten, die ich mit Hartmut reden kann, ohne dass mein Vater mich erwischt. Vielleicht steht meine Zukunft auf dem Spiel.»
«Ist dir klar, dass ich einen Verstoß gegen die Regel des heiligen Benedikt im Kapitelsaal vor meinen versammelten Mitschwestern und der ehrwürdigen Mutter auf Knien bereuen muss?», schimpfte Dorothea missmutig. «Dabei wäre das nicht das Schlimmste, denn die Äbtissin ist eine nachsichtige Frau. Aber solange sie krank ist, übernimmt Schwester Diemut ihre Pflichten, und mit der ist nicht zu spaßen. Die alte Eule bringt es fertig und beschneidet mir wieder die Mahlzeit, so, wie sie es vorige Woche getan hat, weil ich während des Komplets eingenickt bin.» Dorothea hatte sich in Rage geredet, doch es war nicht zu übersehen, dass auch sie inzwischen die Neugier gepackt hatte. Daher überlegte sie nur kurz, bevor sie schließlich widerstrebend nickte. «Aber nur, weil mich die Apothekerin gebeten hat, ihr nach dem Vesperläuten ein wenig zur Hand zu gehen. Sie sieht immer schlechter, trotz der geschliffenen Gläser, die ihr ein Krämer im Tausch für Heilsalben überlassen hat, und fürchtet, die Arzneien zu verwechseln, die sie für unsere Kranken im Spital zubereitet. Wie man hört, ist in der Stadt mal wieder ein Fieber ausgebrochen. Wenn du mich fragst, wurde es von diesen vermaledeiten Teufelsknechten eingeschleppt, die sich in der Stadt aufhalten und beim Adamshof ihrem gotteslästerlichen Treiben hingeben.»
Regina vermutete, dass ihre Freundin von dem abgelegenen Hof sprach, auf dem seit einiger Zeit Gaukler mit Billigung des Fürstbischofs einen Unterschlupf fanden, solange sie sich in der Stadt aufhielten. Von dort zogen sie auf den Marktplatz, wo sie ihre Kunststücke vorführten, sangen oder auf der Sackpfeife bliesen. Ehrbaren Bürgern war das Anwesen nicht geheuer; sie mieden es und nahmen lieber einen Umweg in Kauf, als sich in die Nähe des Hauses zu begeben. In der Stadt hielt sich das Gerücht, der Teufel selbst habe den Hof in Besitz genommen. Die Spielleute seien nichts anderes als Betrüger, Spione der ungläubigen Osmanen, die das Heilige Römische Reich bedrohten. Feinde des gesamten Menschengeschlechts.
Dorothea schimpfte noch eine Weile auf die Fahrenden, auf ihre Bleibe und sogar auf den Fürstbischof, der einfach zu milde war. Sie traute dem fremden Gauklervolk und seinen Wirtsleuten noch Übleres zu als den Osmanen. Doch Regina hörte längst nicht mehr zu. Ihre Gedanken waren zu ihrem heimlichen Verehrer zurückgekehrt, der sie in seinem Schreiben um ein Treffen am Klostertor bat. Noch in dieser Nacht wollte Hartmut von Weikersheim sie sehen. Was er ihr sagen wollte, musste sehr wichtig sein, sonst würde er nicht wagen, sie ohne Begleitung zur Pforte zu bitten. Er wusste, was sie riskierte, wenn sie einen Mann traf, der kein Familienangehöriger war, noch dazu bei Dunkelheit.
«Mir gefällt das nicht», unkte Dorothea. «Der Bursche mag gut aussehen und auf einem Rittersitz leben, doch wenn er ehrliche Absichten hätte, würde er deinen Vater am Tuchmarkt aufsuchen und in aller Form um deine Hand anhalten. Aber was tut der feine Herr stattdessen? Er verlangt von einer ehrbaren Jungfrau, dem Kind einer der angesehensten Familien Würzburgs, dass sie ihm nachts die Klosterpforte öffnet wie eine Magd, die auf einen Fuhrknecht wartet.»
«Du kennst doch seine Gründe gar nicht!»
Dorothea schnaubte. «Gründe? Was für Gründe sollen das denn bitte schön sein? Ich glaube allmählich, dass du dich in einen Herumtreiber verguckt hast, der nur auf ein Stelldichein mit einem Klostermädchen aus ist. Hast du dich wenigstens vergewissert, dass seine Ohren nicht aufgeschlitzt wurden? Nein? Wie dumm von dir! Dabei weiß doch jeder, dass den Betrügern und Dieben die Ohren mit einem glühenden Stift durchstoßen werden.»
«Ich kann dir versichern, dass seine Ohren heil sind», meinte Regina trocken. «Und mit meinem Vater will er sprechen, sobald er ein wichtiges Geschäft unter Dach und Fach gebracht hat. Er muss es geschickt anstellen. Ich meine, er kann nicht einfach zu meinen Eltern laufen und sie fragen: Gebt Ihr mir Eure Tochter zur Frau? Genau, das Mädchen, das Ihr hinter Klostermauern versteckt, weshalb ich es eigentlich gar nicht kennen darf. Dafür weiß ich aber über Euren Besitz und Euren Einfluss in der Stadt Bescheid. Beides käme mir gelegen. Nein, Dorothea, sobald mir Hartmut seinen Antrag gemacht hat, muss ich Vater überzeugen, dass er mich aus der langweiligen Klosterschule nimmt und nach Hause zurückkehren lässt.»
Stürmisch drückte sie Dorothea einen Kuss auf die Wange, dann stapfte sie mit großen Schritten durch den knirschenden Schnee, geradewegs auf das mit roten Schindeln bedeckte Gebäude hinter der Klosterkirche zu, das den Laienschwestern, Mägden und Schülerinnen als Schlafsaal diente.
2. Kapitel
Regina wartete ungeduldig, bis der Abend endlich hereinbrach und sie von ihrer wachsenden Aufregung erlöste. Während der endlosen Übungen im Lateinischen, die wegen der frostigen Kälte im großen Kapitelsaal vorgenommen wurden, war sie ungewohnt schweigsam und mit den Gedanken ganz woanders gewesen. Mehrmals wurde sie wegen ihrer Unaufmerksamkeit gemahnt. Beim Abendbrot, das von einer griesgrämigen älteren Nonne mit Frostbeulen an den Zehen beaufsichtigt wurde, fiel es ihr nicht schwer zu schweigen. Dafür erntete sie misstrauische Blicke von einigen der jungen Mädchen. Insbesondere Jutta von Hochstein schien sie argwöhnisch zu beobachten.
Nach dem Vespergebet begab sich Regina auf dem schnellsten Wege zu ihrem Schlafquartier. Während den Schwestern für die kurzen Nächte zwischen den vorgeschriebenen Gebeten kleine kahle Zellen zustanden, teilten sich die Zöglinge der Klosterschule einen großen Raum mit strohbedecktem Fußboden, der von zwei mächtigen Säulen in zwei Hälften geteilt wurde. Reginas Lager befand sich gleich links neben der Tür, was sich als vorteilhaft erwies, denn so konnte sie sich bei Bedarf hinausschleichen, ohne dass ihre Gefährtinnen oder die Aufseherin, die hinter einem Vorhang schlief, etwas davon bemerkten.
Regina setzte sich auf ihr Bett und nahm die Geige zur Hand, die ihre Mutter ihr vor Jahren geschenkt hatte. Dorothea nannte sie ein wenig abfällig Gauklerfiedel, aber Regina liebte das Musikinstrument, auch wenn es alt und abgegriffen aussah. Im Laufe der Jahre hatte Regina das rötliche Holz immer wieder sorgfältig poliert, um ihm etwas Glanz zu verleihen, doch die Geige wirkte dennoch schäbig. Regina hatte niemals erfahren, wie ihre Mutter an die Fiedel gekommen war. Dies war wohl eines der Geheimnisse ihrer Familie, an dem nicht gerüttelt werden durfte.
«Ich wundere mich wirklich, dass die Priorin dir dieses fürchterlich vulgäre Ding nicht schon längst abgenommen und es ins Feuer geworfen hat», hörte Regina plötzlich eine schrille Stimme. Sie blickte auf und sah Jutta von Hochstein, die sich mit einem Lächeln die hüftlangen Haare bürstete. Einige der Mädchen, die zur Anhängerschaft der jungen Ritterstochter gehörten, kicherten belustigt.
Jutta war im Kloster nicht wirklich beliebter als Regina, schon gar nicht unter den hart arbeitenden Nonnen, die für weibliche Eitelkeiten kein Verständnis hatten. Anders als Regina hatte Jutta es jedoch früh verstanden, sich mit Schmeicheleien und Geschenken Gunst sowie ein treues Gefolge zu erkaufen, das sie auf Schritt und Tritt begleitete. Jutta von Hochsteins Familie stammte nicht aus Würzburg, das Mädchen verriet auch nicht, wohin sie an den Feier- und Märtyrertagen ging, wenn den Schülerinnen Besuche bei ihren Angehörigen gestattet wurden. Zuweilen prahlte sie damit, dass ihr Vater zu den engsten Vasallen Kaiser Maximilians zählte und eine der stattlichsten Festungen Frankens befehligte. Doch für gewöhnlich hüllte sie sich bezüglich ihrer Abkunft in eisernes Schweigen. Im Unterschied zu den meisten Klosterzöglingen, die ihre Zeit bei den Nonnen äußerst widerwillig absaßen und nur darauf warteten, dass ihre Väter sie standesgemäß verheirateten, klagte Jutta von Hochstein nie über ihren Aufenthalt in St. Afra. Im Gegenteil, sie schien ihn zu genießen. Die strengen Regeln des Konvents machten ihr offensichtlich nicht zu schaffen. Jutta stand manchmal sogar vor dem Morgengrauen auf, um in der Kapelle zu beten. Sie wusch sich mit eisigem Brunnenwasser und jammerte auch nicht über die triste Kleidung, die im Kloster vorgeschrieben war. Für die Schwärmereien ihrer Altersgenossinnen hatte sie nur Hohn und Spott übrig.
Regina hatte Jutta vom ersten Tag an verabscheut. Sie hielt sie für hinterlistig und eigennützig. Die Bemerkung über Reginas Geige kam daher nicht von ungefähr. Ihr ging ein langer, zermürbender Streit mit der Priorin voraus, aus dem Regina schließlich siegreich hervorgegangen war. Diemut von Pinzburg, die Musik mit Ausnahme von geistlichen Gesängen verabscheute, war der Ansicht, dass Instrumente wie Reginas Fiedel in einem Kloster nichts zu suchen hatten. Sie seien die Stimme des Gauklers, so verkündete es auch der Beichtvater des Konvents bei seinen Predigten im Dom. Der Gaukler aber, darin stimmten Priester und Priorin überein, habe sich in die Dienste des Teufels begeben, um unbescholtene Menschen zu verderben und sie zu einem sittenlosen Leben zu verführen.
Reginas Fiedel wäre längst ins Herdfeuer der Klosterküche gewandert, wenn nicht ausgerechnet die alte Äbtissin in den Streit eingegriffen und Regina erlaubt hätte, das Instrument zu behalten. Regina war von Herzen dankbar dafür und besuchte die Klostervorsteherin wenigstens einmal im Monat in ihren prunkvoll eingerichteten Räumen, um ihr vorzuspielen.
Nun aber war die Äbtissin schon seit geraumer Zeit krank; niemand wusste genau, was ihr fehlte, doch die Apothekerin und Schwester Dorothea machten sich große Sorgen um sie. Zu Appetitlosigkeit und bleierner Müdigkeit schien sich nun auch noch eine Schwäche in den Gelenken der älteren Frau gesellt zu haben, was zu den schwersten Befürchtungen Anlass bot. Seit den ersten Schneefällen erlaubte Diemut von Pinzburg niemandem mehr, die Krankenstube der Äbtissin zu besuchen. Nicht einmal die Apothekerin wurde vorgelassen.
«Hoffentlich fängst du nicht an, auf diesem schmutzigen Kasten zu kratzen», sagte Jutta von Hochstein. Es klang verächtlich. Sie legte ihre Haarbürste in ein kirschrotes Kästchen, auf dem ein Wappen in tiefblauer Farbe zu sehen war. «Wir sind hier schließlich nicht auf einem Jahrmarkt! Oder wirst du gleich anfangen, mit Bällen zu jonglieren?»
«Keine Sorge, ich spiele für Menschen, die hübsche Melodien erfreuen. Da dir nur das Geräusch des Rosshaars auf deiner strähnigen Mähne gefällt, darf ich von dir wohl weder Geschmack noch ein gutes Gehör erwarten.» Regina zeigte auf Juttas Decke. «Siehst du das Tier, das da sitzt und dich angrinst? Ich glaube, es ist eine Wanze, die du dir vom Kopf gebürstet hast. Sie scheint deine Gegenwart zu genießen. Vermutlich seid ihr beide vertraut miteinander?»
Einige der Mädchen stießen angewidert die Luft aus. Jutta von Hochsteins Augen wurden so schmal wie ihre Lippen. «Elendes Biest», war alles, was sie hervorbrachte. Während eine ihrer Anhängerinnen Strohsack und Leinen von Juttas Bettkasten riss, starrte das Edelfräulein Regina mit unverhohlenem Hass an. «Du glaubst, du seiest etwas Besseres als wir anderen, weil dein Vater in Würzburg Stadtvogt ist, nicht wahr?»
Regina zuckte mit den Schultern. «Wenigstens muss ich keine Lügengeschichten über meine Familie erfinden, um mich interessant zu machen.»
«Ach, wirklich nicht? Die Priorin scheint da anderer Meinung zu sein!», gab Jutta von Hochstein zurück. Einen Moment lang genoss sie Reginas Verwirrung, bevor sie nachschickte: «Ich hörte sie erst vor wenigen Tagen zu Schwester Agneta sagen, dass der Name Babel einst mit einem Skandal in der Stadt verbunden war, der aber von deinem Vater mit Hilfe seines Reichtums vertuscht wurde.»
Regina warf Jutta einen wütenden Blick zu. Vermutlich spielte das Mädchen auf den Ruin ihres Großvaters an. Wie man sich erzählte, hatte dessen Schwiegersohn sich in der Angelegenheit nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Regina war damals noch zu klein gewesen, um die Zusammenhänge zu verstehen, doch aus einigen aufgeschnappten Bemerkungen ihrer Mutter hatte sie sich im Laufe der Zeit ihr eigenes Bild zusammengesetzt. Heinrich Babel hatte sich an der Notlage seines Schwiegervaters bereichert und ihm nicht geholfen. Das trug gewiss nicht dazu bei, ihn zu einem beliebten Bürger zu machen. Andererseits kamen solche Dinge vor. Gerade unter den Patriziern, die sich oftmals beneideten und Fehden ausfochten. Von einem anderen Skandal wusste Regina nichts. Sie hatte auch gewiss nicht vor, sich von Jutta herausfordern zu lassen. Ohne das Mädchen noch eines Blickes zu würdigen, steckte sie den Brief, den Dorothea ihr an der Pforte ausgehändigt hatte, in den Hohlraum ihrer Fiedel. Dann wickelte sie das Instrument vorsichtig in ein rotes Wolltuch, schob es in ihren Kasten und ging zu Bett. Sie hörte, wie im Schlafsaal die Lampen gelöscht und Gebete gemurmelt wurden, drehte sich aber nicht mehr um. Sie wollte mit ihren Gedanken allein sein.
Nach einer Weile kehrte Ruhe im Saal ein. Bis auf einige erkältete Mädchen, die leise in ihre Kissen husteten, sowie dem verhaltenen Knistern des Feuers im Kohlebecken war nichts mehr zu hören.
Regina wartete noch eine Weile, dann richtete sie sich vorsichtig auf. Aufmerksam lauschte sie, ob sich draußen, auf dem Korridor, etwas regte. Obwohl der verwinkelte Raum nicht wirklich warm geworden war, setzten sich kleine Schweißperlen auf ihre Stirn. Ihr Haar roch nach dem beißenden Rauch, der durch die Luft waberte. Zu dumm. Sie würde später weder besonders vorteilhaft aussehen noch gut riechen, aber das ließ sich nicht ändern. Keinesfalls durfte sie den Fehler machen, in ihrem Kasten nach einem Kamm zu wühlen und damit Jutta von Hochstein zu wecken. Vor ihr musste sie noch mehr auf der Hut sein als sonst. Die Demütigung würde sie ihr sicher heimzahlen wollen.
Regina vertrieb sich die Zeit damit, die lateinischen Vokabeln zu wiederholen, die sie heute gelernt hatte, damit sie die Vita der heiligen Barbara verstehen konnte. Ihre Geschichte wurde in diesem Monat im Kapitelsaal während der Mahlzeiten vorgelesen, doch Regina erinnerte sich nicht mehr, warum die Heilige ihr Leben hatte lassen müssen. Irgendetwas mit Feuer hatte sie zu tun gehabt. Aber was? Die meisten Mädchen interessierten sich für die Erlebnisse der frommen Heiligen nicht mehr als für das Gezänk der Fischkrämerinnen auf dem Marienmarkt. Regina indessen mochte den Wohlklang der alten Sprache.
Als die anderen Mädchen endlich eingeschlafen waren, erhob sich Regina und tastete in der Dunkelheit nach ihrem warmen Schultertuch. Lautlos schlüpfte sie in die weichen Lederschuhe und hoffte, dass sie bis zum Morgen wieder trocken sein würden. Sie konnte sie ja später in die Nähe des Feuers stellen. Bei dem Gedanken, mitten in der Nacht in den einsamen Klosterhof zu schleichen, wurde ihr nun doch ein wenig mulmig. Die Fensterläden klapperten. Das Geräusch des Windes klang klagend wie eine Frau, der ein Leid widerfahren war. Als Regina durch den eisigen Kreuzgang huschte und den trostlosen Innenhof erreichte, wäre sie am liebsten wieder umgekehrt und unter ihre Decke gekrochen. Aber sie durfte Hartmut nicht enttäuschen. Vielleicht wartete er schon in der Kälte auf sie und sehnte sich danach, ihr über das Haar zu streichen.
Bei den letzten beiden Säulen, die das von Schnee bedeckte Dach des Kreuzgangs trugen, blieb sie unvermittelt stehen. Neben dem Pförtnerhäuschen fiel ein dünner Lichtschein auf den schmalen Torweg. Regina biss sich auf die Lippe. Am liebsten hätte sie laut geflucht. Wenn am Tor noch Licht brannte, konnte das nur bedeuten, dass Dorothea es sich anders überlegt hatte und nicht zur Apothekerin ins Hospital gegangen war. Regina spürte, wie die grimmige Kälte ihre Waden lähmte. Ihr Herz begann stärker zu klopfen. Vielleicht hatte die Priorin aber auch eine andere Nonne zum Dienst an der Pforte eingeteilt. Regina beschloss, es herauszufinden. Langsam näherte sie sich der Pforte, wobei sie aufpassen musste, in der Dunkelheit nicht über den Saum ihres Kleides zu stolpern. Der Weg, den die Mägde des Klosters im Sommer stets ordentlich harkten, hielt nun so manches Hindernis bereit, das auch noch von einer Schneedecke überzogen war. Im Schein der Öllampe, die an einer eisernen Halterung neben dem Tor hing, konnte Regina jetzt erkennen, dass die Pforte eine Handbreit geöffnet worden war. Der Wind, in den sich einige dünne Schneeflocken mischten, bewegte die Tür hin und her, sodass sie ein schrilles Geräusch von sich gab. Es hörte sich an wie das jämmerliche Winseln eines Hundes, der vergeblich um Einlass bettelt.
Regina spürte, wie ihr Unbehagen wuchs. Einerseits hätte sie gern gewusst, ob Dorothea an der Pforte saß und einfach eingeschlafen war, andererseits war es gefährlich, sich hier draußen am Tor aufzuhalten. Was, wenn eine andere Nonne als die gutmütige Pförtnerin sie erwischte, am Kragen packte und zeternd zur Priorin schleppte? Während Regina noch überlegte, was sie tun konnte, wurde plötzlich die Tür aufgestoßen. Sie fand gerade noch Zeit, sich hinter einer knorrigen Weinranke zu verstecken, die entlang der Klosterhofmauer wuchs, als auch schon zwei Gestalten auf die Pforte zuhielten. Eine von beiden war Diemut von Pinzburg. Die Priorin bewegte sich vorsichtig, geradezu katzenhaft waren ihre Bewegungen. Während sie die Hand nach dem Riegel ausstreckte, schienen ihre eng zusammenstehenden Augen unter dem strengen Gebände des Schleiers die Umgebung abzusuchen. In ihrer Begleitung befand sich ein Mann, den Regina noch nie gesehen hatte. Er überragte die Priorin, die für eine Frau nicht eben klein war, um mindestens zwei Handbreit. Sein stämmiger Körper, den er wie ein Greis nach vorne beugte, steckte in einem wadenlangen Überwurf, der aus einer Unmenge von Fellstücken zu bestehen schien. Auf dem Kopf des Fremden thronte eine Art türkischer Turban aus rotgefärbtem Filz, und an seinen Füßen bemerkte Regina Schuhe mit langen, nach innen gebogenen Schnäbeln. Insgesamt sah der Fremde nicht gerade wie ein Würzburger Bürger aus, was nicht nur an seiner merkwürdigen Aufmachung lag, sondern auch an der dunklen Haut und dem krausen Haar, das auf Regina wie das Nest eines Raben wirkte. Entgegen seiner Körperhaltung bewegte er sich leichtfüßig, beinahe geschmeidig; gewandt tauchte er unter dem ausgestreckten Arm der Priorin hindurch, die ihm die Pforte aufhielt, um ihn hinauszulassen.
«Und vergiss bloß nicht, dass du einen Schwur geleistet hast», zischte Diemut. Ihre Stimme war heiser vor Anspannung. Mochte es ihr auch unangenehm sein, mit dem wunderlich gekleideten Fremden zu reden, so lag in ihrem Ton doch auch eine bedrohliche Schärfe, die in krassem Gegensatz zu ihrem frommen Gewand stand. «Du wirst mich noch dreimal aufsuchen, bevor sich das Jahr dem Ende zuneigt. Aber wehe dir, wenn du jemanden die Fläschchen sehen lässt.»
Regina sah, wie der Fremde den Kopf neigte. Dann hörte sie ihn fragen: «Aber was geschieht, wenn Eure Äbtissin nach mir fragt? Oder wenn sie sich gegen Euren Rat entschließen sollte, den Arzt des Fürstbischofs ins Vertrauen zu ziehen?» Er machte einen Schritt auf Diemut von Pinzburg zu. «Ich mag nur ein Quacksalber sein, den seine Geschäfte von Ort zu Ort führen. Heute bin ich in Würzburg, morgen könnte ich schon am Ende der Welt sein. Doch Euch, meine verehrte Priorin, wird man büßen lassen, wenn herauskommt, dass Ihr, die Priorin von St. Afra, …»
«Schweig, du frecher Kerl! Ich will kein Wort mehr hören!» Diemut von Pinzburg warf dem Mann einen zornigen Blick zu, der ihn beschwichtigend die Hände heben ließ.
«So habe ich es nicht gemeint», beeilte er sich zu versichern. «Drei Phiolen also. Ich werde sie Euch beschaffen und verbürge mich dafür, dass sie nach Ablauf einer angemessenen Frist ins Kloster geliefert werden. Aber das kann teuer werden.» Er tat, als würde er Geld zählen und rieb Daumen und Zeigefinger aneinander.
«Lass das meine Sorge sein», erwiderte Diemut von Pinzburg. «Du wirst dein Geld bekommen. Aber hüte dich davor, mich zu betrügen.» Sie stieß die Pforte ganz auf und kam dann auf die Ranken zugelaufen. Regina hielt den Atem an. Aber sie hatte Glück. Die Aufmerksamkeit der älteren Ordensfrau galt weder ihr noch dem Fremden; sie schien von einem plätschernden Geräusch irritiert, welches von fern an ihr Ohr drang. Möglicherweise leerte jemand seinen Nachttopf auf die Gasse. Diemut wich hinter das Tor zurück. Sie wollte nicht gesehen werden.
«Was habt Ihr?», wollte der Gaukler wissen.
«Das geht dich nichts an, Fahrender. Was willst du denn noch? Habe ich nicht dafür gesorgt, dass keines dieser dummen Weibsbilder hier mehr die Äbtissin besucht? Die Berichte an den Generalvikar der Benediktiner und den Fürstbischof schreibe und siegle ich selbst. Die ehrwürdige Mutter hat mir sogar ihre Schlüssel anvertraut, was unter den gegebenen Umständen nicht leichtsinnig, sondern eine weise Entscheidung war. Niemand wird Verdacht schöpfen, und es wird sich auch für dich lohnen. Einen verschwiegenen Bediensteten vergesse ich nicht.»
«Ich diene nur Gott allein, ehrwürdige Schwester», erhob der Fremde aufgebracht Einspruch. «Meine Leute werden verachtet und gemieden wie Sklaven, das ist wahr. Sobald das ehrbare Volk unserer Späße und Künste überdrüssig ist, jagen sie uns vor die Stadtmauern. In Würzburg mag das zwar seit einiger Zeit anders sein, aber wer kann mir versprechen, dass der Fürstbischof nicht schon morgen früh seine Meinung ändert, weil ihn nachts sein Leib gezwickt hat? Was auch immer uns in diesem Bistum noch blühen mag, wir sind und bleiben freie Leute. Daran werden weder Könige noch geistliche Würdenträger etwas ändern.»
Diemut von Pinzburg lachte auf. Offensichtlich amüsierte sie der leidenschaftliche Einspruch des Mannes, auch wenn sie keine Silbe von dem ernst zu nehmen schien, was er sagte. «Vogelfrei seid ihr Fahrenden», erwiderte sie mit einer abfälligen Geste. «Aber ich habe weiß Gott Besseres zu tun, als mit dir darüber zu diskutieren. Unsere Pförtnerin wird bald aus der Klosterapotheke zurückkehren. Und sie ist neugierig wie ein Welpe. Also verschwinde durch die Pforte und vergiss gleich, wer dich heute Nacht eingelassen hat! Tust du es nicht, werde ich dafür sorgen, dass dich ein Feuerchen erwartet, auf dem du langsam geröstet wirst. Das hat vor einigen Jahren schon ein anderer Gaukler in Würzburg zu spüren bekommen.»
Der Fremde mit dem Turban gab einen grunzenden Laut von sich. Er schien zu wissen, von wem die Priorin sprach, und die Erinnerung setzte ihm merklich zu. Einen Herzschlag lang befürchtete Regina in ihrem Versteck, er werde Diemut von Pinzburg anspringen wie ein wildes Tier. Doch er beherrschte sich. Ohne ein weiteres Wort stapfte er durch die Pforte und warf die Tür hinter sich zu. Die Priorin gab einen verächtlichen Laut von sich. Dann lief sie mit wehendem Ordensgewand zum Pförtnerhäuschen, wo sie sich bückte und einen Gegenstand aufhob, der, wie sich im Schein der Lampe zeigte, eine mit Bast umwickelte kleine Korbflasche war. Die Frau schlug einen ihrer weiten Ärmel über die Flasche und eilte über den sich windenden Weg auf das Refektorium zu.
3. Kapitel
Regina war halb erfroren, als sie es endlich wagte, ihr Versteck hinter der Ranke zu verlassen. Was sie gesehen und mit angehört hatte, überforderte sie so sehr, dass sie einer Ohnmacht nahe war. Sie fragte sich, ob sie nicht eingeschlafen und alles nur geträumt hatte. Bei rechter Überlegung wäre ihr das sogar lieber gewesen, aber sie wusste, dass es nicht stimmte. In ihrem Kopf bewegten sich die Gedanken mit der Schwerfälligkeit einer Tretmühle. Es war ihr einfach nicht möglich, in dieser Kälte ruhig zu überlegen. Nur eines war gewiss: Priorin Diemut von Pinzburg und dieser Mann führten etwas Schreckliches im Schilde. Was auch immer die Flasche enthielt, die der Fremde ins Kloster gebracht hatte, es würde die Krankheit der Äbtissin weder lindern noch heilen. Ihr Leibarzt wusste jedenfalls nichts von einer neuen Medizin, die der Klostervorsteherin verabreicht werden sollte.
Regina spürte, wie ihr vor Kälte die Tränen in die Augen schossen. Oder war es Hilflosigkeit, die sie weinen ließ? Sie hatte sich nie zuvor so ohnmächtig gefühlt. Sie musste etwas tun, um das abscheuliche Treiben der Priorin, welche die Krankheit ihrer Vorsteherin so gnadenlos ausnutzte, ans Licht zu bringen. Aber wer würde ihr schon glauben? Ihr Wort stand gegen das einer angesehenen Klosterschwester. Man würde sie für eine Schwindlerin halten und bestrafen, wenn sie behauptete, die Priorin von St. Afra öffne nachts heimlich einem Giftmischer die Pforte. Außerdem würde man fragen, was sie zur selben Zeit dort draußen zu suchen gehabt hatte. Diemut würde Mittel und Wege finden, sie mundtot zu machen, wenn sie verriet, was sie gehört hatte. Traf sie nun die falsche Entscheidung, so würde ihr Leichnam möglicherweise schon morgen im Main treiben.
Was soll ich tun?, überlegte Regina, während sie auf das winterlich zugeschneite Dach der Klosterkirche blickte. Hartmut von Weikersheim fiel ihr ein. Doch konnte sie ihn mit einer so heiklen Angelegenheit behelligen? Wie gern hätte sie sich in seine Arme geworfen und den Kopf an seine Brust gedrückt wie ein kleines Mädchen. Sie hätte ihm alles erlaubt, wenn er sie nur tröstete, vielleicht sogar das, was Männer für gewöhnlich mit Frauen taten, wenn sie miteinander allein waren. Wenn sie darüber nur Diemut und ihre fürchterliche Giftflasche aus ihrem Kopf bannen konnte.
Regina ahnte jedoch, dass sie nicht ein einziges Wort des Gesprächs je wieder vergessen würde. Wie sollte sie auch aus ihrem Gedächtnis streichen, dass die Äbtissin in höchster Gefahr schwebte. Zu schwer wog das Netz aus Falschheit, das Diemut von Pinzburg knüpfte, um alle einzuschüchtern, die ihre Pläne störten – wie auch immer diese Pläne aussahen. Vermutlich würde sogar Reginas Freundin Dorothea sich in Kürze in diesem Netz verfangen. Was hatte die Priorin doch gleich gesagt? Sie hielt Dorothea für zu neugierig, vermutlich stellte sie eine Gefahr dar, weil sie an der Pforte saß und genauer als jede andere Nonne über Besucher Bescheid wusste, die ins Kloster kamen. Regina schluckte verzweifelt, als ihr einfiel, dass sie es war, die ihre Freundin in eine gefährliche Lage gebracht hatte.
Regina traf einen Entschluss. Sie würde ihren Vater aufsuchen. Heinrich Babel mochte kein großer Menschenfreund sein und noch weniger ein Freund der Äbtissin von St. Afra, aber er war Advokat. Der begabteste Rechtsgelehrte Würzburgs. Seine Kenntnisse des kirchlichen wie des römischen Rechts befähigten ihn zu entscheiden, wie in einem solch wirren Fall zu verfahren war. Möglicherweise konnte er die Angelegenheit gleich morgen früh dem Fürstbischof vorlegen und um eine offizielle Untersuchung bitten. Dann war Regina die Last der Verantwortung genommen, und kein schlechtes Gewissen konnte sie plagen, nichts gegen Diemut unternommen zu haben. Unter Umständen brachte das ihrem Vater sogar seinem ersehnten Ziel näher, zum bischöflichen Kanzler berufen zu werden. Er würde ihr noch dankbar dafür sein, dass sie ihn aus dem Schlaf riss.