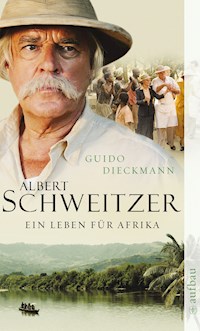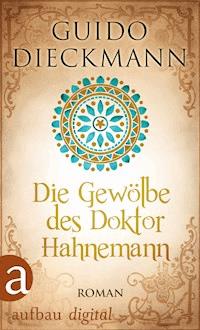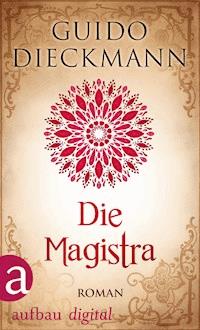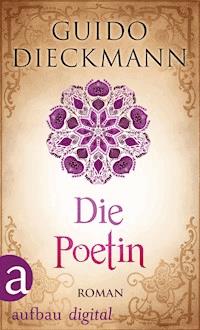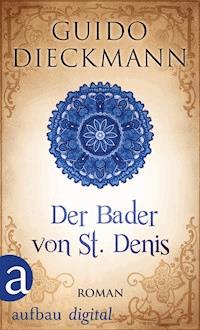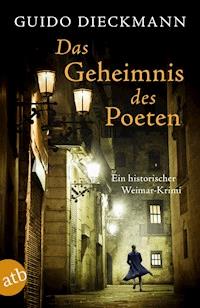9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Templer-Saga
- Sprache: Deutsch
Kann ein Katharer die Templer retten?
Frankreich, im 14. Jahrhundert: Der eigenwillige Ritter Rémy St. Clair kennt nur ein Ziel: Er möchte den Templerorden, der einst vom französischen König vernichtet wurde, wieder zum Leben erwecken. Doch zuvor gilt es für ihn und seine Kameraden, das Vermächtnis eines verstorbenen Ordensbruders zu erfüllen. Sie sollen einen Katharer finden, der angeblich weiß, wo das verschollene Archiv der Templer sowie ein Artefakt aus dem Orient zu finden ist. An der Seite der Templer: die Heilerin Prisca, die aber, weil sie Jüdin ist, stets in besonderer Gefahr schwebt ...
Hochspannend und nach wahren Begebenheiten erzählt – der neue Bestseller über das Vermächtnis der Templer.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 693
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Über das Buch
Frankreich im Jahre 1320: Acht Jahre nach dem Untergang des Templerordens träumen der Ritter Rémy St. Clair und seine Kameraden noch immer davon, die einst mächtigste Organisation der Christenheit wieder zum Leben zu erwecken. Dafür aber benötigen sie das seit langem verschollene Templerarchiv sowie ein geheimnisvolles Artefakt, das angeblich die Macht hat, Kriege heraufzubeschwören. Ausgerechnet der als Aufrührer gefürchtete Katharer Bombaste soll wissen, wo beides zu finden ist. Die Suche nach ihm gestaltet sich schwierig, denn auch der Bischof von Pamiers hat ein Interesse daran, den letzten Katharer aufzuspüren. Zur selben Zeit formiert sich in der Normandie ein „Kreuzzug der armen Hirten“, der auf seinem Weg ins maurische Granada eine Schneise der Verwüstung hinterlässt. Als der Katharer sich dem Zug anschließt, bleibt den Templern und der mit ihnen verbündeten Heilerin Prisca keine andere Wahl: Sie müssen nicht nur Bombaste beschützen, sondern einen ganzen Kreuzzug aufhalten.
Über Guido Dieckmann
Guido Dieckmann, Jahrgang 1969, hat Geschichte und Anglistik studiert und lebt in der Pfalz. Er hat bisher mehrere sehr erfolgreiche historische Romane vorgelegt, unter anderem den Bestseller „Luther“. Zuletzt veröffentlichte er im Aufbau Taschenbuch: „Das Geheimnis des Poeten“ sowie „Der Fluch der Kartenlegerin“. Aus der Templer-Serie sind bisher erschienen: „Die sieben Templer“ sowie „Der Pakt der sieben Templer“.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Guido Dieckmann
Die Mission der sieben Templer
Historischer Roman
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Widmung
Motto
Dramatis Personae
Die Templer
Auf dem Gutsbesitz der Familie de Gros
In Pamiers
In Montaillou
Im Lager der Hirtenpilger
Sonstige
Prolog
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.
XXVII.
XXVIII.
XXIX.
XXX.
XXXI.
XXXII.
XXXIII.
XXXIV.
XXXV.
XXXVI.
XXXVII.
XXXVIII.
EPILOG
Nachwort des Autors
Impressum
Wer von diesem Roman begeistert ist, liest auch ...
Für meine Familie
Am Abend des 12. Oktober 1307 sah ich drei Wagen den Pariser Tempel verlassen, begleitet von den Herren de Villiers und Hugo de Chalons. Sie fuhren in Richtung Meer.
Nach der Zeugenaussage des Tempelritters Jean de Chalons
Dramatis Personae
Die Templer
Rémy St. Clair, ehemals Vorsteher der Templerkomturei Argyll in Schottland und Waffenmeister des Markgrafen von Brandenburg
Primus von Tempelhof, als Findelkind Bote einer Templerniederlassung in der Mark Brandenburg, nun selbst Ordensritter
Gottfried von Bisol, ehemaliger Templer; zwischenzeitlich Angehöriger des Deutschen Ritterordens und Berater des Erzbischofs von Köln
Hugo van Haarlem, ehemaliger Templer aus den Niederlanden
Quartus, einst Bote des Templerordens, jetzt Rémys Knappe
Auf dem Gutsbesitz der Familie de Gros
Prisca von Speyer, Heilkundige; lebt als illegitime Tochter eines Templers und einer Jüdin auf dem Gut ihrer Verwandten
Balthasar de Gros, Grundherr und Priscas leiblicher Großvater
Adaliz, Balthasars Tochter
Marie, Adaliz’ Dienerin und Zofe auf dem Gut de Gros
Roger, Gutsknecht und Führer durch die Pyrenäen
In Pamiers
Jacques Fournier, Bischof von Pamiers und Inquisitor
Bruder Daniel, Franziskaner und Bevollmächtigter des Bischofs von Pamiers
Oliviera, seine Schwester
Leonard de Carcassonne, Erbe der Burg Montloup
In Montaillou
Bombaste Lavalle, geistlicher Führer der letzten Katharer und gesuchter Verbrecher
Pierre Clergue, Dorfpriester von Montaillou
Bernard Clergue, königlicher Beamter und Pierres Bruder
Raymond, heimlicher Katharer
Jacotte, Dorfbewohnerin und Großmutter des Gutsknechts Roger
Béatrice de Planisolles, ehemalige Kastellanin der Burg von Montaillou
Im Lager der Hirtenpilger
Pierrot, Bauer und Anhänger des Hirtenkreuzzugs
Alix, seine Frau
Madeleine, seine Nichte
Le Serpent, Kundschafter der Hirtenpilger
Sonstige
Prinz Alfonso, Sohn des Königs von Aragón
Matteo Zaccaria, Kaufmannssohn aus Genua
Prolog
ÄGYPTEN, ALTSTADT VON KAIRO,
SOMMER 1307
Matteo stolperte hilflos abwärts.
Mit jedem Schritt, den er auf der Treppe zurücklegte, schien er dem fauligen Herz der Hölle näher zu kommen. Er überlegte, ob er vielleicht längst tot war. Ja, womöglich hatte er sich, stur wie eh und je, nur noch nicht eingestanden, dass sein Leben vorbei war. Angst und Verzweiflung ließen ihn mit den Tränen kämpfen. Nicht einmal die Beichte hatte er ablegen können, denn an diesem Ort gab es keine Priester. Aber Tote, so war es ihm von Kindesbeinen an beigebracht worden, spürten keinen Schmerz mehr. Sie waren beneidenswerterweise von allem irdischen Leid erlöst. Demzufolge konnte Matteo nicht tot sein, denn in seinem Schädel brummte es wie in einem Bienenkorb. Seine Lippen waren rau vor Durst, und seine Handgelenke taten so weh, dass jede Bewegung ihn aufstöhnen ließ.
Die Männer, die ihn und seine Mitreisenden am Hafen vom Schiff getrieben hatten, hatten ihm einen Sack über den Kopf gestülpt und die Hände auf den Rücken gefesselt. Das war gegen Mittag gewesen. Matteo erinnerte sich, dass die Sonne fast senkrecht über ihm gestanden war. Dann, nach einer Ewigkeit des Wartens, hatte ein krächzender Grobian ihn mit Fußtritten zum Aufstehen gezwungen und durch das Getümmel stadteinwärts getrieben. Dass Matteo zu Tode erschöpft war und alle paar Schritte stolperte, weil er durch den Sackstoff nicht mehr als vage Umrisse erkennen konnte, hatte den Mann nicht dazu bewogen, langsamer zu gehen. Im Gegenteil, er schien es eilig zu haben. Mitleidlos bugsierte er seinen Gefangenen durch die Menge. Matteo hörte höhnisches Gelächter, Beschimpfungen in Sprachen, die ihm fremd in den Ohren klangen, Kamelgebrüll und Schafsblöken. Offenbar führte der Weg mitten durch den Basar der alten Stadt Kairo.
»Stehen bleiben!«
Der Befehl klang schneidend wie ein Peitschenhieb, aber wenigstens verstand ihn Matteo. Es folgten Schritte auf den Fliesen. Schlüssel klapperten. Jemand stieß einen Pfiff aus.
Die Stimme des Ankömmlings, der Matteo zur Begrüßung mit dem Ellenbogen in die Seite stieß, klang barsch. Dem Mann schien Matteos Anwesenheit in seinem Haus nicht zu behagen. Sogleich begann ein Wortwechsel. Die beiden Männer fauchten sich in arabischer Sprache an, und obgleich Matteo keine Silbe davon verstand, beschlich ihn das bedrückende Gefühl, dass es hierbei um sein weiteres Schicksal ging.
Wenige Augenblicke später wurde ihm mit einem Ruck der Sack vom Kopf gerissen.
»Den Lumpen brauchen wir nicht mehr! Willkommen in deinem neuen Reich, Fremder!« Der Heisere lachte höhnisch auf, verstummte aber sogleich, als Matteos Augenlider unkontrolliert zu zucken begannen. Die Flammen einer Fackel, welche wie eine Horde feixender Dämonen über das rötliche Mauerwerk tanzten, blendeten seine Augen so sehr, dass Ströme von Tränen ihm die Wangen hinabliefen. Voller Verachtung verschränkte sein Bewacher die Arme vor der Brust und starrte ihn an. Vermutlich hielt er Matteo für einen zartbesaiteten Schwächling, der wie eine Küchenmagd heulte. Erst nach einer Weile gelang es Matteo, die unwillkommenen Tränen fortzublinzeln und sich verstohlen umzusehen. Sein Blick fiel auf die Treppenstufen, die in die Freiheit hinaufführten. Diese schienen ohne Handlauf und in einem Abstand von fast einer Elle von der Wand entfernt förmlich in der Luft zu schweben. Matteo schluckte. Ein falscher Tritt und er hätte unterwegs den Halt verloren und wäre in die Tiefe gestürzt.
Der scharfe Geruch nach fauligem Stroh und Exkrementen deutete an, dass er sich in einem Kerker befand, der sich tief unter den Basaren Kairos durch finstere, verwinkelte Schächte und Gänge zog. Es war ein Grab oder würde zumindest bald eines sein. Sein Grab. Wie lächerlich, ihm das Gesicht zu verhüllen, fand Matteo. Er würde auch sehenden Auges nicht wieder hier herausfinden.
Dass der Heisere einem Wärter kurz darauf die Anweisung gab, Matteo etwas zu essen und zu trinken zu bringen, ließ ihn aufatmen. Wenn er gefüttert wurde, so hatte man nicht vor, ihn sofort zu töten.
»Ihr wollt Lösegeld erpressen, nicht wahr?«
Der Heisere lachte. »Hältst du mich für einen Narren, der nicht längst erraten hat, dass du kein Matrose bist, sondern aus wohlhabendem Haus stammst? Das Schiff, auf dem du gesegelt bist, trägt das Wappen der Genueser Kaufmannssippe Zaccaria.« Er deutete auf das Emblem mit dem Kopf einer Taube, das Matteos silberne Gürtelschnalle schmückte. Jedes Mitglied des Handelshauses trug so einen Gürtel, und Matteo hätte sich ohrfeigen können, weil er während des Überfalls auf sein Schiff nicht auf die Idee gekommen war, ihn abzulegen. Andererseits wäre er womöglich wie die Seeleute erschlagen worden, wenn er es getan hätte.
»Du bist einer der Söhne des alten Kaufmanns, nicht wahr?« Wieder lachte der Heisere sein raues, kehliges Lachen, dann legte er jäh einen Finger über die Lippen und funkelte Matteo an. In seinem Blick lagen Kälte und Gier. »Aber das wird unser Geheimnis bleiben, verstanden? Gehorchst du, wirst du vielleicht freigelassen, wenn nicht …« Er sprach nicht weiter, sondern deutete auf den Dolch in seinem Gürtel. Matteo erkannte ihn sofort. Er hatte dem Kapitän gehört, der seit vielen Jahren die Waren seines Vaters durch den Mittelmeerraum beförderte. Und der nun tot war. Der Heisere hatte ihn noch an Bord mit seinem eigenen Dolch niedergestochen und in seinem Blut liegen gelassen. Eine unmissverständliche Warnung, dass er auch Matteo die Kehle durchschneiden würde, falls der sich einfallen ließe, Widerstand zu leisten.
Matteo presste fest die Lippen zusammen. Also deshalb hatte der Mann es so eilig gehabt, ihn von seinen Mitgefangenen zu trennen und sein Gesicht zu verbergen. Er wollte nicht, dass Matteo als Angehöriger des berühmten Handelshauses Zaccaria erkannt wurde, weil er sein eigenes Geschäft mit Matteo im Sinn hatte, und dieses Geschäft gedachte er allein zu machen. Oder wenigstens fast allein, denn allem Anschein nach hatte es sich nicht vermeiden lassen, den Kerkermeister einzuweihen. Vermutlich war der mit einem Anteil an der Lösegeldsumme geködert worden.
Der Heisere zerrte Matteo einen Gang entlang bis zu einer Tür. Sein Kerkermeister tastete nach den Schlüsseln, zögerte aber, sie zu gebrauchen.
»Worauf wartest du? Dieses Loch ist doch ideal für den Burschen. Die größeren Zellen sind vollgestopft mit Dieben und Mördern und werden auch noch regelmäßig von den Männern des Statthalters kontrolliert. Hierher verirrt sich keiner, der neugierige Fragen stellen könnte.«
Der Kerkermeister blickte unbehaglich drein, es vergingen einige Augenblicke, bevor er sich zu einer Antwort durchrang. »Aber … hinter dieser Tür haust einer dieser Teufel von Aruad.«
»Was sagst du da?« Der Heisere schüttelte ungläubig den Kopf. »Das ist unmöglich, du musst dich irren! Von den Männern lebt schon seit Jahren keiner mehr. Sie sind schweigend zur Hölle gefahren! So wurde es jedenfalls dem Statthalter berichtet.« Er trat ein paar Schritte auf den Kerkermeister zu und bedrohte ihn mit seinem Dolch.
»Willst du etwa behaupten, dies sei nur eine Lüge gewesen?«
Erschrocken wiegelte der Kerkermeister ab. »Gewiss nicht, Herr! Das würde ich nie wagen! Diese Teufel sind tot, darauf könnt Ihr Euch verlassen. Ihnen wurde auf allerhöchsten Befehl die Wahl gelassen: Unterwerfung oder Verhungern. Nur ein Einziger ist übrig geblieben, und der klammert sich mithilfe der bösen Dämonen von Aruad an sein elendes Dasein. Aber er steht schon mit einem Bein im Grab, glaubt mir. Redet kein Wort. Starrt nur vor sich hin und brütet. Von dem geht keine Gefahr mehr aus.«
»Hm!« Der Heisere legte die Stirn in Falten; er schien nachzudenken.
Matteo verstand von dem Getuschel der Männer kaum mehr als ein paar Bruchstücke, doch ein Wort hörte er heraus: Aruad. Hieß so nicht eine mächtige Burg, die auf einer Insel vor der Küste Syriens lag? Soweit Matteo sich erinnerte, war die Festung von einer Anzahl christlicher Ordensritter gehalten, dann aber vor ein paar Jahren unter mysteriösen Umständen verlassen worden. Was aus den Rittern geworden war, wusste niemand.
Ohne Vorwarnung packte der Heisere Matteo am Kragen, wobei er ihn zornig anstarrte. »Wir können dich nur hier einsperren, bis das Lösegeld bezahlt wurde. Aber ich warne dich, Bursche! Richtest du auch nur ein einziges Wort an den Mann hinter der Tür, werde ich davon erfahren. Dann bist du tot, verstanden?«
Ohne eine Antwort abzuwarten, stieß er Matteo ins Innere der Zelle, wo ihn tintenschwarze Dunkelheit erwartete. Die Tür fiel krachend ins Schloss.
Warum der Kerker von den Männern als Loch bezeichnet worden war, fand Matteo heraus, als er plötzlich ins Leere trat, den Halt verlor und etwa zehn Fuß in die Tiefe stürzte. Dass er sich dabei nicht die Knochen brach, verdankte er einem Haufen Stroh, der seinen Aufprall auf die massigen Quadersteine abmilderte. Stöhnend kämpfte der junge Mann sich auf die Beine und tastete sich dann mit wild klopfendem Herzen durch die Finsternis. Sofort stieß er gegen Mauerwerk. Es war feucht, schmierig und roch nach Moos. Verzweifelt sank er vor der Wand zu Boden und vergrub seinen Kopf zwischen beiden Armen. Nie hatte er sich hilfloser gefühlt als jetzt. Er würde hier unten sterben, egal was der Heisere versprach. Der würde das Geld einstreichen und ihn dann sich selbst überlassen.
Matteo hob den Blick; seine Augen suchten ein Stück Himmel. Hoch über seinem Kopf drang milchiges Mondlicht durch eine sternförmige Öffnung. Ein Strahl fiel auf eine Nische, die keine fünf Schritte von ihm entfernt aus dem rauen Stein gehauen worden war. Was sich dahinter im Schatten verbarg, konnte Matteo nicht erkennen, dafür erspähte er im Stroh vor der Nische ein paar Näpfe mit abgenagten Knochen sowie einen Wasserkrug, der ihn daran erinnerte, wie sehr seine Kehle noch brannte. Der Becher Wasser, den man ihm gereicht hatte, war nicht genug gewesen, um seinen Durst zu löschen.
Von der Wand ihm gegenüber hingen eiserne Hand- und Fußfesseln herab, in die vermutlich jene unglücklichen Gefangenen geschmiedet worden waren, die man hier unten hatte sterben lassen. Ein grauenhaftes Schicksal! Sie mussten die Schüsseln und den Krug genau vor Augen gehabt, aber durch die Fesseln keine Möglichkeit gehabt haben, an sie heranzukommen. So waren sie qualvoll verhungert und verdurstet.
Mit einer Ausnahme, falls Matteo das Gespräch der Männer richtig gedeutet hatte.
Doch nichts wies darauf hin, dass außer Matteo noch jemand hier unten war. Nicht einmal Ratten knisterten im Stroh, obwohl es oben von den Biestern nur so gewimmelt hatte. Matteo überkam dennoch das Gefühl, aus der Dunkelheit heraus beobachtet zu werden.
Er dachte nach. Sollte er sich bemerkbar machen? Erklären, dass er ein Leidensgenosse war und nichts Böses im Sinn hatte? Ihm fiel die Warnung des Heiseren ein, auf keinen Fall mit seinem geheimnisvollen Mitgefangenen zu reden. Nun, Matteo würde nicht so verrückt sein, mit unsichtbaren Geistern zu sprechen.
Eine Weile saß Matteo nur da und lauschte in die Stille hinein, die ihn wie eine eiskalte Hand zu streicheln schien. Er dachte an seinen Vater in Genua, der noch keine Ahnung hatte, dass Matteos Schiff überfallen und er nach Kairo verschleppt worden war. Das Handelshaus der Familie Zaccaria war überall in der Levante bekannt und verfügte seit den Tagen von Matteos Großvater über Verbindungen im Mittelmeerraum. Doch um Matteos Freilassung zu erwirken, mussten Boten ausgesandt, Verhandlungen geführt werden. Das war aufwendig und dauerte lange. Wochen, vielleicht sogar Monate.
Als Matteo die Augen wieder aufschlug, quälte ihn der Durst so sehr, dass er sich auf die Beine kämpfte. Vielleicht hatte er ja Glück und es war noch etwas in dem Wasserkrug. Als er die Hand nach ihm ausstreckte, ertönte plötzlich ein Geräusch, das wie das Knurren eines Hundes klang. Matteo blieb fast das Herz stehen, als sich unter dem Stroh in der Nische etwas regte. Also hatte der Kerkermeister nicht gelogen. Außer ihm war doch noch jemand hier.
Plötzlich zog ihn etwas zu Boden. Der Tonkrug entglitt seiner Hand und zersprang klirrend auf dem Stein. Gleichzeitig spürte Matteo, wie zwei klauenartig gekrümmte Hände nach seiner Kehle suchten. Sie gehörten einem kleinen, aber drahtigen Mann in schmutzigen Lumpen, von dem ein widerlicher Gestank ausging. In seinen dürren Fingern steckte indes noch eine Menge Kraft. Verzweifelt versuchte Matteo, die kräftigen Arme abzuschütteln, was ihm jedoch nicht gelang. Nur einen Augenblick später kämpfte er um sein Leben. Vor seinen Augen zerplatzten Feuerkugeln, hinter denen er eine vor Wut verzerrte Fratze wahrzunehmen glaubte. Seine Rettung war eine scharfe Scherbe des zerbrochenen Wasserkrugs. Es gelang ihm mit einiger Mühe, sie zu fassen zu bekommen, bevor seine Arme erlahmten. Mit letzter Kraft zog er die Scherbe über den Handrücken seines Angreifers.
Zunächst schien dieser davon völlig unbeeindruckt. Weder gab er einen Schmerzenslaut von sich, noch lockerte er den eisernen Griff um Matteos Kehle. Erst als ein wenig Blut aus der Wunde rann und auf Matteos Gesicht tropfte, ließ er ihn plötzlich los. Mit einem Schnauben richtete er sich auf und verzog seinen unter einem wirren ergrauten Bart liegenden Mund zu einer verächtlichen Grimasse.
»Das ist mein Wasser, nicht deines! Wenn ich dich leben lasse, kannst du deinen Diebstahl wiedergutmachen und mir von deinen Rationen abgeben!« Er funkelte Matteo abwägend an. »Man wird dir doch etwas zu essen geben, oder?«
Matteo nickte. Da die Mamelucken ihn für eine wertvolle Geisel hielten, würden sie ihn nicht verhungern lassen.
»Was ist nun?«, brummte der Gefangene. »Warum starrst du mich so an? Ich gefalle dir wohl nicht? Mein Anblick lässt dich erschaudern.« Er lachte bitter auf. »Aber lass dir gesagt sein: In ein paar Wochen wirst du ähnlich aussehen wie ich und gewiss nicht besser riechen.«
»Es heißt, man habe befohlen, alle Gefangenen in diesem Kerker verhungern zu lassen.« Matteo biss sich auf die Zunge, als ihm einfiel, dass der Heisere ihm bei Todesstrafe verboten hatte, mit dem Mann zu sprechen. Er konnte nicht wissen, ob die hohen Wände seine Stimme nicht weitertrugen. Erschrocken blickte er zu Boden, doch sein Zellengenosse ging darüber mit einem Achselzucken hinweg. Er selbst schien sich vor den Wärtern keineswegs zu fürchten, was in Anbetracht seiner Situation aber wenig verwunderlich war. Als Todgeweihter hatte er nicht mehr viel zu verlieren.
»Ich werde das Tageslicht nicht mehr sehen«, bestätigte er Matteos Vermutung gleichmütig. »Anfangs waren noch vierzig meiner Brüder am Leben, dann nur noch zwei. Und nun …« Er spie geräuschvoll ins Stroh, dann bewegten sich seine Lippen, als murmelte er ein stilles Gebet für seine Kameraden. »Es scheint fast, als wären die Mamelucken noch unentschlossen, wann und auf welche Weise sie mich aus dem Weg räumen wollen. Immerhin erspart mir der Wärter die Handfesseln, und von Zeit zu Zeit finde ich nach dem Erwachen ein wenig Wasser im Krug vor. Zuerst dachte ich, sie würden es vergiften, aber es scheint in Ordnung zu sein.«
»Und … das Essen?«, wandte Matteo kleinlaut ein. Allmählich meldete sich sein Magen.
»Oh, für meine Mahlzeiten sorge ich selbst. War schon immer ein guter Jäger. Sei froh, so wirst du hier nicht von den Ratten angeknabbert. Bevor sie zum Zuge kommen, knabbere ich an ihnen.« Der Mann grinste, und für einen kurzen Augenblick blitzten seine Augen schalkhaft. Erst jetzt bemerkte Matteo, dass sein Mitgefangener viel jünger war, als er geglaubt hatte. Mit gebeugtem Rücken und verzerrten Gesichtszügen hatte er greisenhaft gewirkt, dachte man sich das graue Haar und den wirren Bart aber weg, stieß man auf einen Mann in den besten Jahren. Selbst abgemagert und von Floh- und Wanzenstichen übersät, ging von ihm noch eine Würde aus, die Matteo einschüchterte. Zweifellos war der Fremde kein Händler und auch kein Bediensteter gewesen, sondern ein Soldat. Möglicherweise sogar ein Ritter.
»Ihr gehört zu den letzten Verteidigern von Aruad, nicht wahr?«, flüsterte Matteo. »Ich habe die Mamelucken den Namen der geheimnisvollen Burg sagen hören.«
Der Gefangene antwortete nicht sofort. Stattdessen ließ er sich mit einem Seufzer ins Stroh fallen, wo er seine Beine ausstreckte und die Zehen bewegte. Diese waren von Brandwunden und alten Narben gezeichnet. Matteo fragte sich, ob die zahlreichen Verletzungen vom Kampf herrührten oder ob man den Mann im Kerker gefoltert hatte, um seinen Willen zu brechen. Zu fragen traute er sich nicht.
»Ich gehöre dem Templerorden an«, erklärte der Gefangene. In seinen Worten schwangen Stolz, aber auch etwas Wehmut mit. »Meine Brüder waren ebenfalls Templer.«
»Templer«, wiederholte Matteo beeindruckt. Ja, das klang plausibel. Die Templer zählten zu den schlagkräftigsten und tapfersten Kriegern der Christenheit. Ritter, die wie Mönche lebten und beteten, aber auch das Schwert zu führen verstanden. Ihr Orden war reich und mächtig und nur dem Papst zu Gehorsam verpflichtet. Nachdem die christlichen Herrscher nach vielen Kämpfen gegen die Sarazenen Palästina verloren hatten, war es um den Templerorden ruhig geworden. Niemand schien so recht zu wissen, womit die Ordensleute seit ihrer Flucht aus dem Heiligen Land ihre Tage verbrachten. Es gab da ein paar wenig schmeichelhafte Gerüchte, Geschichten, mit denen Matteos Amme ihn als Kind erschreckt hatte. Man erzählte sich von Ausschweifungen hinter den Mauern ihrer Ordensburgen, von geheimen Ritualen, auf deren Verrat die Todesstrafe stand. Ja, sogar Teufelsanbetung und Gotteslästerung warf man den Rittern mancherorts vor. In Matteos Genueser Heimat herrschte die allgemeine Meinung, der Templerorden biete mittlerweile, fast zweihundert Jahre nach seiner Gründung im Heiligen Land, nur noch einen Abglanz seiner einstigen Blüte, und die über ganz Europa verstreuten Komtureien seien zu Brutstätten des Lasters verkommen, in denen alle sieben Todsünden praktiziert würden.
»Nichts als Lügen«, brauste der Gefangene auf, als Matteo ihn vorsichtig mit einigen dieser Vorwürfe konfrontierte. »Meine Brüder und ich haben sich weder auf die faule Haut gelegt noch die Gelübde vergessen, die wir einst im Angesicht des Kreuzes ablegten. Wir hatten den Auftrag, das Heilige Land zurückzuerobern, Zoll um Zoll, Stadt um Stadt. Zuletzt auch Jerusalem. Deshalb haben wir mit nur einhundertzwanzig Rittern und vierhundert Bogenschützen die Burg Aruad verteidigt. Sie sollte uns als Ausgangspunkt für einen gewaltigen Eroberungsfeldzug dienen, um die heiligen Stätten ein letztes Mal von den Sarazenen zu befreien. Doch wir wurden betrogen.« Er ballte seine Hände zu Fäusten, denn die Erinnerung schien ihn zu überwältigen.
»Betrogen?«
»Ja, verdammt! Wir warteten auf Verbündete. Mongolen. Aber die trafen nicht rechtzeitig ein. Stattdessen rückten die Mamelucken mit sechzehn Schiffen von Ägypten nach Tripolis vor und begannen, die Insel zu belagern, bis uns die Vorräte ausgingen. Um nicht zu verhungern, mussten wir notgedrungen mit dem feindlichen Anführer verhandeln, einem Mann namens Sayf Din Zarrak. Das hätten wir besser nicht getan. Dieser ehrlose Verräter sicherte uns Rittern und unseren syrischen Bediensteten freien Abzug zu, doch kaum hatten wir die Burg verlassen, befahl Zarrak, uns am Strand zusammenzutreiben. Dort fielen seine Männer mit Schwertern und Säbeln über uns her, bis die meisten meiner Ordensbrüder tot waren. Ihre Leichen warf man ins Meer. Die Verwundeten wurden auf Schiffen nach Kairo verschleppt. Dies geschah am 26. Tag des Monats September im Jahre des Herrn 1302.«
Matteo schnappte schockiert nach Luft. »Barmherziger Gott, vor fünf Jahren also. So lange harrt Ihr schon hier in diesem Kerker aus?«
Der Templer sah Matteo verwirrt an. »Fünf Jahre, sagst du? Das hätte ich nicht erwartet. Es kommt mir so vor, als habe man mich erst gestern hierhergebracht. Aber ich will dir gern glauben. Folglich schreiben wir inzwischen das Jahr …«
»1307, Herr«, ergänzte Matteo bereitwillig. Es wunderte ihn keineswegs, dass der Templer sein Gefühl für Zeit verloren hatte. Vermutlich würde es ihm selbst bald ebenso ergehen. Er würde vergessen, welchen Wochentag sie schrieben oder ob Sommer oder Winter herrschte. Irgendwann würde er Ratten hinterherjagen und sich nicht mehr an die Gesichter seiner Eltern erinnern.
»Sayf Din Zarrak hatte vor, ein paar überlebende Templer in seine Dienste zu nehmen«, fuhr sein Mitgefangener fort. »Als Offiziere für sein Mameluckenheer wären wir ihm mit unseren Kenntnissen im Waffenhandwerk gerade recht gekommen. Vermutlich träumt er noch heute davon, dieser Schuft. Was für ein Triumph wäre das für ihn gewesen. Ich stelle mir gern vor, wie er geflucht haben muss, als keiner von uns Rittern seinem Glauben abschwor und zu den Mamelucken überlief.«
Matteo stimmte nicht in das trotzige Gelächter des Mannes ein, denn er bezweifelte, dass der Befehlshaber sich überhaupt an den letzten überlebenden Templer in seinem Kerker erinnerte. Dass dieser noch lebte, verdankte er nicht Sayf Din Zarrak, sondern irgendwem in der Stadt, der den Kerkermeister aus unbekannten Gründen dafür bezahlte, seinen Gefangenen nicht verdursten zu lassen.
Die nächsten Tage vergingen für Matteo qualvoll langsam. Der Heisere hielt zwar Wort und ließ ihm durch den Wächter Brot, bröckeligen Käse und Wasser in einem Korb hinunter, aber darüber hinaus blieb er sich selbst und seiner Angst überlassen. Nachdem sein Mitgefangener sich zu Beginn recht offen und redselig gezeigt hatte, zog er sich nun wieder in seine Nische zurück und richtete nur selten das Wort an Matteo. Allmählich vermutete Matteo, dass der Templer nicht mehr recht bei Verstand war. Er bestand nämlich darauf, den Tagesablauf, den er von früher her gewohnt war, auch im Kerker zu pflegen. Dazu gehörten regelmäßige lange Gebete sowie Tätigkeiten, die Matteo verrückt vorkamen. So kroch der Templer jeden Morgen nach Sonnenaufgang aus dem Stroh und tat so, als ginge er irgendwelchen Arbeiten nach. Mal gab er vor, ein Pferd zu striegeln, mal reinigte er ein Schwert, das es jedoch nur in seiner Vorstellung gab. Nach einigen Wochen forderte er Matteo sogar zu Waffenübungen auf.
»Du siehst mir nicht so aus, als könntest du deine Haut verteidigen! Nun steh schon auf! Ich kann dir einiges beibringen!« Der Templer brach einen Stab in zwei Hälften und warf Matteo eine davon zu. »Ein besseres Schwert kann ich dir momentan leider nicht bieten, aber es wird schon seinen Zweck erfüllen!«
Verrückter Kerl, dachte Matteo und kehrte dem Templer den Rücken zu. Er war nicht darauf aus, sich mit ihm herumzubalgen, wunderte sich aber gleichzeitig, wie der Mann es überhaupt schaffte, so sicher auf beiden Beinen zu stehen. Er bediente sich zwar ungeniert von Matteos Brot und erlaubte ihm erst, selbst davon zu essen, nachdem er seine weitschweifigen Gebete beendet hatte, doch da schien es noch etwas anderes zu geben, das seinen unbändigen Willen stählte.
Nachdem Matteo den Templer eine Weile aus den Augenwinkeln beobachtet hatte, siegte die Neugierde. Vielleicht konnte es ja wirklich nichts schaden, wenn er sich von dem Mann ein wenig in der Waffenkunst unterweisen ließ. Das war besser, als den lieben langen Tag vor sich hinzubrüten.
Zu seinem Erstaunen erwies sich Matteo als gelehriger Schüler. In seiner Heimatstadt Genua war er oft wegen seiner gedrungenen Gestalt und den überflüssigen Pfunden um seine Hüften verspottet worden. Doch die hatte er im Kerker längst verloren. Anfangs musste er jede Menge Prügel einstecken und schlief abends mit blauen Flecken ein. Doch nach und nach wurde er wendiger und lernte, Schlägen auszuweichen. Es gelang ihm, Angriffe des Templers zu parieren und schließlich ertappte er sich dabei, dass er sich jeden Tag darauf freute, wenn die Sonne aufging und sein Mitgefangener ihn zu sich winkte, damit er mit ihm gemeinsam die Gebete sprach.
Eines Abends, als der Templer Matteos Unterricht gerade beendet und sich zum Gebet zurückgezogen hatte, wurde die Kerkertür aufgestoßen. Matteo erschrak, als er den Kopf hob und im Licht einer Laterne die verkniffenen Gesichtszüge des Heiseren erkannte. Der hatte sich seit Matteos Gefangennahme nicht mehr blicken lassen. Matteos Herz begann vor Aufregung zu flattern wie ein Kolibri. Wenn der Mann nach ihm sah, konnte das doch nur bedeuten, dass das Lösegeld bezahlt worden war. Ja, so musste es sein. Nach all diesen Wochen waren seine Gebete doch noch erhört worden. Er würde freikommen, Genua wiedersehen.
Er hob den Arm, doch bevor er die entscheidende Frage stellen konnte, schlug der Heisere die Tür zu. Matteo schnappte nach Luft, den Blick wie erstarrt nach oben gerichtet. So stand er lange da, ohne sich zu rühren. Dann brüllte er seine Enttäuschung in die Nacht hinaus.
Sein Mitgefangener sah ihm eine Weile zu, schließlich zuckte er gleichmütig mit den Achseln. »Warum regst du dich auf? Der Bursche wird dich bald aus diesem Loch herausholen.«
»Ach ja?« Matteo blickte den Templer böse an. »Woher zum Teufel wollt Ihr das wissen?«
»Er wäre sonst nicht gekommen. Nun weiß er, dass du bei Kräften bist und er dich gesund ausliefern kann.« Mit durchgestrecktem Rücken kam der Mann auf Matteo zu und legte ihm eine Hand auf die Schulter. In seinen Augen blitzte etwas auf, das Matteo beunruhigte.
»Das heißt aber auch, dass uns beiden nur noch wenig Zeit bleibt.«
»Zeit?« Matteo hob verwirrt die Augenbrauen. »Wofür denn?«
»Schweig jetzt und hör mir zu«, befahl der Templer in strengem Ton. »Vor einigen Jahren hat der Großmeister unseres Ordens sieben jungen Rittern etwas anvertraut, das einst in den Gewölben unter unserem früheren Hauptquartier in Jerusalem entdeckt wurde. Zu Jesu Zeiten hatten die Juden dort ihren Tempel. Nach ihm haben wir uns benannt, aber das ist unwichtig. Wichtig ist das Mysterium, auf das die sieben Ordensbrüder aufpassen sollen!«
»Ein … Mysterium?« Matteos Augen weiteten sich. »Etwa ein Schatz?«
Der Templer nickte. »Ich sollte einer dieser sieben Wächter sein, denn es gibt da noch etwas, von dem die anderen nichts wissen können, weil es erst später in Aruad gefunden wurde: eine alte Botschaft, die ebenso wichtig ist wie das Mysterium aus Jerusalem. Wie die Dinge liegen, ist außer mir niemand mehr am Leben, der die Botschaft kennt, aber …« Für einen Moment hielt er inne, und als er fortfuhr, klang seine Stimme zittrig. Vielleicht dachte er daran, dass er seinen Fund mit ins Grab nehmen würde.
»Seit ich in diesem Kerker bin, träume ich jede Nacht von einer Gefahr für den Orden«, sagte der Mann müde. »Ich weiß, dass es jemanden gibt, der finstere Pläne schmiedet, um uns zu vernichten. Frag mich nicht, woher diese Ahnung kommt, ich weiß es selbst nicht. Dafür weiß ich aber, dass viele meiner Waffenbrüder bald in ähnlichen Kerkern wie diesem verrotten werden, wenn das Unheil seinen Lauf nimmt. Ich werde sie nicht warnen können, weil ich hier nicht mehr herauskomme. Aber du, mein Junge …«
Matteo schluckte schwer, als der Mann seine Hand drückte. Auf dieselbe Weise hatte sich sein Vater im Hafen von Genua von ihm verabschiedet. Ein Zufall? Oder hatten die Stimmen recht, die den Templern Umgang mit finsteren Mächten unterstellten?
»Ich soll in eurem Auftrag eine Botschaft überbringen, nicht wahr?«
Der Templer nickte eifrig. »Bring sie nach Zypern, und wenn du den Großmeister des Ordens dort nicht antriffst, geh nach Paris. Warne die Brüder und trage Sorge, dass die Botschaft, die ich dir mitgebe, sogleich in unser geheimes Archiv gebracht wird.«
»Ein … Geheimarchiv?«, fragte Matteo. »Wo ist das?«
»Das darf ich dir nicht sagen. Ich verspreche dir aber, dass man dich für deinen Botendienst belohnen wird. Du wirst genug Geld erhalten, um dein eigenes Handelshaus aufzubauen! Ein größeres und mächtigeres als das Unternehmen deines Vaters!«
Über Matteos Kopf wurde die Tür aufgerissen. Diesmal war es nicht der Heisere, sondern sein Helfershelfer, der dem jungen Mann etwas auf Arabisch zurief. Matteo verstand so viel, dass man ihn in einer Stunde holen würde. Eine Stunde. In nur einer Stunde würde dieser Albtraum für ihn zu Ende sein. Und er hatte schon das Schlimmste befürchtet.
»Also schön, Herr«, seufzte Matteo erleichtert. »Dann heraus mit der Sprache! Was soll ich Eurem Großmeister sagen?«
Der Templer lächelte. »Du musst ihm überhaupt nichts sagen!«
Flink bückte er sich nach einer der Holzschüsseln, und bevor Matteo auch nur aufschreien konnte, wurde er von einem dumpfen Schlag gegen den Kopf niedergestreckt. Er nahm noch wahr, wie ihm sanft der Kittel über den Kopf gezogen und sein Rücken entblößt wurde. Dann glitt er in eine tiefe Dunkelheit hinab.
I.
FRANKREICH, AUF DEM MARKTPLATZ VON BORDEAUX
12 JAHRE SPÄTER
Gelangweilt aß Prisca von Speyer einen Apfel und zählte dabei die steinernen Figuren, die das breite Hauptportal der Kathedrale St. André schmückten. Tags zuvor hatte sie ihren Großvater gefragt, wen die streng dreinblickenden Männer über dem Eingang darstellten.
»Das sind die Erzbischöfe von Bordeaux«, hatte der Alte ihr zugeflüstert. »Sie passen auf ihre Stadt auf. Wenn du dich ihnen anvertraust, werden sie auch auf dich ein Auge haben!«
Prisca hatte die leise Mahnung höflich zur Kenntnis genommen, jedoch nichts darauf erwidert. Wann wurde ihr Großvater endlich müde, sie zu seinem Glauben bekehren zu wollen? Er musste doch längst eingesehen haben, dass dies vergebliche Liebesmüh war. Sie war momentan eigentlich zufrieden mit ihrem Leben und suchte beileibe keine neuen Schwierigkeiten. Ein Glaubenswechsel würde aber unweigerlich Probleme nach sich ziehen.
Nach einer Weile löste die junge Frau ihren Blick von den bärtigen Steinfiguren, weil sie sich von ihnen beobachtet fühlte.
Die alten Bischöfe haben mich durchschaut, schoss es ihr durch den Kopf. Ihnen kann ich nichts vormachen. Sie wissen genau, wer ich bin und dass ich nicht hierhergehöre.
Prisca musste an die Skulptur der Jungfrau Maria denken, die über dem Eingang des Doms ihrer Heimatstadt Speyer thronte. Als Kind hatte sie sich die Maria manchmal angesehen und dabei nie auch nur eine Spur von Zurückweisung wahrgenommen. Im Gegenteil, die steinerne Figur war ihr wie eine gütige Verwandte vorgekommen, eine Vertraute, die tief in das Herz eines kleinen Mädchens hatte blicken können. Maria, so viel wusste Prisca, hatte in ihrem Leben viel Leid erdulden müssen. Ihre Angehörigen waren getötet, sie selbst von ihren Widersachern von Versteck zu Versteck gehetzt worden. Auch Priscas Dasein war bislang kein Topf süßer Honig gewesen. Als Kind einer verbotenen Liebe war sie unter ihren eigenen Leuten eine Art wandelndes Schandmal gewesen, verachtet und an den Rand gedrängt. Bis sie ihre Begabung für die Heilkunde entdeckt und diese Gabe in den Dienst kranker Menschen gestellt hatte. Ihre Mutter hatte ihr dabei nach Kräften geholfen. Geschwächt und bereits vom Tode gezeichnet, war es ihr noch gelungen, Prisca bei einem heilkundigen Mann unterzubringen, der sie in Anatomie, Philosophie, Kräuterkunde und Mystik unterrichtet hatte. Mit Feuereifer hatte sich Prisca in das Studium medizinischer Schriften gestürzt und schließlich die Erlaubnis des Bischofs von Speyer erhalten, als Ärztin in ihrer Heimatstadt zu wirken. Die Verantwortung für die Kranken hatte ihr über den Verlust der geliebten Mutter hinweggeholfen, die bald darauf gestorben war. Seitdem waren viele Jahre vergangen, doch noch immer dachte Prisca mit Wehmut an die Krankenstube zurück, ein richtiges kleines Spital, in dem sie Menschen behandelt und Arzneien gemischt hatte.
Eines Tages war dann Priscas leiblicher Vater in der Stadt aufgetaucht und hatte sie um Hilfe gebeten. Was Prisca über ihn und seine Herkunft erfahren hatte, hatte ihr Leben für immer verändert. Nach seinem Tod hatte sie ihre geliebte Heimat am Rhein verlassen und war nach Aquitanien gegangen, um dort nach Verwandten ihres Vaters zu suchen.
In der Kathedrale war die Messe noch in vollem Gange. Priscas Großvater und seine Tochter Adaliz, die nur wenige Jahre älter als Prisca und daher mehr Freundin als Tante war, befanden sich unter den Gläubigen, die soeben ein weihevolles Lied anstimmten. Der Chorgesang klang hübsch, das musste Prisca, die Musik über alles liebte, zugeben. Sogar ein paar englische Soldaten, welche Bordeaux seit einiger Zeit besetzten, waren stehen geblieben, um zu lauschen. Einer der Männer warf Prisca einen schmachtenden Blick zu. Vielleicht fragte er sich, warum das dunkelhaarige Mädchen hier draußen vor dem Portal stand, anstatt bei den Gläubigen in der Kathedrale zu sein. Prisca kehrte ihm rasch den Rücken zu. Sie suchte keinen Ärger mit den Engländern, aber auch keine Nähe zu ihnen. Und was den Gottesdienst betraf: Dies war ihre Angelegenheit und ging keinen etwas an. Dass sie Adaliz mit ihrer Weigerung, die heilige Messe zu besuchen, enttäuschte, bekümmerte sie, ändern konnte sie es aber nicht. Ebenso wenig, wie sie ihre Herkunft verleugnen konnte.
Prisca war Jüdin, wie schon ihre Mutter und deren Mutter vor ihr Jüdinnen gewesen waren. Geboren im Judenviertel der alten Bischofsstadt Speyer, war ihr von klein auf beigebracht worden, sich von den Christen fernzuhalten, die sich ihnen gegenüber oft feindselig gaben, dafür aber die zahlreichen Gebote des Volkes Israel zu befolgen. Inzwischen gab es für Prisca tausend Gründe, ihre Vergangenheit abzustreifen.
Warum auch nicht? Schließlich lebte sie nicht mehr in einer engen Gasse am Rhein, sondern auf den Gütern der Familie ihres Vaters, der, wie sie nun wusste, einem alten ritterlichen Geschlecht entstammte. Doch obwohl Prisca aufgehört hatte, die Gebote ihrer Kindheit zu befolgen, empfand sie eine gewisse Scheu, sich einem neuen Glauben zuzuwenden. Ihre Weigerung, die christliche Taufe zu empfangen und in ihrer Umgebung aufzugehen, machte ihr Leben auf den Besitzungen des alten Balthasar de Gros nicht leichter. Nach den Dekreten der Kirche und des Königs von Frankreich war es ihrem Großvater verboten, sie als einzige Tochter seines verstorbenen Sohnes und somit als dessen Erbin anzuerkennen. König Philipp, den man auch den Langen nannte, konnte jederzeit eine Verfügung erlassen, welche die Juden binnen kürzester Zeit aus Frankreich verbannte. Zuletzt hatte dies der Vater des Königs angeordnet. Er hatte die jüdischen Kaufleute vertrieben, ihr Vermögen jedoch einbehalten. Inzwischen waren einige der Juden zurückgekehrt, auch nach Bordeaux, aber Priscas Großvater hatte ihr streng verboten, mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Dass Balthasar de Gros sie unter seinem Dach duldete, setzte ihn ohnehin schon der Verachtung seiner Nachbarn aus. Er ertrug sie, ohne viele Worte darüber zu verlieren, doch Prisca ahnte, dass er ihr insgeheim die Schuld dafür gab. Am liebsten hätte sie das Gut schon vor Monaten verlassen, aber Balthasar war in der Nacht vor Allerseelen am Fleckfieber erkrankt, und Prisca hatte es nicht übers Herz gebracht, ihn leidend zurückzulassen. Gemeinsam mit Adaliz hatte sie ihn hingebungsvoll gepflegt, bis er endlich wieder aufstehen konnte. Kaum genesen, hatte er Familie und Freunde dann mit dem Vorhaben überrascht, nach Bordeaux zu reisen, um der Kathedrale Saint André als Dank für seine Rettung eine großzügige Stiftung zu machen. Weder Drohungen noch gutes Zureden hatten den Alten davon abgebracht, die strapaziöse Reise anzutreten. Was Balthasar in Wahrheit in die Stadt trieb, hatte er Prisca erst ein paar Tage nach ihrer Ankunft offenbart.
Als die Glocken von Saint André zu läuten begannen, dauerte es nicht lange, bis die ersten Männer und Frauen hinaus ins Freie strömten. Balthasar und Adaliz ließen indes auf sich warten. Dafür fing Prisca den Blick eines blonden Jünglings auf, der sich an der Seite eines älteren Mannes durch das Hauptportal schob. Beide waren breitschultrig und hochgewachsen, der junge Mann vielleicht eine Handbreit größer. Obwohl ihre Kleidung nicht viel hermachte, stachen sie aufgrund ihrer würdevollen Ausstrahlung aus der Menge heraus. Der junge Mann war hellhäutig wie ein Nordmann und verfügte über ein fein geschnittenes Gesicht mit hohen Wangenknochen. Seine leicht schräg stehenden kornblumenblauen Augen blinzelten vergnügt, obwohl die Sonne sich zu dieser frühen Morgenstunde noch hinter tiefen Wolken verbarg. Die ganze Gestalt wirkte etwas schlaksig, was durch die lässige Angewohnheit des Mannes, beim Gehen die Arme zu bewegen, untermalt wurde. Während sein Lächeln offen und freundlich wirkte, offenbarte das Mienenspiel seines Begleiters eher düstere Züge. Für Heiterkeit schien er wenig übrig zu haben, für ein würdevolles Auftreten hingegen umso mehr. Sein Gesicht mit dem markanten, gespaltenen Kinn wurde von einem gestutzten Vollbart umrahmt, der seinem Ausdruck eine gewisse Strenge verlieh. Das Haupthaar trug er kurz; es war fast so dunkel wie die stechenden Augen, die unter den buschigen Brauen fast in den Höhlen verschwanden.
Als der Mann Prisca bemerkte, kam er mit langen Schritten auf sie zu, wobei er seine Nase rümpfte, als wäre er soeben in einen Haufen Pferdemist getreten.
»Habt Ihr gewusst, was Euer Großvater vorhat?«, rief er. »Ach, was frage ich noch! Natürlich habt Ihr, das sehe ich Euch an. Dieser Ausflug nach Bordeaux hätte mich stutzig machen sollen! Dankgebete und Schenkungen! Ha! Das hätte der Alte auch von zu Hause aus erledigen können.«
»Beruhigt Euch doch, Rémy«, bat Prisca, die sich immer unbehaglich fühlte, wenn jemand vor aller Augen laut wurde. »Die Leute starren uns schon an!«
»Das ist mir gleich! Von Euch, meine Liebe, will ich wissen, wann Ihr vorhattet, mich in Balthasar de Gros’ Pläne einzuweihen?«
Prisca seufzte schwer. Dass Rémy sich ärgerte, weil er als Geleitschutz der Familie nicht über die geänderten Pläne des alten Gutsherrn in Kenntnis gesetzt worden war, konnte sie durchaus nachvollziehen. Doch war es ihm jemals in den Sinn gekommen, dass ihr Großvater nicht nur ihn, sondern auch sie vor vollendete Tatsachen gestellt hatte? Offensichtlich nicht. Aber so war Rémy St. Clair nun einmal: leicht reizbar, oft miserabel gelaunt und kein Freund von Geheimnissen – sofern es sich nicht um seine eigenen handelte. Er war der Meinung, dass er über alles, was um ihn herum geschah, informiert werden musste, ob es ihn etwas anging oder nicht. Und die Entscheidungen des Gutsherrn, der Rémy und seine Freunde schon seit Monaten beherbergte, gingen ihn wahrhaftig nichts an. Zu gern hätte Prisca ihm das auf die Nase gebunden, denn sie fand es ungerecht, sie anzufahren. Konnte sie etwas für den Starrsinn des Alten? Sie wurde unter seinem Dach allenfalls geduldet, mehr aber auch nicht. Das wusste Rémy ganz genau.
Manchmal fragte sich Prisca, warum der vor fast sechs Jahren in Paris hingerichtete Großmeister des Templerordens ausgerechnet Rémy zu einem seiner engsten Vertrauten berufen hatte. Was mochte es gewesen sein, was der Templer an ihm geschätzt hatte? Seine Sturheit oder sein aufbrausendes Wesen?
Doch Prisca wusste, dass sie dem Ritter damit unrecht tat. Rémy St. Clair mochte zu Jähzorn neigen, aber tief in ihm versteckt gab es auch eine andere, sanfte Seite, die er unter einem dicken Panzer aus Argwohn und Schroffheit verbarg. Vor ihrer Abreise hatte Prisca den Ritter einige Male traurige gälische Lieder singen hören, wenn er sich am Ufer des Dorfbachs unbeobachtet gewähnt hatte. Dort, nahe den Überresten eines Steins aus römischen Zeiten, befand sich das Grab eines seiner Ordensbrüder, der im Kampf gegen gemeinsame Feinde sein Leben verloren hatte. Der gefühlvolle Gesang des sonst so wortkargen Ritters hatte Prisca zu Tränen gerührt. Das Leben mochte mit Rémy hart umgesprungen sein, vor allem nach dem Untergang des Ordens, dem er sein Leben geweiht hatte, dennoch war er tief im Herzen ein mitfühlender Mensch. Dass ihm in letzter Zeit häufiger der Geduldsfaden riss, lag vermutlich daran, dass er sich auf Balthasar de Gros’ Gut zu Tode langweilte. Für einen Templer, der im Heiligen Land einst gegen die Sarazenen gekämpft, später geheimnisvolle Reliquien des Ordens beschützt und zuletzt als Waffenmeister des Markgrafen von Brandenburg gedient hatte, war das Leben auf einem langweiligen Landgut nicht gerade die Erfüllung seiner Träume.
Schon gar nicht, wenn andernorts dringende Pflichten auf ihn warteten.
Doch wie Prisca hatten auch Rémy und seine Gefährten es abgelehnt, den Besitz des Alten zu verlassen, solange dieser fieberkrank gewesen war. Dies verbat den Männern ihr Ehrgefühl. Von Heilkunde und Krankenpflege verstand Rémy wenig, das überließ er lieber den Weibern. Doch um sich nützlich zu machen, hatte er die umfangreichen Bauarbeiten am Herrenhaus beaufsichtigt und sich gemeinsam mit seinen Gefährten um den Schutz des nahen Dorfes gekümmert. Inzwischen war der Winter überstanden, die Natur erwachte wieder aus ihrem tiefen Schlaf, und Prisca ahnte, dass Rémy ein Kribbeln verspürte, das ihm sagte, dass er schon zu lange in Aquitanien weilte.
Der junge Blondschopf machte hinter dem Rücken des Ritters eine Geste, die Prisca warnen sollte, ihm zu widersprechen. Er hieß Primus von Tempelhof, ein Name, den er sich am Hof des Markgrafen Waldemar von Brandenburg zugelegt hatte. Er trug ihn mit einer Mischung aus Stolz und Spott, denn wer ihn näher kannte, wusste auch, dass er nicht von edler Geburt, sondern ein Waisenjunge war und seine Kindheit unter den Knechten einer Templerkomturei im Osten des Deutschen Reiches zugebracht hatte. Nicht einmal einen richtigen Taufnamen hatte man ihm als Knaben zugestanden. Er hieß Primus, was der Erste bedeutete, weil ein Dorfpfarrer ihn am Neujahrsmorgen vor einer Templerkapelle gefunden hatte. Als Ritter hätte Primus allen Grund gehabt, seine Herkunft zu verheimlichen, aber er tat es nicht. »Wer weiß schon, ob ich nicht von edlerer Geburt als alle meine Freunde und nur versehentlich vom Wagen gefallen bin«, hatte er einmal zu Prisca gesagt.
Als der junge Ritter Prisca aufmunternd anlächelte, errötete sie. Verärgert biss sie sich auf die Lippen. Dieser Primus war wirklich eine Plage. Warum musste er sie immer auf diese Weise ansehen? Hatte sie ihm nicht schon hunderttausendmal gesagt, dass er das lassen sollte? Warum behandelte er sie nicht ebenso schroff wie Rémy? Damit wäre sie wesentlich besser zurechtgekommen. Wenn er sie aber auf diese Weise ansah …
Sie seufzte. Adaliz hatte sie schon damit geneckt, dass der junge Primus vernarrt in sie sei, was Prisca stets empört abstritt. Sie und dieser Herumtreiber ohne Namen? Der vom Wagen gefallene Templerknecht? Absurd. Nein, aus ihr und Primus konnte nichts werden, es gab viel zu viel, was sie trennte. Überhaupt waren Rémy St. Clair und seine Freunde alte Waffengefährten ihres Vaters, mehr nicht. Sie hatten geschworen, ein Geheimnis des Templerordens zu bewahren, und anscheinend gehörte zu diesem Eid auch, dass sie sich um Prisca kümmerten wie um ein Küken.
»Ich muss den Befehlen meines Großvaters gehorchen«, erklärte Prisca nach einigem Zögern. »Ihm lag viel daran, dass nicht zu viele Menschen von seiner bevorstehenden Reise erfahren.«
»Nicht zu viele?« Rémy St. Clair stemmte die Hände in die Hüften, um seine Meinung dazu kundzutun, doch dann sah er Balthasar de Gros aus der Kathedrale kommen. Der alte Mann begab sich nicht sofort zu ihnen, sondern wartete geduldig, bis seine Tochter Adaliz ein paar Münzen aus ihrem Gürtelbeutel genommen und in die Schalen der Bettler geworfen hatte, die in großer Anzahl vor der Kirche auf Almosen warteten. Im Nu war die hübsche junge Frau von einer Schar zerlumpter, humpelnder Gestalten umringt, die ihre schmutzigen Hände nach ihrem Kleid ausstreckten. Ihr Vater schritt nicht ein, sondern unterhielt sich seelenruhig mit einem Bettelmönch, der ein schwer bepacktes Maultier an einem Strick führte.
»Eure Tante braucht Hilfe«, brummte Rémy grimmig. »Was mischt sie sich auch unter dieses Gesindel? Hat sie nicht genug für die Armen gegeben? Seit wir in Bordeaux sind, rennt sie jeden Morgen noch vor dem ersten Hahnenschrei nach Saint André oder zu den Benediktinern von Sainte-Croix.«
»Sie betet nicht nur, sondern handelt auch, wie eine gute Christin es tun sollte«, meinte Primus. »Sagt nicht der heilige Jakobus, dass der Glaube ohne Werke tot sei?«
Rémy öffnete empört den Mund, verkniff sich aber eine Antwort. Er hatte sich noch nicht so recht daran gewöhnt, dass Primus inzwischen ein Ritter und kein untergebener Bediensteter mehr war, der zu allem schweigen musste. Um den anderen zu zeigen, dass auch er ein Mann der Tat war, eilte er mit grimmiger Miene an den Ständen der Kramhändler und Bauern vorbei, nahm die überraschte Adaliz bei der Hand und zerrte sie aus dem Kreis der Bettler heraus. Prisca beobachtete, wie Adaliz sich sträubte, doch ein gereizter Blick des ehemaligen Templers genügte, ihren Protest verstummen zu lassen.
II.
Balthasar de Gros hatte seine Familie, Rémy und Primus nicht in einem Gasthof, sondern im Haus eines Bekannten untergebracht, eines wohlhabenden Kaufmanns, der nicht weit von St. André über einen Handelshof mit Wirtschaftsgebäuden und Pferdeställen verfügte. Da der Mann auf Reisen war, standen einige Kammern seines stattlichen Fachwerkhauses in der Rue de la Croix leer. Am liebsten hielt sich Priscas Großvater in einem mit dunklen Eichenmöbeln möblierten Raum auf, in dem es zwar muffig roch, der dafür aber über die Annehmlichkeit eines Kamins verfügte. Balthasar fühlte sich zwar nicht mehr krank, fror jedoch seit der Zeit seiner Fieberanfälle häufig und ließ daher schon in aller Früh das Feuer anfachen. Die beiden Fenster des Raumes durften in seiner Gegenwart nicht geöffnet werden, da er fest daran glaubte, dass kühle Luft seine Lungen angriff.
»Sieh zu, dass man uns etwas zu essen bringen lässt«, trug der alte Mann Adaliz nach ihrer Rückkehr auf. Prisca war froh, das zu hören, denn trotz des Apfels, den sie vor der Kathedrale gegessen hatte, knurrte ihr Magen bereits. Auch Rémy und Primus sahen aus, als wären sie einer Mahlzeit nicht abgeneigt. Wenig später standen Schüsseln mit gesottenem Ziegenfleisch in fetter Brühe, Käse und Weizenmehlfladen vor ihnen auf dem Tisch, die frisch aus dem Ofen kamen. Balthasars alter Freund, der für seine Gastfreundschaft berühmt war, hatte seinem im Haus verbliebenen Gesinde aufgetragen, es den Leuten des Gutsherrn an nichts fehlen zu lassen. Wie die Männer so griff auch Prisca ordentlich zu und ließ sich die Speisen sowie den verdünnten Wein schmecken, der von einer Magd des Kaufmanns serviert wurde.
»Natürlich habe ich nichts dagegen, wenn Ihr auf eine Pilgerfahrt geht«, ergriff Rémy nach einer Weile kauend das Wort. »Aber muss das ausgerechnet jetzt sein? Überall ist von Aufruhr die Rede, sogar von einem drohenden Krieg zwischen Franzosen und Engländern! Edward III. befehligt die besten Bogenschützen der Welt.«
Balthasar vergrub seine Schultern fröstelnd in seinem ausladenden Pelzkragen. Er war ein stämmiger Mann mit schlohweißem, gewelltem Haar und einem Gesicht, in das die Sorge um seinen Besitz tiefe Kerben und Kratzer geschlagen hatte. Von den Beschwerden des Alters war er bislang verschont geblieben. Sogar sein Schwert nahm er noch gelegentlich zur Hand. »Ihr wisst ebenso gut wie ich, dass die Pilgerreise nicht meine Idee war«, entgegnete er auf Rémys Frage. »Sie wurde mir vom Bischof von Pamiers als Buße für meine Sünden auferlegt, und nun, nachdem ich dank der Gnade des Himmels wieder munter bin, muss ich sie auch antreten.«
Prisca seufzte leise. Diese dumme Buße hatte sie schon fast vergessen, aber es entsprach der Wahrheit, was ihr Großvater sagte. Vor einer Weile hatte sich der Gutsherr auf einen Streit mit dem Bischof eingelassen und war sogar in den Verdacht der Ketzerei geraten. Dass sein Sohn, Priscas Vater, sich als Tempelritter einst den Prozessen des Königs entzogen hatte und untergetaucht war, hatte diesen Verdacht erhärtet. Balthasar konnte von Glück reden, dass er mit einem blauen Auge aus der Sache herausgekommen war. Der Bischof hatte ihm unter dem Vorbehalt verziehen, dass er eine Weile auf sein Leben als Herr der weitläufigen Güter von Pouillon in der Provinz Aquitanien verzichtete und stattdessen eine Wallfahrt unternahm, die nicht weniger Zeit als ein Jahr in Anspruch nehmen durfte. Hinzu sollten fromme Stiftungen an das Kloster Saint-Jacques sowie die Höfe der Aussätzigen in Bordeaux und Arles kommen.
»Noch bin ich rüstig genug, um mein Versprechen einzulösen«, gab Balthasar de Gros zu bedenken. »Aber wer weiß, wie lange ich noch bei Kräften bleibe? Sollte ich die Buße ein bis zwei Jahre aufschieben, bin ich womöglich nicht mehr gut zu Fuß. Oder mich trifft unterwegs der Schlag. Natürlich könnte ich auch zu Hause bleiben, bis ich zu tattrig geworden bin, um den Pilgerstab zu nehmen. Aber dann würde ich riskieren, dass mich der Bischof des Eidbruchs anklagt. Die Folgen wären höchst unerfreulich.«
»In diesem Fall fiele Vaters Besitz an das Bistum«, erklärte Adaliz mit glühenden Wangen. Hastig schlug sie den Blick nieder, als sie merkte, dass alle am Tisch sie anstarrten.
Rémy verdrehte prompt die Augen. »Eure Tochter scheint diesen Tag herbeizusehnen!«
»Unsinn! Adaliz lebt nur für den Besitz der de Gros’ und ihr Erbe. Nicht wahr, mein Kind?«
Die junge Edeldame stimmte hastig zu, doch Prisca nahm ihr nicht ab, dass es ihr damit ernst war. Adaliz’ Hingabe an die Kirche hatte in den vergangenen Monaten Züge angenommen, die sie mit Sorge erfüllte. Sie verschenkte kostbare Kleider, Gürtel und Schuhe, stickte Altartücher für die Nonnen umliegender Klöster und verbrachte ganze Nächte im Gebet. Hin und wieder schrieb sie lange Briefe an den Bischof, wollte aber niemandem verraten, worüber sie sich mit ihm austauschte. Prisca konnte verstehen, dass ihre Tante sich nach göttlichem Trost sehnte. Immerhin hatte Adaliz den Verlust geliebter Menschen verkraften müssen, dazu noch die Beschuldigungen gegen ihren Vater. Sie hatte einen Bruder, der als Templer möglicherweise mit bösen Mächten paktiert hatte, und zu allem Überfluss eine Nichte, die es ablehnte, ihren Priestern zuzuhören. Wen wunderte es da, dass Adaliz erpicht darauf war, sich einen Platz im Himmel zu kaufen. Wenn es sein musste, auch mit Hilfe des Bischofs von Pamiers. »Sammelt nicht Schätze auf Erden, wo Motten und Rost sie zerfressen.« Stand es so nicht in den Büchern der Christen?
»Ihr habt es gehört!« Balthasar nickte seiner Tochter huldvoll zu. »Adaliz hat mich übrigens gebeten, sie auf die Pilgerfahrt mitzunehmen. Ich habe es erlaubt. Die Reise wird uns einander wieder näherbringen. Adaliz wird ihrem alten Vater eine große Hilfe sein.«
»Na, davon bin ich überzeugt!« Rémy nahm einen kräftigen Schluck aus seinem Becher. Für gewöhnlich trank er nur wenig Wein, da ihm ein klarer Kopf über alles ging. Doch an diesem Morgen ließ er sich mehrere Male nachschenken.
»Und nun verlangt Ihr, dass wir auf Eurem Gut die Stellung halten und es gegen aufmüpfige Bauern, Räuber und gierige Bischöfe verteidigen?« Am Tisch wurde es still. Auch Prisca senkte verlegen den Blick. Sie hatte ihren Großvater als einen stolzen Mann kennengelernt, der auf Kränkungen oft mit heftigen Wutausbrüchen reagierte. Ihrer Einschätzung nach hasste er nichts so sehr, wie jemanden um einen Gefallen bitten zu müssen. Daher machte sie sich schon auf ein heftiges Wortgefecht gefasst.
Doch Balthasar wurde nicht wütend. Nicht einmal die Stimme erhob er. Stattdessen sagte er in ruhigem Ton: »Ich könnte gut verstehen, wenn Ihr das ablehnen würdet, lieber Rémy. Ihr wollt nach Portugal weiterziehen, nicht wahr? Und das so rasch wie möglich, um Euer Schwert in die Dienste dieses neuen Ordens zu stellen.« Nachdenklich kratzte er sich am Kopf. »Wie nannte der sich noch gleich?«
»Ihr meint den Christusorden!«
»Ja, richtig! Der portugiesische König Dinis muss recht enttäuscht gewesen sein, weil keiner von euch sich bislang entschließen konnte, sein großzügiges Angebot anzunehmen und in den Orden einzutreten. Dabei sollen dort Templer Aufnahme gefunden haben, die der Inquisition hierzulande entkommen sind.«
Rémy verzog das Gesicht, denn daran wurde er nur höchst ungern erinnert. In der Tat hatte er mit Primus und vier weiteren ehemaligen Ordensbrüder das Deutsche Reich verlassen, um in Portugal ein neues Leben zu beginnen. Der portugiesische Christusorden bot ihnen Schutz vor den Verfolgungen, die sie als Templer in ihrer Heimat hatten erdulden müssen. Ein Mann mit Rémys Erfahrung hatte die Möglichkeit, in der Ordenshierarchie rasch aufzusteigen, ja vielleicht sogar Großmeister zu werden. Dessen ungeachtet gab es Gründe dafür, dass Rémy bislang nicht nach Portugal weitergereist war. Gründe, die Prisca, nicht aber ihrem Großvater bekannt waren.
Rémy stand auf, um sich am Kamin die Hände zu wärmen, denn im Raum herrschte eine feuchte Kälte, gegen die selbst das Feuer einen vergeblichen Kampf führte. Das Wetter war während der letzten Monate in der ganzen Provinz schlecht gewesen. Es regnete häufiger als in zurückliegenden Jahren. Die Wege waren schlammig, die Flüsse führten zu viel Wasser, was das Reisen gefährlich machte. Die Bauern klagten über verfaultes Korn auf den Äckern.
Prisca ahnte, was dem Ritter auf dem Herzen lag. Er befürchtete, weitere Wochen, vielleicht gar Monate auf dem Gut des alten Balthasar festzusitzen und den Auftrag, der ihm und seinen Leuten übertragen worden war, nicht erfüllen zu können. Dabei ging es um das Versprechen, das die Ritter einem Sterbenden gegeben hatten. Mit so etwas ging man nicht leichtfertig um.
»Monsieur Rémy und seine Freunde sind Eure Gäste«, erinnerte sie ihren Großvater. »Ihr habt sie eingeladen, zu bleiben, solange sie wollen. Aber wir dürfen sie nicht aufhalten. Auf dem Gut komme ich auch ohne ihre Hilfe zurecht!«
»Du?« Der alte Mann starrte sie an, als tanzte sie auf einem Seil über den Marktplatz. »Willst du dich über mich lustig machen, Mädchen? Als Bastardkind meines Sohnes Payen kann ich dir unmöglich meine Besitzungen anvertrauen. Damit wäre der Bischof von Pamiers niemals einverstanden. Seine Leute würden das Gut besetzen, vielleicht sogar die Mauern schleifen lassen. Dabei sind die gerade erst zum Feiertag der heiligen Cäcilie eingeweiht worden.«
Prisca schluckte. Daran hatte sie nicht gedacht. Auf dem Gutsbesitz der Edelleute de Gros hatte einmal eine Burg gestanden, die aber während der Kreuzzüge Simon de Montforts gegen die Katharer zerstört worden war. Von der Burg war nur noch der Donjon übrig geblieben, ein wehrhafter Turm mit dicken Mauern, in dem der Gutsherr und Adaliz ihre Gemächer hatten. Balthasars Ehrgeiz, die Burg seiner Väter wiederaufzubauen, verschlang Unsummen von Geld, doch immerhin war es ihm schon gelungen, sein Haus mit einer hohen Mauer zu umgeben.
»Ich werde nicht darum betteln, dass eine Schar fremder Ritter mein Haus bewacht«, rief Priscas Großvater. Demonstrativ verschränkte er die Arme. »Dann bleibe ich lieber hier und setze mein Seelenheil aufs Spiel. Der Bischof kann sich freuen!«
Bis auf Adaliz machten alle betretene Gesichter. Primus flüsterte Rémy etwas zu, woraufhin der ältere Ritter zuerst die Stirn runzelte, dann aber nickte. Er sah nicht glücklich aus, doch da er dem Bischof ebenso wenig traute wie einem Beutelschneider, willigte er ein, auf das Hofgut aufzupassen, solange Balthasar auf Reisen war.
»Eine Pilgerreise zum Grab des heiligen Jakobus nach Compostela wird schon nicht zu lange dauern«, sagte er in versöhnlichem Ton.
Balthasar wechselte einen vorsichtigen Blick mit Adaliz, die sogleich errötete. »Um ganz ehrlich zu sein, wir haben nicht vor, nach Compostela zu wandern.«
»Das wäre auch kein angemessener Ablass«, pflichtete Adaliz bei. Sie erhob sich und zog das blütenweiße Leinengebände glatt, unter dem sie ihr Haar verbarg. Eine hastige Entschuldigung murmelnd, eilte sie davon, wurde jedoch von Rémy am Arm gepackt, ehe sie den Raum verlassen konnte.
»Nicht so eilig, meine Gute! Wenn Ihr nicht zum Grab des heiligen Jakobus wollt, wohin zum Teufel dann?«
»Nach Rom«, verkündete Balthasar mit fester Stimme. »Und wenn Ihr nun so gütig wärt, meine Tochter loszulassen! Euer Benehmen ist manchmal …«
Er beendete seinen Satz nicht, weil unten auf der Straße plötzlich Lärm zu hören war. Reiter preschten im Galopp am Haus vorbei. Etwas klirrte. Eine Frau, vermutlich das Weib, das auf der Gasse Tonwaren feilbot, begann wie ein Rohrspatz zu schimpfen. Dann hämmerte jemand lautstark gegen die Eingangstür. Rémy stürzte zu seinem Schwertgurt, den er neben dem Kamin an einen Nagel gehängt hatte. Adaliz huschte hinter den Lehnstuhl ihres Vaters, wo sie ein Gebet zu murmeln begann. Im nächsten Moment wurde die Tür aufgerissen, und ein junger Mann stolperte in den Raum. Prisca erkannte ihn trotz der Schlammspritzer im Gesicht. Er hieß Roger und half seit Martini Balthasars Gutsverwalter Remigio, dessen Augen nicht mehr die besten waren. Der Junge war so atemlos, dass er zunächst kaum ein Wort herausbrachte. Dem Grad seiner Erschöpfung nach hatte er den Weg aus der Grafschaft Foix in die Stadt im Galopp zurückgelegt, ohne zu rasten.
Priscas Großvater runzelte die Stirn. »Roger?«, fragte er scharf. »Solltest du nicht auf dem Gut sein und dem Verwalter zur Hand gehen?«
Der junge Mann verbeugte sich vor seinem Herrn. Ohne auf die Frage zu antworten, fingerte er ein Stück Papier aus seiner Gürteltasche, welches er Balthasar reichte. Der nahm es zögernd entgegen und las.
»Was ist geschehen, Vater?«, erkundigte sich Adaliz aufgeschreckt. Sie ging zu Balthasar und versuchte, einen Blick auf das Schreiben zu erhaschen, was ihr aber nicht gelang, da ihr Vater ihr den Rücken zukehrte. »Schlechte Nachrichten von zu Hause?«
Prisca fand die Frage überflüssig. Rogers plötzliches Auftauchen und Balthasars besorgte Miene ließen kaum einen anderen Schluss zu.
Balthasar atmete ein paarmal durch, bevor er seinen Knecht scharf ins Auge fasste. »Wann sind sie eingetroffen?«
»Vor zwei Tagen, Herr! Wir mussten ihnen öffnen. Die Herren Ritter waren nicht da, bis auf den einen oben in der Turmkammer, und der … Nun ja, Ihr wisst schon!«
Rémy sah verärgert aus, weil er sich aus dem Gespräch der beiden Männer keinen Reim machen konnte. Auf dem Gut war etwas geschehen, was den Knecht durch Wind und Wetter gejagt hatte. Aber was?
Schließlich klopfte er energisch auf den Tisch. »Hättet Ihr die Güte, uns zu verraten, was diese Heimlichkeiten zu bedeuten haben, mein lieber Balthasar!«
Balthasar reichte Rémy den Brief. »Lest selbst!«
Während der Ritter die Zeilen las, wich alle Farbe aus seinem Gesicht. Sie kamen von seinem ehemaligen Ordensbruder Gottfried, der auf dem Gutshof geblieben war, und was er schrieb, klang gar nicht gut.
Balthasar de Gros streichelte Adaliz kurz über die Wange. »Keine Pilgerfahrt, keine Sühne, keine Vergebung«, murmelte er dabei. »Ich muss nach Hause!«
Rémy schüttelte energisch den Kopf. »O nein, Ihr pilgert und erfüllt die Buße, die Euch dieser Bischof auferlegt hat. Um alles Weitere werden wir uns kümmern, sobald wir auf Eurem Hof angekommen sind! Ich verspreche es Euch!«
Bevor der Alte protestieren konnte, trug Rémy Primus auf, die Pferde anspannen zu lassen und sich reisefertig zu machen.
III.
FRANKREICH, GUTSHOF DES BALTHASAR DE GROS,
FRÜHJAHR 1320
Der Erste von euch, der meine Sachen anfasst, ist ein toter Mann, verstanden?«