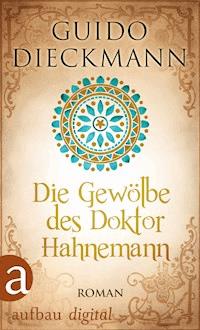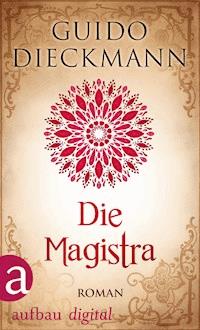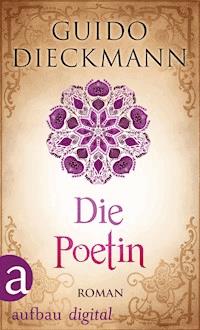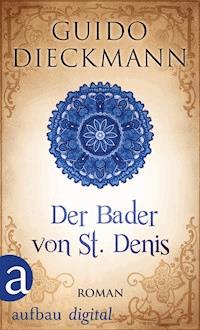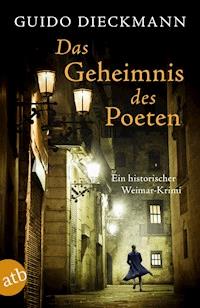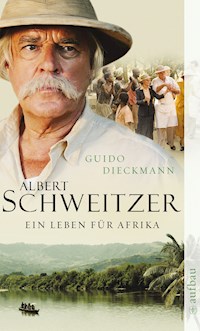
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Leben für Afrika.
1949 - in den ersten Jahren des Kalten Krieges. Der Urwald-Arzt Albert Schweitzer ist einer der am meisten bewunderten Menschen des Jahrhunderts. Doch während eines Besuches in den USA, den er zusammen mit seiner Frau Helene angetreten hat, um Spenden zu sammeln, wird er wegen seines Engagements gegen die Atombombe diffamiert. Plötzlich steht alles auf dem Spiel - sein Hospital "Lambarene" in Gabun und sein Ansehen als Arzt und Humanist. Mit fast 75 Jahren nimmt er eine der größten Herausforderungen seines Lebens an ...
Das Buch zum großen Film über die Legende Albert Schweitzer - in den Hauptrollen Jeroen Krabbé, Barbara Hershey, Judith Godrèche, Samuel West, Jonathan Firth, Armin Rohde u. v. a.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 479
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Guido Dieckmann
Albert Schweitzer
Ein Leben für Afrika
Roman
Impressum
ISBN 978-3-8412-0791-3
Aufbau Digital,
veröffentlicht im Aufbau Verlag, Berlin, Februar 2014
© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin
Die Originalausgabe erschien 2009 bei Aufbau Taschenbuch, einer Marke der Aufbau Verlag GmbH & Co. KG
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung und Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlages zulässig. Das gilt insbesondere für Übersetzungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie für das öffentliche Zugänglichmachen z.B. über das Internet.
Umschlaggestaltung capa Design, Anke Fesel
Covermotiv © NFP / Photo Stefan Falke
E-Book Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig, www.le-tex.de
www.aufbau-verlag.de
Inhaltsübersicht
Cover
Impressum
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
Epilog
Nachwort des Autors
Informationen zum Buch
Informationen zum Autor
Wem dieses Buch gefallen hat, der liest auch gerne …
Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt,
Das habt ihr mir getan.
Matthäus, 25, 40
Nachdenklich machen ist die tiefste Art zu begeistern.
Albert Schweitzer
Prolog
Straßburg, im Herbst 1905
Professor Fehling war ein Mann, der seine Pflichten als Dekan der Universität Straßburg trotz seines vorgerückten Alters stets gewissenhaft erfüllt hatte. Im Grunde lebte er für die Universität, etwas anderes interessierte ihn nicht. Dennoch war allseits bekannt, dass die Stunde vor dem Mittagsläuten für ihn heilig war. Weder Studenten noch Kollegen wagten es daher, den Gelehrten während dieser Zeit aufzusuchen oder um ein Gespräch zu bitten.
Auch an diesem regnerischen Herbstmorgen hatte es sich Professor Fehling mit der Morgenzeitung und einer Tasse Kaffee an seinem Schreibtisch im Dekanatsgebäude bequem gemacht, als sein Assistent den Raum betrat und einen Besucher ankündigte. Seufzend legte der Gelehrte seinen Löffel auf die Untertasse und warf dem hageren jungen Mann an der Tür durch seine dicken Brillengläser einen scharfen Blick zu.
»Muss das ausgerechnet jetzt sein? Seit den frühen Morgenstunden bin ich auf den Beinen, und das bei diesem scheußlichen Wetter.«
Der Professor stand auf, trat ans Fenster und hob die ergraute Gardine ein wenig an, damit er hinunter auf den mit Kopfstein gepflasterten Innenhof sehen konnte. Die Steine glänzten im Regen. Sie wirkten frisch gewaschen und rein. So mochte es Fehling. Zwei Studenten eilten mit wehenden Mänteln durch den Regen auf das Portal des Dekanatsgebäudes zu.
Missmutig klappte der Dekan seine Taschenuhr auf und starrte schweigend auf das Zifferblatt. Die letzte Vorlesung vor dem Mittagessen hatte bereits vor zehn Minuten begonnen. Er hasste Unpünktlichkeit, gleichgültig, um welche Art von Veranstaltung es sich handelte. Keiner der Professoren hatte seine Zeit gestohlen. Wann würden die jungen Leute das jemals einsehen?
Fehling begann vor dem zugigen Fenster zu frösteln. Im Studierzimmer gab es einen kleinen Kohleofen, doch dieser schaffte es nicht, dem großen Raum an kalten, regnerischen Tagen eine behagliche Note zu verleihen.
Der Assistent räusperte sich. »Herr Professor ...«
»Ach ja, Sie sagten, es wolle mich jemand sprechen. Ein Student? Richten Sie ihm aus, er soll die Vorlesungen abwarten und sich für heute Nachmittag ...«
»Aber Herr Dr. Schweitzer von der theologischen Fakultät wünscht, Sie zu sehen, Herr Dekan«, unterbrach ihn der junge Mann. Er sah unglücklich aus. »Dr. Schweitzer behauptet, er habe seinen Besuch bereits vor zwei Wochen angekündigt und müsse mit Ihnen dringend unter vier Augen reden. Es scheint so, als ließe er sich nicht vertrösten.«
Professor Fehlings Miene hellte sich ein wenig auf. Mit zwei geübten Handgriffen richtete er seinen Kragen und zog die gelockerte Krawatte straff, bevor er sich wieder zu seinem Stuhl hinter dem wuchtigen, schwarzen Eichentisch begab.
»Also wirklich, warum haben Sie das nicht gleich gesagt, Sie unglückseliger Mensch? Sie können doch Herrn Dr. Schweitzer nicht vor der Tür stehen lassen wie einen neunmalklugen Studiosus aus dem ersten Semester. Nur herein mit ihm, wenn ich bitten darf!«
Auf die steife Verbeugung des Assistenten betrat ein mittelgroßer, schlanker junger Mann das Zimmer des Dekans. Sein Anzug war zerknittert und roch nach feuchter Wolle. In seinem dichten dunklen Haar und dem ordentlich gestutzten Oberlippenbart glitzerten Regentröpfchen, die im Schein der Lampe wie Kristallsplitter aussahen. Der junge Mann schien längere Zeit durch den Regen gelaufen zu sein. Unentwegt strich er sich durch das zerzauste Haar, während Fehlings Assistent ihm aus dem Mantel half und dann mit Hut und Regenschirm im Vorzimmer verschwand.
Fehling fragte sich, warum Schweitzer seinen Schirm nicht benutzt hatte, wenn er ihn schon bei sich trug, hielt dies aber nicht wichtig genug, um den jungen Gelehrten darauf anzusprechen. Dr. Schweitzer war schließlich als brillant, aber auch als etwas zerstreut bekannt. Insbesondere betraf dies alltägliche Angelegenheiten, die nichts mit seinen Fachgebieten zu tun hatten. Soweit Professor Fehling sich erinnern konnte, hatte Albert Schweitzer, ein Pfarrersohn aus der elsässischen Provinz, nicht nur in Straßburg, sondern auch an der berühmten Pariser Sorbonne studiert. Nun, mit gerade einmal dreißig Jahren, hatte er bereits eine beeindruckende Laufbahn vorzuweisen. Er war Doktor der Philosophie, Privatdozent der Theologie, dazu ein wahres musikalisches Genie an der Orgel und hatte ein in Fachkreisen bedeutendes Buch über das Vermächtnis des Komponisten Johann Sebastian Bach geschrieben. Nicht nur an der Universität, in der ganzen Stadt redete man über Schweitzers Erfolge. Er wurde zu Abendgesellschaften in die ersten Häuser am Platz eingeladen, und so mancher Gelehrte hätte ihn sich wohl auch als Schwiegersohn gewünscht, denn der junge Wissenschaftler war mit seiner bescheidenen, freundlichen Art nicht nur bei seinen Studenten, sondern auch bei allen Kollegen beliebt.
»Was führt Sie denn an einem so grauen Oktobertag zu mir, mein Freund?«, wollte Professor Fehling wissen, nachdem er seinem Gast einen Stuhl und eine Tasse Kaffee angeboten hatte. Er lächelte den jungen Mann aufmunternd an, spürte er doch, dass diesem etwas auf der Seele lag. »Haben Sie Schwierigkeiten mit Ihren Vorlesungen? Einem Studenten? Oder handelt es sich um ein wissenschaftliches Problem, das Sie mit mir erörtern möchten?«
Albert Schweitzer hob abwehrend die Hand. »Nichts von alldem, Herr Dekan. Ich bin gekommen, um mich als Student der medizinischen Fakultät vorzustellen. Wenn es noch nicht zu spät für eine Immatrikulation ist, würde ich mein Studium gern noch im Oktober beginnen, damit ich nicht allzu viel Zeit verliere.«
Professor Fehling schüttelte verwirrt den Kopf. »Ich fürchte, ich verstehe Sie nicht, Herr Kollege. Sie sind ein erfolgreicher Wissenschaftler und dabei noch so jung, dass eine glänzende Karriere auf Sie wartet. Vor einigen Tagen berichtete mir der Rektor, dass er große Stücke auf Sie hält. Sie scheinen ihm ein rechter Wunderknabe zu sein, wobei Sie mir nicht übelnehmen dürfen, wenn ich als Mediziner solchen Begriffen stets skeptisch gegenüberstehe.«
Fehling ging zu seinem Bücherschrank, in dem er Dutzende von schweren, in Leder gebundenen Werken über die Anatomie des Menschen, Physiologie, Chemie, Physik, Zoologie und Botanik aufbewahrte. Eine Fundgrube des Wissens, die er im Laufe vieler Jahre in aller Welt zusammengetragen hatte und auf die er nicht stolzer hätte sein können. Energisch öffnete er den Schrank mit einem Schlüssel, der an seiner Uhrkette hing. Dann wählte er einige der Bücher aus und warf sie mit mürrischem Gesichtsausdruck vor Schweitzer auf den Schreibtisch.
»Die Medizin ist eine ernstzunehmende Wissenschaft und kein Steckenpferd für gelangweilte Philosophen. Seit vierzig Jahren bläue ich meinen Studenten ein, dass Sie niemals vergessen dürfen, wie wenig wir doch über die Krankheiten der Menschen wissen. Manche Leiden mögen wir inzwischen kurieren können, doch die meisten Geheimnisse des menschlichen Körpers und seines Geistes sind uns doch verborgen. Wir verstehen von ihnen bestenfalls soviel, wie in einen Fingerhut passt. Und nun kommen Sie, Philosoph, und glauben, den Herren Professoren ihre kostbare Zeit stehlen zu dürfen, indem Sie mit ihnen Fragen über den Sinn des Lebens, über Geist und Materie erörtern? Offen gesagt, halte ich das für infam.«
Schweitzer errötete vor Verlegenheit, doch er senkte den Blick nicht. »Aber nein, Sie haben mich missverstanden, Herr Dekan«, sagte er mit fester Stimme. »Ich käme niemals auf die Idee, Medizin und Heilkunde als philosophische Forschungsprojekte zu betrachten. Ich möchte ganz einfach Arzt werden.«
»Warum denn, zum Teufel? Warum wollen ausgerechnet Sie Arzt werden?«
Schweitzer atmete tief durch; die Selbstsicherheit, mit der er das Studierzimmer des Dekans betreten hatte, begann unter dessen strengem Blick nun doch ein wenig zu bröckeln. »Das ist nicht ganz einfach zu erklären ...«
»Falls Sie meine Zustimmung zu diesem aberwitzigen Vorhaben haben wollen, in Ihrem Alter noch einmal zu studieren, werden Sie um eine Erklärung aber nicht herumkommen, Schweitzer«, erwiderte Fehling kühl. »Also, reden Sie schon! Sie sind doch auf ihrem Lehrstuhl auch nicht um Worte verlegen.«
Schweitzer räusperte sich. Er dachte einen Moment lang nach, dann sagte er: »Nun, ich denke, alles fing damit an, dass ich mir als Student das Versprechen abnahm, nach Vollendung meines dreißigsten Lebensjahres nicht mehr nur an mich selbst und an mein berufliches Weiterkommen zu denken, sondern mein Leben in den Dienst einer guten Sache zu stellen.«
»Ihr Unterricht ist doch eine gute Sache. Jedenfalls schien er mir das bis heute zu sein.«
Schweitzer stand auf und begann im Studierzimmer auf und abzugehen. »Nein, so meine ich das nicht. Meine Forschungen auf dem Gebiet der Kulturphilosophie, die Kirchenkonzerte, die ich auf der Orgel gebe, all die hochgeistigen Gespräche mit Freunden und Kollegen hier an der Universität sind letzten Endes nur ein Widerhall meiner eigenen menschlichen Eitelkeit. Sie bringen mich keinen Schritt weiter, im Gegenteil, sie beginnen allmählich mich zu stören, mir die Luft zum Atmen zu nehmen. Ich möchte mein Leben lieber damit verbringen, etwas wahrhaft Sinnvolles zu tun.«
Professor Fehling seufzte. »Und das wäre ...«
»Was könnte sinnvoller sein, als kranken Menschen dort zu helfen, wo es kaum Ärzte und Hospitäler, dafür aber umso mehr Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung gibt?«
Albert Schweitzer blieb vor Fehlings Schreibtisch stehen und schlug eines seiner alten medizinischen Fachbücher auf. Beinahe ehrfurchtsvoll glitten seine Finger über die dunklen, abgegriffenen Seiten.
»Ich habe den Entschluss gefasst, nach Abschluss meiner Studien als Tropenarzt nach Afrika zu gehen.«
»Afrika? Aber mein lieber Freund, wer hat Ihnen denn nur diesen Floh ins Ohr gesetzt?« Die Stimme des Dekans klang nun nicht mehr verärgert, sondern besorgt. Eingehend betrachtete er den sonderbaren Mann, der so entschlossen wirkte wie kaum einer seiner Kollegen, und kam zu dem Schluss, dass vermutlich Erschöpfung und Überarbeitung seinen Gemütszustand hervorgerufen hatten. Vermutlich verbrachte Schweitzer seine Nächte nicht in den Armen einer jungen Frau, sondern allein an seinem Schreibtisch. Sein magerer Körper und die dunklen Ringe unter seinen Augen verrieten ihm, dass er zu wenig aß und schlief.
Vielleicht sollte ich mich mit den Kollegen der Psychiatrie beraten, überlegte Fehling, verwarf den Gedanken aber wieder. Wenn sich in Straßburg herumsprach, dass ausgerechnet er ein hochgeachtetes Mitglied des akademischen Lehrkörpers der Hysterie verdächtigte, konnte das nicht nur seinem eigenen Ruf schaden, sondern auch dem Ansehen des Rektors, der nach wie vor seine schützende Hand über Albert Schweitzer hielt. War der Junge nicht sogar mit dessen Tochter gut befreundet?
Schweitzer klappte geräuschvoll das Lehrbuch zu. Als er zu Fehling aufschaute, lagen in seinem Blick weder Unsicherheit noch Erschöpfung.
»Herr Dekan, wenn Sie mir das Studium der Medizin verweigern, sehe ich mich gezwungen, meine Bitte einer anderen Universität vorzutragen«, erklärte er ernst. »Mein Entschluss steht fest. Er ist unwiderruflich. Sobald ich meine Examina vor dem Kollegium abgelegt habe, trete ich die Reise ins französische Äquatorialafrika an, um dort für die Eingeborenen ein Hospital aufzubauen.«
»Sie werden auf große Schwierigkeiten stoßen, Schweitzer. Ist Ihnen das überhaupt klar?« Fehling lockerte seine Krawatte; der Knoten saß viel zu straff. So konnte doch kein Mensch atmen. Er öffnete auch die Manschettenknöpfe und streifte langsam die Ärmelaufschläge ab. Für ihn war nun alles gesagt. Mehr Zeit wollte er den verrückten Ansichten dieses Philosophen nicht opfern.
Ein Hospital in Afrika. Ein Leben unter Wilden. Wenn Schweitzer sich unbedingt in ganz Straßburg lächerlich machen wollte, sollte er ruhig Medizin studieren und zu den Eingeborenen fahren. Vermutlich würden die ihn erschlagen, lange bevor er eine Strohhütte gebaut und die erste Behandlung durchgeführt hatte.
Ihn ging das alles nichts mehr an.
Vor dem Tor der Universität wartete eine schlanke junge Frau im strömenden Regen. Sie trug ein dunkelbraunes Kleid mit Stickereien, dessen Saum bis über die Knöchel fiel, dazu einen weiten Sommerschal, den sie gleich dreimal um den Hals gewunden hatte. Mehr zum Schutz vor neugierigen Blicken als vor dem Wetter hatte sie einen breitkrempigen Hut aufgesetzt und den Schleier tief ins Gesicht gezogen.
Albert Schweitzer hätte sie beinahe nicht erkannt, als er mit hängenden Schultern die Treppe hinuntergelaufen kam. Als sie ihren ausladenden Regenschirm anhob, um ihm darunter Platz zu machen, lächelte er ihr jedoch aufmunternd zu und winkte.
Die junge Frau versuchte angestrengt, seiner Miene zu entnehmen, wie das Gespräch mit Dekan Fehling verlaufen war. Schweitzers Ausdruck blieb jedoch gleichmütig. Also blieb ihr nichts anderes übrig, als ihn direkt darauf anzusprechen.
»Und? So reden Sie schon!«
»Ach, Helene, ich glaube nicht, dass Professor Fehling mich verstanden hat. Er hat mir prophezeit, es würde einmal schlimm mit mir enden.«
Das Mädchen schüttelte den Kopf, während sie den Schleier ein wenig hob. »Was um alles in der Welt haben Sie erwartet, Albert? Dass er Ihren Entschluss begrüßt, hier alles aufzugeben, was Sie sich erarbeitet haben, und das Land zu verlassen? Nicht einmal Ihre eigenen Eltern können das.«
Schweitzer machte ein trauriges Gesicht. »Meine Eltern haben Angst, dass nun alles umsonst war, was sie sich für mich erträumten. Meine Ausbildung, die Karriere an der Universität. All die Vorträge, die ich gehalten, die Bücher, die ich schon geschrieben habe.« Er zuckte mit den Schultern. Dann bot er Helene galant seinen Arm, um sie über den Hof der Universität zur Straße zu begleiten. Als die Glocken des Münsters zu läuten begannen, blieb er stehen; seine Augen durchdrangen den feuchten Nebel des Oktobermorgens, als suchten sie den Turm der Kathedrale, doch die milchigen Schleier, die durch die Luft zogen, ließen nur verschwommen die Konturen von Dächern und Mauern erahnen. In der Nähe holperte eine Pferdedroschke über das Pflaster.
»Sie scheinen die Einzige zu sein, die mich versteht, Helene«, sagte er ungewohnt kleinlaut. »Vielleicht mache ich ja einen Fehler, wenn ich glaube, Menschen in Afrika als Arzt helfen zu können, aber ...«
Über das Gesicht seiner jungen Begleiterin huschte die Andeutung eines Lächelns, das sein Herz wärmte.
»Die Missionsgesellschaft hat Ihnen aber unmissverständlich klargemacht, dass sie gute Ärzte sucht und keine Prediger. Wenn Sie Seelen retten wollen, Albert, bleiben Sie besser hier, in Straßburg. Nach Afrika sollten Sie nur gehen, wenn es Ihnen ernst damit ist, gegen die Krankheiten zu kämpfen, unter denen die Einheimischen leiden.« Sie errötete, als er ihre Hand drückte.
»Vielleicht brauchen Sie ja eine Krankenschwester, wenn Sie Ihr Urwaldhospital aufbauen«, schickte sie zaghaft nach. »Es hält mich nämlich nichts mehr in Straßburg, wenn Sie abreisen.«
Schweitzer hob in gespielter Empörung den Zeigefinger. »Ihr Vater würde mich mit der Schrotflinte aus der Stadt jagen, Helene! Professor Bresslaus einzige Tochter kann doch nicht mit einem verschrobenen Träumer in den Urwald ziehen. Was würden die Leute sagen?«
Helenes Lachen deutete an, wie egal ihr das Gerede war. Davon abgesehen war Albert Schweitzer ihren Eltern angenehm, und sie glaubte nicht, dass seine Pläne etwas daran ändern konnten. Mit klopfendem Herzen lief sie voraus, hinein in den Regen, der immer stärker zu werden schien. Ihre helle, beinahe blasse Haut leuchtete im trüben Licht des Herbsttages wie feines Porzellan. Während sie ging, löste sich eine widerspenstige Locke ihres tiefschwarzen Haars. Behutsam strich Schweitzer sie ihr aus der Stirn. »Ihnen scheint es genauso ernst mit der Sache zu sein wie mir!«
»Wir müssen unsere Träume leben, damit sie Wirklichkeit werden können«, sagte Helene leise. »Würden Sie mich denn überhaupt mitnehmen, Albert?«
Er lächelte geheimnisvoll. Obwohl er ihr die Antwort schuldig blieb, festigte sich in seinem Innern doch das Gefühl, dass er nicht allein nach Afrika reisen würde. Sollte er Helene jedoch bitten, ihm zu folgen, so weder als Krankenschwester noch als Sekretärin, sondern nur als seine Frau.
1. Kapitel
New York, 1949
Helene Schweitzer trat aus dem großzügigen Ankleidezimmer der Hotelsuite und warf ihrem Ehemann, der sich auf dem Sofa entspannte, einen kritischen Blick zu. Sie konnte verstehen, dass Albert nach der langen Reise von Afrika nach New York erschöpft war, ihr selbst ging es nicht besser. Dennoch durften sie sich keine längere Pause gönnen, wenn sie den straffen Zeitplan einhalten wollten.
»Bitte mach dich fertig, Albert«, sagte sie mit einem mahnenden Blick auf die Uhr. »Es würde keinen guten Eindruck machen, wenn wir zu deinem eigenen Konzert zu spät kämen. Vergiss nicht, dass die amerikanische Presse über jeden unserer Schritte berichtet.«
Energisch öffnete Helene die Schublade des Spiegeltisches im Schlafzimmer und entnahm ihr eine Schachtel mit Aspirintabletten gegen die Kopfschmerzen, die sie seit ihrer Ankunft im Hotel nicht losgeworden war. Als ein flüchtiger Blick ihr Spiegelbild traf, runzelte sie die Stirn und berührte seufzend ihre Wange. Albert hatte ihre Haut immer mit weißem Porzellan verglichen – ihrer Einschätzung nach hatte das Porzellan allerdings inzwischen erhebliche Sprünge bekommen. Für ihren Mann war sie trotz ihrer einundsiebzig Jahre noch immer eine attraktive Frau, doch die Falten, die sich tief in ihre blasse Haut gegraben hatten, kündeten vom Kampf gegen die vielen Krankheiten, denen sie in Afrika begegnet war, sowie von jahrelangen Entbehrungen in der Heimat. Dessen ungeachtet war ihre Haltung unverändert aufrecht, Albert behauptete sogar, sie bewege sich würdevoll. Das gefiel ihr und tröstete sie. Mochte ihr Haar inzwischen grau geworden sein, noch immer legte es sich in einer dichten Fülle um den zierlichen Kopf. Davon abgesehen verstand sie es, sich geschmackvoll zu kleiden. Zur Feier ihres ersten öffentlichen Auftretens in Amerika hatte sich Helene Schweitzer für ein Kostüm aus mehlfarbenem Tweed entschieden. Die Jacke war dreiviertellang und eine Spur zu weit geschnitten, bedeckte dafür aber die füllig gewordenen Körperpartien auf vorteilhafte Weise.
Liebevoll betrachtete sie die Perlenkette auf dem Spiegeltisch, die einst ihrer Mutter gehört hatte, heute aber ihren Hals schmücken würde. Helene hatte sich nie viel aus modischer Kleidung oder Schmuck gemacht, nicht einmal als sie noch jung war. Im Urwald von Äquatorialafrika, in dem sie und Albert ihren Lebenssinn gefunden hatten, hätte sie damit auch niemanden beeindrucken können.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!