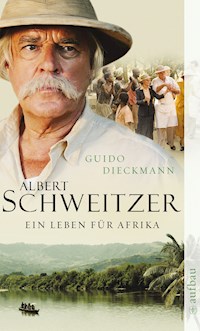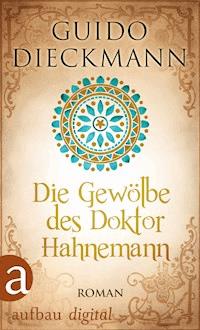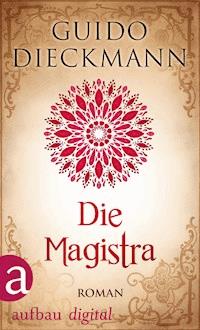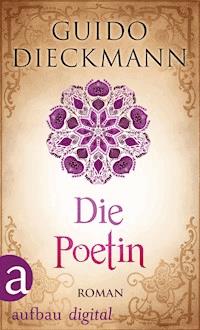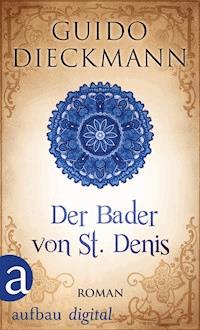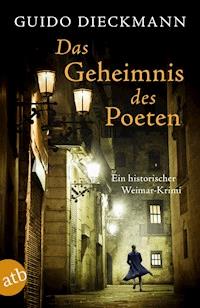8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die Abenteuer der Dunkelgröfin. Thérèse, die Tochter König Ludwigs und Marie Antoinettes, lebt wie in einem großen Traum. Bis im Jahr 1789 die Revolution ausbricht und sie, statt ihre große Liebe zu finden, durch halb Europa gehetzt wird. Zusammen mit einem zwielichtigen Diplomaten beginnt sie um ihre Ehre und ihr Leben zu kämpfen ... Ein bewegender Roman um eine Frau, die als "Dunkelgräfin" in die Geschichte einging. "Guido Dieckmann - ein Garant für spannende, historische Unterhaltung." Iny Lorentz.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 633
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Informationen zum Buch
Thérèse, die Tochter König Ludwigs und Marie Antoinettes, lebt wie in einem großen Traum. Bis im Jahr 1789 die Revolution ausbricht und sie, statt ihre große Liebe zu finden, durch halb Europa gehetzt wird. Zusammen mit einem zwielichtigen Diplomaten beginnt sie um ihre Ehre und ihr Leben zu kämpfen.
Ein bewegender Roman um eine Frau, die als »Dunkelgräfin« in die Geschichte einging.
»Guido Dieckmann – ein Garant für spannende, historische Unterhaltung.« Iny Lorentz
Guido Dieckmann
Die Frau mit den Seidenaugen
Roman
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Handelnde Personen im Roman
Prolog
Erstes Buch
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Zweites Buch
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Einundzwanzigstes Kapitel
Dritter Teil
Zweiundzwanzigstes Kapitel
Dreiundzwanzigstes Kapitel
Vierundzwanzigstes Kapitel
Fünfundzwanzigstes Kapitel
Sechsundzwanzigstes Kapitel
Epilog
Nachwort des Autors
Über Guido Dieckmann
Impressum
Wem dieses Buch gefallen hat, der liest auch gerne …
Handelnde Personen im Roman
Die königliche Familie
Thérèse
»Madame Royale«; Tochter Ludwigs XVI. von Frankreich*
Marie Antoinette
Königin von Frankreich, Thérèses Mutter*
Ludwig XVI.
König von Frankreich*
Joseph
ältester Sohn und Thronfolger; stirbt 1789*
Louis Charles
jüngerer Sohn*
Madame Elisabeth
Schwester des Königs*
Am Hof zu Versailles
Josephine Tourzel
Thérèses Erzieherin*
Blanche
ihre Nichte
Philippine de Lambriquet
Hofdame der Marie Antoinette*
Ernestine
ihre Tochter*
Prinzessin Lamballe
Vertraute der Marie Antoinette*
Axel Graf von Fersen
ein gern gesehener Gast in den Gemächern der Königin*
Jacques Necker
Finanzminister des Königs*
Charles de la Motte
einflußreicher Graf und Hofbeamter
Bastien
sein Handlanger
In Paris
Marius de Montregiasse
junger Medizinstudent aus Louisiana
Lionel de Montregiasse
sein Vater; Hofapotheker der Marie Antoinette
Babette
Dienstmagd in der Apotheke der Montregiasses
Maurice Chignon
Barbier und Perückenmacher in der Rue St. Jacques
Madeleine
seine Frau
Yvette
beider Tochter
Cornelius van der Valck
holländischer Diplomat und Offizier*
Jacques Mars Gaurre
Ernestine de Lambriquets Großvater
Dorette Mars Gaurre
seine Tochter, Ernestines Tante
Camille Desmoulins
Advokat und Revolutionär*
Hébert
Herausgeber des Journals »Père Duchesne«*
Maximilien de Robbespierre
Vorsitzender des Wohlfahrtsausschusses; radikaler Revolutionär*
Corélie Hrátsová
aus Böhmen eingewanderte Besitzerin eines Vergnügungssalons beim Palais Royal
Stephane Vaurien
Gefängniswärter im Temple de Paris, ehem. Apothekengehilfe
Hauptmann Abaisse
Kommandant des Temple de Paris
Im Exil
Schwester Anne
Karmeliternonne
Herbst
Ernestine de Lambriquets Diener in Wien
Caroline Weber
Köchin in der sächsischen Residenz zu Eishausen*
Die mit * gekennzeichneten Romanfiguren sind historisch nachweisbar.
Prolog
Wenige Stunden bevor die Glocken der alten Stadtkirche das neue Jahr einläuteten, erloschen in der herzoglichen Residenz von Sachsen-Hildburghausen, einige Meilen von der Stadt entfernt, die Lichter.
Es herrschte eine finstere, sternenlose Winternacht, die Mensch und Tier Stille gebot. Aus den Häusern und Ställen, welche dem Herrensitz benachbart lagen, drang nicht einmal das Gebell eines Hundes auf die Straße.
Hinter den Fenstern der herzoglichen Bibliothek lief ein Mann auf und ab, gehetzt trat er ans Fenster, um hinaus in die Nacht zu starren, ebenso gehetzt lenkte er seine Schritte zu den hohen Regalen, um seine Unruhe durch ein Buch zu betäuben, was ihm aber nicht gelang. Er war müde und hätte es sich am liebsten auf einem Sofa bequem gemacht, aber er durfte die Augen nicht schließen. Noch nicht. Immer wieder blickte er auf die Zeiger der alten Pendeluhr, welche, von seiner Nervosität unberührt, ihren Dienst versahen.
In wenigen Stunden gehörte das alte Jahr der Vergangenheit an – und mit ihm ein Kapitel seines Lebens, das nie zuvor erzählt worden war.
Schaudernd hauchte sich der Mann in die vor Kälte geröteten Hände und dachte darüber nach, wie stark doch das Gemüt eines Menschen den Ort beeinflussen konnte, an dem er sich finsteren Gedanken hingab. Im Sommer mochte die Bibliothek, in der er sich befand, ein heiterer, beliebter Ort sein, weil die hohen Bäume, die unmittelbar vor den Terrassentüren wuchsen, ihren Schatten über jeden Winkel des Raumes warfen und ihm somit Kühlung spendeten. Im Winter jedoch wirkten die verkrüppelten Äste und Zweige nur öde und leblos. Selbst das kräftigste Kaminfeuer vermochte die Kälte der Mauern nicht restlos zu vertreiben. An den Fensterscheiben bemerkte der Mann winzige Eiskristalle, die wie sternenförmige Zuckerstückchen aussahen. Selbst auf die Seidentapeten, die zwischen den wuchtigen Bücherregalen die Wände zierten, schien sich eine hauchdünne Eisschicht gelegt zu haben, die im matten Schein der Kerze wie Wachs glänzte.
Er stellte sich an die Tür zur halbmondförmigen Freiterrasse, schob nun zum zehnten Male den schweren Vorhang aus rotem Brokat zur Seite und spähte voller düsterer Gedanken in den Park. Nachdem er eine Weile beobachtet hatte, wie der Schneeregen in kleinen Böen über die gefrorene Erde wirbelte und die dürren Zweige der nahen Ulme zum Erbeben brachte, griff er mit einem Seufzer nach einer Kristallkaraffe, die auf einem zierlichen Beistelltisch stand, und schenkte sich ein Glas Portwein ein. Er brauchte dringend einen Schluck zum Aufwärmen, ehe er sich hier auf seinem einsamen Posten zu Tode fror.
Einige Male ließ er die funkelnde rote Flüssigkeit kreisen, dann stürzte er sie in einem einzigen Zug hinunter und wartete gespannt auf das wohlige, brennende Gefühl im Magen, welches ihm verriet, daß er noch Herr seiner Sinne war.
Das Brennen blieb aus, lediglich in seinem Rachen spürte er ein leichtes Kratzen, das er jedoch als unangenehm empfand. Er überlegte, ob er sich ein zweites Glas genehmigen sollte, entschied sich aber schließlich dagegen. Mit einigem Bedauern stellte er die Karaffe wieder zurück an ihren Platz.
Wie es aussah, würde die Nacht anstrengend genug für ihn werden. Obgleich noch nicht alt, fühlte er sich doch keineswegs als jugendlicher Heißsporn, daher brauchte er kühles Blut und einen klaren Kopf. Allein auf diese Weise hatten er und seine Gefährtin eine Chance, den Morgen des neuen Jahres überhaupt noch zu erleben.
Schwerfällig streckte er seine Glieder, unterdrückte ein Gähnen und nahm dann seinen ursprünglichen Platz am Fenster wieder ein. Verärgert stellte er fest, daß der Eisregen die Scheiben völlig beschlagen hatte.
Warum mußte es ausgerechnet in dieser Nacht schneien! Gegen alle Widrigkeiten hatte er sich gewappnet, jedes Hindernis in Gedanken durchgespielt, aber mit einem neuerlichen Wintereinbruch hatte er wahrhaftig nicht mehr gerechnet. Er erwog kurz, die Terrassentür oder wenigstens ein Fenster zu öffnen, um den Schneematsch zu entfernen.
Nein, es war besser, die Kerze wegzustellen. So spiegelte sich ihr Schein wenigstens nicht in dem dünnen Glas.
Etwa hundert Schritte von ihm entfernt erhoben sich die Umrisse des Torbogens aus der Dunkelheit, der sich am anderen Ende einer schmalen Allee befand. Der Weg, der dorthin führte, war unter dem verräterischen Schneemantel verschwunden, aber der Mann glaubte einen Herzschlag lang das vertraute Geräusch der Torangeln zu hören, welche die hölzernen Flügel im Sturmwind gegeneinander schoben.
Das Geräusch verursachte ihm eine Gänsehaut auf Armen und Beinen. Allmählich bekam er Angst. War es ein Fehler gewesen, das Tor nach Einbruch der Dunkelheit offen stehen zu lassen, anstatt es zu verrammeln und mit starken Ketten zu sichern? Aber das Tor der herzoglichen Residenz war niemals verschlossen, möglicherweise hätte es Verdacht erregt, wenn er sich ausgerechnet in dieser Nacht nach einem Schlüssel erkundigt hätte. Er mußte sich seinem Besucher stellen, einen anderen Weg gab es nicht, um dem Verhängnis zu entkommen.
Wachsam eilten seine Blicke durch die eisige Nacht. In einem geschützten Winkel zwischen zwei von Efeu überwucherten Mauervorsprüngen, wo sich die Scheune des Guts befand, brannte ein einzelnes Licht. Es rührte von einer eisernen Laterne her, wie sie an Postkutschen befestigt waren. Er selbst hatte sie aus dem Pförtnerhäuschen geholt und entzündet. Mit ihrer Hilfe sollte es ihm gelingen, jeden Eindringling aus der Ferne zu bemerken. Er mußte nur wach bleiben und hoffen, daß sein Besucher ihn nicht allzu lange warten ließ.
Leise seufzte er auf, während sich seine klammen Finger in den Taschen des langen Mantels vergruben. Die Kälte war wahrhaftig eine Qual und kaum mehr zu ertragen. Er blickte hinüber zur Kaminuhr, danach auf seine schmerzhaft pochenden Finger. Herzog Friedrichs Residenz war alles andere als eine Festung, und er selbst hatte weder die Kraft noch die Geduld, um sich wie ein Torwächter stundenlang auf die Lauer zu legen. Noch vor wenigen Jahren hätten ihm die Unbequemlichkeiten wenig ausgemacht, obgleich er sich eingestand, daß er Waffengänge stets verabscheut hatte. Zum Leidwesen vieler seiner Freunde und Kameraden war er nie ein Mann des Degens, des Säbels oder der Muskete geworden. Sein Vater und die Revolution hatten ihn jedoch gezwungen, sich im Waffengang zu üben.
Er wollte überleben, um seine Schuld an der Frau, die er liebte, wiedergutzumachen. Um sie zu schützen, die ihm mehr bedeutete als alles andere auf der Welt, hatte er ein Leben als Vagabund auf sich genommen. Für sie, die er einst verraten hatte, würde er auch weiterhin auf ein eigenes Heim, auf Ruhe und Frieden verzichten. Gleichzeitig mußte er sich eingestehen, daß ihn nicht der gekonnte Umgang mit Waffen bis hierher geführt hatte, sondern allein sein Geschick, bedrohliche Situationen mit scharfen Argumenten, mit Raffinesse, List und Hinterhalt zu begegnen. Widerwillig mußte er lächeln, als er daran dachte, wie leicht es gewesen war, die Fährte für seine Verfolger auszulegen. Eine Fährte, die nach Hildburghausen wies. Mochte der Fuchs auch in den Hühnerstall einbrechen; dieses Mal würden die Hühner gewappnet sein.
Ein leises Geräusch auf dem Korridor ließ ihn zusammenzucken. Er wandte sich um und bemerkte, wie die hohe Flügeltür geöffnet wurde. Im nächsten Augenblick steckte eine korpulente Frau mittleren Alters ihren Kopf in die Bibliothek. Er atmete auf, als er die rundliche Gestalt der Köchin erkannte. Sie war Witwe und stand seit vielen Jahren im Dienste des Herzogs. Ihr zerfurchtes Gesicht sah mürrisch aus, vermutlich ärgerte sie sich über das schlechte Wetter.
»Ich habe noch Licht gesehen«, sagte die Frau mit gedämpfter Stimme. »Sämtliche Diener haben das Haus verlassen, wie der gnädige Herr es angeordnet hat. Wenn die Herrschaften keinen Wunsch mehr haben, werde ich mich nun ebenfalls zurückziehen. Was für ein schauerliches Wetter!«
Er hatte keinen Auftrag für sie und hob daher nur abwägend die Schultern. Die Anwesenheit der Köchin verwirrte ihn. Dabei gehörte sie noch zu den wenigen Dienstboten, die ihm stets mit dem gebührenden Respekt und betonter Höflichkeit begegneten, vermutlich weil er sie schalten und walten ließ, wie sie es wollte. Nur selten meldeten er oder sein Schützling ausgefallene Wünsche an, und kam es doch einmal vor, daß er sie in den Salon rufen ließ, um den Speiseplan zu besprechen oder ein besonderes Gericht bei ihr zu bestellen, so tat er dies stets rücksichtsvoll und auf eine Art, welche die Kompetenz der Köchin in keiner Weise in Frage stellte.
Die Frau schüttelte mißbilligend den Kopf. »Sie werden sich den Tod holen, wenn Sie in Ihrem dünnen Hausmantel hier am Fenster stehen. Merken Sie denn nicht, daß es im Zimmer kalt wie in einer Gruft ist? Das Feuer ist erloschen.« Zur Bestätigung ihres Vorwurfs stieß sie ihren Atem aus, der sich vor seinen Augen in ein milchigweißes Wölkchen verwandelte.
»Irrtum, meine Gute«, erwiderte er mit einem nachsichtigen Lächeln. »Nicht wir Menschen holen uns den Tod, er holt uns. Wenn die Zeit gekommen ist, um ihm zu folgen, helfen auch keine Wärmflaschen oder gefütterten Kleider mehr.«
»Mag sein, aber ein wärmerer Mantel könnte es ihm zumindest schwerer machen. Wenn Sie unbedingt in der Bibliothek bleiben möchten, werde ich Ihnen ein paar Decken und Ihre festen Lammfellstiefel holen!«
Er hielt sie mit ausgestrecktem Arm zurück. »Warum sind Sie hier geblieben? Sie spionieren mir doch nicht etwa nach?«
Die Köchin brummte etwas Unverständliches vor sich hin. Sie hatte bereits vor Stunden das Silber geputzt, die Kupferpfannen, Töpfe und Kessel poliert und der Waschmagd Aufträge erteilt, die bis zum neuen Jahr warten konnten. Der freie Abend bedeutete ihr nicht besonders viel. Er stellte eine Abwechslung dar, aber mehr auch nicht. Sie hatte keine Verwandten in der Stadt. Dennoch hatte man sie eingeladen, die letzte Nacht des Jahres bei der Familie des Pfarrers von Hildburghausen zu verbringen.
»Die gnädige Frau hat mich in ihrem Boudoir gebraucht«, antwortete sie betont zurückhaltend und wies zu den schwarzen Deckenbalken hinauf. »Nachdem im Herbst ihre letzte Zofe davongelaufen ist, gibt es niemanden mehr, der heißes Wasser in den oberen Stock trägt oder sich um die Garderobe der Herrin kümmert. Nun gehe ich aber, gleich hinter dem Tor wartet eine Droschke auf mich.«
Er lächelte, weil er genau spürte, daß sie ihn belog. Die Köchin war zu keiner Zeit darum gebeten worden, die Kleider ihrer Herrin in Ordnung zu bringen. Er kannte die Gewohnheiten seines Schützlings gut genug, um zu wissen, daß sie es niemandem erlaubte, ihre wenigen Habseligkeiten auch nur anzurühren. Davon abgesehen, war die Frau keine Kammerzofe.
Schwerfällig trat er an seinen Sekretär, der sich unter der Last zahlreicher Bücher, Urkunden und Briefe wölbte, und zückte einen Schlüsselbund. Hier, unter dem goldgerahmten Ölporträt des Herzogs, pflegte er oft viele Stunden des Tages zu verbringen, während der Wind um die hohlen Ecken strich. Er liebte und brauchte die Unordnung, solange er sie auf einen Blick durchschaute. In dieser Beziehung ähnelte er seiner Gefährtin. Sobald er eine Schreibfeder über das Papier kratzen hörte oder im Schein der Kerzen Siegelwachs auf ein Kuvert tropfen ließ, lebte er auf. Dann redete er sich ein, daß er das Verhängnis abwenden konnte, das ihn und die Dame in den oberen Gemächern wie ein Schatten verfolgte.
»Sie und der Kutscher haben noch Lohn zu bekommen«, sagte er schließlich und lächelte spöttisch, weil er sich wie ein penibler Buchhalter anhörte. Mit zitternden Fingern öffnete er eine kleine Lade im Sekretär und entnahm ihr eine pralle Lederbörse. Sie war mit Silbermünzen gefüllt. »Zählen Sie nach! Ich habe noch einige Gulden dazugelegt, denn Sie haben uns während der vergangenen Monate treu gedient.«
Er reichte ihr den Beutel und versetzte der Lade einen kräftigen Stoß. »Man sollte kein Jahr verabschieden, ohne zuvor seine Schuld beglichen zu haben«, murmelte er. »Und nun Gott befohlen. Ich möchte Sie bitten, sich nicht länger aufzuhalten. Sie haben gewiß Besseres vor, als einem Nachtschwärmer wie mir an einem scheußlichen Abend Gesellschaft zu leisten. So Gott will, werden wir uns im nächsten Jahr wiedersehen.«
Die Köchin drückte ihren Dank durch ein schiefes Lächeln aus. Sie hatte keine Ahnung, warum ihr Herr sie derart feierlich verabschiedete, aber wer kannte sich schon mit den Launen der ausländischen Aristokraten aus? Umständlich ließ sie die Lederbörse unter ihrem warmen Umhang verschwinden, dann machte sie auf dem Absatz kehrt.
»Es zieht! Würden Sie nun endlich die Tür schließen?«
Der Mann wartete, bis er die Tür zur Halle ins Schloß fallen hörte, dann beugte er sich vor, rückte den Kerzenleuchter näher an die Schubladen seines Sekretärs heran. Nach einigem Suchen beförderte er eine Kassette ans Licht. Ihr Inhalt mochte für fremde Augen wenig spektakulär sein, für ihn hatte er eine besondere Bedeutung: Eine Pistole mit Elfenbeingriff samt Pulverfläschchen befand sich in einem geölten Tuch, außerdem verschiedene Portraits von der Hand eines unbekannten Künstlers und ein Medaillon mit Ölbild, auf dem das Antlitz einer jungen Frau zu sehen war. Zuunterst fand er eine Haarlocke sowie ein Arzneifläschchen.
Einen Moment lang betrachtete er die Gegenstände wie Freunde, die er lange nicht gesehen hatte, dann schob er sie mit einer abweisenden Geste auf die Seite. Er hatte keine Zeit, sich melancholischen Gefühlen hinzugeben, die Briefe beanspruchten seine Aufmerksamkeit zur Genüge. Sie waren mehrfach gefaltet, einige trugen Wasserflecken, die ihn an schlecht verheilte Narben auf dem Gesicht eines Soldaten erinnerten. Die Bögen waren eng beschrieben, ordentlich gesiegelt und mit Jahreszahlen versehen.
Die Zweige der Ulme schlugen geräuschvoll an die Fensterscheibe. Argwöhnisch blickte er auf, als befürchtete er eine weitere Störung. Doch dieses Mal regte sich nichts im Haus. Er stieß die Luft aus; auf seinem hageren Gesicht lag ein Schatten, als er die erste Seite seiner Aufzeichnungen überflog. Er prüfte das Datum und stellte fest, daß der Brief im Jahre 1789 geschrieben worden war. Unmittelbar darunter hatte eine unbekannte Hand in großen Druckbuchstaben das französische Wort Fatalité geschrieben. Es bedeutete Verhängnis.
Ein plötzlicher Hustenreiz trieb ihn von seinem Stuhl. Er röchelte, rang nach Luft. Seine Hand zerrte an dem seidenen Schal, bis dieser sich gelockert hatte und ihn wieder freier atmen ließ. Unbeholfen wankte er zu dem Tisch, auf dem die halbvolle Portweinkaraffe stand. Die Arznei, die der Stadtapotheker ihm gemischt hatte, befand sich in einem anderen Flügel des Schlosses, aber es war spät geworden; er durfte die Bibliothek nun nicht mehr verlassen.
Ich werde hier sein, wenn sie kommen, um uns zu holen, überlegte er mit einem leisen Triumph. Alles ist vorbereitet. Sie darf nur vor der Zeit ihr Zimmer nicht verlassen. Das Brennen in seiner Kehle wurde schwächer. Er starrte versonnen durch das Fenster, die Schneeflocken hatten sich im Wind aufgelöst. Die Laterne am Ende der Einfahrt warf einen gelben Streifen, der sich quer über die gepflasterte Einfahrt bis hin zum Pförtnerhäuschen erstreckte.
Während er ein weiteres Glas Portwein trank, arbeitete sein Verstand wie ein Uhrwerk. Ihm blieb keine Wahl, er mußte die verräterischen Seiten verbrennen, selbst wenn Generationen von Historikern und Philosophen ihn für diese ruchlose Tat verteufeln mochten. Auf keinen Fall durften die Urkunden und Briefe einem seiner Feinde in die Hände fallen. Doch auch seinem Schützling, der Frau, die friedlich in ihrem Schlafgemach lag, wollte er nicht zumuten, die alten Aufzeichnungen jemals zu Gesicht zu bekommen. Sie hätten sie nur an ein düsteres Kapitel ihres Lebens und ihrer Familie erinnert. Mehr noch, sie hätten wahrscheinlich dazu geführt, daß sie ihn verachtete. Der Gedanke, sie könnte ihn hassen, war ihm schlimmer als der Tod.
Mit dem Bündel und den Gegenständen aus den beiden Kassetten schleppte er sich vor das Kaminfeuer. Die Wärme, die seine Beine umschmeichelte, entspannte ihn. Sie half ihm beim Nachdenken. Hatte die Köchin Verdacht geschöpft? Wirkte das Mittel schon, das er seiner Gefährtin in den Wein gemischt hatte? Von nun an galt es, jeden seiner Schritte sorgfältig auf den nächsten abzustimmen.
Behutsam nahm er das Medaillon in die Hand und reinigte seine silberne Hülle von Staub und Schmutz, bis es wieder glänzte. Mit einem Stilett entfernte er anschließend das Ölporträt der Frau aus seinem Rähmchen. Dabei war ihm, als verfolgten ihre Augen jede seiner Bewegungen mit spöttischen Blicken.
»Du bist schuld daran, daß wir wie Tiere von Ort zu Ort gehetzt wurden«, murmelte er. Sein Ton klang bitter. »Aber ich schwöre dir, heute nacht hast du zum letzten Mal über uns triumphiert!«
Er warf das Porträt in das Kaminfeuer und beobachtete, wie die Flammen gierig nach ihm griffen, bis es endlich zu Asche zerfallen war. Als er die nächsten Gegenstände aus dem Kästchen nahm, hielt er betroffen inne. Es waren Miniaturen. Sie zeigten einen kräftigen Mann mit müden Augen und eine verschwenderisch gekleidete Frau in aristokratischer Pose. Daneben stand ein kleines Mädchen, das zwischen den Erwachsenen auf eine anrührende Art verloren wirkte. Mit seinen verträumten Augen und den dichten Locken fiel es kaum auf.
Ein kleines Mädchen. Ludwig XVI. von Frankreich und seine Gemahlin, die schöne Königin Marie Antoinette hatten lange auf einen Thronfolger warten müssen. Ihr erstes Kind war nicht der ersehnte Sohn, sondern eine Tochter geworden. Ein schwarzer Tag für das Königreich.
Ein Sonnentag für die Welt. Für ihn ein Fingerzeig Gottes.
Seufzend schloß er die Augen und versuchte sich an den Tag zu erinnern, an dem er Marie Antoinettes Tochter zum ersten Mal begegnet war. Es gelang ihm nicht auf Anhieb, zu viele Ereignisse lagen zwischen seiner Erinnerung und der Gegenwart, aber er war davon überzeugt, daß es ein Sommertag gewesen war.
Nach einer Weile glaubte er beinahe, eine vertraute Melodie und den Duft von Gewürzen, Wachs und Parfüm wahrzunehmen. Vogelgezwitscher und das Summen von Bienen vereinigten sich in seiner Erinnerung mit dem hellen Gelächter junger Frauen. Die Stimmen klangen wie Rufe aus einer untergegangenen Welt. War dort nicht auch das Plätschern eines Springbrunnens zu hören? Die Laute und Bilder verwandelten die Bibliothek, in der er vor starren, hohen Regalwänden saß, in ein warmes Meer aus grünem Rasen und duftenden Blüten. Eine bleierne Müdigkeit überfiel ihn.
»Ich muß wach bleiben«, befahl er sich, während sein Kopf bereits langsam auf die Seite sank. »Bitte, Gott, hilf mir nur das eine Mal. Laß mich nicht einschlafen!« Ganz deutlich sah er nun die Gärten und Mauern des königlichen Schlosses von Versailles vor sich, wie sie in der Nachmittagssonne lagen und auf seine Rückkehr warteten. Ein Lächeln legte sich auf seine Lippen; es war kaum zu glauben, wie wohl er sich plötzlich fühlte.
Im selben Moment schob ein anderer Mann die beiden Torflügel auseinander und spähte in den einsamen Innenhof. Er lauschte, ob aus irgendeiner Richtung ein Geräusch zu hören war, das sich vom Tosen des Sturms abhob. Dann zog er den Kopf zwischen die Schultern und betrat das Anwesen. Die Wolle seines Kutschermantels war bereits weiß von den Flocken, die sich in ihr verfangen hatten; seine Stiefel zerteilten die dünne Schneespur. Als er die brennende Laterne nahe der Scheune gewahrte, stahl sich ein verächtliches Lächeln auf seine Züge.
»Wie amüsant«, brummte er, »die Herrschaften beabsichtigen demnach, mit ihrem Henker zu spielen.« Er lachte bitter auf, dann rieb er sich mit dem Ärmel über seinen langsam ergrauenden Bart. Er wollte keine Zeit mehr verlieren, zu lange hatte er schon gewartet.
Er bewegte sich an der Mauer aus Feldsteinen entlang, welche hinter einer Scheune unversehens im Nichts endete. Das Haus selbst stand frei, schutzlos inmitten des Gartens. Seine Augen registrierten die Gegebenheiten des Ortes wie ein Raubtier auf der Pirsch. Wenn alles so einfach weiterging wie bisher, würde er ein leichtes Spiel haben. Vorausgesetzt, die Alte vom Markt hatte ihm keinen Bären aufgebunden. Sie hatte ihn sofort wiedererkannt, als sie ihm an der Abzweigung zur Stadt in die Arme gelaufen war. Aber dies spielte nun keine Rolle mehr.
Er verharrte lauschend, als aus der Ferne, irgendwo inmitten der verschneiten Landschaft ein Hund anschlug. Zu den dumpfen Lauten gesellte sich ein metallisches Klirren, vermutlich die Kette, mit der das Tier angebunden war. Dann verstummten die Geräusche plötzlich.
Die Augen des Mannes, die unter der Krempe seines ausladenden Hutes beinahe verschwanden, nahmen einen fieberhaften Ausdruck an. Mit einem geübten Griff zog er einen Degen unter dem Mantel hervor, dann stieß er sich von der Mauer ab und stapfte durch den Schnee auf das Licht zu, das sich in den Scheiben der Bibliothek spiegelte.
Das Jahr ist noch nicht zu Ende, dachte er, während er sich wie ein Fuchs durch die Dunkelheit auf sein Ziel zubewegte. Für mich fängt es in dieser Nacht erst an.
Erstes Buch Avant le déluge – Vor der Sintflut
Erstes Kapitel Versailles, im Sommer 1788
Der Namenstag Seiner Majestät, des Königs von Frankreich, wurde wie in jedem Sommer mit großem Prunk und Aufwand gefeiert.
Die Königin war bester Laune, denn wohin sie an diesem Abend auch blickte, sie sah in vergnügte, strahlende Gesichter. Ein samtenes Lächeln umspielte die Lippen der immer noch hübschen Frau, als sie ihr Kleid raffte und hoch erhobenen Hauptes durch den weiträumigen Spiegelsaal schritt. Sie fühlte sich beinahe schwerelos, jung und so begehrenswert wie kaum jemals zuvor in ihrem Leben.
Es war also doch richtig gewesen, den Widerstand meines Gemahls zu brechen und die ewigen Nörgeleien der Minister für einen Abend zu verdrängen, dachte sie. Mochten die Kassen des Staates auch leer sein, Versailles war nicht irgendein Bauwerk aus Stein, Holz und Glas. Versailles war der Mittelpunkt des Königreiches, es besaß eine Seele, ein schlagendes Herz, und sie, Marie Antoinette, hatte von jeher die Meinung vertreten, daß das Land nur dann genesen konnte, wenn sein Herz gesund und kräftig schlug. Viel zu lange hatte die Residenz auf ein Fest verzichten müssen. Daher sah es die Königin als ihre Pflicht an, endlich wieder für ein paar vergnügte Stunden zu sorgen. Nach den Feierlichkeiten konnte sich ihr Gemahl getrost den Problemen des Staatshaushalts zuwenden. Doch das Vergnügen dieses Abends konnte ihr keine Macht der Welt wieder entreißen.
Würdevoll schritt Marie Antoinette durch die festlich geschmückten Räume und beobachtete, wie fein herausgeputzte Lakaien mit gepuderten Perücken rote, zu Herzen geformte Wachskerzen entzündeten. Sie seufzte leise, die kleinen Gebilde sahen entzückend aus. In den benachbarten Sälen herrschte bereits Festtagsstimmung.
In der Tat hatten die prächtigen Galerien des Schlosses selten zuvor in seidigerem Schimmer geglänzt als an diesem Abend. Die Flötisten und Violinisten, ohne Ausnahme Meister ihres Fachs, waren auf Befehl der Königin aus verschiedenen Provinzen des Landes angereist, um den Hofkapellmeister zu unterstützen. Zauberhafte Klänge hallten durch den Spiegelsaal und die von tausend Kerzen beleuchteten Korridore. Pagen in glitzernder Livree bewegten sich durch die Reihen der Edelleute, die lachend und plaudernd in kleinen Gruppen beisammenstanden. Lächelnd servierten Mädchen köstlich duftende Wildpasteten aus Blätterteig, in alten Cognac getränktes Mandelgebäck und reichten dazu edle Weine aus Burgund und der Champagne.
Die Mitglieder der königlichen Familie sowie sämtliche anverwandten Prinzen und Herzöge von Geblüt wurden von goldenen Tabletts bedient, die mit frischen violetten Lilien geschmückt waren; für die einfacheren Edelleute mußte das einfachere Silber herhalten. Allgemein war man sich darüber einig, daß es einer Auszeichnung gleichkam, den Namenstag des Königs gemeinsam mit dessen Familie feiern zu dürfen.
Mit vor Glück erhitztem Gesicht setzte die Königin ihren Erkundungsgang durch die Räume fort. Halb verborgen hinter einem ausladenden venezianischen Fächer, schätzte sie die Garderobe und das Geschmeide der anwesenden Hofdamen ab. Marie Antoinette verfügte über ein ausgezeichnetes Gedächtnis für Namen, Gesichter und Kleider. Sie vergaß niemals, wer sie gelobt und wer schlecht über sie geredet hatte. Daher fiel es ihr auch an diesem Abend nicht schwer herauszufinden, welche der Damen von Rang sich für den Anlaß ein neues Kleid hatte schneidern lassen und wie das Atelier des Schneidermeisters hieß, der ihre Bestellung ausgeführt hatte. Mit einiger Schadenfreude registrierte sie, daß die eingebildete Comtesse Marley, die zum Gefolge ihrer Schwägerin gehörte, sowie ihre eigene Kammerfrau Philippine de Lambriquet die gleichen Ohrgehänge trugen. Ihr Juwelier mußte ihnen einen Streich gespielt haben, wahrscheinlicher war, daß irgendein Höfling den Mann für diesen Streich fürstlich entlohnt hatte.
Marie Antoinette näherte sich den beiden Damen. Es interessierte sie, worüber sich die Comtesse so eifrig mit ihrer Kammerfrau unterhielt. Doch Madame de Lambriquet schien zu spüren, daß sie beobachtet wurde; sie verfiel in einen zischenden Flüsterton, der sich in den Ohren der ertappten Lauscherin beinahe provozierend anhörte. Brüsk wandte sie der Königin den Rücken zu und verließ schließlich mit hochmütiger Miene den Salon.
Ihre Anhängerinnen folgten ihr, die Königin blieb allein zurück.
Marie Antoinette unterdrückte ihren Unmut, innerlich aber schäumte sie. Sie war nie besonders gut mit der eitlen Philippine de Lambriquet ausgekommen, denn die ließ es seit geraumer Zeit an Ehrerbietung fehlen. Manchmal kam es der Königin so vor, als legte die Kammerfrau es förmlich darauf an, ihre Herrin vor deren eigenem Hofstaat zu blamieren.
Wie lächerlich sich manche dieser Pfauen doch betragen, wenn man ihnen ein paar bunte Federn schenkt, dachte Marie Antoinette verdrossen. Was hatte sie, die Königin von Frankreich, schon mit einer ungebildeten Gans wie dieser Philippine de Lambriquet zu schaffen? Der Rang und die Herkunft ihres verstorbenen Gemahls waren zwar über jeden Zweifel erhaben, doch war ihre Abstammung eher fragwürdig. Es hieß, sie verstecke ihr eigenes Kind, ein Mädchen, hinter den Mauern eines Klosters, um es von Versailles fernzuhalten.
Marie Antoinette hatte sich bislang wenig um die Angelegenheiten der Madame de Lambriquet gekümmert. Sie nahm sich vor, die Kränkung, die sie erlitten hatte, zu vergessen, nach den Feierlichkeiten jedoch ein ernstes Wort mit der störrischen Kammerfrau zu wechseln.
Schnell verlor die Königin die Lust daran, ihre Gäste zu beobachten. Statt dessen richtete sie ihre ganze Aufmerksamkeit auf die eleganten, mit grünem Marmor belegten Spieltische, die abseits des Lärms, der im Ballsaal herrschte, in einer dezenten Nische des Salons aufgeschlagen worden waren. An einem der Tische, wo es besonders lebhaft zuging, traf sie auf zwei ihrer engsten Vertrauten, die hübsche Prinzessin Lamballe und die Marquise Josephine Tourzel. Auch sie hatten den Ballsaal frühzeitig verlassen, um ihr Glück im Spiel zu suchen.
Die Lamballe war eine ebenso elegante wie lebenslustige Person, die keinem Vergnügen, ob bei Hofe oder in der Stadt, aus dem Weg ging. Ihr offener Hang zum Spiritismus und zur Kunst des Weissagens erweckte bei manchem Höfling ein Gefühl des Unbehagens, dennoch galten die Séancen, die sie zuweilen in ihrem Boudoir abhielt, als aufregende Abwechslung im höfischen Einerlei. Wer auch immer von der Freundin der Königin eingeladen wurde, einer Geisterbeschwörung in den Gemächern der Lamballe beizuwohnen, lehnte es nicht ab, sondern empfand diese Gunst als Ehre und Verpflichtung.
Ganz anders verhielt sich die Sache mit Madame de Tourzel. Sie und deren Nichte Blanche, die an diesem Abend nur als stille Beobachterin am Tisch saß, galten als gewissenhaft, sittenstreng und langweilig. Sie besuchten die Messe in der königlichen Schloßkapelle öfter als der übrige Hofstaat. Da ihnen das leichtfertige Treiben von Hofdamen wie der Prinzessin Lamballe aus tiefstem Herzen zuwider war, hielten sie sich für gewöhnlich lieber an die Worte der Jesuiten oder suchten die Nähe der sieben Betschwestern, die der Kardinal von Paris eigens nach Versailles entsendet hatte. Kein Wunder, daß Hofdamen wie die Prinzessin keine Gelegenheit ausließen, um die ältlich wirkende Madame Tourzel mit Spott zu überziehen.
Nun aber waren sie alle der Einladung ihrer Königin gefolgt, sowohl Gönner als auch Neider, und dieser Umstand verschaffte Marie Antoinette ein Gefühl leisen Triumphs.
»Wir haben bereits sehnsuchtsvoll auf Eure Majestät gewartet«, rief die Prinzessin Lamballe erfreut aus, als sie die Königin erblickte. »Ich fürchte nämlich, unser lieber Freund, der Graf, ist heute abend nicht so recht bei der Sache. Vermutlich sind wir für ihn keine würdigen Gegnerinnen! Seine Blicke gelten allein der kleinen Blanche, nicht wahr, Madame Tourzel?«
»Halten Sie besser Ihre boshafte Zunge im Zaum«, brummte die Marquise. Beleidigt funkelte sie die Prinzessin durch die rosa getönte Linse ihres Sehglases an. »Es dürfte Ihnen bekannt sein, daß meine Verwandte bereits versprochen ist. Ich dulde nicht, daß Sie ihren guten Ruf in den Schmutz ziehen.«
Marie Antoinette senkte den Blick. Mit dem Grafen meinte ihre Freundin Axel von Fersen, einen jungen schwedischen Adligen und Offizier, der seit einiger Zeit ein gern gesehener Gast im Palast zu Versailles war. Daß er darüber hinaus auch in den Gemächern der Königin ein und aus ging, wußten die wenigsten. Prinzessin Lamballe war in das Geheimnis eingeweiht, denn sie hatte angeblich die Sterne über die verbotene Liaison befragt; ihre ironischen Bemerkungen schreckten Marie Antoinette daher nicht. Mit dem spöttischen Hinweis, der Graf könnte sich für die Nichte der Tourzel interessieren, war es ihr sogar gelungen, den Verdacht eines innigen Verhältnisses zwischen Fersen und der Königin zu zerstreuen.
»Wir werden noch sehen, ob Monsieur Fersen wirklich eine so glückliche Hand hat, Teuerste!« Marie Antoinette raffte ihr ausladendes Kleid aus purpurnem Brokat und ließ sich auf einem der freien Gobelinstühle nieder. Mit einem liebenswürdigen Lächeln schob ihr die Prinzessin ein Bündel Spielkarten und eine Anzahl goldfarbener Billets zu. Dann gab sie dem Comte La Motte, einem gutaussehenden Mann mittleren Alters, der als Spielführer am Tisch agierte, ein Zeichen mit ihrem Fächer: Das Spiel sollte zu Ehren der Königin von neuem beginnen. Der Comte La Motte lächelte verständnisvoll. Er begann damit, Karten und Billets einzusammeln. Marie Antoinette war erleichtert. Sie nickte der Prinzessin dankbar zu, dann vergrub sie ihr Gesicht in den ausgegebenen Spielkarten, ohne dem jungen Grafen von Fersen, der ihr gegenübersaß, auch nur einen Blick zu gönnen.
»Wenn Majestät es wünschen, werde ich die neue Runde nun eröffnen«, sagte La Motte.
Marie Antoinette nickte geistesabwesend. Sie liebte das Kartenspiel beinahe ebenso sehr wie die Musik, das Schauspiel und den Tanz. In diesen Dingen stand sie der Prinzessin Lamballe in nichts nach, von Kindesbeinen an war sie daran gewöhnt worden, ihre Leidenschaften zu fördern. Obwohl die Königin für gewöhnlich eine aufmerksame Beobachterin war, gelang es ihr an diesem Abend jedoch nicht, sich auf das Spiel zu konzentrieren. Sie hatte eine Anzahl wertvoller Trümpfe in der Hand, doch ihre Gedanken schweiften ab, sooft sie versuchte, das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden. Mehrere Male ertappte sie sich dabei, wie sie ihre Karten an falscher Stelle ausspielte, oder sie versäumte ihre Einsätze, was ihr bedauernde Blicke und mitfühlende Kommentare des Comte La Motte eintrug.
Der Prinzessin Lamballe entging der Grund für die Unachtsamkeit der Königin nicht. Sanft drehte sie den goldenen Reif, den sie am Handgelenk trug. »Unglück im Spiel, Majestät?« fragte sie mit einem süffisanten Lächeln. »Ich brauche wohl nicht meine Karten zu befragen, um Euch zu erklären, was dieses Omen bedeutet?«
»Es bedeutet, daß einer der edlen Herrschaften seiner Königin aus der Bredouille helfen muß«, antwortete Marie Antoinette schlagfertig. Ihre Lippen wurden schmal, wie so oft, wenn sie eine Bitte zum Befehl werden ließ. Zum ersten Mal an diesem Abend schaute sie dem Grafen von Fersen offen ins Gesicht.
Das Gesicht des jungen Grafen wirkte im Kerzenschein bleicher als bei Tageslicht. Dennoch war er mit seinen markanten Zügen ein betont gutaussehender Mann. Seine blaugrünen Augen schimmerten wie die Splitter kleiner Smaragde. Gekleidet war er stets geschmackvoll, wenngleich er sich als Ausländer nicht dem Diktat des französischen Hofes unterwarf. Verzichtete er auf seine Uniform, so traf man ihn zumeist mit einem aquamarinfarbenen Gehrock und einer Weste aus himmelblauer Seide an. Militärisch enge Kniehosen und einfaches schwarzes Schuhwerk, doch auffallend wenig Zierat vervollständigten das Erscheinungsbild. Am beeindruckendsten waren jedoch seine tiefschwarzen Haare, die nach Meinung der Königin so gar nicht zu einem Skandinavier passen wollten. Schwarze Locken stahlen sich übermütig unter dem Netz der gepuderten Perücke hervor; sie verliehen dem Gesicht mit der schmalen Nase und den buschigen Brauen etwas erfrischend Jungenhaftes. Graf von Fersen war nicht nur ein geschickter Kartenspieler, sondern auch ein amüsanter Gesprächspartner, dessen Erzählungen von seiner Heimat im Norden zumeist auf geneigte Zuhörer stießen. Sein heiteres Wesen und sein männlicher Charme machten ihn bei Hofe beliebt. Dennoch blieben die meisten der Edelleute auf Distanz zu dem jungen Schweden. Zu delikat erschien ihnen das vertraute Verhältnis, das den Fremden und ihre Königin miteinander verband. Die unausgesprochenen Beweise ihrer Zuneigung sprachen für sich. Wenn es etwas gab, das Marie Antoinette nicht nach allen Regeln der Kunst beherrschte, so war es der Sturm ihrer eigenen Gefühle.
Axel von Fersen erhob sich sogleich, lief um den Tisch herum und ergriff ohne Scheu die Hand der Königin.
»Es wäre mir eine Ehre, wenn ich die Spielschulden Eurer Majestät begleichen dürfte!« Er lächelte sie mit blitzenden Augen an. Madame Tourzel entglitten vor Verblüffung die Spielkarten. Der Comte starrte ohne jede Regung auf eine der Obstschalen. Beide schienen dasselbe zu denken: Was, um alles in der Welt, erlaubte sich dieser junge Mann?
»Sie wissen, Madame, für Sie würde ich alles tun! Wenn ich die Gelegenheit erhielte, würde ich Sie aus jeder Not erlösen!«
»Das würde Seine Majestät aber auch tun«, mischte sich Madame Tourzel mit schnarrender Stimme ein. Ihrem Tonfall war zu entnehmen, daß sie der Königin eine Peinlichkeit ersparen wollte, auch wenn sie sich später dadurch eine Rüge einhandelte. Es war ein Jammer, wie tief die Moral bei Hofe gesunken war, befand sie in Gedanken. Zuerst warf die falsche Schlange Lamballe Spitzen auf ihre arme Nichte, dann entdeckte dieser dumme schwedische Junge auch noch seine Ritterlichkeit und machte der Königin Avancen. Und dies alles geschah ausgerechnet auf einer Gesellschaft, die zu Ehren des Königs abgehalten wurde.
Die Marquise unterdrückte ein ärgerliches Grollen. Sie mochte den Schweden ebensowenig wie die Lamballe und war eifersüchtig auf den Einfluß, den er bei Hofe genoß. Auch wenn das Königspaar sich zuweilen gern mit ausländischen Diplomaten umgab, um ihnen die Pracht des französischen Königshofes vor Augen zu führen, war ihre eigene Stellung doch zweifellos die bedeutendere. Madame Tourzel kümmerte sich seit dem vergangenen Frühjahr voller Hingabe um die Erziehung der jungen Prinzessin Marie Thérèse, die einzige Tochter des Königs. Diese Aufgabe war, wie jedermann in Versailles bezeugen konnte, eine ebenso ehrenvolle wie schwierige Aufgabe, die ihre gesamte Kraft in Anspruch nahm. Sogar ihre verwaiste Nichte Blanche mußte hinter dem zeitraubenden Dienst in den königlichen Gemächern zuweilen zurückstehen. Doch Blanche war von jeher ein stilles, verschlossenes Mädchen gewesen, das jeden Wirbel um ihre Person ablehnte und kaum jemals von sich reden machte. In wenigen Monaten würde sie einen wohlhabenden jungen Aristokraten heiraten und mit ihm auf seinen Gütern bei Toulouse ein unspektakuläres Leben führen.
»Ich fürchte, unsere Freundin Madame Tourzel hat recht, mein Freund«, stimmte Marie Antoinette nach einem peinlichen Moment des Schweigens zu. »Mein Gemahl wird meine Schulden mit Freuden tragen. Das tut er bereits seit Jahren, und noch nie habe ich aus seinem Mund eine Klage darüber gehört.«
Die umstehenden Gäste applaudierten höflich. Sie ließen den König hochleben. Nur wenige bemerkten dabei, daß Axel von Fersens Gesicht nicht die geringste Spur von Enttäuschung zeigte, als er die Hand der Königin losließ. Er war Offizier und daran gewohnt, seine Eroberungen mit größerem Geschick zu planen, als die fromme Marquise Tourzel es in ihren kühnsten Träumen ahnen mochte.
Mit einer galanten Verbeugung verabschiedete sich der Schwede von den Damen und Herren am Tisch und schritt durch die Tür, die zum Marmorsaal führte.
»Auf den jungen Mann sollten Sie ein Auge haben, werter Comte«, flüsterte die Prinzessin Lamballe ihrem Tischnachbarn zu. »Er scheint mir allzu siegessicher zu sein.«
La Motte zog es vor, nichts darauf zu erwidern. Einen Moment lang blickte er unheilverkündend zur Salontür, durch die der Schwede verschwunden war, dann zuckte er gleichmütig die Achseln.
Axel von Fersen war mit dem Verlauf des Abends zufrieden. Die schöne Königin war ihm trotz der vorsichtigen Zurückhaltung, die sie in Gegenwart ihrer Hofschranzen an den Tag legen mußte, gewogen, darauf mochte er sein letztes Pferd verwetten. Der König hingegen hatte sich während des ganzen Abends nicht ein einziges Mal im grünen Salon blicken lassen. Möglicherweise hatten ihn einige seiner Minister mit dringlichen Regierungsgeschäften aufgehalten und langweilten ihn nun mit ihren Vorschlägen zur Behebung der Staatsmisere. Vielleicht saß der König aber auch längst wieder in seinem Uhrenkabinett, um sich einem mechanischen Problem zu widmen. Wie die Königin Fersen beim gemeinsamen Souper berichtet hatte, vergeudete ihr Gemahl zuweilen ganze Nächte in einem zur Werkstatt umgewandelten Raum, wo er klemmende Türschlösser reparierte, Zahnräder mit Feilen bearbeitete oder Federn in Uhrengehäuse einsetzte. Fersen spürte deutlich, daß sie Mitgefühl mit dem Mann hegte, dem das Schicksal es auferlegt hatte, über ein Land zu regieren, das er nicht einmal im Ansatz zu verstehen schien. Zu schade, daß Frankreich keine Uhr ist, dachte Fersen, Ludwig hätte es sonst längst repariert.
Der Korridor, von dessen hohen, mit Kristall versehenen Wänden noch immer die Musik des Ballsaales widerhallte, lag im Halbdunkel. Daher erkannte Fersen den Mann, der ihm plötzlich gegenüberstand erst, als dieser sein Gesicht mit einer Kerze beleuchtete. Fersen atmete auf. Es war Cornelius van der Valck, der Graf de Versay, der zur Zeit in Versailles eine Kadettenausbildung absolvierte. Die beiden Männer kannten sich bereits von früheren Begegnungen. Sie hatten ähnliche Interessen und verstanden sich glänzend, daher hatte Fersen es sich angewöhnt, den jüngeren auch in so mancher persönlichen Angelegenheit ins Vertrauen zu ziehen.
»Du willst schon gehen?« fragte Cornelius, als er den Freund erkannte. Er lächelte. Der plötzliche Aufbruch des jungen Offiziers überraschte ihn. »Für gewöhnlich gehörst du zu den letzten Kavalieren, die einen Ball des Königs verlassen.«
Axel von Fersen hob die Augenbraue und blickte dem Kadetten ins Gesicht. Einen Moment lang irritierte ihn etwas am Gesichtsausdruck des Holländers, dann lachte er plötzlich schallend und klopfte ihm kameradschaftlich auf die Schulter. »Wie kommt es nur, daß man uns Schweden und Niederländern immer wieder nachsagt, steife, protestantische Kostverächter zu sein? Als solcher hätte ich heute abend wohl kaum den königlichen Spieltisch aufgesucht. Allerdings steht mir der Sinn nun wirklich nicht nach dem Gedränge im großen Saal.«
»Du magst Versailles nicht?«
»Ich liebe Versailles, aber ich vertraue niemandem in diesem Palast. Seine Mauern haben seit den Tagen Ludwigs XIV. wahrscheinlich mehr Intrigen gesehen als die Werke Molières und Shakespeares zusammengenommen.« Er blinzelte van der Valck verschwörerisch zu. »Gewiß kennst du ein hübsches Gasthaus in der Stadt, in dem wir uns den Staub dieses Palasts aus der Kehle spülen können?« Cornelius hob abwägend die Schultern. Er war klug genug, um zu begreifen, womit Fersen ihn mit seiner Warnung aufmerksam machen wollte. Vertrauliche Gespräche waren im Schloß trotz der vielen Gemächer und Kabinette, die es hier gab, nur schwer möglich. Hinter jedem Paravent, hinter jeder Pflanze konnte ein heimlicher Lauscher stehen, der gegen ein kleines Entgelt Neuigkeiten weitertrug. Cornelius glaubte zwar nicht, daß er, ein ausländischer Offizier, Gegenstand vordringlichen Interesses war, doch bei Fersen lagen die Dinge anders. Nach einem kurzen Zögern erklärte er sich bereit, den Palast gemeinsam mit dem Freund zu verlassen.
Gutgelaunt zog Axel von Fersen eine samtene Börse aus der Tasche und wog sie prüfend in der Hand. Marie Antoinettes charmante Weigerung, ihn ihre beträchtliche Spielschuld begleichen zu lassen, hatte ihn gerettet. Sie sollte nicht wissen, daß er in Geldnöten steckte. Mit dem eingesparten Geld und seinem eigenen Gewinn am Spieltisch konnte er sich nun wenigstens noch eine vergnügte Nacht bereiten, ehe er die Gemächer der Königin aufsuchte.
Die beiden Männer hatten den Gang beinahe durchquert, als Fersen plötzlich innehielt. Mit einer verstohlenen Geste machte er seinen Freund auf einen Vorhang aufmerksam, der sich merkwürdigerweise wie von einem Luftzug aufgebläht in den Korridor wölbte. Mit einem Satz sprang er auf den Vorhang zu und riß ihn zur Seite. Hinter dem ausladenden Tuch ertönte ein erstickter Schrei, erschrockene Blicke kreuzten sich.
Fersen packte den Lauscher grob bei der Schulter; ohne auf Widerstand zu stoßen, beförderte er ihn auf den Gang, wo er ihn im schwachen Schein der Kerzen musterte. Sein strenger Gesichtsausdruck begann aufzuweichen. »Sieh einer an«, rief er Cornelius zu. »Wie mir scheint, werden die Schloßgespenster von Jahr zu Jahr jünger!«
»Und hübscher«, ergänzte Cornelius mit gutmütigem Spott. Er ließ seinen ebenfalls gezückten Degen sinken und befeuchtete die Lippen. »Was sagst du dazu, nie zuvor habe ich in solch bemerkenswert tiefe Augen geblickt. Ihr Schimmer erinnert mich an ein Gewand aus grüner Seide.«
Der heimliche Lauscher war ein zierliches Mädchen mit blonden Locken, das ihm nicht einmal bis zur Schulter reichte. Der Blick der Kleinen richtete sich weniger furchtsam als vielmehr trotzig auf Fersens prächtigen Hüftgürtel. »Sie tun mir weh! Nehmen Sie auf der Stelle die Hände von mir, oder soll ich die Palastwachen rufen?«
»Das Schloßgespenst besitzt ein Paar scharfer Krallen. Nun, die Garde Seiner Majestät wäre gewiß neugierig zu erfahren, was Ihre Hoheit zu dieser Stunde auf die Gänge treibt?« Fersen ließ die Schulter des Mädchens los, stemmte aber in gespielter Empörung beide Hände in die Taille. »Noch dazu in dieser Aufmachung! Sollten Sie nicht längst unter der Obhut Ihrer Amme in Ihren Gemächern sein? Hoheit?«
»Hoheit?« Cornelius begriff nicht sogleich und blickte sich ratlos nach allen Seiten um. »Meinst du, die Kleine mit den Seidenaugen ist …«
Der Graf warf den Kopf in den Nacken und lachte schallend. Als er sich wieder gefangen hatte, erklärte er mit sichtlichem Genuß: »Ohne jeden Zweifel, mein Freund. Die hübsche Mademoiselle ist Marie Thérèse, Madame Royale, die erstgeborene Tochter unseres verehrten Königs. Nun, meine Liebe, im Krieg pflegen wir wichtige Gefangene an unsere Vorgesetzten auszuliefern, damit sie eingehend befragt werden können. Königin Marie Antoinette ist doch noch immer beim Kartenspiel im grünen Salon, nicht wahr?« Er warf einen gespielt nervösen Blick über die Schulter, als habe er im Wirrwarr der Säle und Gemächer die Orientierung verloren.
Thérèse fror plötzlich unter ihrem leichten Gewand, ein scharfer Luftzug kroch ihre Schenkel hinauf. Was hatte sie sich nur bei diesem Ausflug gedacht? Es war ihr peinlich, daß die beiden Offiziere sie im Korridor ertappt hatten, dabei hatte sie doch nur vorgehabt, einen kurzen Blick vom festlich erleuchteten Ballsaal zu erhaschen, eine Weile den Musikern zu lauschen und vielleicht von einem der Pagen ein Stück duftenden Zuckerkuchen stibitzen. In ihren eigenen Wohngemächern war es zu dieser Stunde so still. Düster und langweilig schlich die Zeit dahin wie eine behäbige Schnecke. Da Madame Tourzel, ihre Erzieherin, sich bereits am Nachmittag unter die Festgesellschaft gemischt hatte, bestand Thérèses einzige Gesellschaft aus einer dicken alten Zofe, die jedoch bereits kurz nach Sonnenuntergang über einem Band stumpfsinniger Liebesgedichte eingeschlafen war und nun so laut schnarchte, daß sie selbst das Schluchzen der Geigen im Ballsaal übertönte.
»Ich denke, wir können auf die Palastwachen verzichten«, warf Thérèse mit dünner Stimme ein. Sie stellte sich auf die Zehenspitzen und bemühte sich nach Kräften, vor den fremden Edelleuten nicht die Fassung zu verlieren. »Bitte, Monsieur, erlauben Sie mir, mich in meine Räume zurückzuziehen, ohne daß mich jemand sieht und es meiner Mutter verrät. Madame Tourzel, meine Erzieherin, könnte sonst leicht in Ungnade fallen, weil sie nicht besser auf mich achtgab.«
»Madame Tourzel?« Fersens Augen blitzten auf einmal spöttisch auf. War dies nicht diese farblose, frömmelnde Marquise, die ihm am Spieltisch mit offener Verachtung begegnet war? Während er noch überlegte, ob es sich lohnte, die unerwartete Begegnung mit der Prinzessin für seine eigenen Zwecke zu nutzen, klopfte Cornelius ihm freundschaftlich auf die Schulter. »Wir sollten Madame Royale nun entschuldigen, bevor jemand uns zusammen sieht, der die Situation mißverstehen könnte!« Er blinzelte dem Mädchen gönnerhaft zu. »Wer große Geheimnisse miteinander teilt, schafft sich treue Verbündete, nicht wahr, Hoheit?«
»Wer sagt das?« knurrte Fersen, dem das plötzliche Einvernehmen seines Freundes mit der jungen Prinzessin nicht gefiel. »Dein verdammter Voltaire?«
Cornelius lachte. »Nein, aber mein alter Herr. Als Bankier in Amsterdam versteht er mit Geheimnissen und Verbündeten umzugehen!«
»Also schön!« Ein wenig enttäuscht ob der versäumten Chance, die Marquise Tourzel bloßzustellen, ergriff der Graf Thérèses Hand und hauchte ihr einen kühlen Kuß auf die Fingerspitzen. »Und wie finden Hoheit nun in Ihre Gemächer?«
Thérèse atmete auf. Die Sache war noch einmal glimpflich ausgegangen. Widerstrebend erklärte sie dem Offizier, daß sich hinter dem Vorhang eine schmale Stiege befand, die an den Räumen der Silberputzerinnen und den Speiseaufzügen vorbei geradewegs ins obere Stockwerk führte. Sie warf dem Holländer noch einen knappen Blick zu, aus dem Erleichterung und Dankbarkeit sprachen. Dann raffte sie, ohne zu zögern, den Saum ihres Gewandes und verschwand hinter dem Wandbehang.
Das Gelächter der beiden Männer begleitete die Geräusche ihrer Schritte auf den knarrenden Stufen, aber die Stimmen klangen eher ausgelassen als schadenfroh. Sie würden sie gewiß nicht verraten.
Zweites Kapitel
Der Tag versprach warm, sonnig und trocken zu werden. Der Himmel war blau, nicht ein einziges Wölkchen war am Horizont zu entdecken. Kurz entschlossen verlegte die Königin den zweiten Teil der Feierlichkeiten in die weiträumigen Gärten des Petit Trianon, die ihr besonders am Herzen lagen. Dort draußen, nur wenige Schritte von einem kleinen Gartenschlößchen entfernt, hatten findige Köpfe auf Geheiß der Königin eine neue Welt erschaffen, die einlud, in entspannter Atmosphäre die Annehmlichkeiten des Sommers zu genießen. Um das Ufer eines Teichs von märchenhaften Ausmaßen gruppierten sich idyllische Häuschen mit Strohdächern, Fachwerk und kunstvoll geschmiedeten Geländern. Auf den saftigen Rasenflächen, die bis ans Seeufer reichten, grasten Schafe, die von einigen Pagen und Mädchen in bäuerlich wirkenden Phantasiekostümen gehütet wurden. Junge Hofdamen breiteten plaudernd seidene Decken auf dem Gras aus oder ließen sich von ihren Kavalieren in bunt bemalten und mit Fähnchen geschmückten Booten über den See rudern, um Schwäne zu füttern. Es gab eine Mühle, deren Rad von einem künstlichen Wasserlauf bewegt wurde, außerdem mehrere Stallungen, in denen Blumen gezüchtet wurden und sogar eine Molkerei. Zuweilen konnte man die Königin persönlich in dem idyllischen Häuschen antreffen und einen Becher frisch gemolkene Milch aus ihrer Hand erhalten. Eine Wiese, die von einem griechischen Heckenlabyrinth umgeben war, wurde zum dörflichen Tummelplatz mit Ziehbrunnen, kleinen Läden und einem Tanzboden umgestaltet. Zwischen bemoosten Statuen antiker Gottheiten und rauschenden Fontänen spielten Musikanten der französischen Garde. Am Abend sollte der König zu der Gesellschaft im Trianon stoßen. Marie Antoinette hatte befohlen, aus diesem Anlaß sechshundert bunte Lichter im Park zu entzünden. Die Aufführung eines komischen Balletts sollte den Tag in glanzvollem Rahmen beschließen.
Thérèse genoß die heitere Nachmittagsstimmung, die über den königlichen Gärten lag. Sie empfand den Ausflug als willkommene Abwechslung und war dankbar, daß ihre Mutter sie eingeladen hatte.
Hier draußen, in den Anlagen des Trianon, war es möglich, der strengen Disziplin, die Madame Tourzel ihr von früh bis spät auferlegte, wenigstens für einige Stunden zu entfliehen, ohne sich größeren Ärger einzuhandeln. Wie es schien, hatten die beiden Edelleute ihr Wort gehalten und niemandem von Thérèses Lauscherei hinter dem Vorhang erzählt.
Thérèse war dankbar dafür. Sie galt als empfindsames, beinahe scheues Mädchen, das den Trubel, den ihre Mutter im Schloß und den Gärten so gern veranstaltete, mit einer Mischung aus Faszination und Grauen beobachtete. Bei festlichen Gelegenheiten stand sie ganz im Schatten ihrer älteren Verwandten oder ihres jüngeren Bruders, des Thronfolgers, der von allen verhätschelt und vergöttert wurde. Manchmal beneidete Thérèse ihre Mutter um deren Esprit, um die sprühende Lebensfreude, mit der sie die Menschen in ihren Bann zog. Marie Antoinette besaß in der Tat nicht nur Tatkraft, in ihr steckte auch die überschäumende Phantasie eines zwölfjährigen Kindes. Sie umgab sich für ihr Leben gern mit jungen Menschen, die ihrer Meinung nach die geistreichsten Einfälle hatten und sie auf vielfältige Weise inspirierten.
Ihre Tochter Thérèse schien sie davon jedoch ausdrücklich auszunehmen. Noch nie hatte die Königin sie nach ihren Empfindungen und Gedanken gefragt. Offensichtlich, weil sie die Ansicht vertrat, daß Thérèse unter einem für ihr Alter grotesken Hang zur Schwermut litt und außerdem hoffnungslos langweilig war. Für sie hatte Thérèse das phlegmatische Temperament ihres Vaters geerbt. Insgeheim befürchtete die Königin, ihre Tochter würde sich eines Tages in eine Schmiede oder eine Werkstatt zurückziehen, um Eisen mit dem Hammer zu bearbeiten oder lächerliche Figuren aus Holz zusammenzuleimen. Um diese Ängste zu mindern, hatte die Königin Madame Tourzel angewiesen, bei der Erziehung ihrer Tochter die strengsten Maßstäbe des Hofzeremoniells anzulegen. Phantasie hin oder her, die Prinzessin sollte lernen, wie sich eine Tochter des mächtigsten Monarchen Europas in der Öffentlichkeit und am Hofe zu verhalten hatte. Versagte sie vor ihren Augen, so würde gewiß kein Angehöriger des europäischen Hochadels jemals um sie anhalten, und sie würde hinter Klostermauern oder als ältliche Tante in den Spielräumen ihrer Nichten und Neffen enden.
Thérèse bedauerte es manchmal, daß sie keine Möglichkeit fand, einen Zugang zu der aufregenden und geheimnisvollen Welt ihrer Mutter zu finden. Wäre ihr Verhältnis unverkrampfter gewesen, so hätte die Königin zweifellos festgestellt, daß es eine Menge Dinge gab, welche die junge Prinzessin faszinierten. So jedoch hatten sich beide im Laufe der Jahre daran gewöhnt, ihre Geheimnisse voreinander zu hüten. Thérèse fühlte sich oft einsam, aber sie hatte gelernt, ihre Gefühle nicht auf der Zunge zu tragen. Wenigstens wußte sie Madame Tourzel auf ihrer Seite und ihren kleinen Bruder Louis Charles, der sich zuweilen in ihre Gemächer schlich, um sich vorlesen zu lassen. Außer den beiden gab es noch ihre Tante Elisabeth, eine Schwester des Königs, die ihr bei offiziellen Anlässen freundlich begegnete. Elisabeth war noch unverheiratet, beklagte sich aber nie darüber, ihr Leben am Hofe des Bruders zu vergeuden. Unfähig, das eigene Schicksal in die Hand zu nehmen, verbrachte sie ihre Tage und Nächte damit, abzuwarten, ob ihre königliche Schwägerin nicht doch noch einen Gemahl für sie fand. Eine Freundin, der Thérèse ihre Beobachtungen über das Leben am Hof zu Versailles hätte anvertrauen können, war Elisabeth somit beim besten Willen nicht geworden.
Nachdem Thérèse eine Weile mit Blanche, der Nichte ihrer Erzieherin, geplaudert hatte, beschloß sie, ihre Zeichenutensilien zu nehmen und mit ihnen ein ruhiges, abgelegenes Plätzchen zu suchen.
Das Entdecken von Formen und Perspektiven nahm seit einiger Zeit ihre gesamte Aufmerksamkeit in Anspruch, denn dies gehörte zu dem Unterrichtsstoff, mit dem sie von einem der Hofmaler ihrer Mutter traktiert wurde. Thérèse, die zwar Interesse an der Geometrie, aber wenig Sinn für die Komposition von Farben hatte, ahnte, daß es dem begabten Künstler, der bereits ihre gesamte Familie in Öl gebannt hatte, keine besondere Freude bereitete, ausgerechnet sie zu unterrichten. Dennoch lobte er ihre Fortschritte in Gegenwart der Königin oder Madame Tourzels in den höchsten Tönen. Thérèse fand dieses Verhalten mehr als eigenartig. Sie hatte sich längst daran gewöhnt, daß jede ihrer Bewegungen bei Hofe abschätzend beobachtet wurde, ihre Mutter schien es indessen als Beleidigung aufzufassen, auf einen Verstoß gegen das strenge Hofzeremoniell hingewiesen zu werden, auch wenn dieser noch so gering war. Bislang hatte Marie Antoinette nicht darauf bestanden, die Skizzen und Entwürfe ihrer Tochter zu begutachten, aber das konnte sich ändern, sobald die Feierlichkeiten zum Namenstag des Königs zu Ende waren. Es war also besser, den Ärger der Königin gar nicht erst heraufzubeschwören und statt dessen die langweiligen Übungen zu Papier zu bringen, die der Meister ihr aufgegeben hatte.
Ohne Eile wanderte Thérèse am Ufer des Sees entlang. Das Geblöke der Schafe, die auf den Rasenflächen weideten, machte sie müde. Sie überquerte einen Bach nahe der alten Mühle und folgte seinem Lauf, bis sie den hübschen Temple d’Amour vor sich aufragen sah. Die weißen Säulen des Gebäudes glitzerten im Sonnenschein, als hätten seine Baumeister einst Diamantensplitter unter den Mörtel gemischt. Thérèse blieb einen Augenblick stehen, um die Atmosphäre auf sich wirken zu lassen. Von fern drangen gedämpfte Stimmen und Gelächter an ihr Ohr. Offensichtlich hatten die Höflinge ihre Mahlzeit inzwischen beendet und ergingen sich nun in Spielen, Mokkatrinken oder anderem Zeitvertreib. Die Königin und ihre Freunde fanden Gefallen daran, in den Gärten oder in dem kleinen Theater des Trianon Stücke großer französischer Poeten aufzuführen.
Thérèse war froh, daß sie sich rechtzeitig aus dem Staub gemacht hatte. Sie hatte kein Verlangen danach, in die Haut einer anderen Person zu schlüpfen, und zitterte regelmäßig bei der Vorstellung, ihre Mutter könnte sie mit einer Rolle versehen, die sie vor aller Augen der Lächerlichkeit preisgab. Bisher war ihr wegen ihrer von der Königin selbst attestierten Phantasielosigkeit dieses Los erspart geblieben, nicht aber Madame Tourzel, für die sich die Königin und Prinzessin Lamballe im vergangenen Sommer etwas ganz Besonderes hatten einfallen lassen. Die Marquise, die recht behäbig war, hatten beide kurzerhand zur Waldnymphe erklärt und in ein Kostüm aus dürren Zweigen, Blättern und Rinde gesteckt, in dem die Unglückliche so lange verharren mußte, bis junge Tänzerinnen und ein als pferdefüßiger Hirtengott Pan verkleideter Höfling vor ihr ein improvisiertes Prunkballett aufführten. Irgendwann hatte sich der verwöhnte Schoßhund der Prinzessin Lamballe losgemacht, um sich zum Vergnügen der Gäste auf die Suche nach einem geeigneten Baum zu begeben. Das schadenfrohe Gekreische und Gelächter, das die Marquise Tourzel in ihrem Nymphenkostüm erdulden mußte, während der Hund der Lamballe an ihren Zweigen kaute, klang Thérèse noch immer schauerlich in den Ohren.
Unweit des hellen Gebäudes befand sich eine kaskadenartige Grotte, zwischen deren künstlich aufgerichteten Felsen es im Sommer herrlich kühl war. Thérèse rückte ihren gelben Strohhut zurecht und schirmte die Augen vor dem gleißenden Licht ab, dann nahm sie mit ihren Zeichenutensilien auf einem warmen Stein Platz. Abwägend schaute sie sich um. Wenn sie etwas von ihrer Mutter angenommen hatte, so war es die Gabe, jede noch so unbedeutend wirkende Einzelheit zu erfassen. Doch was sie in ihrer Umgebung erblickte, kannte sie in- und auswendig. Es gab einfach nichts mehr, was reizvoll genug war, um es aufs Papier zu bannen. Schließlich entschied sie sich dafür, sich an einer der wild wachsenden Pflanzen zu versuchen, die unter einem Stein hervorwucherte. Beschienen von der Sonne, wirkte das dürre Strauchwerk beinahe so, als würde es lodern. Thérèse mußte an die Geschichte vom brennenden Dornbusch denken, die der Hofkaplan ihr bei einer der täglichen Andachtsstunden am frühen Morgen erzählt hatte.
Auf dem Kiesweg, der einige Schritte entfernt von der Grotte verlief, ertönten plötzlich knirschende Geräusche. Thérèse hob überrascht den Kopf. Jemand kam in ihre Richtung gelaufen. Soweit sie sehen konnte, waren es zwei Männer, ein junger und ein älterer, die geradewegs auf das Schloß zuhielten. Thérèse legte die Stirn in Falten, während sie sich hinter einem Findling verbarg. Sie kannte die beiden Fremden nicht, offensichtlich gehörten sie nicht zum Hofstaat ihres Vaters. Die Männer waren schlicht gekleidet, wenngleich sich an dem dunkelblauen, mit Silberfaden gesäumten Tuch ihrer Gehröcke unschwer ein bescheidener Wohlstand ablesen ließ. Ihre Gesichter waren erhitzt und glänzten im Sonnenlicht wie Wachs.
Den jungen Mann schätzte Thérèse auf etwa achtzehn Jahre. Die Sonne hatte seiner Haut einen bronzenen Teint verliehen. Offenkundig beschäftigte er sich oft und gerne unter freiem Himmel.
Beneidenswert, dachte Thérèse. Ihr dagegen war es von Madame Tourzel strikt untersagt worden, das Schloß ohne ihren breitkrempigen Sonnenhut oder einen kleinen Seidenschleier zu verlassen. Am Hof zu Versailles galt es als unschicklich, sich Wind und Wetter auszusetzen. Frauen, die zum Umfeld der Königin gehörten, achteten darauf, ihre natürliche Blässe zu bewahren, was dazu führte, daß ihre Haut fahl, die Augen dagegen groß und vorwurfsvoll aussahen. Auf Thérèse wirkten die meisten Edeldamen wie leblose Porzellanpuppen. Hölzern und leblos. Sie fürchtete sich direkt vor ihrem Anblick.
Vorsichtig kletterte Thérèse ein Stück höher und stemmte sich mit den Ellenbogen gegen einen der glatten Felsen, um den jungen Mann besser beobachten zu können. Sie bemerkte, daß er ein grünes, mit Eisen beschlagenes Kästchen vor sich her trug. In regelmäßigen Abständen blickte sich sein Begleiter mit besorgter Miene um, als befürchtete er, der Junge könnte stolpern und die Kassette zu Boden fallen lassen.
Als sie am Portal des Trianon angelangt waren, blieb der alte Mann unvermittelt stehen. Er schaute sich argwöhnisch nach allen Seiten um, vergewisserte sich, daß der Hof verlassen vor ihm lag. Dann klemmte er seinen Spazierstock unter den Arm, zog ein Tuch aus der Brusttasche seines Gehrocks hervor und begann, seine gerötete Stirn abzutupfen. Thérèse vermutete, daß der Alte unter seiner gepuderten Perücke wie ein Eintopf kochte und empfand Mitgefühl für ihn. Gewiß war er ein Hoflieferant, den man bei dieser Hitze nach Versailles bestellt hatte, um die Launen einer der Edeldamen zu befriedigen.
Zu ihrer Überraschung sah Thérèse, wie der Mann plötzlich vortrat und dem Jüngeren das Kästchen mit einer barschen Bewegung aus der Hand riß. Die beiden Männer begannen vor dem Tor miteinander zu diskutieren. Das Gesicht des Alten schwoll dabei krebsrot an, irgend etwas schien ihn zu erregen.
Thérèse wandte sich ab. Ein Gefühl der Beklommenheit begann sich in ihrer Brust zu regen. Madame Tourzel hätte ihr Verhalten zweifellos mißbilligt, denn es gehörte sich nicht, den Streit wildfremder Menschen zu belauschen. Zu ihrem Bedauern war sie zu weit entfernt, um zu verstehen, worum es bei der Auseinandersetzung der Männer ging, doch ihr entging nicht, wie der Junge schließlich ärgerlich kehrtmachte und mit wehenden Rockschößen dem Tor zu den Parkanlagen entgegeneilte. Der ältere Mann starrte ihm einen Augenblick lang betreten nach, dann straffte er seine Schultern und betrat das Lieblingsdomizil der Königin.
Thérèse machte sich an den Abstieg von ihrem heimlichen Beobachtungsposten. Ihr Ausflug durch die Gärten des Trianon war pure Zeitverschwendung gewesen, nicht eine einzige Linie hatte sie zu Papier gebracht. Es ging sie ja auch wahrhaftig nichts an, was sich zwischen den beiden Fremden, möglicherweise Vater und Sohn, zugetragen hatte.
Das französische Volk lebte jenseits der hohen Mauern, welche die Palastanlagen weiträumig umgaben, in seiner eigenen Welt. Seine Nöte kannte Thérèse nur aus Madame Tourzels unverbindlichen Andeutungen. In Paris war sie zu ihrem Bedauern nie gewesen. Ihre Eltern, vor allem der Vater, mieden die Hauptstadt. Lediglich Blanche Tourzel, die sich um ein Waisenhaus in einem der ärmsten Viertel kümmerte und regelmäßig Vorräte dorthin schaffen ließ, vermittelte ihr einen Eindruck von den Zuständen, die auf den Gassen und Plätzen von Paris herrschten. In einigen der Gasthäuser am Seineufer wurden immer häufiger Stimmen laut, die offenen Aufruhr predigten. Blanche kehrte von ihren Besuchen stets mißgestimmt ins Schloß zurück, aber da Madame Tourzel es ihr untersagte, Thérèse mit ihren Beobachtungen zu konfrontieren, konnte sich das Mädchen nicht so recht vorstellen, wie das Volk wirklich lebte.
Versailles dagegen war Thérèse von Kindheit an wie ein goldener, himmlischer Ort vorgekommen. Ihre Mutter behauptete, es sei für die Ewigkeit erbaut worden, und bezweifelte, daß sich am Leben seiner Bewohner jemals etwas ändern würde. Dennoch hatte selbst Thérèse schon zuweilen erleben müssen, wie unbeliebt ihre Mutter bei der einfachen Bevölkerung geworden war. Sie kannte das höhnische Getuschel, das sich hinter ihrem Rücken durch die Säle des Palastes zog, und hatte die zerrissenen Pamphlete gesehen, die Blanche kopfschüttelnd ins Kaminfeuer geworfen hatte und in denen man sich über den König und seine Gemahlin lustig machte. Selbst einige der mächtigsten Aristokraten des Landes nannten Marie Antoinette abfällig »die Österreicherin«, verweigerten ihr sämtliche Ehrenbezeugungen und verdächtigten sie geheimer Liebschaften. Für sie trugen allein die Königin und ihre Vertrauten die Verantwortung für die bittere Armut des Volkes.