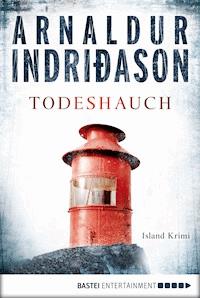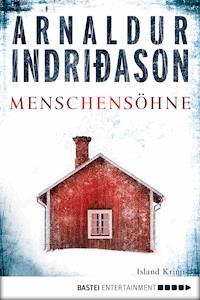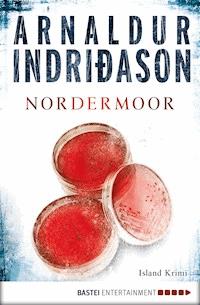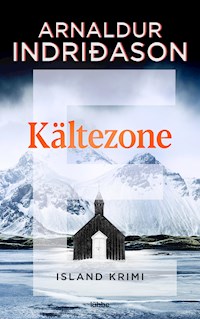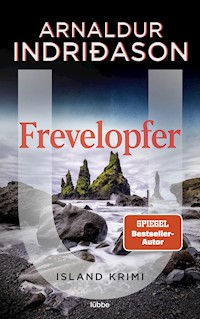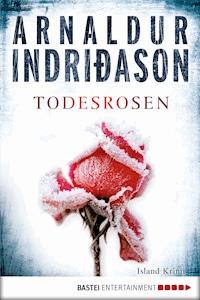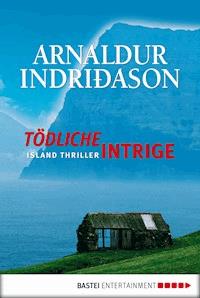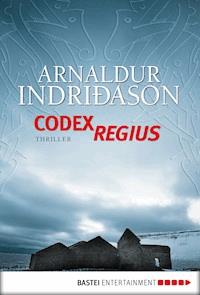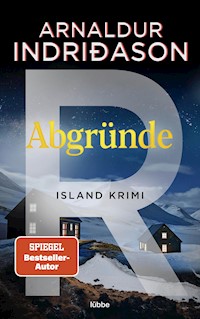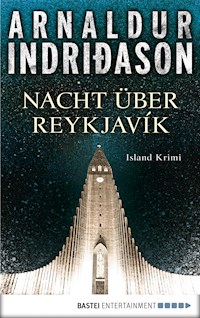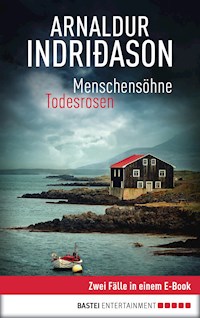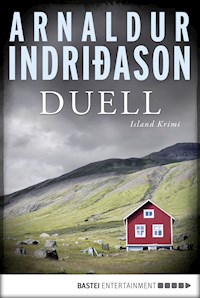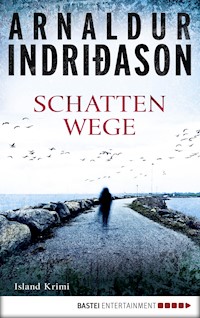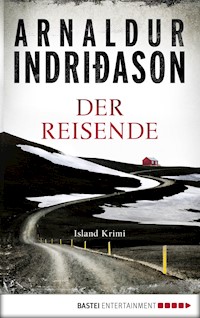
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Krimi
- Serie: Flovent-Thorson-Krimis
- Sprache: Deutsch
Ein Handelsreisender wird in einer Wohnung in der Innenstadt ermordet aufgefunden. Der gezielte Schuss in den Kopf, der ihn getötet hat, erinnert an eine Hinrichtung. Der Verdacht der Polizei fällt sofort auf die ausländischen Soldaten, die während der Kriegsjahre die Straßen Reykjavíks bevölkern. Thorson, kanadischer Soldat mit isländischen Wurzeln, und Flóvent von der Reykjavíker Polizei nehmen die Ermittlungen auf. Steht der Mord mit Spionagetätigkeiten auf Island in Verbindung?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 446
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Über dieses Buch
Ein Handelsreisender wird in einer Wohnung in der Innenstadt ermordet aufgefunden. Der gezielte Schuss in den Kopf, der ihn getötet hat, erinnert an eine Hinrichtung. Der Verdacht der Polizei fällt sofort auf die ausländischen Soldaten, die während der Kriegsjahre die Straßen Reykjavíks bevölkern. Thorson, kanadischer Soldat mit isländischen Wurzeln, und Flóvent von der Reykjavíker Polizei nehmen die Ermittlungen auf. Steht der Mord mit Spionagetätigkeiten auf Island in Verbindung?
Über den Autor
Arnaldur Indriðason, 1961 geboren, graduierte 1996 in Geschichte an der University of Iceland und war Journalist sowie Filmkritiker bei Islands größter Tageszeitung Morgunbladid. Heute lebt er als freier Autor mit seiner Familie in Reykjavik und veröffentlicht mit sensationellem Erfolg seine Romane. Arnaldur Indriðasons Vater war ebenfalls Schriftsteller. 1995 begann er mit Erlendurs erstem Fall, weil er herausfinden wollte, ob er überhaupt ein Buch schreiben könnte. Seine Krimis belegen allesamt seit Jahren die oberen Ränge der Bestsellerlisten. Seine Kriminalromane »Nordermoor« und »Todeshauch« wurden mit dem »Nordic Crime Novel’s Award« ausgezeichnet, darüber hinaus erhielt der meistverkaufte isländische Autor für »Todeshauch« 2005 den begehrten »Golden Dagger Award« sowie für »Engelsstimme« den »Martin-Beck-Award«, für den besten ausländischen Kriminalroman in Schweden. Arnaldur Indriðason ist heute der erfolgreichste Krimiautor Islands. Seine Romane werden in einer Vielzahl von Sprachen übersetzt. Mit ihm hat Island somit einen prominenten Platz auf der europäischen Krimilandkarte eingenommen.
Arnaldur Indriðason
Der Reisende
Island Krimi
Übersetzt aus dem Isländischenvon Anika Wolff
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Namen, Personen und Begebenheiten in diesem Roman sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind nicht beabsichtigt.
Titel der isländischen Originalausgabe:
»þýska húsið«
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2015 by Arnaldur Indriðason
Published by arrangement with Forlagið, www.forlagid.is
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Anja Lademacher, Bonn
Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign, München, unter Verwendung von Motiven von © photocase.de/rcaucino und shutterstock.com/Alina G
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN: 978-3-7325-4941-2
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Eins
Vorsichtig steuerte die Súðin an den Fregatten und Zerstörern vorbei in den Hafen von Reykjavík. Wenig später gingen nach und nach die Passagiere von Bord, einige noch schwankend, froh, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Auf dem Weg über die Faxaflói-Bucht war das Schiff nach einer bis dahin ruhigen Fahrt in starken Südwestwind und Regen geraten und heftig hin- und hergeworfen worden. Die meisten waren unter Deck geblieben, wo es eng war und feucht von den nassen Kleidern der Leute. Ein paar wurden auf diesen letzten Metern zur Stadt noch seekrank, darunter auch Eyvindur.
Er war in Ísafjörður mit seinen beiden abgewetzten Reisetaschen an Bord gegangen und hatte den Großteil der Fahrt verschlafen, erschöpft von der Handelsreise. In den Taschen war Meltonian-Schuhcreme und Politur der Marke Poliflor. Außerdem hatte er Ansichtsexemplare eines Geschirrs dabei, das er in den Dörfern und auf den Höfen im Westen zu verkaufen versucht hatte: Teller, Tassen und Besteck aus Holland, die der Großhändler noch kurz vor Ausbruch des Kriegs importiert hatte.
Die Schuhcreme und die Politur hatte er einigermaßen gut verkaufen können, und er hatte sich auch bemüht, das Service anzupreisen, doch es schien, als stünde den Leuten in solch bedrohlichen Zeiten nicht der Sinn nach derartigen Dingen. Außerdem war es ihm diesmal schwergefallen, wirklich bei der Sache zu sein. Er war nicht in guter Verfassung und hatte einige Orte ausgelassen, die er sonst auf dieser Tour besuchte. Irgendwie mangelte es ihm an Überzeugungskraft, dieser beinahe religiösen Überzeugung, die – wie sein Großhändler immer betonte – für einen guten Verkäufer unabdingbar war. Und so kam er mit nur einer Handvoll Bestellungen zurück. Eyvindur hatte ein schlechtes Gewissen deswegen. Er hätte sich deutlich mehr ins Zeug legen können. Wusste, dass die paar Bestellungen, die er mitbrachte, die Vorräte des Großhändlers wohl kaum schmälern würden.
Als er sich vor einem halben Monat von Reykjavík aus auf die Reise gemacht hatte, war er völlig aufgewühlt gewesen, unter anderem deshalb war die Tour auch nicht so gelaufen, wie er es sich gewünscht hatte. Er hatte sich mit Vera zerstritten, nachdem er sie auf eine Sache angesprochen hatte, ungeschickt, wie er sein konnte, und das saß ihm die ganze Zeit über in den Knochen. Sie hatte sehr heftig darauf reagiert und ihn beschimpft, und er bereute seine Worte bereits, als die Súðin den Reykjavíker Hafen gen Westen verließ. Er hatte zwei Wochen Zeit zum Nachdenken gehabt, um sich eine Entschuldigung zu überlegen, obwohl er sich gar nicht so sicher war, ob er wirklich unrecht hatte. Doch ihre Reaktion war ihm ehrlich vorgekommen. Sie hatte gesagt, dass sie es kaum glauben könne, so etwas von ihm zu hören. Dann war sie in Tränen ausgebrochen und hatte sich eingeschlossen und geweigert, mit ihm zu reden. Eyvindur war drauf und dran gewesen, das Schiff zu verpassen, er hatte sich die Taschen mit der Schuhcreme, der Politur und dem holländischen Geschirr geschnappt und sich gewünscht, nicht Handelsreisender zu sein und so lange von zu Hause wegbleiben zu müssen, ohne zu wissen, was Vera in der Zwischenzeit tat.
Dasselbe dachte er auch noch, als er an Land sprang und in Richtung Stadtzentrum eilte. Er lief, so schnell er konnte, nach Hause, trotz seines jungen Alters beleibt und schwerfällig, die Fußspitzen leicht nach außen gedreht, in seinem Trenchcoat und in jeder Hand eine Tasche. Inzwischen regnete es noch stärker, und das Wasser rann von der Hutkrempe, lief ihm in die Augen und durchnässte Hose und Schuhe. Er stellte sich am Eingang der Apotheke unter und lugte um die Ecke zum Austurvöllur. Ein Trupp Soldaten marschierte über den Platz vor dem Parlamentsgebäude. Die amerikanischen Truppen lösten langsam die britischen ab. Vor lauter Amis und großen Trucks und Sandsackstellungen und Kanonenschnauzen und Militärjeeps konnte man in Reykjavík kaum noch einen Schritt tun. Die einst so friedliche kleine Stadt war seit Ausbruch des Kriegs nicht mehr wiederzuerkennen.
Hin und wieder hatte Vera ihn abgeholt, wenn das Schiff anlegte, ihn nach Hause begleitet und ihm erzählt, wie es ihr in der Zwischenzeit ergangen war, und er hatte ihr alles von seiner Reise berichtet, welche Leute er getroffen hatte, wie der Verkauf gelaufen war. Er hatte ihr gesagt, dass er nicht wisse, wie lange er diesen Job noch machen werde, dass er glaube, kein besonders guter Verkäufer zu sein. Er wisse einfach nicht, wie er die Waren anpreisen könne, um bei den Kunden den Wunsch zu wecken, sie unbedingt besitzen zu wollen. Noch dazu war er kein Konversationstalent, im Gegensatz zu Felix beispielsweise. Der strotzte nur so vor Selbstvertrauen.
Dasselbe galt für Runki. Der war manchmal auch an Bord der Súðin, die Taschen vollgestopft mit allen möglichen Hüten und sonstigen Kopfbedeckungen aus Luton. Er beneidete Runki um seinen forschen Auftritt, er schnitt immer dick auf und war selbstsicher, die Leute hingen ihm an den Lippen. Er war wirklich ein Verkäufer von Gottes Gnaden. Der Schlüssel zum Erfolg lag in seinem Selbstvertrauen. Während Eyvindur noch irgendetwas von holländischem Geschirr faselte, setzten die Leute in der ganzen Stadt schon Runkis neue Hüte auf und schauten drein, als hätten sie das Geschäft ihres Lebens gemacht.
Eyvindur hatte keine Ruhe mehr, darauf zu warten, dass der Regen nachließ. Er nahm seine beiden Taschen, zog den Kopf ein und lief über den Austurvöllur, Wind und Regen entgegen, diesem kalten Spätsommerregen, der sich über der Stadt ausschüttete. Sie wohnten in einer kleinen Mietswohnung, die dem Bruder seines Vaters gehörte. Der Wohnraum in der Stadt war knapp, und dementsprechend hoch waren die Mieten. Die Leute strömten vom Land in die Städte, vor allem nach Reykjavík, in der Hoffnung auf Arbeit beim Militär, echtes Geld, ein besseres Leben. Seinem Onkel gehörten einige Wohnungen in der Stadt, und er verdiente sich eine goldene Nase, doch Eyvindur gegenüber war er fair und verlangte keine Wuchermiete. Dennoch war sie für ihn noch hoch genug, und es kam vor, dass er seinen Onkel um Aufschub bitten musste, wenn es um sein Selbstvertrauen besonders schlecht bestellt war und seine Arbeit nichts abwarf.
Die Wohnung lag im Erdgeschoss eines dreistöckigen Steinhauses. Er schloss Eingangs- und Wohnungstür auf, holte schnell die Taschen, die er vor der Haustür abgestellt hatte, und trug sie in die Wohnung. Gleichzeitig rief er nach seiner Liebsten, in der festen Überzeugung, dass sie bereits auf ihn wartete.
»Vera? Schatz?«
Eyvindur bekam keine Antwort und schloss die Tür, schaltete das Licht ein und holte tief Luft. Er hatte sich auf dem letzten Stück so beeilt, ganz umsonst. Vera war nicht zu Hause. Sie war irgendwo unterwegs, und er musste noch warten, bis er sich zu ihr setzen und sich für seine Worte entschuldigen konnte. Im Stillen hatte er schon geübt, was er sagen wollte und musste, damit alles wieder so würde wie zuvor.
Nach dem Regen war keine trockene Faser mehr an ihm. Er nahm seinen Hut ab, zog den Mantel aus und legte ihn über einen Stuhl im Wohnzimmer. Sein Jackett hängte er in den Garderobenschrank. Er öffnete eine seiner Taschen und nahm ein Pfund echten Kaffee heraus, den er im Westen aufgetrieben hatte und mit dem er Vera eine Freude machen wollte. Er war schon auf dem Weg in die Küche, als er plötzlich stehen blieb. Irgendetwas am Garderobenschrank war ungewöhnlich gewesen.
Eyvindur machte kehrt und öffnete den Schrank im Flur noch einmal. Sein Jackett hing dort auf einem Kleiderbügel, daneben eine weitere, etwas längere Jacke von ihm und ein zweiter Mantel. Doch was ihn so stutzig machte, waren die Sachen, die fehlten. Veras Kleider waren nicht mehr da. Die Schuhe, die normalerweise auf dem Boden des Schranks standen, fehlten. Zwei Mäntel, die ihr gehörten, waren ebenfalls weg. Er stand eine Weile da und starrte in den Schrank, dann ging er ins Schlafzimmer. Dort stand der Kleiderschrank, der noch etwas größer war, mit Schubladen für Strümpfe und Unterwäsche und einer Stange für Hemden und Kleider. Eyvindur öffnete die Schranktüren und zog die Schubladen heraus und musste feststellen, dass merkwürdigerweise Veras gesamte Kleidung verschwunden war. Seine Sachen waren alle noch an Ort und Stelle, doch es gab keinen einzigen Fetzen Frauenkleidung mehr.
Eyvindur traute seinen Augen nicht. Wie in Trance ging er zu Veras Nachttisch, guckte überall hinein und sah, dass ihre Sachen auch hier fehlten. Hatte sie ihn verlassen? War sie ausgezogen?!
Geistesabwesend setzte er sich aufs Bett und erinnerte sich an das, was Runki über Vera gesagt hatte, als er glaubte, Eyvindur würde ihn nicht hören. Sie waren sich im Heitt og kalt in der Stadt begegnet, einem bei den Soldaten beliebten Lokal, und hatten ein paar Worte gewechselt. Das war am Tag seiner Abreise gewesen. Runki saß dort mit irgendeinem Freund und aß Fish and Chips, und als er Eyvindur außer Hörweite glaubte, sagte er diese Sache über Vera.
Diesen unsinnigen Quatsch, den dieser Halunke von Runki lieber sofort wieder hätte zurücknehmen sollen, darauf hätte er bestehen müssen. Diese Lüge, die Vera so wütend gemacht und verletzt hatte, als er sie dämlicherweise beim Abschied darauf angesprochen hatte.
Eyvindur starrte auf die leeren Schubladen und rammte die Faust ins Bett. Tief in seinem Inneren hatte er so etwas befürchtet. Und inzwischen war er sich gar nicht mehr so sicher, ob das wirklich nur ein aus der Luft gegriffenes Gerücht gewesen war, das Runki seinem Freund zugeflüstert hatte. Dass Vera im sogenannten Zustand sei, dass sie etwas mit einem Soldaten angefangen habe.
Und was hatte sein ehemaliger Mitschüler, dieser Mistkerl von Felix, geredet, als sie sich in Ísafjörður über den Weg gelaufen waren? War etwas dran an dem, was er über die Schule und die Untersuchungen gesagt hatte, oder wollte er ihn nur runtermachen, weil er sturzbetrunken und immer noch genauso abscheulich war wie damals, als Eyvindur noch glaubte, sie seien Freunde?
Zwei
Flóvent sah sich die Wohnung an und konnte nichts entdecken, was auf eine gewalttätige Auseinandersetzung hindeutete. Und dennoch sprang ihn die Gewalt in all ihrer Monstrosität an. Auf dem Boden lag die Leiche eines Mannes, dem man durch den Kopf geschossen hatte. Es wirkte wie eine Hinrichtung, das Opfer schien keine Chance gehabt zu haben, sich zu wehren. Kein Stuhl war umgeworfen worden. Kein Tisch verrückt. Alle Bilder hingen gerade an den Wänden. Die Fenster waren ganz und verschlossen, sodass es kein Einbruch gewesen sein konnte. Auch die Wohnungstür war unversehrt. Der Mann mit der Schusswunde im Hinterkopf hatte also dem Angreifer die Tür geöffnet oder sie für ihn offen stehen lassen, nicht ahnend, dass es das Letzte sein würde, was er tat. Allem Anschein nach war er gerade erst nach Hause gekommen, als man ihn angegriffen hatte, denn er trug noch seinen Mantel und hielt den Wohnungsschlüssel in der Hand. Auf den ersten Blick wirkte es nicht so, dass etwas aus der Wohnung gestohlen worden war. Das einzige Ziel des Besuchers schien es gewesen zu sein, dieses Verbrechen zu begehen, und zwar auf eine Weise, dass die Polizisten, die als Erste am Tatort gewesen waren, sich noch immer nicht davon erholt hatten. Einer von ihnen hatte sich im Wohnzimmer übergeben. Der andere stand vor dem Haus und wollte nicht wieder hinein.
Flóvents erste Maßnahme am Tatort war es gewesen, all diejenigen fortzujagen, die nicht direkt an der Untersuchung des Falls beteiligt waren. Die Polizisten, die überall in der Wohnung Spuren hinterlassen hatten. Die Zeugin, die die Polizei informiert hatte. Neugierige Nachbarn, die nicht sicher waren, ob sie etwas gehört hatten, als sie erfuhren, dass in der Wohnung ein Schuss gefallen war. Am Ende waren nur noch Flóvent und der Kreisarzt übrig, der gekommen war, um den Tod des Mannes festzustellen.
»Er stirbt natürlich sofort«, sagte der Arzt, ein kleiner schmaler Mann mit vorstehenden Zähnen, die auf eine Pfeife bissen, die er kaum aus dem Mund nahm. »Der Schuss kommt aus so kurzer Entfernung, dass es nur auf eine Art enden kann«, fuhr er fort und blies Pfeifenqualm aus. »Die Kugel verlässt den Schädel durch das Auge, daher diese verdammte Sauerei«, fügte er hinzu und betrachtete die langsam trocknende Blutlache, die sich unter der Leiche gebildet und auf dem Holzboden ausgebreitet hatte. Einer der Polizisten war versehentlich in die dunkle Pfütze getreten und weggerutscht, sodass er beinahe gefallen wäre. Man sah noch seine Fußspuren im Blut. Die Möbel und Wände waren mit Blut bespritzt. Hirnmasse klebte in den Vorhängen. Der Mörder hatte durch ein dickes Sofakissen geschossen, um den Knall zu dämpfen, und das Kissen anschließend wieder aufs Sofa geworfen. Die Hälfte des Gesichts, die nach oben zeigte, fehlte fast vollständig.
Flóvent versuchte, sich in Erinnerung zu rufen, wie man bei einer Ermittlung am Tatort vorging. Mord war kein alltägliches Ereignis in Reykjavík. Außerdem war er noch ziemlich neu und unerfahren in diesem Job und wollte alles richtig machen. Er arbeitete erst seit wenigen Jahren für die Kriminalpolizei in Reykjavík, war einmal einen halben Winter bei der Kriminalbehörde von Edinburgh gewesen, wo er einiges Wissen und Erfahrungen gesammelt hatte. Den toten Mann schätzte er auf Ende zwanzig, sein Haar wurde schon dünner, er trug einen zerschlissenen Anzug, einen Mantel und billige Schuhe. Man hatte ihn wohl auf die Knie gezwungen, und er war nach vorn gekippt, als der Schuss seinen Hinterkopf getroffen hatte. Ein Schuss an der richtigen Stelle. Aber das hatte dem Mörder aus irgendeinem Grund nicht gereicht. Die Leiche lag auf der Seite, und der Mörder hatte in die Einschussstelle gefasst und die Stirn des Mannes mit Blut beschmiert. Was hatte es damit auf sich? Hatte der Mörder es für notwendig gehalten, eine Art Unterschrift zu hinterlassen? Einen Kommentar, den er wichtig fand, dessen Bedeutung Flóvent aber nicht verstand. Sollte es eine Entschuldigung sein? Eine Erklärung? Zweifel? Reue? Von allem etwas? Oder nichts von all dem, sondern im Gegenteil eine Provokation, die Beteuerung, dass der Täter nichts bereute oder bedauerte? Flóvent schüttelte den Kopf. Er konnte nichts aus diesem blutigen Geschmier herauslesen.
Die Kugel, die fest im Boden steckte, war schnell gefunden. Flóvent markierte die Stelle, bevor er sie mit einem Taschenmesser herausholte und auf der flachen Hand betrachtete. Er wusste sofort, zu welchem Modell die Munition passte, denn neben der Untersuchung von Fingerabdrücken interessierte er sich besonders für Waffenkunde. Ihm war es außerdem wichtig, Fotos von Tätern und Tatorten machen zu lassen, wenn es um ernsthaftere Verbrechen ging. Das alles waren hierzulande Neuerungen bei der Ermittlung in Kriminalfällen. Wenn er es für nötig hielt, rief er den Fotografen, der ein kleines Fotostudio in der Stadt betrieb, und ließ ihn im Auftrag der Polizei Fotos machen. So hatten sie inzwischen einige Informationen und erste Kenntnisse über die Ermittlung in Kriminalfällen gesammelt – auch wenn diese immer noch sehr bescheiden und unausgereift waren.
»Derjenige, der den Schuss abgegeben hat, stand hinter ihm, die Waffe natürlich eine Armlänge von sich entfernt«, sagte der Kreisarzt und nahm die Pfeife einen Moment aus dem Mund, bevor er sie sich wieder zwischen die Zähne schob. »So kannst du dir in etwa vorstellen, wie groß er war.«
»Ja«, sagte Flóvent. »Darüber habe ich gerade nachgedacht. Der Mörder muss nicht unbedingt ein Mann sein. Es könnte auch eine Frau gewesen sein.«
»Ich weiß ja nicht. Machen Frauen so etwas? Ich denke eher nicht.«
»Ich will nichts ausschließen.«
»Du siehst ja, das ist die reinste Hinrichtung«, sagte der Arzt und paffte. »So etwas ist mir noch nie zu Gesicht gekommen. Er musste sich in seinem eigenen Zuhause auf den Boden knien und ist wie ein Hund erschossen worden. Zu so etwas ist doch nur ein kaltblütiger Scheißkerl fähig, oder?«
»Und die Stirn mit Blut zu beschmieren?«
»Ja, keine Ahnung … ich weiß auch nicht, was das bedeuten soll.«
»Wann, meinst du, ist das passiert?«
»Lange ist das noch nicht her«, sagte der Arzt und sah sich das getrocknete Blut auf dem Boden an. »Einen halben Tag vielleicht. Nach der Obduktion werden wir es genauer wissen.«
»Also gestern Abend?«, folgerte Flóvent.
In diesem Augenblick kam der Fotograf herein, mit Stativ und einer Speed-Graphic-Kamera, die er vor dem Krieg erworben hatte. Er begrüßte Flóvent und den Arzt und sah sich Wohnung und Tatort an, ohne eine Miene zu verziehen. Der Mann ging routiniert ans Werk, stellte das Stativ auf, öffnete den Kamerakasten, setzte die Kamera aufs Stativ und schob die Kassette in die Rückseite des Apparats. Darin waren zwei Filme. Er hatte mehrere solcher Kassetten und einige Blitzbirnen dabei.
»Wie viele Bilder willst du?«, fragte er.
»Mach ein paar«, sagte Flóvent.
»War der Täter einer vom Militär?«, fragte der Fotograf, als er eine Pause machte, um eine neue Filmkassette einzulegen. Er stellte die Kamera wieder auf und tauschte die Birne aus.
»Warum glaubst du das?«
»Hat das nicht was Militärisches?«, sagte der Fotograf. Er sah müde aus, war um die sechzig. Flóvent hatte ihn noch nie lächeln sehen.
»Mag sein«, sagte Flóvent geistesabwesend und sah sich nach Spuren des Schützen um, ob er irgendetwas zurückgelassen hatte, Fußabdrücke, Kleidung, Zigarettenasche. Das Opfer schien kurz zuvor noch in der Küche gewesen zu sein, um eine Kleinigkeit zu essen. Ein angebissenes trockenes Käsebrot lag auf dem Tisch. Daneben eine Tasse Tee, von dem ein paar Schlucke getrunken worden waren. Flóvent hatte den Mann nach seiner Geldbörse abgesucht, aber keine gefunden, auch sonst nirgends in der Wohnung.
»Ich glaube, dass nur Soldaten so entschieden vorgehen«, sagte der Fotograf.
Ein Lichtblitz erhellte das Wohnzimmer, und noch einmal machte er sich daran, den schweren Apparat an einer anderen Stelle zu positionieren und eine neue Kassette einzulegen.
»Das kann gut sein«, sagte Flóvent. »Damit habe ich keine Erfahrung. Du kennst dich da vielleicht besser aus.«
»Vielleicht sogar ein hohes Tier?«, überlegte der Fotograf. »Irgendjemand mit Macht, ein ranghoher Offizier? Das ist doch die reinste Hinrichtung. Voller Überheblichkeit.«
»Da seid ihr euch wohl nicht ganz einig«, sagte der Kreisarzt und stopfte seine Pfeife. »Flóvent glaubt, dass es eine Frau war.«
»Nein«, sagte der Fotograf und sah sich lange den Mann auf dem Boden an, bevor er ein weiteres Foto schoss. »Nein, das ist ausgeschlossen.«
»Vielleicht ist er ausgeraubt worden«, sagte Flóvent. »Ich habe keine Geldbörse gefunden.«
Die Wohnung sah aus, als hätte der Mann sie allein bewohnt. Eine typische Junggesellenwohnung, klein und einfach, ohne Schnickschnack, aber sauber. Der einzige Schmuck war das Sofakissen, das als Schalldämpfer hatte herhalten müssen. Ansonsten war die Wohnung sparsam eingerichtet, das meiste wirkte abgenutzt, ein Sofa und ein Sessel im Wohnzimmer, zwei alte Holzstühle in der Küche. Alle Vorhänge waren zugezogen, aber in Küche und Wohnzimmer brannte Licht. Auf dem Sofa lag eine offene Reisetasche, darin waren Dosen mit Lido-Reinigungscreme und einige Packungen Kolynos-Zahnpasta. Das Blut des Mannes war bis zu den Waren in der Tasche gespritzt.
Ein letztes Mal leuchtete die Schweinerei im Blitzlicht auf, dann packte der Fotograf seine Sachen zusammen. Der Kreisarzt stand schon in der Tür, wo er seine Pfeife wieder ansteckte. Flóvent betrachtete den Mann auf dem Boden, konnte die nackte Gewalt nicht begreifen, die hinter diesem Mord stecken musste, den Hass und die Wut und diese absolute Erbarmungslosigkeit.
»Hast du auch die Schmiererei auf seiner Stirn fotografiert?«, fragte er den Fotografen.
»Ja. Was ist das? Was soll dieses Geschmier?«
»Ich weiß es nicht«, sagte Flóvent. Die ganze Zeit über hatte er es vermieden, sich das zerschossene Gesicht des Mannes anzusehen. »Ich kann da nichts herauslesen. Habe keine Ahnung, warum seine Stirn so mit Blut besudelt worden ist.«
»Hast du schon rausgefunden, wer der Mann ist?«, fragte der Fotograf auf dem Weg nach draußen.
»Ja, die Vermieterin hat es mir gesagt, und hier sind auch Rechnungen auf seinen Namen«, sagte Flóvent.
»Und, wer ist es?«
»Ich kenne ihn nicht«, sagte Flóvent. »Er hieß Felix. Felix Lunden.«
Drei
Die Frau, die die Leiche gefunden hatte, hieß Ólafía, eine Witwe um die fünfzig, die meinte, sie habe von dem Mann die noch ausstehende Miete kassieren wollen, als sie in diesen Horror geriet, wie sie es nannte. Er bezahle monatlich und in der Regel pünktlich, bis jetzt, daher hatte sie sich gezwungen gesehen, ihn auf die Zahlung anzusprechen. Sie hatte den Mann schon einige Zeit nicht gesehen, denn manchmal war er ein, zwei Wochen unterwegs oder auch noch länger. Sie sei runter in den Keller gegangen und habe bei ihm anklopfen wollen, doch die Tür stand einen Spalt offen. Sie habe nach ihm gerufen, aber keine Antwort erhalten und nach einigem Zögern beschlossen, nachzusehen, ob er zu Hause sei, um nachzufragen, ob alles in Ordnung sei und warum er noch nicht gezahlt habe.
»In erster Linie bin ich natürlich aus Sorge um den jungen Mann runtergegangen«, erklärte sie Flóvent, als wollte sie ihm alle Zweifel an ihrer guten Absicht nehmen und sicherstellen, dass sie nicht herumgeschnüffelt hatte. »Ich war noch nicht ganz drin, als ich den Mann im Wohnzimmer liegen sah. Das war furchtbar, ganz furchtbar, und ich … ich habe nach Luft geschnappt und geschrien und bin sofort wieder raus und habe fassungslos die Tür zugeknallt. Das ist der reinste Alptraum. Der reinste Alptraum!«
»Sie haben die Tür also offen vorgefunden?«
»Ja, was sehr ungewöhnlich ist, weil er die Wohnung normalerweise immer abschließt. Am liebsten hätte er sogar das Schloss ausgetauscht, er meinte, dass es alt und leicht zu knacken sei. Das mag ja sein, aber wir schließen uns hier normalerweise nicht ein, genau wie alle Bewohner in dieser Stadt. Das kennen wir gar nicht. Aber vielleicht ist das ja auch naiv und nicht mehr zeitgemäß. In der jetzigen Situation.«
»Hat außer Ihnen sonst noch jemand einen Schlüssel zu dieser Wohnung?«
»Wie meinen Sie das?«
»Wo bewahren Sie Ihren Schlüssel auf?«
»Meinen Schlüssel? Was? Wollen Sie etwa behaupten, ich hätte das getan?!«, empörte sich die Frau und guckte, als hätte Flóvent sie beleidigt. Sie siezte ihn betont.
»Nein, keineswegs«, sagte Flóvent. »Ich muss nur wissen, wer Zugang zu dieser Wohnung gehabt hat, vor allem in den letzten vierundzwanzig Stunden. Nichts weiter. Könnte vielleicht jemand Ihren Schlüssel genommen haben, damit in die Wohnung gelangt sein und ihn anschließend wieder zurückgebracht haben? Er könnte anschließend auf den Mann gewartet und ihn angegriffen haben, als er nach Hause kam. Oder vielleicht hat ja auch jemand das Schloss geknackt, wie Sie sagen. Das wäre dann gestern Abend gewesen.«
Misstrauen sprach aus Ólafías Augen.
»Meinen Schlüssel hat niemand genommen«, behauptete sie, »weil er ihn hatte. Felix hatte den Zweitschlüssel von mir bekommen, er wollte ihn nachmachen lassen. Weil er seinen angeblich verloren hatte. Ich denke, deshalb hat er wohl auch von einem neuen Schloss geredet.«
»Haben Sie Felix gestern Abend gesehen?«
»Nein.«
»Und Sie haben auch nichts in seiner Wohnung gehört?«
»Nein, das habe ich nicht. Ich habe wie immer gegen zehn Uhr geschlafen. Um diese Zeit schlafen hier die meisten Bewohner. Ich lege Wert darauf, dass die Dinge hier ihre Ordnung haben.«
»Ist er schon lange Mieter bei Ihnen?«
»Nein, es mag vielleicht ein halbes Jahr her sein, dass er wegen der Wohnung nachgefragt hat. Damals waren hier noch andere Leute, die ich rausgeworfen habe, ein elender Trinker und seine Frau. Heruntergekommene Leute. Für so etwas habe ich kein Verständnis.«
»Sie sagen, dass er manchmal ein, zwei Wochen außer Haus war. Warum?«
»Na, er war Handelsreisender! Ist regelmäßig durchs Land gefahren.«
»Und bis jetzt hat er seine Miete immer pünktlich gezahlt?«
»Ja. Aber diesmal war er eine Woche drüber, und ich wollte das Geld von ihm.«
Die direkten Nachbarn des Mannes, ein Ehepaar in den Dreißigern, kannten ihn nur flüchtig und hatten in der Nacht keine Bewegungen und keinen Streit mitbekommen. Sie sagten, sie hätten gegen Mitternacht fest geschlafen. Sie wohnten schon länger in diesem Haus als er und bestätigten, dass er ein umgänglicher, munterer junger Mann gewesen sei, wahrscheinlich genau so, wie Handelsvertreter sein müssten. Sie wussten nichts davon, dass er in irgendwelche Konflikte verwickelt gewesen sei, hatten keine Vorstellung, was das hätte sein sollen, und konnten die Gewalt und Brutalität, die in der Nachbarwohnung stattgefunden hatte, nicht begreifen.
»Ich weiß nicht, ob ich heute Nacht hier schlafen kann«, sagte die Frau und sah Flóvent besorgt an. Sie hatte gleich ihren Mann angerufen, der Vorarbeiter bei der Armee war. Er war nach Hause gekommen und saß nun neben ihr. Die beiden waren seit zwei Jahren Mieter bei Ólafía.
»Ich denke nicht, dass in diesem Haus jemand in Gefahr ist«, beruhigte Flóvent sie.
»Wer bringt so etwas über sich, einem Menschen in den Kopf zu schießen?«, fragte die Frau.
Darauf hatte Flóvent keine Antwort.
»Hatte er irgendetwas mit den ausländischen Truppen zu tun?«, fragte er. »Haben Sie Felix in Begleitung von Soldaten gesehen? Haben ihn Soldaten besucht?«
»Nein, ich denke, nicht«, sagte die Frau. »Jedenfalls habe ich nie Soldaten bei ihm gesehen.«
Ihr Mann sagte dasselbe, und Flóvent stellte ihnen noch ein paar Fragen, bevor er bei der dritten Mietpartei anklopfte, einem betagten Ehepaar, das bereits bei Ólafía wohnte, seit ihr Mann gestorben war. Sie erzählten ihm ungefragt, dass er auf See umgekommen sei, bei einem Orkan vor der Halbinsel Reykjanestá.
Keiner von ihnen hatte einen Schuss gehört, beide sagten, dass sie zu der Zeit, zu der die Waffe vermutlich abgefeuert worden war, fest geschlafen hatten. Über Felix Lunden konnten sie nicht viel sagen. Er war oft weg und ansonsten unauffällig, keine laute Gesellschaft oder Feiern, er schien nicht viele Freunde zu haben, und sie wüssten nicht, dass er mit einer Frau zusammen sei. Jedenfalls hätten sie nie eine zu ihm nach Hause kommen sehen. Auch über seine Familie wussten sie nichts.
»Ist Ihnen bekannt, ob er irgendeine Verbindung zum Militär hatte?«, fragte Flóvent.
»Nein – meinen Sie, ob er für die Truppen gearbeitet hat?«
»Ja, oder ob er mit Soldaten befreundet war?«
»Nein«, antwortete die Frau, »das … das ist uns nicht aufgefallen.«
Flóvent saß noch eine Weile bei dem Ehepaar, ehe er zurück in die Wohnung von Felix Lunden ging. Die Leiche war inzwischen ins Leichenschauhaus des Universitätsklinikums gebracht worden. Der Kreisarzt und der Fotograf waren weg, nur ein Polizist in Uniform stand Wache und passte auf, dass kein Unbefugter die Wohnung betrat. Flóvent war der einzige Mitarbeiter der Kriminalpolizei von Reykjavík. Seine ehemaligen Kollegen hatten andere polizeiliche Aufgaben übernommen, die nach Ausbruch des Krieges dringlicher schienen. Vielleicht musste er einige von ihnen zur Unterstützung bei den Ermittlungen zurückholen. Alles deutete darauf hin, dass sie sich kompliziert und schwierig gestalten würden.
Er sah sich noch einmal den Blutfleck im Wohnzimmer und die Kugel an, die im Holzboden gesteckt hatte. Er nahm sie mit zwei Fingern auf und hielt sie ins Wohnzimmerlicht. Er wusste, dass jede Pistole Spuren auf dem Projektil hinterließ, die ganz individuell waren und nur zu dieser einen Schusswaffe passten, genau wie jeder Mensch seinen unverwechselbaren Fingerabdruck hatte. Wenn er die Pistole fand, konnte er die Beschaffenheit des Laufs mit den Spuren auf der Kugel vergleichen und so eindeutig feststellen, ob es sich wirklich um die richtige Waffe handelte.
Den Munitionstyp kannte er. Es war die Standardmunition des Revolvers, den die Amerikaner am häufigsten in diesem Krieg verwendeten: den Colt .45. Nicht umsonst hatte er die Nachbarn nach Berührungspunkten zwischen Felix Lunden und den amerikanischen Soldaten gefragt. Aller Wahrscheinlichkeit nach hatte ihn einer dieser Soldaten ermordet, und die Botschaft war offenbar, dass Felix nichts Besseres verdient hatte, als auf diese Weise hingerichtet zu werden.
Vier
Das Flugzeug war am Ende der Bahn angelangt, drehte dort um und machte sich zum Abflug bereit. Thorson raste ihm in einem Wahnsinnstempo entgegen, sah keine andere Möglichkeit, als sich der Maschine in den Weg zu stellen. Wenn irgend möglich, wollte er keine weitere Zeit mehr an diesen amerikanischen Sänger verschwenden.
Der Mann war spurlos verschwunden gewesen, bis eine ältere Bewohnerin der Öldugata die Polizei auf ihn aufmerksam gemacht hatte. Schon seit dem Morgen hatten sie nach ihm gesucht. Im ersten Moment hielt sie den Mann, den sie auf der Eingangstreppe schlafend vorgefunden hatte, für einen Obdachlosen, aber dann fand sie das doch eher unwahrscheinlich – es wäre der bestgekleidete Obdachlose gewesen, dem sie je begegnet war. Bei näherer Betrachtung glaubte sie sogar, dass er ein Ausländer sein könnte, der möglicherweise den Streitkräften angehörte, auch wenn er keine Uniform trug. Als die Polizei ihr schließlich mitteilte, dass es sich um einen amerikanischen Sänger handele, der sich verlaufen habe und obendrein ein Trinker sei, lachte sie auf und sagte, wenn sie das gewusst hätte, hätte sie ihn hereingebeten.
Thorson hatte den ganzen Tag damit zugebracht, diesen Sänger zu suchen, um ihn in ein Flugzeug zu stecken, das ihn nach Hause bringen sollte. Der Mann stammte aus New York und war eine Woche zuvor mit einer Gruppe amerikanischer Entertainer eingereist, um die Soldaten zu unterhalten. Er war fast während seines gesamten Aufenthaltes auf Island betrunken gewesen und von einem Problem ins nächste gestolpert.
Und so war er auch Thorson begegnet. Der Sänger hatte es fertiggebracht, einige Soldaten nach einem Auftritt so zu beleidigen, betrunken, wie er war, und nicht mehr ganz bei Sinnen, dass sie ihn zusammengeschlagen hatten. Die Militärpolizei war gerufen worden und Thorson nahm zu Protokoll, was der Mann schilderte, nachdem er im Lazarett verarztet und anschließend in sein Zimmer im Hótel Ísland gebracht worden, war. Der Sänger wusste nicht mehr, wer ihn angegriffen hatte, die Täter hatten sich nicht gestellt, und es gab auch keine Zeugen, die die Schlägerei beobachtet hatten. Der Sänger wusste nur noch, dass sie zu dritt gewesen waren und etwas an seinem Gesang auszusetzen gehabt hatten, woraufhin er sie als Provinzler oder etwas in dieser Art beschimpft hatte. Das war hinter der großen Baracke gewesen, in der die Veranstaltung, ein Soldatenball mit allem Drum und Dran, stattgefunden hatte. Dem Mann war die Auseinandersetzung deutlich anzusehen. Er hatte eine aufgeplatzte Lippe, ein blaues Auge und klagte über Schmerzen in der Seite, auf die sie eingetreten hatten.
Als er sich zwei Tage später am Flughafen einfinden sollte, um mit den anderen Entertainern zurückzufliegen, ließ er sich nicht blicken, und Thorson bekam den Auftrag, ihn zu finden und in die Maschine zu setzen, koste es, was es wolle. Der Sänger war nicht in seinem Hotelzimmer und hatte seine Sachen noch nicht gepackt, es herrschte ein einziges Chaos, Kleidung und Weinflaschen und Notenblätter waren über den ganzen Boden verteilt. Man sagte Thorson, er habe in der Nacht und bis in den Morgen hinein mit den Köchen Poker gespielt, und einer von ihnen berichtete, der Sänger habe am frühen Morgen verkündet, dass er sich noch einige Männer vorknöpfen müsse. Dann sei er in Richtung Hafen verschwunden.
»Kann er gut pokern?«, fragte Thorson.
»Er hat uns bis aufs Hemd ausgezogen«, antwortete der Koch müde.
Thorson rief beim Flughafen an und erfuhr, dass man auf den Mann warte, die Maschine fliege erst, wenn er an Bord sei. Daraufhin trommelte Thorson einige Kollegen von der Militärpolizei zusammen, und sie durchkämmten die ganze Stadt, alle Kneipen und Gästehäuser und sogar die Hinterhöfe der Wohnhäuser. Er informierte auch die isländische Polizei über die Suchaktion, für den Fall, dass sie etwas über den Verbleib des Mannes erfuhr. Der Sänger kannte sich in der Stadt kaum aus, und es war unmöglich zu sagen, wo er sich aufhielt. Es hieß, ein Mann, der ihm der Beschreibung nach ähnlich war, bettele im Seemannsheim der Heilsarmee um Schnaps, und einige Gäste, die vor Marta Björnssons Restaurant in der Hafnarstræti standen, berichteten, einen Amerikaner in westliche Richtung wanken gesehen zu haben. Eine Frau in isländischer Tracht zeigte an, von einem Ausländer belästigt worden zu sein, der ihr in der Nähe einer Spelunke namens White Star auf dem Laugavegur nachgestellt habe. Der Mann habe ihr Geld für Beischlaf angeboten. Thorson wusste, dass solche Anzeigen laufend eingingen, nachdem unter den Soldaten der Irrglaube die Runde gemacht hatte, dass alle Frauen in solch volkstümlichen Trachten Prostituierte seien.
Erst gegen Mittag wurde der Sänger schließlich gefunden, als die Frau aus der Öldugata Kontakt zur Polizei aufnahm. Er wurde Thorson übergeben, der mit ihm zuerst zum Hotel raste, um seine Sachen einzusammeln, und dann zum Flughafen von Reykjavík. Dort teilte man ihnen mit, dass der Kapitän mit seiner Geduld am Ende sei. Die Maschine stand schon auf dem Rollfeld und machte sich startbereit. Ohne zu fackeln, raste Thorson mit dem Jeep auf das Flugzeug zu. Jetzt kam auch der Sänger allmählich wieder zu Bewusstsein und begriff, dass seine Maschine kurz davorstand abzuheben und er auf dieser abgelegenen Insel festsitzen könnte. Er sprang auf, wedelte wild mit den Armen und schrie dem Flugzeug mit seiner schönen Tenorstimme entgegen, dass es warten solle.
Der Kapitän sah sich an, wie die beiden auf ihn zugerast kamen, und einen Moment wirkte es, als wollte er sie ignorieren, doch dann hob er kapitulierend die Hände und wartete, bis Thorson an die Maschine herangefahren kam. Die Propeller drehten sich mit ohrenbetäubendem Lärm. Die Tür klappte auf die Flugbahn herunter, und der Sänger sprang aus dem Jeep, griff seine Tasche und wollte ins Flugzeug stürmen, als ihm sein Retter wieder einfiel. Er drehte sich um, stand stramm, legte eine Hand an die Stirn und verabschiedete sich nach Soldatenart. Dann verschwand er in der Maschine. Thorson atmete auf, machte die Bahn frei und sah zu, wie das Flugzeug über die Startbahn donnerte, schwerfällig abhob und in Richtung Sonnenuntergang verschwand.
Auf dem Weg zum Flughafen hatte Thorson versucht herauszufinden, was der Sänger auf der Öldugata gemacht und warum er sich dort schlafen gelegt hatte. Doch der Sänger hatte keinen blassen Schimmer mehr, was geschehen war, und erinnerte sich auch nur noch vage daran, dass er Thorson schon einmal begegnet war. Redete davon, dass ihn irgendwelche Frauen im Hótel Ísland angesprochen hätten und eine ihm ihre Adresse gegeben und er vielleicht versucht hatte, sie ausfindig zu machen.
»Immerhin scheinen Sie sich in Island nicht gelangweilt zu haben«, sagte Thorson und musterte den Mann. Er hatte italienische Wurzeln, ein dunkler Typ, die Sonne gewohnt, und wenn er lächelte, strahlten seine schönen weißen Zähne.
»Warum starrst du mich so an?«, fragte der Sänger, als er Thorsons Blick bemerkte.
»Entschuldigung, ich habe in letzter Zeit wenig schlafen können«, antwortete Thorson. »Schon ein sonderbarer Ort, diese Insel.«
»Es ist ein beschissenes Nest«, schimpfte der Sänger entnervt.
Fünf
Als Thorson schließlich zum Hauptquartier der Militärpolizei zurückkehrte, hieß es, sein höchster Vorgesetzter habe nach ihm gefragt. Der Mann war Amerikaner, hieß Franklin Webster, und befehligte als Colonel die Militärpolizei. Thorson war ihm bislang noch nicht persönlich begegnet. Er befand sich auf einem wichtigen Treffen im britischen Konsulat, und Thorson sollte dorthin fahren, um mit ihm zu sprechen. Also stieg er wieder in den Militärjeep und fuhr zu dem stattlichen Gebäude, das in der Nähe der Region Laugarnes an der Küste stand. Das Haus, von den Einheimischen Höfði genannt, war ihm gleich in seinen ersten Tagen in Reykjavík aufgefallen, für ihn eines der schönsten Häuser der Stadt. Er wusste, dass es seinerzeit einem der größten isländischen Dichter gehört hatte, und es kursierten Gerüchte darüber, dass es darin spukte. Kurz nachdem die britische Armee nach Reykjavík gekommen war, hatten die Briten das Haus gekauft, und jetzt diente es ihrem Botschafter als Residenz.
Thorson fuhr vor und meldete sich an, sagte, wen er treffen sollte, und wurde in einen Warteraum geschickt. Es ging dort ziemlich betriebsam zu, ranghohe Männer unterhielten sich in gedämpftem Ton, britische Vorgesetzte und ihre amerikanischen Kollegen eilten zwischen den Räumen hin und her, und ein isländischer Minister, den Thorson vom Sehen kannte, kam mit zwei weiteren Männern hineingestürmt und verschwand im ersten Stock. Irgendetwas Wichtiges schien bevorzustehen. Eine große Fotografie des britischen Premiers Winston Churchill hing im Warteraum an der Wand. Thorson stand davor und starrte sie an, als er mit tiefer Stimme angesprochen wurde.
»Ich habe gehört, dass einer unserer geliebten Sänger Sie ganz schön in Bedrängnis gebracht hat«, sagte der Colonel, der auf einmal hinter ihm stand.
Thorson drehte sich um und salutierte. Der Colonel war mindestens dreißig Jahre älter als er, sah zwar freundlich aus, hatte aber Haare auf den Zähnen. Das wusste Thorson von seinen Kollegen bei der Militärpolizei.
»Das haben wir geklärt«, antwortete Thorson.
»Gut. Soweit ich weiß, sprechen Sie fließend Isländisch, sind sogar isländischer Abstammung, in Kanada aufgewachsen. Ist das richtig?«
»Das ist richtig, Colonel. Ich bin ein sogenannter West-Isländer. Meine Eltern sind nach Kanada ausgewandert, wo ich geboren und aufgewachsen bin.«
»Gut. Und seit wann sind Sie in Island?«
»Ich wurde mit einigen kanadischen Freiwilligen als Übersetzer hergeschickt, als das Land besetzt wurde, und bin sofort der Militärpolizei zugeteilt worden. Und als die Briten im Sommer den Schutz des Landes übernahmen, bin ich Ihren Truppen zugewiesen worden. Es entstehen oft Situationen zwischen dem Militär und den Einwohnern, bei denen die Kenntnis der Sprache sehr hilfreich ist.«
»Ja, das kann ich mir denken, und genau danach habe ich gesucht. Ich brauche einen Mann, der Isländisch spricht und über gewisse Kenntnisse verfügt, was die Einheimischen betrifft, aber trotzdem die Interessen des Militärs wahrt. Glauben Sie, Sie sind dieser Mann?«
»Ich spreche Isländisch«, sagte Thorson. »Aber Kenntnisse über die Einheimischen habe ich noch nicht erlangt.«
Der Colonel lächelte.
»Ich gehe davon aus, dass Sie noch keine großen Erfahrungen mit Mordermittlungen haben?«
»Nein, überhaupt keine«, gestand Thorson.
»Sie werden schnell lernen. Die Reykjavíker Polizei bittet um Unterstützung«, sagte der Colonel. »Um es kurz zu machen: Sie werden sie unterstützen, so gut Sie können. Der Mann, der die Ermittlungen leitet, heißt Florent oder so ähnlich. Sie arbeiten mit ihm zusammen. Er wartet darauf, dass Sie ihn kontaktieren.«
»Um was für einen Fall geht es denn, wenn ich fragen darf, Colonel?«
»Ein Isländer, in seiner Wohnung erschossen«, fasste der Colonel zusammen. »Sie glauben, dass die Kugel, die sie am Tatort gefunden haben, aus einem Revolver der amerikanischen Armee stammt. Sie glauben, ein amerikanischer Soldat habe das getan. Alles Unsinn, denke ich, aber ich kann natürlich nicht … Sie werden mir über den Stand der Dinge regelmäßig Bericht erstatten. Wenn Sie weitere Unterstützung unsererseits benötigen, melden Sie sich bei mir. Wenn es stimmt, was sie sagen, und der Verdacht wirklich auf unsere Truppen fällt, wäre das eine unschöne Sache, es gibt sowieso schon genug kritische Stimmen in Bezug auf unsere Präsenz hier. Behalten Sie das im Hinterkopf: Wir wollen wegen dieser Sache nicht in Schwierigkeiten geraten. Davon haben wir schon genug.«
Der Colonel verabschiedete sich und verschwand so schnell aus dem Wartezimmer, wie er dort erschienen war. Thorson blickte noch einmal zu Churchill hinauf, der ihn mit finsterer Miene betrachtete, als wollte er ihm in Erinnerung rufen, in welch ernsten Zeiten sie lebten. Dann machte Thorson auf dem Absatz kehrt und verließ das Gebäude. Auf der Eingangstreppe standen der isländische Minister und die beiden Männer, die ihn begleiteten, und unterhielten sich leise in der Annahme, dass niemand verstand, was sie sagten. Als Thorson den Namen Churchill hörte, hielt er inne.
»… sicher wissen sie es noch nicht. Und natürlich muss das ohne großes Tamtam ablaufen«, sagte der Minister, der älteste der drei Männer.
»Das halte ich für unrealistisch«, entgegnete einer der anderen Männer. »Wenn er denn wirklich käme.«
»Sie sagen, es sei nicht ausgeschlossen. Sie haben keine genaueren Informationen, aber sie hoffen das Beste.«
Die drei Männer sahen Thorson an, der zurücklächelte, als verstünde er kein Wort Isländisch, die Treppen hinunterlief, sich in seinen Jeep setzte, in die Stadt fuhr und darüber nachdachte, was er da gerade gehört hatte: Hatten diese Männer tatsächlich über einen möglichen Besuch von Winston Churchill in Island gesprochen?
Sechs
Als Flóvent das Leichenschauhaus betrat, hatte der Arzt, der meist die Obduktionen am Klinikum durchführte, die Untersuchung von Felix Lundens Leiche gerade beendet. Zwei weitere Leichen lagen unter weißen Laken auf Tischen, die in den Raum geschoben worden waren. Der Arzt hieß Baldur, kam aus den Westfjorden und bewegte sich schwerfällig, hinkte leicht, das Überbleibsel einer Tuberkuloseerkrankung an einem seiner Beine. Er schob einen Metalltisch mit blutigen Gerätschaften vor sich her, Messer und Zangen und kleine Sägen, die er brauchte, um zu den verborgensten Winkeln des menschlichen Körpers vorzudringen. Dann ging er zu einem Stahlbecken und wusch sich die Hände.
»Das war kein schöner Anblick«, sagte er und rieb sich die Hände an einem Handtuch trocken. »Dem fehlt das halbe Gesicht.«
»Ja«, stimmte Flóvent zu. »Das war tatsächlich nicht schön.«
»Ich muss dir nicht erklären, wie er gestorben ist. Ein Schuss durch den Kopf und aus«, sagte Baldur und bot Flóvent Kaffee aus einer Feldflasche an, die er in eine Wollsocke gesteckt hatte. Er goss den mäßig heißen Kaffee in eine Tasse, reichte sie Flóvent und fragte ihn, ob er einen Schuss Schnaps hinein wolle, für den Geschmack. Flóvent lehnte dankend ab, während Baldur seinen Kaffee mit einem Schuss Schnaps aus einer Flasche anreicherte, die er in einem Schränkchen unter dem Waschbecken aufbewahrte. Es wurde schon Abend, doch Baldur war noch längst nicht fertig und hatte Flóvent gesagt, dass er sicher noch bis Mitternacht dort sein würde. Kalt war es in diesem Raum. Flóvent konnte sich keinen ungemütlicheren Ort in der ganzen Stadt vorstellen.
»Ist bei der Obduktion irgendetwas herausgekommen?«
»Nichts Besonderes, was die Leiche an sich angeht«, antwortete Baldur. »Der Gesundheitszustand des Mannes war nicht gerade gut, er muss viel geraucht haben, das sieht man an den gelben Fingern, und auch die Lunge sieht entsprechend aus. Körperlich schwer gearbeitet hat er die letzten Jahre nicht. Die Haut an seinen Händen ist ganz zart und unversehrt.«
»Soweit ich weiß, war er Handelsreisender.«
»Ja, das passt. Sieht ganz danach aus, als wäre hier ein Profi am Werk gewesen. Ein Schuss hat genügt.«
»Als ob ein Soldat es getan hätte? Meinst du das?«
»Ja, vielleicht. Aber darüber möchte ich lieber nicht spekulieren.«
»Habe ich das richtig gesehen, dass der Mörder ihm Blut auf die Stirn geschmiert hat?«, fragte Flóvent.
»Ja, das stimmt.«
»Mit dem Finger?«
»Ja, das hat er mit dem Finger getan.«
»Hat er ihn in die Wunde gesteckt?«
»Ja, oder er hat es vom Boden genommen, an Blut wird es sicher nicht gemangelt haben.«
»Warum tut er das? Warum muss er die Stirn des Mannes mit Blut beschmieren?«
»Wie war noch mal sein Name, Felix Lunden? Hieß er so?«
Flóvent nickte.
»Kann sein, dass er mit einem Arzt verwandt ist, der mal hier am Krankenhaus war«, sagte Baldur. »Diesen Nachnamen tragen ja bei uns nicht gerade viele Leute. Er hatte lange eine Praxis in der Hafnarstræti.«
»Wie heißt dieser Arzt?«
»Rudolf heißt er. Rudolf Lunden. Dänisch-deutsch. Hat nach einem Unfall seine Praxis geschlossen und seitdem nicht mehr praktiziert, soweit ich weiß. Ich kannte ihn nicht gut. Ein unangenehmer Kerl, launisch und eigenbrötlerisch. Hatte Verbindungen zu den isländischen Nazis, als die hier vor dem Krieg ihre Hochphase hatten, wenn ich mich recht entsinne.«
»Dann könnte das also sein Sohn sein?«
»Das war mein Gedanke. Weil er Lunden heißt. Und wegen der Schmiererei auf seiner Stirn. Die wurde aus einem ganz bestimmten Grund dort hinterlassen, scheint mir«, sagte Baldur.
»Ach ja? Konntest du das genauer erkennen?«
»Ja, ich denke schon«, antwortete der Arzt und trank einen Schluck von seinem Kaffee. »Ich denke, derjenige, der ihn umgebracht hat, hat versucht, ihm ein gewisses Symbol auf die Stirn zu malen.«
»Und was … was soll das sein?«
Die Tür zum Obduktionssaal öffnete sich, und ein junger Soldat kam herein. Flóvent erkannte an der Uniform, dass er zur Polizei der Besatzungsmacht gehörte. Der junge Mann sah sie abwechselnd an.
»Mir wurde gesagt, dass ich Flóvent hier finden würde, den Kriminalinspektor«, sagte er zögernd.
»Ich bin Flóvent.«
»Guten Tag«, sagte der junge Mann höflich und in tadellosem Isländisch und gab Flóvent die Hand. »Ich heiße Thorson und habe den Befehl erhalten, der isländischen Polizei bei den Ermittlungen in einem Mordfall zur Verfügung zu stehen, und wollte mich so schnell wie möglich bei Ihnen melden. Ich hoffe, ich störe nicht.«
»Nein, keineswegs, wir sprechen gerade über die Obduktion«, sagte Flóvent, der um die Zusammenarbeit gebeten hatte. »Du sprichst so gut Isländisch – bist du Isländer? Dann sollten wir uns duzen.«
»West-Isländer«, antwortete Thorson und gab auch Baldur die Hand. »Aus Manitoba. Meine Eltern stammen aus dem Norden, vom Eyjafjörður. Ist das der Mann, dem in den Kopf geschossen wurde?«, fragte er, und Flóvent bemerkte, dass er sich scheute, die Leiche direkt anzusehen.
»Ja«, antwortete Flóvent. »Felix Lunden, Handelsreisender, soweit wir wissen. Hat Kleidungsaccessoires und diverse Cremes, Salben und derlei verkauft.«
»Creme?«, hakte Baldur nach und gab noch einen Schuss Schnaps in seinen Kaffee. »Kann man davon leben?«
»Natürlich. Er hatte keine Familie zu versorgen. Lebte allein. Du bist es sicher nicht gewohnt, dir Leichen anzusehen, die so übel zugerichtet sind, oder?«, fragte Flóvent, dem aufgefallen war, dass Thorson sich in diesem Raum nicht gerade wohlzufühlen schien.
»Nein«, bestätigte Thorson. »Ich … Island ist mein erster Einsatz. Ich habe noch an keiner Schlacht teilgenommen, und die Fälle, um die ich mich bislang bei der Militärpolizei kümmern musste, waren nicht … nicht vergleichbar mit so etwas.«
Flóvent sah, dass der junge Soldat nach Kräften versuchte, Haltung zu bewahren, was ihm recht gut gelang. Flóvent bemerkte, wie viel reifer er wirkte, als es sein junges Alter und das jugendliche Aussehen erwarten ließen. Thorson ging auf die dreißig zu, ein heller Typ mit unschuldigem Blick, der Vertrauen in die Menschen ausstrahlte. Vielleicht ein bisschen zu viel. Flóvent meinte, in seinen klaren Augen zu erkennen, dass schon manch einer dieses Vertrauen missbraucht hatte.
»Ihr glaubt, dass ein amerikanischer Soldat ihn so zugerichtet hat?«, fragte Thorson.
»Du hast wahrscheinlich gehört, dass wir die Kugel gefunden haben und sie aus einer Waffe stammt, wie die amerikanischen Truppen sie benutzen.«
»Kann sich nicht auch ein Isländer eine solche Waffe beschafft haben?«
»Das schließen wir nicht aus«, entgegnete Flóvent.
»Wenn es die Runde macht, dass ein Soldat einen Isländer auf diese Art zugerichtet hat, befürchten meine Vorgesetzten … wie haben sie es noch genannt: ein gesteigertes Misstrauen gegenüber der Besatzungsmacht. Sie haben Sorge, dass über dieses Verbrechen sehr einseitig geredet werden könnte.«
»Und du sollst dafür sorgen, dass das nicht geschieht?«, folgerte Baldur. »Bist du nicht viel zu jung, um Politik zu betreiben?«
»Für Politik interessiere ich mich nicht«, erwiderte Thorson. »Was ist das da auf seiner Stirn?«, fragte er und hatte inzwischen offenbar genug Mut gefasst, um sich das zerschossene Gesicht anzusehen. »Sind das Buchstaben?«
»Ich war gerade dabei, Flóvent das zu erklären, als du hereinkamst«, sagte Baldur. »Das sind keine Buchstaben, nein, das ist etwas anderes, etwas recht Interessantes. Man könnte sagen, die Leiche ist auf diese Weise markiert worden.«
»Womit?«, wollte Flóvent wissen.
»Das sieht ganz nach dem Zeichen der Nazis aus«, sagte Baldur.
»Zeichen der Nazis? Was meinst du damit? Das Hakenkreuz?«
»Ja, das Hakenkreuz«, sagte der Arzt, ging schwerfällig zur Leiche und leuchtete den Kopf an. »Mir scheint es, als hätte man dem Mann mit Blut ein Hakenkreuz auf die Stirn gemalt.«
Flóvent und Thorson kamen näher heran und starrten auf die Stirn der Leiche. Der Arzt hatte recht. Obwohl es grob dahingeschmiert und zerlaufen war, konnte man unter dem starken Licht des Obduktionssaals ein Hakenkreuz auf der Stirn des Mannes erkennen.
Sieben
Sie hörten Geräusche im Flur, und Flóvent vermutete, dass das Ólafía war, die er hatte holen lassen, damit sie ihren Mieter identifizierte. Er ging hinaus, um sie in Empfang zu nehmen. Sie war alles andere als einverstanden, sich an diesem schrecklichen Ort aufhalten zu müssen. Sie sei todmüde. Das sei ein außergewöhnlich schwerer Tag für sie gewesen. Ein brutaler Mord sei in ihren Räumen begangen worden. Der Ruf des Hauses sei zerstört. Ihr Ruf. Und das, obwohl sie doch immer so gewissenhaft sei und ihre Mieter mit größter Sorgfalt auswähle. Nur anständige Leute. Zwei Kinder höchstens.
»Ich habe den armen Kerl am Boden liegend aufgefunden, reicht das denn nicht?«, fragte sie, als Flóvent ihr den Weg in den Obduktionssaal wies.
»Wir müssen diese Formalität so schnell wie möglich erledigen«, erklärte Flóvent entschuldigend. »Ich weiß nicht, wie gut Sie ihn gesehen haben, und in meinem Bericht muss ich festhalten, dass Sie ihn offiziell als Ihren Mieter identifiziert haben. Wir müssen die Familie des Mannes ausfindig machen und …«
»Jaja, bringen wir es hinter uns.«
»War Felix Ihnen auf Anhieb sympathisch, als er bei Ihnen eingezogen ist?«, fragte Flóvent.
»Er wirkte sehr anständig«, antwortete Ólafía. »Für so etwas habe ich einen Riecher. Höflich. Augenscheinlich gut erzogen. Mit Benimm.«
»Sie sagten, er habe seine Miete stets pünktlich gezahlt?«
»Immer. Da war er sehr gewissenhaft.«
»Hat er in isländischen Kronen bezahlt? Hatte er Devisen? Dollar? Pfund?«
»Devisen? Nein, er hatte keine Devisen. Zumindest weiß ich nichts davon. Er hat wie alle anderen in Kronen gezahlt.«
»Hat er irgendwann einmal seine Eltern namentlich erwähnt?«, fragte Flóvent. »Seinen Vater? Seine Mutter?«
»Nein. Leben seine Eltern überhaupt noch?«
»Das wissen wir nicht. Auch nicht, ob er Geschwister hat. Wir wissen bislang kaum, wer dieser Mann ist. Deshalb ist es ja so wichtig für uns, dass Sie ihn identifizieren.«
»Ja, aber das ist mir wirklich zuwider«, sträubte sich Ólafía. »Das ist alles so furchtbar. Die ganze Sache. Man stelle sich das mal vor! Ich weiß nicht, ob ich die Wohnung je wieder vermietet bekomme. Ob ich das schaffe. Oder ob überhaupt noch jemand dort wohnen will, nach diesem … diesem Horror. Ich weiß nicht, was ich mit dieser Wohnung machen soll. Ich muss irgendwelche Mädchen finden, die sie säubern. Das wird nicht billig werden.«
Sie wünschte Baldur und Thorson einen guten Tag, als sie den Obduktionssaal betrat. Der Arzt wies auf den Obduktionstisch.
»Ich habe versucht, ihn so gut es geht zusammenzuflicken«, sagte Baldur, »falls irgendwelche Angehörigen ihn sehen wollen. Er ist trotzdem noch ganz schön lädiert. Ich hoffe, das erschreckt dich nicht. Sag, wenn du so weit bist.«
»Immerhin bin ich diejenige, die ihn gefunden hat«, entgegnete Ólafía. »Aber ich kann mich nicht entsinnen, Ihnen das Du angeboten zu haben.«
»Nein, natürlich, bitte entschuldigen Sie«, sagte Baldur, sah Flóvent an, als belustigte ihn ihre schnippische Art, und schlug das Tuch zurück, das über die Leiche gedeckt war. Ólafía erschrak, als sie das übel zugerichtete Gesicht sah, die leere Augenhöhle, das zerschmetterte Jochbein darunter und den gebrochenen Kiefer. Die andere Gesichtshälfte jedoch war relativ unversehrt geblieben, und man konnte deutlich die Gesichtszüge erkennen, auf die Ólafía sich jetzt konzentrierte. Sie wirkte unschlüssig, sah abwechselnd Baldur und Flóvent an, als verstehe sie gar nichts mehr.
»Was – noch ein Mord?«, fragte sie mit finsterer Miene, als hätte sie nun endgültig genug von all dem. »Genau dasselbe wie bei dem ersten?«
»Bei dem ersten?«
»Ja.«
»Was meinen Sie damit?«
»Bin ich nicht hier, um meinen Mieter Felix Lunden zu identifizieren? Deshalb haben Sie mich doch an diesen schrecklichen Ort geschleppt?«
»Ja, richtig?«
»Und wo ist er dann?«, fragte Ólafía und sah sich um.
»Was meinen Sie damit?«, hakte Flóvent nach. »Liegt er nicht vor Ihnen auf dem Tisch?«
»Wer?«
»Na, Felix Lunden.«
»Dieser Mann hier?«
»Ja.«
»Nein. Diesen Mann habe ich noch nie gesehen.«
»Aber …«
»Das ist nicht Felix Lunden, das ist mal sicher«, behauptete Ólafía entschieden. »Ich habe nicht die geringste Ahnung, wer dieser Mann ist! Nicht die geringste!«
Acht
Immer noch stand ein Polizist vor Felix Lundens Wohnung und passte auf, dass niemand sie ohne Erlaubnis betrat. Thorson parkte den Jeep am Straßenrand. Flóvent stellte sich hinter ihn und öffnete Ólafía die Tür, begleitete sie zu ihrem Haus und bedankte sich noch einmal für ihre Hilfe.