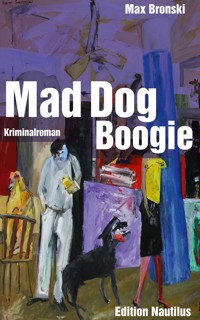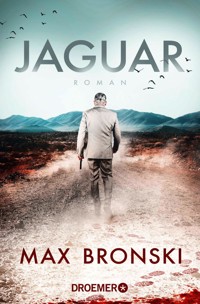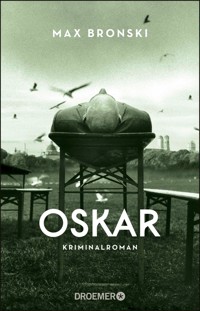Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Nautilus
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein verträumter Gutsverwalter in Bayern, der durch einen skrupellosen Mord aus seiner beschaulichen Idylle gerissen wird. Ein junger Kernphysiker, der sich im Intrigenspiel des Kalten Krieges verfängt. Eine Formel, die möglicherweise die gesamte Menschheit gefährdet. Ein Notizbuch, dem das legendäre Zitat Robert Oppenheimers »Der Tod bin ich, Erschütterer der Welten« vorangestellt ist. Drei ehemalige Agenten der Supermächte, die sich auf eine letzte Mission begeben ... Ein dramatischer Thriller über die explosive Verbindung von Forschung und Macht, akademische Konkurrenz und geheimdienstliche Konspiration, die letzten Fragen der theoretischen Physik und die ethische Verantwortung der Wissenschaft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 447
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Max Bronski
Der Tod bin ich
Thriller
Edition Nautilus
So urteilt die Kritik über „Der Tod bin ich“
Max Bronski schreibt unter Pseudonym und hat ein Flair für Physik und Musik. Sein Agentenroman ist nicht nur ein spannender Thriller aus der Zeit des Rüstungswahns, er erzählt auch über die Schönheit und Harmonie von wissenschaftlichen Formeln. (Wolfgang Bortlik, 20Minuten vom 22. Januar 2013)
„Der Tod bin ich“ schafft eine Symbiose aus Wissen und Spannung. Max Bronski gelingt ein spannendes Buch, das eine nunn schon lange vergangene Epoche aufs Vortrefflichste mit einer spannenden Rahmenhandlung in der Jetztzeit verknüpft. Was darüber hinaus das Buch auszeichnet, ist sein hohes Niveau der Sprache. (Marius Müller, Academicworld.net vom 6. März 2013)
Der im lockeren Tonfall eines Krimis verfasste Roman wartet mit einer Vielzahl an Figuren und Schauplätzen auf, und setzt weniger auf psychologischen Tiefgang, als auf eine spannend konstruierte Handlung. (Walter Brunhuber, Bayern im Buch Nr.1 von 2013)
Max Bronski, der sich selbst mit theoretischer Physik beschäftigt, gelingt es in seinem Roman, Zeitgeschichte, Erkenntnisse der modernen Physik und Thriller-Spannung zusammenzuführen. (Andreas Trojan, Börsenblatt Heft 2 vom 10. Januar 2013)
Perfekt für alle, denen zu viel Idylle verdächtig vorkommt. (Bernd-Uwe Gutknecht, Bayern 3 vom 31. Juli 2013)
Max Bronski hat mit der „Tod bin ich“ einen spannenden Thriller um Wissenschaft, Konkurrenz und die ewige Suche nach der allumfassenden Formel geschaffen. (Roana Brogsitter, B5 aktuell, Neues vom Buchmarkt vom 16. Januar 2013)
Max Bronski zeigt sich als Fan der theoretischen Physik und schafft es, diese Elemente zu einem Wissenschaftsthriller zu verschmelzen. (Bücher vom 13. Mai 2013)
Wie diese Machenschaften bis in die Gegenwart herüberragen, ist glänzend recherchiert und hochspannend. (Eckart Baier, Buchjournal Nr. 1 von 2013)
Der Film zu „Der Tod bin ich“ entsteht im Kopf jedes ein zelnen Zuhörers, reich genährt durch die detailreiche und bildhafte Sprache des Autors. (Andrea Büchner, Südkurier vom 16. Januar 2013)
Und wer Spannung, skurrile Charaktere, politische Verwicklungen sowie Naturwissenschaften und ihre ethische Verantwortung schätzt, kommt mit diesem Werk auf seine Kosten. (Der Nordschleswiger vom 6. Juli 2013)
Doch zu den Vorzügen dieses Thrillers gehört es, dem Laien zumindest eine Ahnung davon zu vermitteln, welchen Dingen ein Wissenschaftler wie Paul Dirac nachspürte und weshalb Julius Robert Oppenheimer nach dem Zünden der ersten, von ihm konstruierten Atombombe – erschüttert von den Folgen seiner Erfindung – diese Zeilen aus der heiligen Schrift des Hinduismus, der Bhagavadgita zitierte: „Jetzt bin ich Tod geworden, der Zerstörer der Welten“ – eine Zeile, auf die der Thriller-Titel anspielt. (Knut Cordsen, Deutschlandradio Kultur vom 17. Januar 2013)
Der Ton ist schön, die Zahl der Themen hoch. (…) Ein großer, sehr ernster Spaß, der elegant auf der Grenze zwischen Seriosität und Parodie tänzelt. (Elmar Krekeler, Die Welt vom 26. Januar 2013)
…ein Welttheater in Zeiten des Kalten Krieges, ein Spionagethriller á la John Le Carré. (Dresdner Neueste Nachrichten vom 9. September 2013)
Kurz gesagt: man kann sich in dieses Buch versenken und einen authentischen Eindruck sowohl der Epoche der sechziger Jahre als auch der grundlegenden Probleme der modernen Physik mitnehmen. (Frank Raudszus, egotrip vom April 2013)
… legt der Münchener Autor in lakonisch-trockener Sprache einen intelligenten Spionagethriller vor… (Ulrike Weil, ekz-Informationsdienst vom 4. März 2013)
Wobei die Idee mathematische Formeln als Noten zu kodieren und somit als Komposition zu tarnen geradezu genial erscheint. (Michael Petrikowski, Gedankenspinner vom 14. Februar 2013)
Wer Lust am Kombinieren hat und sich für die „Weltformel“ interessiert (…) wer zudem geheimnisvolle Plots liebt, die in einer unverwechselbar eigenen Sprach geschrieben sind, wird Bronski lieben. (Emmanuel van Stein, Kölner Stadt-Anzeiger Bücher Magazin vom Februar 2013)
Freunde anspruchsvollerer Unterhaltung, die auch mal gerne zwischen den Zeilen über Gott und die Welt nachdenken, werden an „Der Tod bin ich“ ihre Freude haben. (Jürgen Priester, Krimi-Couch vom März 2013)
Ebenso spannend wie „Der Tod bin ich“ scheint die Frage zu sein, wer sich hinter diesem Autorenpseudonym verbirgt. (Elke Held-Paulus, Krimi Kiosk vom 15. Januar 2013)
Wer mal einen Agententhriller lesen möchte, der seinen Schwerpunkt in physikalischen Überlegungen gemixt mit philosophischen Gedanken und einem Schuss Musik lesen möchte, der ist hier richtig. (Krimimimi vom 4. Februar 2013)
395 spannende Seiten lang fiebert man mit… (Christiane Osterhof, KuNo vom 20. Dezember 2012)
Damit ist der Roman ein bisschen Gegenentwurf zu Dan Brown – eine komplexe Handlung (…) in einer fast schon dichterischen Sprache. (…) „Der Tod bin ich“ ist ein erstklassiger Spionageroman mit Tiefgang. (Dominik Roth, lettra vom 27. März 2013)
Das ist ein spannender Stoff, und Bronski tut sein Bestes, Fachfremde in die Geheimnisse der Weltformel einzuweihen. (Frauke Meyer-Gosau, literaturen Nr. 109 vom Frühjahr 2013)
Max Bronski (…) macht das ganz hervorragend. Raffinierte Verwicklungen, undurchsichtige Spione, der Kampf System gegen System und eine Formel, die die Welt bedroht, auch aus diesen Stoffen können tolle aktuelle, deutsche Krimis sein. (literaturkurier vom 24. Januar 2013)
Aber letztlich beweist Max Bronski (…) wie gut sein Roman gebaut ist. (Tageblatt vom 20. März 2013)
Bronski hat ein spannendes (…) Buch geschrieben, das sich in seinem Kern mit der ethischen Verantwortung der Wissenschaft auseinandersetzt. (Dietmar Jacobsen, Moment vom 14. Februar 2013)
Die Beschreibung der astronomischen Uhr des Straßburger Münsters (…) ist ein Genuß. (Frank Becker, Musenblätter vom 15. Januar 2013)
Aber dann gelingen Max Bronski wieder schillernde Charaktere und sehr atmosphärische und hochdramatische Szenen, die den Leser in Atem halten. Das ist ein bunter deutscher Spionageroman, mal trivial, mal hintersinnig - aber immer spannend. (Krischan Koch, NDR Buchtipps vom 16. Januar 2013)
Dem Münchner Schriftsteller Max Bronski ist ein cleverer und ziemlich geschickt konstruierter Grundlagenforschungskrimi gelungen. (Ariane Verena Breyer, Neon vom Februar 2013)
Max Bronski folgt mit seinem Thriller den Spuren von John Le Carré und Frederick Forsyth – lesenswert! (Frank Riebow, Polizeispiegel vom Juli/August 2013)
Weil er anders als die meisten seiner verzagten Kollegen hierzulande mit dem Willen zur Größe schreibt. Und weil „Der Tod bin ich“ eine Seltenheit ist: ein geistreicher Spannungsroman aus Deutschland. (…) Gewitzt. Gewagt. Gewonnen! (Marcus Müntefering, Spiegel Online Krimis des Monats vom 6. März 2013)
All das hat Bronski zügig und elegant zu Papier gebracht und dankenswerterweise ohne melancholische Töne oder jene Romantisierung des Kalten Kriegs, mit der Thriller wie die jüngste John-Le-Carré-Verfilmung „Dame König As Spion“ einen so ratlos zurücklassen. (Christiane Müller-Lobeck, die tageszeitung vom 19./20 Januar 2013)
Max Bronskis souveräner Politthriller… (Ralf Stiftel, Westfälischer Anzeiger vom 16. Februar 2013)
Geometria est archetypus pulchritudinis mundi.
JOHANNES KEPLER
Die mathematische Struktur, nämlich das rationale Zahlenverhältnis als Quelle der Harmonie – das war sicher eine der folgenschwersten Entdeckungen, die in der Geschichte der Menschheit überhaupt gemacht worden sind.
WERNER HEISENBERG
Nein, sondern so unbegreiflich es der gemeinen Vernunft erscheint: du – und ebenso jedes andere bewußte Wesen für sich genommen – bist alles in allem. Darum ist dieses dein Leben, das du lebst, auch nicht ein Stück nur des Weltgeschehens, sondern in einem bestimmten Sinn das ganze. Nur ist dieses Ganze nicht so beschaffen, daß es sich mit einem Blick überschauen läßt. – Das ist es bekanntlich, was die Brahmanen ausdrücken mit der heiligen, mystischen und doch eigentlich so einfachen und klaren Formel: Tat twam asi (das bist du).
ERWIN SCHRÖDINGER
TEIL I 2006
1.
Der ältere Herr war eine auffällige Erscheinung. Aufrecht wie ein Herrenreiter saß er auf seinem Hollandrad und die Rockschöße seines beigen Leinenanzugs flatterten im Wind. Mit der Hand hielt er den Strohhut fest. Seine Hosenbeine waren mit Metallklammern vor der Kette geschützt. Um die Schulter trug er ein bauchiges Futteral, in dem sich ein Fernglas befinden mochte. Er ließ dem Rad bergab freien Lauf und bog in den weitläufigen Biergarten der Ottenrainer Schlossbrauerei ein. Gelenkig stieg er von dem federgepolsterten Ledersattel. Zunächst richtete er seinen Anzug, nahm die Klammern ab und zog die Hosenbeine glatt. Dann lupfte er den Strohhut, fuhr sich durchs Haar und reihte sich in die lange Schlange der an der Schänke Wartenden ein.
Die Hitze drückte. Vom Hochstädter See herkommend suchten die Leute einen schattigen Platz im Biergarten. Eigentlich war Kaffeezeit, aber ein kühles Getränk tat wohler. Manche waren in Badehosen, T-Shirt und Plastiklatschen, andere in bunten Rennsporthäuten oder eben in sonntäglichem Chic, wie der Kreis von mager gewordenen alten Damen in pastellfarbenen Kleidern und bukettgeschmückten Hüten. Um die Kastanien und die massiven, im Boden verankerten Tische herum tobten schreiend und lachend Kinder.
So fiel auch der ältere Herr nicht weiter auf, obwohl er doch ein Glas Dunkles trank, für das der Kellner in die Wirtsstube hatte gehen müssen. Am Tisch zog er einen rindsledernen Tabakbeutel aus seiner Jacketttasche, entnahm ihm eine Bruyèrepfeife und stopfte sie. Rauchend studierte er die Landkarte und zwirbelte dabei seine buschigen Augenbrauen. Nachdem er seine weitere Route geprüft hatte, faltete er die Karte wieder sorgfältig zusammen und steckte sie in das Futteral zurück. Mit wohlwollendem Interesse widmete er sich anschließend dem bunten Treiben um ihn herum.
Etwa eine halbe Stunde später verließ er auf seinem Rad Ottenrain und fuhr die sanft geschwungene Straße zum Wald hin. Hinter den Weizenfeldern zweigte ein Schotterweg ab. Ein Schild mit der verwitterten Aufschrift Moosrain wies auf ein Holzhaus hin, das an den Waldrand geschmiegt lag. Er sprang aus dem Sattel, schob das Rad und legte dabei seine Hand auf die Glocke, um ihr Anschlagen auf dem holprigen Untergrund zu dämpfen. In einiger Entfernung vom Haus stellte der Besucher sein Fahrrad am Wegesrand ab. Er hatte es bereits gewendet, sodass er nur wieder aufsteigen musste, um zur Straße zurückzufahren. Ruhigen Schritts näherte er sich dem Haus, kurz davor hielt er inne. Er stemmte die Hände in die Hüften und nahm das sich ihm bietende Bild so aufmerksam zur Kenntnis wie zuvor die Landkarte.
Die Bepflanzung vor allem fiel ihm ins Auge. Ging man geradewegs auf den Eingang zu, zeigten sich Haus und Garten von einem kompakten Bewuchs umgeben. Kam man von der Seite, sah man, dass die Bambusbuschen nicht auf einer Linie, sondern parallel gegeneinander versetzt standen und vielfach Einlass boten. Der Garten war karg und streng. Bäume mit vielfingrigem Geäst in filigraner Struktur hatte man auf Miniaturmaß heruntergeschnitten. Das satte Grün des Rasens wirkte wie eine dicht gewebte Moosfläche und wölbte sich zu sanften Buckeln auf. Ein scharfer Rand trennte das Grün von einer im Sonnenlicht fast weiß schimmernden Sandfläche, in der wie zufällig verstreut Steinbrocken lagen. Ein gebeugter alter Mann stand mittendrin und zog mit einer Harke Linien in einer Anordnung um die Steine herum, als stünden Felsen in strömendem Wasser, das sich an ihnen brach.
Vom Wipfel einer Buche flog ein Bussard auf. Mit kräftigen Flügelschlägen arbeitete er sich in den strahlend blauen Himmel empor. Dort breitete er seine Schwingen aus, ließ sich von den warmen Winden tragen und kreiste über dem Gelände. Der Besucher verfolgte aufmerksam den Flug des Raubvogels. Dann blickte er wieder auf das Haus, ohne sich von der Stelle zu bewegen. Er zögerte und tastete die Seitentaschen seines Jacketts ab. Endlich streifte er Lederhandschuhe über, die er dort aufbewahrt hielt. Damit hatte er seine Entschlossenheit wiedergewonnen. Er öffnete das Futteral, holte eine Pistole hervor, anschließend einen Schalldämpfer und schraubte ihn ohne Hast auf den Lauf. Er entsicherte die Waffe und betrat den Garten durch einen Einlass im Bambusgesträuch.
Der alte Mann blieb in seine Arbeit vertieft und nahm den Ankömmling nicht wahr. Mit einem Rechen zog er den Sand glatt und zerteilte ihn anschließend mit der Harke in Strömungslinien. Schließlich hielt er doch inne und stützte sich auf den Stiel der Harke. Er trug eine Art Kaftan und einen an den Rändern ausfransenden Strohhut. In seiner Bewegungslosigkeit wirkte er wie eine Vogelscheuche, die man dort in die Mitte gestellt hatte.
„Bertold?“
Der Alte wandte sich langsam um. Obwohl seine Augen ausreichend beschattet waren, legte er die Hand an die Krempe seines Huts, um den Gast zu mustern. Unschlüssig blieb er auf seine Harke gelehnt stehen, bis ihn der andere heranwinkte. In einer seltsam anmutenden Choreografie, bei der er sich von dem Ankömmling zunächst einmal abwenden musste, um auf ihn zuzugehen, folgte er dem ausladenden Wellenkamm, den er zuvor in den Sand geharkt hatte. Schließlich stand er vor ihm und nahm ihn in Augenschein. Der Fremde schien Wert darauf zu legen, erkannt zu werden, jedenfalls zog er seinen Hut vom Kopf, um sein Gesicht im Licht zu zeigen.
„Bertold?“, fragte er nochmals.
Der Angesprochene wiegte den Kopf, als gäbe es Zweifel, dann nickte er. In stummer Erinnerung lief eine lange Geschichte ab. Aber auch nach dieser Vergegenwärtigung hatte er nichts mit ihm abzugelten. Erst jetzt bemerkte er die Waffe, die sein Gegenüber in der Hand hielt. Einen Moment lang flackerte Erschrecken in seinen Augen auf. Gleich darauf hatte er sich wieder unter Kontrolle, und von seiner gleichmütigen Miene war keine innere Bewegung mehr abzulesen. Er faltete die Hände und verbeugte sich wie einer, der in Demut sein Schicksal annahm. Dann drehte er sich um und kehrte ohne Hast zu der zuletzt bearbeiteten Stelle zurück. Er nahm seine Arbeit wieder auf und wies dem anderen wie zuvor den Rücken.
Als habe er Scheu, die Sandfläche zu betreten, blieb der Besucher am Rand in einer Entfernung von etwa fünf Metern stehen. Er hob die Waffe und zielte. Die Kugel traf den Nacken. Der Getroffene schwankte, wollte nach hinten zurückweichen, um nicht in seine Wellenzeichnung zu fallen. Schließlich kippte er doch kopfüber nach vorne. Das aus der Wunde strömende Blut sickerte in den Sand.
In der Ferne bellte ein Hund.
Der Besucher atmete tief durch und lauschte wie in ein Gebet versunken den Geräuschen der Natur. Das an- und abschwellende Zirpen der Grillen, das Tschilpen von Finken, Schreie von Krähen und dann das Brummen einer metallisch blaugrün schimmernden Schmeißfliege, die den Kopf des im Sand Liegenden umkreiste.
Schließlich ging er näher an den Getroffenen heran und beugte sich über ihn. Er hörte ein Stöhnen, in das sich undeutlich Worte zu mischen schienen, und drehte ihn auf den Rücken.
2.
Der Sterbende schlug die Augen auf und begegnete noch einmal dem Blick seines Mörders. Dann glitt sein Kopf zur Seite und die zunehmend undeutlicher werdende Wahrnehmung verlor sich in der feinkörnigen, hellen Fläche seines Gartens wie in einer weit gestreckten Wüste. Alles darin war flüchtige Gestaltung, in der er zu Wellen aufgeworfene Dünen erkannte, die sich bis zum Horizont hin wanden. Auf ihrem Kamm zeichneten Wind und Hitze sich verwirbelnde, schlängelnde Erscheinungen. Auf der dem Wind abgewandten Flanke floss der Sand in lang gezogenen Rinnsalen herunter. Er öffnete seinen Mund, und, da er es nicht mehr zustande brachte, dachte ein Lächeln.
In bildhafter Klarheit zog ein letztes Mal seine große Entdeckung herauf. Am Anfang stand ein Prinzip unbekannter Herkunft, einheitlich stark in seiner Art, ohne Schwäche und Makel, reine Kraft, die sich entfaltete. Er durchlebte alle Phasen ihres Wirkens, bis am Ende der Impuls in seinen Formungen verschwunden war und von einer Hülle umkleidet wurde wie Samen von einer Fruchtkapsel. Endlich, dabei aber unbegrenzt – von diesem Gegensatz hatte er sich nie eine andere Vorstellung bilden können als die einer rotierenden Kugel, auf deren Oberfläche die Holzlokomotive seiner Kindheit ebenso Platz fand wie die Armspange des Achilles, aber auch das Lachen Alexander des Großen beim Anblick von Amun-Re und der Abwurf von Little Boy über Hiroshima. Und natürlich auch sein Tod, der jetzt wie flutendes Licht auf ihn herabkam.
„Wenn der Schein von tausend Sonnen plötzlich am Himmel hervorbräche, wäre es gleich dem Glanze dieses Herrlichen …“
In ihm war alles aufgehoben, das Ende, aber auch jeder Anfang. Er begegnete dem Unergründlichen.
„Wer bist du, Fürchterlichgestaltiger?“
Dann brach der Totgeweihte ab.
3.
Sein Widersacher ging so nah an ihn heran, dass er ihm ins Ohr flüstern konnte.
„Der Tod bin ich, Erschütterer der Welten.“
Er richtete sich auf, setzte erneut seine Waffe an, hielt auf den Hinterkopf und drückte ab. Ein Zucken fuhr durch den Leib. Ohne den Blick von dem starr werdenden Körper abzuwenden, schraubte er den Schalldämpfer vom Lauf der Pistole, wickelte sie in ein Tuch und verstaute sie in dem Futteral.
Schließlich ging er zum Haus. Die Tür stand offen. Drinnen verschaffte er sich einen groben Überblick. Kurz danach ahnte er schon, dass er nichts finden würde. Die Einrichtung war karg, hier lebte ein Eremit. Durch die offene Tür sah er den Toten im Sand. Er lag reglos und doch so, als würde er ihn beobachten.
Schubladen und Schränke waren unverschlossen. Ohne Hast suchte er das Mobiliar ab. Er prüfte Matratzen, Kissen und Teppiche, er visitierte Taschen, Dosen und Schachteln. Dann setzte er eine Brille auf, an deren Gestell eine Doppellupe geklippt war, kroch auf allen vieren durch die Räume und durchforschte Bohlen und Holzverschalungen. Er klopfte und horchte, um dem Haus Hohlräume abzulauschen, eine lange Nadel, die er bei sich hatte, setzte er wie eine Sonde ein, um Dahinterliegendes zu ergründen. Schließlich fügte er sich der Erkenntnis, dass seine Hoffnungen vergeblich gewesen waren.
Er trat aus dem Haus. Auf dem Hinterkopf des Toten hatten sich Schmeißfliegen niedergelassen. Aus der Entfernung sah ihr Gewimmel wie eine blaugrüne Membran aus, die sich hob und senkte. Sorgenvoll blickte er nach oben. Eine Schar Krähen kreiste krächzend über dem Haus, zerstob dann und ließ sich in den nahen Bäumen nieder. Kurz entschlossen packte er den am Haus lehnenden Spaten und begrub den Toten im Sand. Er glättete den aufgeworfenen Haufen und zeichnete mit der Schaufelspitze zwei übereinanderliegende Dreiecke.
Die Sonne war hinter den Bäumen verschwunden.
4.
Führungen durch Schloss Ottenrain brauchte an einem Badesonntag wie heute niemand, es sei denn mein Chef, der Hausherr.
„Vielleicht gibt es ein Gewitter“, meinte Leo. „Und dann haben wir volles Haus.“
Ich warf einen Blick auf den wolkenlosen Himmel und zuckte die Achseln.
„Möglich“, erwiderte ich, um ihn nicht vollends zu enttäuschen.
Bei Regen war die Gaststube unten in der Wirtschaft stets brechend voll, wer keinen Platz mehr fand, drängte herauf und machte, um trocken zu bleiben, eine Führung. Aber danach sah es leider nicht aus. Trotzdem ging ich regelmäßig zum Kassenhäuschen am Eingang hinunter, setzte mich hinein und wartete. Für eine Führung sollten wenigstens zehn Personen zusammenkommen. Gegen Mittag spazierten vier alte Damen den Schlossberg herauf. Ihre Liebe zum Adel trotzte jedem Wetter. Auf dem grob gepflasterten Vorplatz hakten sie sich paarweise unter. Am Eingang löste sich eine aus der Gruppe und kam zur Kasse. Durch das ovale Sprechfensterchen lächelte sie zu mir herein.
„Vier Erwachsene“, sagte sie unter dem Gekicher ihrer Gefährtinnen. „Mit Führung.“
Sicher hatten sie das Schild bemerkt, demzufolge nur größere Gruppen durch das Schloss geführt werden konnten. In ihrer angeregten Stimmung machten sie aus ihrem Alter ein Privileg, das ihnen gestattete, Hindernisse zu übersehen. Und ich brachte es nicht übers Herz, sie wegzuschicken.
Ich verschloss das Kassenhäuschen und ging voraus.
„Und wenn wir ihm begegnen, wie sprechen wir ihn an?“
„Sagen Sie einfach Herr Baron zu ihm. Sein korrekter Name ist Leopold Freiherr von Rothenberg.“
Die Damen lachten höflich, und ich schleuste sie durch die Räume. Dass Leos Großvater eine Bartholdy-Wildenhain geehelicht hatte, wussten sie aus einschlägiger Lektüre. Vor allem das Schlafzimmer mit Himmelbett, die atlasblaue Wäsche und der Wandschrank der Baronin entzückten sie. Beseelt spazierten sie anschließend zur Schlosswirtschaft hinunter.
Bis in den Nachmittag hinein war Langeweile. Ich verlegte meinen Platz nach draußen in den Hof. Aus dem mit massiven Steinen umfassten Brunnen drang auch im Sommer von tief unten eine angenehme Kühle herauf, dazu spendete der alte Lindenbaum ausreichend Schatten. Ich hatte dort einen runden Tisch aufgestellt und eine Tischdecke aufgelegt. Richard Eulmann, mein Vorgänger, pflegte mich sonntags zu besuchen. Er wohnte in einem am Waldrand gelegenen Haus außerhalb von Ottenrain, das früher einmal als Jagdhütte gedient hatte. Am Sonntagnachmittag unternahm er regelmäßig einen längeren Spaziergang, der ihn zu mir führte. Wir tranken dann Tee zusammen.
Von diesem Platz aus hatte ich alles im Blick, konnte ungestört rauchen und meine Gedanken schweifen lassen, allerdings wäre mir mehr Betrieb lieber gewesen. Wenigstens so viel, dass wir meine Personalkosten wieder hereinbekamen. Es deprimierte mich, wenn Leo mit seinen schütteren blonden Haaren und, je nach Jahreszeit, in Leinen oder abgewetztem Cord aus seinem Herrenhaus geschlurft kam. Seinen hängenden Schultern sah ich an, was das Thema war: Geld! Freilich hatten wir Einnahmen aus Forstwirtschaft und Verpachtung, aber ein so weitläufiges, jahrhundertealtes Gemäuer war ein riesiges Sparschwein. Es musste dauernd gefüttert werden.
Warum sollten auch beim Entwurf und Bau eines solchen Schlosses immer nur Meister ihres Fachs unterwegs gewesen sein? Unser Barockschloss verfügte über einen Konzertsaal, der für nahezu zweihundert Personen ausgelegt war. Rechnete man allerdings Bestuhlung und alle sonstigen benötigten Anlagen hinzu, so würde bei einer Auslastung von etwa achtzig Besuchern der Boden durchbrechen. Mit anderen Worten: Wir hatten eine perfekte Lokalität für Konzerte, konnten sie aber nicht nutzen. Es sei denn, wir hätten den Boden komplett erneuert. Und dazu brauchte man Geld.
Bei unserer regelmäßigen kleinen Lagebesprechung, die wir meist freitags abhielten, hatte Leo wieder einmal gefragt, ob nicht die Gutsverwaltung Ideen hätte, zusätzliche Einnahmequellen zu erschließen. Mit Gutsverwaltung war ich gemeint. An Titeln mangelte es in einer adeligen Umgebung nie, aber genauso gut konnte er fragen, ob der Gärtner oder der Nachtwächter einen zündenden Einfall zu präsentieren habe. Auch damit wäre ich gemeint gewesen. Ich machte alles, was so anfiel.
„Hast du schon mal über Merchandising nachgedacht?“
Leo legte bei seiner Frage den Kopf schief.
„Kaffeetassen? T-Shirts?“
Er zuckte die Achseln.
„Was eben so geht.“
Ich wünschte mir in solchen Momenten, wenigstens einer von uns wäre der mit allen Wassern gewaschene Verkäufer.
„Weißt du, Leo, um Merchandising zu machen, müsste man eine Marke haben, die die Leute interessiert. Wer kennt schon Schloss Ottenrain?“
Ein schmerzvoller Zug ging über Leos Gesicht.
„Wir haben jetzt die Medaillons, die Postkarten und die Schneekugeln im Verkauf. Es würde mich wundern, wenn wir die Produktionskosten schon wieder drin hätten.“
Leos Augen wurden wässrig.
„Bringt nichts, wie?“
Ich nickte. Dann tranken wir unseren Kaffee aus, redeten noch über diese oder jene Ausbesserungsarbeit.
„Du machst das schon!“
Leo klopfte mir zum Abschied auf die Schulter.
„Klar“, sagte ich, „ich mach das schon!“
„Noch was!“
Leo wandte sich in der Tür noch einmal um.
„Vor der Mauer da unten beim Wassergraben wuchert das Unkraut. Könnte man da nicht mal mit der Sense ran?“
Ich musterte ihn besorgt. Aber seine Miene blieb arglos. Das Unkraut, von dem Leo sprach, war meine kleine Hanfplantage. Silver Haze, ideal platziert und inzwischen schon so reif, dass die Pflanzen intensiv rochen. Allerdings wagte sich kaum einer zum Wassergraben hinunter.
„Ich sehe zu, was sich machen lässt.“
Leo nickte mir zu und verschwand.
5.
Komischer Tag, dieser Sonntag heute! Waren das Langeweile und Einsamkeit? Das Warten? Irgendwo im Solarplexus vibrierte ein Nervenfaden, von dem eine flatterige Unruhe ausging. Ich löste eine Magnesiumtablette in Wasser auf und trank das Glas auf einen Zug aus. Neulich hatte ich ähnliche Zustände gehabt. Belanglose Sätze bedrängten mich wie Druckwellen. Manchmal waren Dehydrierung und Wassermangel für solche Zustände verantwortlich. Weit draußen meinte ich einen Hund heulen zu hören, ein Schwarm aufgeregt krächzender Krähen flog über das Dach. Ich fühlte mich in schwarze Schwermut getunkt. Sogar Eulmann schien sich heute verspäten zu wollen. Die Ruhe, die von ihm ausging, rückte viele Sorgen und Nöte zurecht. Früher hatte ich seine Wortkargheit als abweisend empfunden. Inzwischen spürte ich aus seiner Lakonie einen stoischen Humor heraus.
Dankbar für jede Abwechslung registrierte ich, dass eine junge Frau hereinflaniert kam. Ich nahm meinen Platz im Kassenhäuschen wieder ein. Sie lächelte zu mir her, warf einen Blick in den Empfangssaal und lugte durch das Hoftor. Als sie mir den Rücken zuwandte, musterte ich sie. Sehr ansehnlich. Sie wiegte die Hüften, wenn sie einen Fuß vor den anderen setzte. Sobald sie mich im Blick hatte, beschäftigte ich mich mit unseren Eintrittskarten. Geschäftsmäßig rieb ich mit Daumen und Zeigefinger das blaue, dicke, fast filzige Papier der Billetts. Schließlich kam die junge Frau ans Kassenhäuschen und fragte, ob sie das Schloss besichtigen könnte.
„Führungen sind leider erst ab zehn Personen möglich“, sagte ich. „Aber wenn Sie sich die völkerkundliche Sammlung ansehen möchten?“
Ich reichte ihr ein Faltblatt hinaus, und sie schaute es durch. Schließlich löste sie eine Eintrittskarte, und ich begleitete sie in den ersten Stock hinauf. Dort im ehemaligen Empfangssaal, in dem die Rothenbergs auch ihre Feste gefeiert hatten, war die Sammlung untergebracht.
„Aber ein paar Informationen dazu könnten Sie mir vielleicht trotzdem geben?“
6.
Um interessante Hinweise für Besucher war ich nicht verlegen. Die Einschätzung unserer Sammlung allerdings behielt ich für mich. Unsere Exponate als völkerkundlich zu bezeichnen, klang gut. Kuriositätenkabinett wäre zutreffender gewesen. Bei uns war von allem etwas und meist nicht das Repräsentative geboten. Hubertus von Rothenberg hatte vor fast zweihundert Jahren von einem Hamburger Kaufmann die Abdeckung eines ägyptischen Mumienschreins erworben. Dies markierte den Beginn einer familiären Tradition, möglichst exotische Teile zu beschaffen, als Erinnerungsstücke von Reisen, als Trophäen von kolonialen Abenteuern oder durch Ankauf auf Versteigerungen. Leos Vater Ignaz, ein zivil gesinnter, bodenständiger Mann, dem das militärische Engagement seiner Vorfahren ein Gräuel war, hatte die Frage aufgeworfen, was man mit dem angesammelten Plunder anfangen solle. Vor allem wohin damit? Das neue Herrenhaus war weder zweckmäßig noch gemütlich eingerichtet, sondern museal. Empfangsraum, Salon und Kaminzimmer boten kaum mehr ein Stück freie Wand. Ignaz’ größter Wunsch war eine Bibliothek.
Richard Eulmann hatte sich schließlich darangemacht, die Stücke zu katalogisieren und sie im Festsaal des Schlosses als völkerkundliche Sammlung zu zeigen. Nicht dass er von Haus aus ethnologisch versiert gewesen wäre, aber er widmete sich dieser Aufgabe mit Eifer und bewies ein gutes Gespür bei der Präsentation der Stücke. Als er mich damals einstellte, waren zwei Schrumpfköpfe, die Veit von Rothenberg als Trophäen von Amazonasindianern mitgebracht hatte, die Glanzlichter der Ausstellung. Tatsächlich hatte Veit sie in Ripley’s Gallery an der Lower Eastside erworben. Vor dieser Vitrine vor allem sammelten sich Besucher. Schrumpfkopfgucken und sich dem leichten Gruseln auszusetzen brachte einige Leute dazu, einen Abstecher nach Schloss Ottenrain zu machen. Anschließend ging man in die Schloss-Schänke, die sich mit ihrer deftigen Küche und den reichlichen Portionen einen Namen gemacht hatte.
Ein besonderes Verhältnis zu unseren Exponaten hatte ich bis dahin nie. Ich kümmerte mich um sie wie um sperrige Antiquitäten. Eines Tages jedoch holte mich Eulmann in sein Büro. Nächste Woche sei Freinacht, sagte er. Er halte es für klug, Wache zu halten. Die Ausstellung sei bereits einmal Ziel eines derben Scherzes geworden.
Von acht bis ein Uhr war mir die Aufsicht übertragen worden. Nach dem Abendessen machte ich noch einen Spaziergang und rauchte einen Joint. Anschließend ging ich zum Schloss hinauf und richtete mich in der Nische oben im ersten Stock vor dem Eingang zur Ausstellung ein. In der kalten Jahreszeit betrieben wir dort ein provisorisches Kassenhäuschen, um nicht die zugige, kaum heizbare Pförtnerloge unten am Hauptportal benutzen zu müssen. Die Nächte im April waren noch empfindlich kühl. Mit zwei Decken, einem Buch und einer Thermoskanne Kaffee machte ich es mir bequem. Um die Sammlung nicht dem prallen Tageslicht auszusetzen, hatten wir die großen Fenster mit Holzblenden abgedichtet. Die Vitrinen und Schaukästen wurden von innen beleuchtet, und durch die Lichtinseln entstand in dem abgedunkelten Raum eine leicht geheimnisvolle Atmosphäre, die unsere Besucher für die Wunder fremder Länder und Kulturen aufnahmefähig machte. Die Beleuchtung allerdings war bereits abgeschaltet, nur einige kleine Fenster direkt unter der Decke spendeten noch Licht. Von dort oben herab drangen die letzten Sonnenstrahlen und illuminierten die Stücke auf der gegenüberliegenden Seite. Ein klar umrissener, zum Trapez verzogener Lichtausschnitt fiel auf den reisenden Mönch, eine tibetische Malerei auf Seide, die in Tusche und Farbe ausgeführt war. Der Mönch trug eine Fahne vor sich her und hielt ein Bündel Sutras geschultert. Begleitet wurde er von einem Tiger. Die fehlenden Teile waren durch neutrale Naturseide ergänzt worden. Die harten Schattenlinien des Fensterkreuzes zerschlitzten das Bild in vier Teile.
Ich war fasziniert und spürte eine gesteigerte Aufnahmefähigkeit für das, was da vor sich ging. Alles verlangsamte sich. Die Minuten sprudelten nicht mehr, vielmehr verdickte sich die Zeit und floss so gemächlich wie Honig an einem Löffel herunter. Diese Vorstellung machte mir unheimlich Lust auf etwas Süßes, ich durchsuchte die Schubladen der Kassentheke, fand aber nur scharfe Pfefferminzbonbons.
Nun kroch der Lichtausschnitt zu dem chinesischen Steinguttopf mit Drachenhenkeln. Dort zerstreuten sich die Sonnenstrahlen und die scharfen Konturen verschwammen im Bläulichen. Die grünen Mosaiksteine der Maske des Quetzalcoatl begannen zu schimmern, die holzgeschnitzten weißen Zähne traten hell hervor und die aufgesteckten Federn bekamen irisierenden Glanz. Der bronzene Buddha erstrahlte, im matten Weiß der reich verzierten Muscheltrompete spiegelte sich warmes Licht und der Jadephönix aus China nahm die Gestalt eines gekrönten Hahns an. Schließlich erahnte man noch die Abbildung der schwarzen Todesgöttin Kali auf einem Buchdeckel, dessen Silberbeschläge das letzte Licht einfingen, und in den erdigen Farbtönen des Mumiendeckels, der den Sarg eines unbekannten Schreibers verschlossen gehalten hatte, reflektierte sich noch ein schwaches Glühen. Daraufhin kippte alles in dämmriges Grau. Die polynesische Holzbüste eines fremden Gottes starrte mich mit ihren weit aufgerissenen, weiß umrandeten Augen an, das geöffnete, nach unten gezogene Maul begann zu klaffen. Die sich auflösenden Konturen verzerrten die große schildförmige afrikanische Tanzmaske, blutrot, schwarz und weiß bemalt, zu einer bösen Fratze.
Mir war, als hätte ich bei allen unseren Ausstellungsstücken die Parade abgenommen, um sie in die Nacht zu verabschieden. Ich schaute auf die Uhr. Viertel nach neun. Erst jetzt schaltete ich das Lämpchen in der Nische an. Mehr als eine Stunde hatte ich mich von einem Schauspiel in Bann ziehen lassen, das dort drüben offenbar täglich ablief. Ich kannte den Raum bei Tag, war an die Anwesenheit von Besuchern gewöhnt und immer nur auf meine Aufgaben und die technischen Abläufe konzentriert. Hatte sich jemand ohne Eintrittskarte eingeschlichen, musste das Vitrinenglas gesäubert werden, trat jemand unseren wertvollen Stücken zu nahe? Abends wurden die Lichter gelöscht und die Tür geschlossen. Aber nun war in die toten, von mir so abgerückten Gegenstände ein Eigenleben gefahren, das ich noch nie zuvor wahrgenommen hatte. Fast jedes Stück war ein Kultgegenstand, hatte Segen oder Fluch gebracht und begann seine Aura abzustrahlen, als die museale Beschränkung aufgehoben war.
Ich hatte gar nicht bedacht, dass ich in dieser sonst so vertrauten Umgebung in so merkwürdige Zustände geraten könnte. Um mich wieder auf Alltagstüchtigkeit herunterzubringen, goss ich mir einen Kaffee ein und las in meinem Buch. Aus Eulmanns Büro hatte ich unverfängliche Fachlektüre mitgebracht. Die Geschichte der archäologischen Grabungen im Tal der Pharaonen. Gelangweilt von der Darstellung wissenschaftlicher Methoden in der Archäologie, aber fasziniert von Fotos und Schemazeichnungen der Pyramiden und Gräber, blätterte ich in dem voluminösen Band.
Irritiert unterbrach ich und stand auf, als ich Pochgeräusche aus dem Saal hörte. Ich versuchte mich nach Gehör zu orientieren, bis ich an eine der großen Wasserleitungen geriet, von der das Geräusch herzurühren schien. Beruhigt ging ich in meine Nische zurück und las weiter.
Trotz der wohlmeinenden Texte fiel es mir schwer, in den Heroen der archäologischen Grabungen, denen wir die großen Funde verdanken, mehr zu sehen als Abenteurer, die, wenn nicht durch die Gier nach Reichtum, so doch durch die nach Anerkennung getrieben, jahrtausendealte Monumente entweihten und Grabstätten aufbrachen, um möglichst viel davon als Beute in ihre Heimat schaffen zu können. Für mich waren sie Plünderer, die im Namen der Wissenschaft in verbotene Bezirke eingedrungen waren.
Doch immer wieder lauschte ich auf das Pochen, das nun an- und abzuschwellen schien, und versuchte drüben in dem dunklen Raum etwas auszumachen. Ich dachte daran, einen großen Rundgang zu unternehmen, wie Eulmann das vorgeschlagen hatte. Schon einige Meter hinter der Schwelle wusste ich, dass ich es nicht fertigbringen würde. Unsichtbare Tentakel tasteten mich ab. Auf meine Brust legte sich ein Druck, der mich kurzatmig werden ließ. Ich gab mir einen Ruck und strengte mich an, nur das wirklich Wahrnehmbare an mich heranzulassen. Nur das Sichtbare, nur Geräusche! Warum hatte ich nicht daran gedacht, eine Taschenlampe mitzunehmen? Der scharfe, unbeteiligte Blick, den ich mir verordnen wollte, war verlorene Liebesmüh, denn der Saal blieb in undurchdringliches Grauschwarz getaucht, aus dem mein überreiztes Hirn wie aus wogendem Plasma immer neue Gestalten formte. Achtete ich nur auf Geräusche, nahm ich ein Rascheln, Schlurfen und beständiges Ticken wahr. Solche Geräusche verschwanden genauso rasch, wie sie gekommen waren, wenn ich glaubte, sie orten zu können. Endlich gestand ich mir meine vollständige Hilflosigkeit ein. Ich konnte aus mir keinen Helden herauszwingen. Etwas saß mir im Nacken, eine namenlose Angst wie in Erwartung eines Hiebs, und so entfernte ich mich langsam Schritt für Schritt rückwärts aus dem Raum.
Ich setzte mich wieder in die Loge, goss den restlichen Kaffee ein und schämte mich. Wie hatte ich als Kind meine Mutter angebettelt, mich bei Dunkelheit nicht mehr in den lichtlosen Schuppen zu schicken, um Holz und Kohlen zu holen! Solche Ängste konnte ich auch als Erwachsener nicht abschütteln.
Um mich abzulenken, kehrte ich zu meinem Buch zurück. In einer Art von Zwang stieß ich rasch auf einen Abschnitt, der sich dem sogenannten Fluch des Pharaos widmete. Wie von einer Viper gebissen klappte ich das Buch zu. Nun war der Damm gebrochen. Ich wusste, dass ich, um mich zu schützen, dieses Kapitel keinesfalls lesen durfte. Zittrig hüllte ich mich in meine Decken und versuchte etwas Helles, Tagklares und Warmes zu denken. Den Hochstädter See im glitzernden Sommerlicht, das Lachen der jungen Frauen, die Gänsehaut auf ihren braunen Schenkeln, wenn sie aus dem Wasser stiegen, die Fangspiele der Kinder. Aber nichts half mir wirklich weiter.
Also hob ich vorsichtig den Blick und versuchte mich endlich dem zu stellen, was dort drüben stattfand: eine Versammlung von Dämonen, die nachts ihre Unterwerfung unter die Herrschaft der fremden Ordnung abschüttelten, eine Zusammenkunft von Geistern, die alte Rituale aufleben ließen und die dazu die gesamte Örtlichkeit in Besitz genommen hatten. Und der Saal fügte sich, als sei die Behausung von Schattenwesen schon immer seine Bestimmung gewesen. Alle Nippesfantasien von Rokokodamen und galanten Herren, die ich bei Führungen zitierte und nach denen hier gut gelaunte Herrschaften schöne Tanzfiguren aufs Parkett zirkelten, verschwanden. Dieses Gemäuer hatte Jahrhunderte gesehen und ihr Leid, ihr Unglück und ihren Schmerz aufgesogen. In jedem Stein ruhte eine Geschichte.
Solche wilden Vorstellungen verwirbelten sich in meinem Kopf.
Als dann unten jäh und laut die Riegel der großen Tür aufgeschlagen wurden, stockten mir Herz und Atmung. Eulmann kam die Treppe herauf, um mich abzulösen.
„War was?“, fragte er und prüfte meinen Gesichtsausdruck.
„Alles bestens. Keine besonderen Vorkommnisse.“
Ich vermied, ihm ins Gesicht zu sehen. Der ausgestandene Schrecken war mir anzumerken. Mit gesenktem Kopf raffte ich Decke, Thermoskanne und Buch zusammen. Aus den Augenwinkeln meinte ich ein Lächeln in Eulmanns schmalem Gesicht zu bemerken. Ich sagte, ich sei hundemüde und müsse mich gleich hinlegen. Er ließ mich wortlos gewähren und klopfte mir nur zum Abschied auf die Schulter.
Erlöst schloss ich das große Tor hinter mir und trat ins Freie. Die frische Luft tat gut. Ich durchquerte den Ziergarten, den wir neben der Kapelle kultiviert hatten. Wir nannten ihn für unsere Besucher Prälatengarten, um das Anheimelnde der Anlage hervorzuheben. Jeder Strauch und jedes Pflänzchen waren mir vertraut, ich atmete durch und fühlte mich erleichtert und frei. Meine Ängste kamen mir nun vollends unangemessen und kindisch vor.
Endlich erreichte ich das Gutshaus. Dort hatte ich im Obergeschoss eine Wohnung, die eigentlich dem Gutsverwalter zustand. Nach Eulmanns Auszug war sie mir zugefallen. Leise stieg ich die Treppen nach oben. Die alten Bohlen knarrten. Miras kleine Wohnung befand sich im ersten Stock. Sie führte den Rothenbergs den Haushalt. Vor ihrer Tür blieb ich stehen und lauschte. Man hörte ihre regelmäßigen Atemzüge. Sacht drückte ich die Klinke. Wenn Mira nicht absperrte, durfte ich zu ihr. Ich schlich hinein, zog mich aus und schlief sofort ein.
7.
Solche Erlebnisse hatten mein Verhältnis zu unserer Sammlung geprägt, Besuchern war das nicht zu vermitteln. Ich gab der jungen Frau daher einige Hinweise zum Sargdeckel des Mumienschreins und zur polynesischen Holzbüste und ließ sie dann alleine durch die Ausstellung streifen. Währenddessen ging ich hinüber zum Südbalkon. Von dort hatte man einen Ausblick auf den Wanderweg, der zum Schloss führte. Aber von Eulmann war immer noch nichts zu sehen.
Die Prognosen bei meiner Anstellung damals waren ziemlich schlecht gewesen. Mit so einem wie Eulmann könne man nur schwer auskommen. Er sei unzugänglich. Überraschenderweise klappte es mit uns von Anfang an sehr gut. Vielleicht weil er mich selbst für die Stelle ausgesucht hatte und sich mit seiner Wahl nicht blamieren wollte. Bei mir hatte es nicht zu einem Studium gereicht. Zu wenig Biss. Dass aus mir dann der Großhausmeister der Rothenbergschen Güter geworden ist, war für meine Verhältnisse sogar eine Art Karriere.
Ich war hobbymäßig Sternegucker. Bei uns zu Hause in den Bergen war ein klarer Nachthimmel normal gewesen. Dort Formationen ausmachen zu können hatte mich fasziniert. Zu Anfang waren es meine eigenen, hier entdeckte ich den Schädel einer Kuh, dort Gesprenkel wie auf dem Fell unserer Katze. Von meinem Firmpaten bekam ich die erste Himmelskarte, später schaffte ich ein Teleskop an. Eulmann förderte mein Hobby. Zusammen richteten wir im Schlossturm eine kleine Sternwarte ein. Er hatte ganz erstaunliche Kenntnisse in Physik und Astronomie. Durch ihn habe ich einiges über die Grundlagen dieses Fachs erfahren. Fragen, warum er nie mehr daraus gemacht hatte, wehrte er ab.
Nach seinem Ausscheiden in den Ruhestand frönte ich diesem Hobby auf meine Weise. Ich machte aus dem Hochsitz mit Blick ins Universum ein gemütliches Kabinett, schaffte Matratzen, Tisch und Stühle hoch, Kochplatte und einen kleinen Kühlschrank. So war nun für alle Bedürfnisse gesorgt, und vor allem in der warmen Jahreszeit konnte man dort oben wunderbare Abende verbringen. Ich rauchte in der Hängematte auf dem Balkon ein paar Joints, guckte in die Sterne und meditierte anschließend sanft hin- und herschaukelnd vor mich hin. Obwohl ich die Gestirne und Bilder inzwischen recht gut auseinanderhalten und benennen konnte, war der wissenschaftliche Zugang nie wirklich mein Interesse. Die Muster, zu denen sich die Haufen zusammenballten, beschäftigten mich immer wieder neu. In dem Astronomieforum, in dem ich regelmäßig zugange war, hatte ich von einer Theorie gelesen, nach der die Himmelskörper wie Pixel auf einem Computerbildschirm Zeichen bildeten und eine Inschrift formten, die sich entziffern ließ. Kosmische Chiffren, in denen das Rätsel unseres Daseins aufgehoben war. Solche Vorstellungen faszinierten mich. Nachts auf dem Balkon wurden die Gedanken beweglich, sie flogen. Sie verließen diese Welt und traten mit dem Universum in Kontakt. Nicht selten stellte sich das Gefühl ein, als hielte es mich wie eine Mutter in den Armen. Leider überwältigte mich dabei regelmäßig der Schlaf.
Mit einer Frau konnte man dort oben schöne Abende ganz anderer Art erleben. Mira und ich waren uns so nähergekommen. Im Turmzimmer waren wir ganz ungestört. In einer lauen Nacht traten wir hinaus auf den kleinen Balkon. Mira hatte nur ihr T-Shirt anbehalten und stützte sich auf die Brüstung. Das Vergnügen, mit ihr sein zu können, wurde dort oben mit Blick in die glitzernden Sterne zu einem kosmischen Erlebnis.
Als Eulmann noch Verwalter gewesen war, hatte ich solche Eskapaden nicht gewagt. Er war durchaus freundlich und zugewandt, aber das Gefühl, dass er etwas verbarg, wurde ich nie los. Im ehemaligen Pferdestall beispielsweise waren unsere Geräte und Ersatzteile untergebracht. Ganz am Ende befand sich eine schwere Tür, die ständig abgeschlossen blieb. Nie bekam ich einen Hinweis, was dort gelagert wurde oder wofür der Raum gut war. Irgendetwas Wichtiges allerdings musste es sein, sonst wäre die Tür nicht so konsequent versperrt geblieben.
An einem warmen Frühsommertag hatten wir im Garten gearbeitet. Am späteren Nachmittag sammelte ich schließlich die Geräte auf einer Schubkarre zusammen, um sie zurückzubringen. Wegen der Besucher war der Stall abgesperrt. Das gehörte zu den Grundregeln, denn ein Tourist würde jeden unverschlossenen Raum betreten.
Eulmann hatte sich auf eine Bank gesetzt und warf mir seinen Schlüsselbund zu. Ich fuhr mit der Karre zum Pferdestall hinüber und stellte alles an seinen Ort zurück. Die Gelegenheit war günstig. Rasch hatte ich den richtigen Schlüssel an Eulmanns Bund ausgemacht und schloss auf. Der enge Raum war in frischem Weiß gekalkt, den gesamten verfügbaren Platz hatte man für Holzregale genutzt, die bis zur Decke hoch reichten. Dort hineingestopft lag ein Sammelsurium von Gegenständen, das in mir die Vorstellung eines Dritte-Welt-Andenkenladens erweckte. Steinbrocken, Masken, gefiederte Totemgestalten, holzgeschnitzte Figuren. An einem Querholm hing ein Traumfänger, ein Holzring, in dem ein zartes Netz aufgespannt war. Etwas ratlos sah ich mich um. Auf einem Tischchen stand ein Karteikasten. Daneben lagen ein Konvolut von Papieren, das von einem Gummiband zusammengehalten wurde, eine Kladde mit schwarz marmoriertem Umschlag und obenauf eine Pistole, die in einem braunen Halfter steckte. In ihren Kolben war ein Stern eingraviert.
Ein plötzlicher Luftzug ließ den Traumfänger hin und her pendeln. Ich machte auf dem Absatz kehrt, um rasch den Raum zu verlassen. Gerade noch rechtzeitig hatte ich ihn wieder verschlossen, da stand Eulmann schon hinter mir. Mit einer Handbewegung forderte er seinen Schlüsselbund ein.
Wir sprachen nie über den Vorfall, aber zwei Wochen später führte er mich ungefragt in den Raum. Ich sah sofort, dass er aufgeräumter war. Vor allem waren die Kladde und der Revolver verschwunden.
„Der Raum hier ist eine Art Asservatenkammer“, sagte Eulmann. „Alle Stücke tragen eine Nummer, zu der du hier in dieser Handkartei einen Brief, eine Karte oder sonst etwas Handschriftliches findest.“
Ich verstand überhaupt nichts.
„Mitbringsel aus aller Welt sind hier gesammelt.“
Er nahm eine geschnitzte Maske aus schwarzem Holz aus dem Regal. Die Fratze eines Buschgeistes.
„Aus Afrika.“
Er zeigte mir eine Totemfigur, eine Puppe aus Stroh und Stoff, wie sie zu Voodoozeremonien verwendet wurde.
„Aus Brasilien.“
Dann tippte er auf einen von mehreren Steinbrocken, die aufgereiht standen.
„Aus Australien vom Ayers Rock. Der Stein hier ist ein gutes Beispiel. Reisende sollten eigentlich wissen, dass die Aborigines den Uluru als Heiligtum betrachten. Man ist dringlich gehalten, die heiligen Stätten zu meiden.“
Eulmann zuckte die Achseln.
„Trotzdem klauben die Touristen dort irgendwelche Brocken als Andenken auf.“
Er zog einen Brief aus dem Karteikasten und reichte ihn mir.
„Dann passiert so etwas. Lies das mal.“
Ich überflog das Schreiben, es klang wie ein Hilferuf. Ein Ehepaar war auf Urlaub in Australien gewesen und hatte vom Ayers Rock einen Stein im Gepäck mit nach Hause geschmuggelt. Dort lag er unbeachtet im Schrank bei den Urlaubsdias. Dann aber wurde die Familie, wenn man der Briefschreiberin Glauben schenken durfte, in eine Unglücksserie verstrickt. Die Schwiegermutter erlitt einen Schlaganfall und das Kind bekam Drüsenfieber. Als sich ihr Mann dann das Bein brach, mochte sie an keinen Zufall mehr glauben. Man bestrafte sie. Zum ersten Mal kam ihr in den Sinn, der Steinbrocken vom Uluru könnte dafür verantwortlich sein. Sie holte sich bei einem Priester Rat. Der schalt sie und bezeichnete ihre Ängste als Aberglauben. Das seelsorgerliche Gespräch verschaffte ihr nur kurzzeitig Erleichterung. Die Verbindung mit dem Steinbrocken war hergestellt und ließ sich durch keine Rückbesinnung mehr kappen. Natürlich durfte man aus religiösen Gründen nicht an einen Fluch glauben. Aber ein heiliger Stein wirkte möglicherweise auch ohne den Glauben an seine Macht. Jedenfalls reifte in der Frau der feste Entschluss, sich dieses Brockens zu entledigen. Aber wie? Ihn wegzuwerfen, zu zerkleinern oder zu vergraben verbot sich von selbst: Die falsche Behandlung würde womöglich alles nur noch schlimmer machen. Sie bitte daher inständig darum, so schrieb die Frau, das Stück anzunehmen, angemessen zu verwahren und so den Bann zu brechen.
Ich blickte auf.
„Verstehst du jetzt?“, fragte Eulmann.
Ich nickte.
„Solche Objekte lagere ich hier ein.“
8.
Lösungen wie die einer Asservatenkammer waren typisch für Eulmann. Ob er an Totems, Amulette oder Magie glaubte, bekam man nicht heraus. Er behandelte diese Sendungen mit Respekt, der ihm jedoch, wie mir schien, nicht den mit ihnen verknüpften Glauben abverlangte. Selbst Reaktionen, die mir zunächst unverständlich vorkamen, entsprangen bei ihm nie nur einer Laune, er fällte keine Entscheidung aus dem Bauch heraus. Wenn man nachbohrte, merkte man, dass er seine Handlungsweise wohl zu begründen verstand. Er war ein grüblerischer Mensch, der ständig in sich hineinhorchte, dazu ein Musiknarr, der viel Zeit damit verbrachte, auf seiner Geige oder dem Harmonium in der Schlosskapelle zu spielen. Demgegenüber stand seine Manie, alles messen und berechnen zu wollen. In seine voluminöse Armbanduhr war ein Rechenschieber integriert, den er jedem Taschenrechner vorzog. In dieses Bild passte, dass er einige Wissenschaftsmagazine abonniert hatte, die er mit großer Akribie durchackerte.
Vor gut sechs Jahren, kurz nach meiner Einstellung, hatten wir uns darangemacht, die Rosenbeete im Prälatengarten zu erweitern. Die Idee, die Anlage zu vermessen und umzugestalten, ging auf Eulmann zurück. Mit dem Maßband ermittelte er die neuen Begrenzungspunkte und fixierte die Größe und Lage der Beete mit Pflöcken. Er begutachtete das Resultat seiner Arbeit aus immer wieder anderen Perspektiven, bestieg die Gartenmauer für einen Überblick und ging in die Hocke, um den Standort der Pflöcke zu kontrollieren. Bevor wir zur Markierung die Schnüre spannten, schritt er seine Messungen noch einmal ab. Dabei summte er in seinem Altherrentenor vor sich hin. Ich dachte, Freude habe ihn gepackt, weil alles so gut zu gelingen schien. Dann aber merkte ich, dass er jeder Messstrecke einen Ton zuordnete.
„Die Quinte hier stimmt nicht.“
Er war stehen geblieben und schüttelte den Kopf. Ich schaute ihn verdattert an.
„Wovon sprichst du eigentlich?“
Er bemerkte meine Fassungslosigkeit.
„Du glaubst, ich bin übergeschnappt?“
Er winkte mich heran.
„Schon mal etwas vom Monochord gehört?“
Ich wiegte den Kopf und dachte nach. Er winkte ab.
„Denk dir eine Saite. Wenn wir sie mit klaren, ganzzahligen Werten unterteilen und die verkürzten Saitenlängen anschlagen, dann klingen sie harmonisch zueinander. Aber nur, wenn sich die Stücke wie eins zu zwei, zwei zu drei oder drei zu vier und so fort verhalten. Wenn du jetzt, sagen wir: vier Dreizehntel zu neun versuchen würdest, klingt es schmutzig.“
„Und warum?“
„Weil geometrische Proportionen, die wir als schön empfinden, Längenmaße enthalten, die, auf eine Saite übertragen, auch harmonisch klingen. Die Wahrnehmung von Schönheit beruht beim Hören und Sehen auf denselben mathematischen Prinzipien.“
Eine Ahnung von dem, was er meinte, zog in mir auf.
„Das Grundmaß des Gartens, übrigens nicht von uns, sondern von unseren klugen Vorgängern angelegt, sind zwölf Meter. Als hätten sie dabei an die zwölf Töne der Notenskala gedacht. Das große Beet misst zum Beispiel zwölf Meter, die beiden kleinen zusammen ergeben zwölf und so fort. In die Musik übersetzt ergibt sich aus der Zwölf unser Grundton, und ich versuche nun dem Ganzen ein Zusammenspiel aus Oktave, Quinte und Quarte zu geben.“
Er summte mir das Exempel noch einmal vor.
„Bis zum Mäuerchen haben wir zunächst Grundton und dann Quinte. Und was hat man da für einen Eindruck?“
„Keine Ahnung, ich verstehe nichts von Musik.“
„Dass etwas aufgemacht wird. Die Quinte öffnet den Tonraum. Hier brauchen wir aber einen Abschluss. Muss also die Quarte sein. Klar?“
Er gab mir einen Klaps auf den Hinterkopf.
„Auch wenn du meine Idee jetzt nicht verstehst, du wirst sie begreifen, wenn die Anlage zugewachsen ist. Komm, wir stecken das noch mal um.“
Ob er damit recht hatte, konnte ich nicht entscheiden. Allerdings erfreute sich der Prälatengarten größter Beliebtheit, was sich aber wohl auch auf den prächtigen Bewuchs und nicht nur die zumeist verborgen liegenden Harmonien der Beete, Wege und Brunnen untereinander zurückführen ließ.
9.
Vor fünf Jahren schließlich war Eulmann in Pension gegangen, und ich folgte ihm als Verwalter nach. Er lebte nun zurückgezogen in seinem Holzhaus und begann sich, wie Rasso Hambichl, Musiklehrer und Organist in Ottenrain, es einmal gesagt hatte, in einen Walderemiten zu verpuppen. Musik, Bücher, Meditation und die Pflege seines japanischen Gartens, den er mit großem Aufwand angelegt hatte, waren seine Beschäftigungen. Telefon schaffte er sich nicht an. Wenn ich sonntags einmal nicht da war, fuhr ich vorher bei ihm vorbei und gab ihm Bescheid. Er stand mir zwar auch weiterhin mit seinem Rat zur Seite, respektierte es jedoch, wenn ich einen eigenständigen Weg gehen wollte. Das galt insbesondere für unsere völkerkundliche Sammlung. Die meisten unserer Ausstellungsstücke sind Kultgegenstände. Sie besitzen Kraft, weil sie ein magisches oder religiöses Ritual repräsentieren. Nur aus der Distanz betrachtet, sind es exotische Stücke, die einen gleichgültig lassen. Denn wehe, sie rücken uns zu nahe! Noch nicht einmal der aufgeklärteste Mensch würde sie in seinem Schlafzimmer dulden. Auch wenn wir sie nicht wirklich verstehen, rühren sie doch an etwas Archetypisches in uns. In der Angst, die ich damals in der Freinacht ausgestanden hatte, zeigten diese Stücke ihre Macht. Sie erzwingen eine Stellungnahme, man meidet oder flieht sie, ihre Nähe wird nur im Eingeständnis erträglich, dass sie etwas bedeuten, das uns übersteigt. Meine Arbeit brachte es mit sich, mich mit ihnen arrangieren zu müssen.
Ich habe mir einen ganz eigenen Reim darauf gemacht. Für unser Forum der Astronomiefreunde wollte ich das schon einmal in einem längeren Beitrag beschreiben. Leider ist mir der Text nicht so gelungen, wie ich ihn gerne gehabt hätte. Plötzlich klang alles ziemlich naiv, und ich behielt meine Gedanken lieber bei mir. Nur Eulmann gegenüber traute ich mich, meine Überlegungen preiszugeben.
Jenseits unserer Welt, in der alles so geordnet und erklärbar oder wenigstens nach unserem Willen zugeht, kennen wir nur den großen Bereich des Zufalls. Das ist, als würde jenseits unseres gut gepflegten Gärtchens eine Wildnis ungeahnten Ausmaßes beginnen. Dort herrschen Gesetze, die niemand versteht, sicher ist nur, dass sie dem, was wir erwarten, zuwiderlaufen. Was uns daraus zustößt, ist selten Glück, meistens Unglück, so oder so ist es Schicksal. Man nimmt es an, demütig oder fluchend, man begehrt dagegen in sinnlosem Stolz auf, dem Schicksal oder dem, der es über uns gebracht hat, ist das eine so gleichgültig wie das andere.
Kaum einer pflegt einen einsichtigen Umgang mit diesem dunklen Bezirk. Viele halten große Stücke auf ihre vernünftige Weltsicht, was da nicht hineinpasst, überlässt man besser den Betschwestern oder Esoterikern. Sagen sie. Wenn sie allerdings einen Lottoschein ausfüllen, geben sie wie selbstverständlich ihre Glückszahlen an, das eigene Geburtsdatum, Mutters Hochzeitstag oder was auch immer. Sie hängen sich Amulette um den Hals, lassen sich das Zeichen eines chinesischen Glücksdrachens oder ein Hexagramm auf das Hinterteil tätowieren, wenn sie etwas Wichtiges vorhaben, praktizieren sie irgendwelche Rituale, wie den Morgenkaffee aus ihrer Kindertasse zu trinken, oder sie spenden, zünden Kerzen an, lesen Horoskope. Jeder hat so seine Tricks, den angeblich großen Geist, der über allem waltet, in seine ganz persönliche Abhängigkeit zu bringen. Am besten steht man da, wenn er einem etwas schuldet.
Natürlich fühlt sich eine ganze Handvoll Gefestigter vor jeglichem Humbug gefeit, sie sind vernünftig bis auf die Knochen. Ihre Kritikfähigkeit rührt von einem großen Misstrauen allem Gesundbeten gegenüber her. Das Einfallstor für Aberglauben ist bei ihnen ein komplett anderes: Quält sie beispielsweise ein Dauerkopfschmerz, sind sie sicher, dass sie einen Tumor haben. Oder sie werden von Zukunftsängsten gepeinigt. Ihr Leben ist umstellt von Feinden. Sie werden krank. In allen diesen Fällen lässt sich beobachten, wie ihre unbestechliche Logik umschaltet, sie wird assoziativ und folgt einer Spur der Angst, die immer den größtmöglichen Unglücksfall als unausweichlich ausmalt.
Man muss daher die Existenz dieses dunklen Bereichs anerkennen. Erstaunlicherweise tun das die wenigsten. Sie finden es angemessener, sogar tapferer, das alles als bloßes Hirngespinst abzulehnen, obwohl sie doch gleichzeitig versuchen, das Undurchsichtige mit den primitivsten magischen Mitteln zu kontrollieren. Drei Mal auf Holz zu klopfen oder sich mit anderen unzureichenden Lebensbewältigungs-Strategien in die Tasche zu lügen ist genauso beschämend, wie sich mit Hypochondrie, Beruhigungsmitteln oder Sauferei in seinen Ängsten zu suhlen.
Was aus diesem dunklen Bezirk vor einen hin tritt, dem sollte man mit klarem Verstand und geschärfter Intuition begegnen. Durch Eulmann habe ich auch ausgefallene Lösungen akzeptieren gelernt. Mit der glosenden Niedertracht des polynesischen fremden Gottes habe ich mich ebenso lange herumgequält wie mit der Boshaftigkeit dieser schildförmigen afrikanischen Tanzfratze. Deren Schwingungen waren einfach immer ungut. In einer mutigen Aufwallung habe ich beide einfach umquartiert und ihnen den Platz neben der Tür zugewiesen. Dort sollten sie als Wächter fungieren und dafür sorgen, dass nichts Böses über die Schwelle tritt. Eine lächerliche Maßnahme vielleicht, aber sie hat gewirkt und mir geholfen, meinen Frieden mit den beiden Stücken zu machen. Heute haben sie eine Aufgabe und sind für mich da.
Wenn meine Schulkarriere nicht so in den Graben gegangen wäre, hätte ich mich gerne mehr mit Physik befasst. Man könnte diese Zusammenhänge dann einfach besser erklären. Auch wenn nichts daraus geworden ist, weiß ich zumindest so viel, dass auch der Zufall einer Regel gehorcht, die wir nie am einzelnen Ereignis begreifen können, sondern nur an der großen Zahl. Wenn wir das Einzelne betrachten, verhalten wir uns wie ein Quantenphysiker, der immer da, wo er ein Teilchen herauszumessen versucht, auch tatsächlich eines findet. Weil er es durch seine Messung hervorruft. Er könnte es genauso zuverlässig an einer ganz anderen Stelle registrieren. Deshalb stoßen auch wir bei der Betrachtung unseres Lebens oft auf Unglück, wo wir ebenso gut dem Gegenteil hätten begegnen können.
10.
„Darf ich Sie noch etwas fragen?“
Ich schrak auf. Ich war in mich versunken gewesen und hatte meinen Gedanken freien Lauf gelassen. Die junge Frau stand vor mir. Ihre Augen funkelten spöttisch.
„Ganz zu Diensten, Gnädigste!“
„Ich habe gelesen, dass es hier Schrumpfköpfe geben soll. Kann sie aber nicht finden.“
Sie hielt mir ihren Führer unter die Nase und tippte auf ein Foto.
„Da sind Ihre Informationen nicht mehr aktuell genug. Die Köpfe gibt es schon seit einigen Jahren nicht mehr.“
Ich tat so, als musterte ich das Foto. Ihr weißes kurzärmeliges Oberteil lag eng am Körper an und pauste den Spitzenbesatz ihres BH-Körbchens durch. Die Hitze draußen hatte die Luft im Schloss stickig gemacht. Ich bildete mir ein, dass ihr Dekolleté feucht glitzerte. Jedenfalls stieg mir ein anregend blumiger Duft ihres Parfüms in die Nase.
„Warum denn das?“
Ihr Blick hatte etwas Herausforderndes.
„Wollen Sie eine ernsthafte Antwort?“
Sie trat einen Schritt zurück.
„Aber sicher!“
„Okay. Ich habe die beiden Köpfe begraben. Sie liegen in dem Rosenbeet neben dem Herrenhaus. Ich fand es einfach nicht mehr zu verantworten, dass wir hier Leichenteile ausstellen. Wie auch immer! Es handelte sich dabei um Menschen oder dem, was man von ihnen übriggelassen hat. Das darf man nicht zeigen. Als bloße Kuriosität und nur zur Belustigung. Verstehen Sie?“
Sie legte ihre Stirn in Falten und nickte ganz ernst. Ihr Stimmungswandel verscheuchte allen Eros.
„Verstehe ich gut“, sagte sie.
Ich geleitete sie nach unten. Vom Hoftor aus zeigte ich ihr die Kapelle.
„Die Kapelle wäre auch noch zu besichtigen.“
Erst jetzt bemerkte ich, dass zwei Krähen ein Beet mit ihren Schnäbeln durchwühlten.
„Weg da“, schrie ich.
Ich lief auf sie zu und klatschte in die Hände, um sie zu vertreiben. Sie hüpften aus dem Beet und flogen dann zum Kapellendach hoch. Ihr Krächzen klang wie ein frecher Protest. Ich warf einen Stein nach ihnen, und sie schwangen sich in den hellblauen sommerlichen Himmel empor. Als ich mich umdrehte und zurückging, war die junge Frau bereits verschwunden. Wie ein Raubtier seine Beute, so packte mich wieder das ungute Gefühl, das mir seit heute früh ständig auflauerte.
11.
Professor David Ashton war bereits seit einigen Jahren emeritiert und daher von seiner Verpflichtung zur Lehrtätigkeit freigestellt, aber auf die ehrenvolle Aufgabe, Studenten in die Quantenmechanik einzuführen, mochte er nicht verzichten. Die geschichtsträchtige Vorlesungsreihe war von Paul Dirac auf ihn gekommen, einem der Gründerväter dieses Zweigs der Physik. Dirac war in Cambridge Gott gewesen, und Ashton bezeichnete sich als einen seiner bescheidenen Jünger. Diesen bedeutenden Mann noch leibhaftig vorne am Pult erlebt zu haben, begriff er als Privileg, ihn ersetzen zu dürfen als Ehre. Ashton hatte die siebzig bereits überschritten, war jedoch ein rüstiger alter Herr, der sich guter Gesundheit erfreute. Solange er noch seine fünf Sinne beisammenhalten konnte, wollte er auch weiterhin lesen.
Das Thema brachte es mit sich, dass sich David Ashton wie ein Magier inszenieren durfte. Richard Feynman, dem er sich im historischen Teil seiner Vorlesung ausführlich widmete, hatte provozierend behauptet, dass niemand die Quantenmechanik verstehe. Was das Publikum seiner Vorlesung anging, es handelte sich um jüngere Semester, die erstmals mit dieser Materie in Berührung kamen, konnte diese Charakterisierung kaum zutreffender sein. Es war, als würden sie von der lichten Plattform ihres Wissenschaftsgebäudes in den dunklen Keller hinabsteigen. Oben gab es alles, was sich Studenten von einer Wissenschaft erwarten durften, wie Wiederholbarkeit, Objektivität und Regel, unten herrschten Zufall, Subjektivität und Wahrscheinlichkeit. Oben regierte das sinnlich Erfahrbare, das Kompakte und mit Händen zu Greifende, unten das Unsichtbare, Flüchtige und nur in Bildchiffren Darstellbare.
Zu Beginn der Vorlesungen zerriss Ashton Papier, zerknüllte es und legte die Teile demonstrativ auf verschiedene Seiten seines Katheders. In der Physik, die sie bisher kennengelernt hätten, sei klar geschieden, ob sich das Papier hier oder dort befinde. In der Quantentheorie seien diese Verhältnisse aufgehoben, die Eindeutigkeit des Ortes nämlich. Bei Elementarteilchen existierten Überlagerungen und Mischzustände, nach denen das Papier gleichzeitig hier wie dort, ja sogar überall angenommen werden müsse.
Die Studenten warteten darauf, dass derart steile Thesen zu guter Letzt wieder aufgehoben und in einem wissenschaftlichen Prinzip befriedet würden, aber genau das geschah nicht. So entspann sich ein zäher, manchmal aussichtsloser Kampf, den sogenannten gesunden Menschenverstand zu verabschieden, der gegen dergleichen rebellierte.
Ashton gefiel sich in der Rolle eines Meisters der Unterwelt. Das Paradoxe müsse hart an die Schädel der Lernenden stoßen, nur dann finde es Eingang. Er hoffte, damit jede Studentengeneration aufs Neue verblüffen zu können. Vielleicht würde seine Vita nicht nur der Vermerk zieren, er sei Paul Dirac nachgefolgt, sondern später auch einmal das schmückende Beiwort würdig dazu kommen.
Ashton sah auf die Uhr. Um pünktlich zu beginnen, war noch eine halbe Stunde Zeit, ausreichend Gelegenheit also, einen Kaffee bei Martha’s zu nehmen. Um sich später keine Blöße zu geben, war es hilfreich, sich vor Beginn der Veranstaltung sammeln zu können. Dass er für diese schon Jahrzehnte währende Reihe keine spezielle Vorbereitung mehr benötigte, verstand sich. Das von ihm verfasste Kompendium der Quantenphysik, das als Taschenbuch weite Verbreitung erfahren hatte, genügte ihm als Vorlage.
Ashton bestellte einen Milchkaffee und zog das zerfledderte Exemplar seines Buchs aus der Tasche. Heute wollte er die aussichtsreichsten Versuche vorstellen, eine Weltformel zu entwickeln. Er und seine Kollegen, die schon seit der Mitte des letzten Jahrhunderts in diese Richtung gearbeitet hatten, scheuten sich nicht, mit diesem Begriff umzugehen. Selbst wenn er inzwischen in leere Gesichter blickte, verwendete er ihn aus konservativem Trotz gerne.