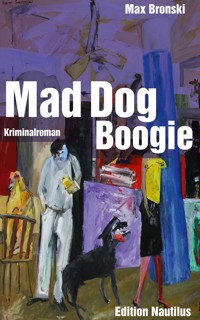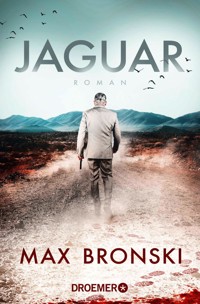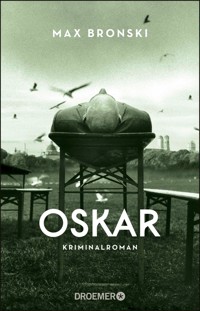12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Der neue Kult-Krimi von Max Bronski – Fall Nr. 6 um Trödelhändler Gossec aus dem Münchner Schlachthofviertel "Eine Story wie ein total abgedrehtes Krippenspiel, Auferstehung inklusive. Bronski at his best!" Friedrich Ani Wieder einmal gerät Wilhelm Gossec auf Abwege, diesmal auf biblische: Statt seine Waren auf dem Münchner Christkindlmarkt feilbieten zu können, muss er in einer kalten Dezembernacht in seinem Trödelladen einer jungen unbekannten Frau namens Mariella helfen, ihr Kind zur Welt zu bringen. Das Neugeborene wird Joshua genannt, wie es scheint, stellt der Himmel selbst Gossec eine Aufgabe. Doch damit nicht genug. Kurz darauf werden in der nahe gelegenen Maiklinik Neugeborene getötet, und jemand hat es offenbar auch auf Mariellas Baby abgesehen. Gossec beginnt, Nachforschungen anzustellen. Kuriose Begegnungen, himmlische Helfer, göttliche Eingebungen und der eine oder andere Wink des Schicksals treiben seine Ermittlungen voran. Und dann verschwinden Mariella und ihr Kind spurlos. Der notorische Zweifler Gossec fühlt sich einmal mehr im Stich gelassen. Wo bleibt denn nun die himmlische Gerechtigkeit? Der neue Krimi um Trödelhändler Gossec verbindet sprachliche Raffinesse mit einer rasanten, eigenwilligen Handlung, die voller Ironie und psychologischer Tiefe Münchner Lokalkolorit verbreitet wie keine andere. Gossec ist Kult!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 195
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Max Bronski
Schneekönig
Kriminalroman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Der neue Kult-Krimi von Max Bronski – Fall Nr. 6 um den Trödelhändler Gossec aus dem Münchner Schlachthofviertel
Weil man einen Zweifler wie ihn im Himmel partout nicht haben will, kehrt Wilhelm Gossec nach einer seltsamen Nahtoderfahrung eben doch heim zu seinem Trödelladen. Und findet im dichten weihnachtlichen Schneegestöber Mariella und Joschka, sie hochschwanger, er aber nicht der Vater. Das kommt dem hadernden Katholiken Gossec vage bekannt vor, und natürlich bietet er seine Hilfe an. Prompt werden kurz darauf in einer nahe gelegenen Klinik Neugeborene ermordet, die am selben Tag zur Welt kamen wie Mariellas Baby. Also nimmt Gossec sich des Falls an, um die himmlische Gerechtigkeit wiederherzustellen.
»Herrliche Zerstreuung, Unterhaltungsliteratur mit Tiefgang.« Deutschlandradio Kultur
Inhaltsübersicht
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
Nachwort
Münchner-Kindl:
Lasst euch vom Kasperl nur nicht irremachen; Ich brauch’ ihn wohl bisweilen, sollt ihr lachen; Doch alles in der Welt hat seine Zeit, Das alte Sprichwort sagt: Auf Leid kommt Freud’. Er ist ein guter Narr, doch etwas ungeschlacht; Nehmt’s ihm nicht übel, wenn er Späße macht, Die etwas derb sind – er meint’s gut Und ist ein Bürschlein von gesundem Blut. Und nun beginn’ das Spiel, mög’s euch gefallen, Damit Ihr oft erscheint in diesen Hallen!
Franz Graf von Pocci, Prolog zur Eröffnung des Marionetten-Theaters
Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich von keinem Manne weiß?
Lukas 1,34
1
Schwer zu sagen, was den Ausschlag gegeben hatte. Mit biologischen oder veganen Waren konnte ich nicht punkten, ein Stammbeschicker mit über fünfjähriger Zulassung war ich auch nicht. Und doch hatte ich es schon mit meiner ersten Bewerbung auf den Christkindlmarkt geschafft. Altbairische Weihnachtsantiquitäten, das klang gut und überzeugte, wenn man nicht jedes Wort auf die Goldwaage legte. Besser als mit dem Christkindlmarkt konnte ein Tandler in München nur dann abschneiden, wenn er eine Oktoberfestzulassung ergatterte, aber Trödel, wie ich ihn führe, trägt der Besucher bereits am Leib, er kauft ihn nicht mehr draußen auf der Wiesn. Meine Bude stand direkt am Marienplatz in letzter Reihe vor dem Donisl. Dass hinter einem geheizt wurde, machte sich normalerweise angenehm bemerkbar. Heute allerdings half auch das nichts mehr.
Sobald es dunkel wurde, kam mein Geschäft zum Erliegen. Leute hatte ich nur deshalb noch vor meiner Theke stehen, weil nebenan eine Bratwurst- und Glühweinstation aufgebaut war, aber die würdigten meine Ware keines Blicks, wandten mir den Rücken zu und hielten sich an ihren Porzellanhaferln fest. Abends lassen sich Touristen, Lauf- und Stammkundschaft nur noch mit süßlichen Alkoholdüften und rustikalen Grillaromen einfangen. Deshalb stellte ich dreimal die Woche meinen Stand der Münchner Obdachlosenhilfe e. V. zur Verfügung, die eine lebende Krippe veranstalten und dabei Spenden einsammeln durfte. Wahrscheinlich hatte mich diese schöne Idee in der Rangliste der Bewerber weit nach oben katapultiert.
Gegen siebzehn Uhr kam Vierthaler mit seinen Kumpanen, die in ihren langen speckig-abgetragenen Mänteln auch ohne Schlapphüte wie ein Trupp von Hirten aussahen. Die nötige Ausstattung karrten sie auf zwei Leiterwagen heran und begannen sofort, meinen Stand umzudekorieren. Strohballen, eine Futterkrippe, in die eine große nackige Puppe als Christkindl gelegt wurde, und vor allem eine Art Feuerstelle, um die herum die Hirten lagerten, eine Installation, die natürlich Vierthaler ersonnen hatte. Unten ein Grill mit Holzkohle, darüber an drei Stangen hängend ein Kessel, in dem sich warme Getränke für das Krippenpersonal bereiten ließen. Um den prosaischen Zweck zu kaschieren, warf Vierthaler von Zeit zu Zeit ein wenig Weihrauch in die Glut und verbreitete so rundherum sakrale Atmosphäre. Drei Hirten lagerten um die Feuerstelle, drei weitere schwärmten mit ihren Blechbüchsen als Spendensammler aus. Jede halbe Stunde vollzogen die beiden Gruppen einen Schichtwechsel, sodass sich jeder einmal wärmen und stärken durfte. Traditionell am Heiligabend ging der Christkindlmarkt und damit auch das Krippenspiel zu Ende, glücklicherweise, denn drei Weise aus dem Morgenland hätte man aus dem derangierten Trupp nicht rekrutieren können.
Eine halbe Stunde später stieg auch Roswitha, eine achtzehnjährige Rotkreuz-Schwesternschülerin, aus dem S-Bahn-Untergrund herauf und vervollständigte zusammen mit Hannes, dem Stationspfleger, die Familienaufstellung. Roswitha war als Maria eine Idealbesetzung, ihr blondes Haar hatte sie zu Stopselzieherlöckchen aufgedreht, der Umhang, den sie sich umlegte, war strahlend himmelblau. Wer sie sah, verlor sämtliche Zweifel an der unbefleckten Empfängnis Mariä und jungfräulichen Geburt Jesu. Hannes schlüpfte in einen Fellmantel und stützte sich auf einen Hirtenstab. Groß, wie er war, bildete er als Joseph eine ideale Kontrastfigur zur kindlichen Maria.
Der eigentliche Star unserer Truppe war jedoch der zwölfjährige Georg Reisinger, ein Ministrant, den wir uns von der Pfarrei St. Peter, der Kirche gegenüber, ausgeliehen hatten. Der Schorschi wurde von seiner Mutter pünktlich um neunzehn Uhr vorbeigebracht und war gekleidet, wie man sich international einen bayerischen Hütebuben vorstellte. Er trug Lederbundhosen, grob gestrickte Wollstrümpfe und Haferlschuhe. Auf dem Kopf saß ein spitz zulaufender Filzhut mit roter Kordel. Gegen die Kälte schützte er sich mit einem Lodenumhang, den der Bayer Kotze und der Österreicher gnädigerweise Wetterfleck nennt.
Schorschi rezitierte die Weihnachtsgeschichte, denn in Zeiten wie den unseren durfte man nicht mehr voraussetzen, dass sie allgemein bekannt war. Durch seinen herzigen bayerischen Vortrag mied man theologische Fallstricke und historische Glaubwürdigkeitsprobleme gleichermaßen elegant. Vierthaler schwenkte eine Glocke und holte das Publikum heran. Schorschi stellte sich vor der Bude auf. Er hob wie ein kleiner Hirte, dem gerade draußen auf der Weide die Engel erschienen waren, zu erzählen an. Der Kaiser Augustus habe eine Volkszählung angeordnet, und Joseph müsse sich nun mit seiner schwangeren Verlobten Maria nach Bethlehem aufmachen. Schon hier wurde klar, dass man ihnen mit einem solchen Zensus eine Gemeinheit zugefügt hatte, zumal einer schwangeren Frau, deren einzige Erleichterung auf dieser beschwerlichen Reise ein Eselchen darstellte. Unentschieden blieb, ob nun die Frau oder das Eselchen mehr zu bedauern waren. Und niemand fragte, wie es denn dazu kommen konnte, dass Maria, wiewohl nur verlobt, bereits schwanger war, und noch weniger, wie es zuging, dass nicht Joseph, sondern der Heilige Geist der Verursacher gewesen war.
Zu diesem Zeitpunkt der Erzählung überwog im Publikum der Frauenanteil bereits deutlich. Nicht wenige knüllten Taschentücher in ihren Händen, denn wie grausam das heilige Paar in den bethlehemitischen Herbergen abgewiesen wurde, ließ kein Auge trocken.
»Überall sind wir verstoßen, jedes Tor ist uns verschlossen!«
Das Drama strebte unumkehrbar seinem Höhepunkt zu. Es kam, wie es kommen musste, und so wurde das Kind ausgerechnet in einem Stall zwischen Ochs und Esel geboren.
»Maria wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe«, deklamierte Schorschi.
Auf dieses Stichwort hin drehte Vierthaler das Licht, das unsere nackige Puppe anleuchtete, ein wenig heller. Was dann folgte, war gute bayerische Folklore: dass die Geburt des Erlösers von Engeln nicht in den Villen und Palästen bekannt gemacht, sondern dem einfachen Volk in Gestalt der auf dem Feld lagernden Hirten verkündet wurde.
»Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk zuteilwerden soll; denn heute ist euch der Heiland geboren.«
Daraufhin hoben Vierthalers Mannen frohlockend die Hände, knieten nieder und begannen anzubeten. Der Chor der Engel mit ihrem Gloria in excelsis Deo war dann nur noch erzählerisch und nicht mehr darstellerisch zu bewältigen. Schorschi schloss seinen Vortrag mit dem Ausblick auf die Heiligen Drei Könige, jene drei Weisen, die sich im fernen Morgenland bereits auf den Weg gemacht hatten und bald eintreffen würden, um dem Kind ihre Geschenke darzubringen. Danach kämmten die Spendensammler nochmals das Publikum ab, und unsere schöne Veranstaltung näherte sich dem Ende.
An diesem Abend jedoch hatte keiner von uns Freude am guten Werk, denn wir wurden mit der Russenpeitsche traktiert, einem schneidend kalten Wind, der durch die Theatinerstraße und ihre Verlängerung, die Weinstraße, blies. Nach Westen und Osten lag mein Stand gut geschützt, vom Süden kam ohnehin nur Lindes, aber die Flanke nach Norden war empfindlich offen. Wenn man sich von meiner Bude aus eine Gerade als Verlängerung Richtung Norden denkt, landet man über die Wein-, Theatiner-, Ludwig-, Leopoldstraße und die A9 geradewegs in Berlin. Entlang dieser Achse trieb es den sibirischen Frosthauch direkt zu uns in die Münchner Innenstadt hinein; wir froren elend, und unsere Gesichter färbten sich ungesund blau.
Vierthaler schuf Linderung. Er war der Ansicht, dass es dem sozial engagierten Trupp in Ausübung seiner Mission durchaus gestattet sein musste, Spesen zu machen. So verschwand er mit dem rustikalen Korb, den die Hirten, Geschenke symbolisierend, zu Füßen der Heiligen Familie platziert hatten, im nahe gelegenen Kaufhof und kam mit Wurstsemmeln und Hochprozentigem wieder. Später, als er mir einen Becher, frisch vom Kessel gezapft, reichte, merkte ich, dass aus Tee mit Rum Rum mit Tee geworden war. Ich bin beim Bier kein Kind von Traurigkeit, aber bei diesem Höllenpunsch zog es sogar mir die Füße weg. Später, als alles vorbei war, bauten wir ab, und Vierthaler drängte mir noch einen weiteren Becher dieses Gebräus mit dem Hinweis auf, dass es doch schade wäre, den guten Stoff wegzukippen.
Als ich mich dann auf den Weg nach Hause machte, stellte ich zum ersten Mal in meinem Leben fest, dass es vom Marienplatz Richtung Rindermarkt leicht bergauf geht, dahinter dann geradezu abschüssig zum Jakobsplatz hinunter, wo ich mich schließlich stolpernd den Unteren Anger entlangbewegte, an dessen Ende ich den Versuch unternahm, die vom Verkehr stark frequentierte Blumenstraße zu überqueren.
Abgelenkt vom Marionettentheater und in Kindheitserinnerungen an eine Aufführung vertieft, in der ein Riese drohte, die ganze Welt zu Klump zu hauen, es sei denn, man würde ihm endlich köstlichen kandierten Kürbis bereiten – eine Obsession, die mich bis ins Erwachsenenalter begleitete, weil mir niemand kandierten Kürbis bereiten konnte –, geistesabwesend also, sah ich Grün, wo vermutlich keines war, betrat die Fahrbahn, hörte ein durchdringendes Hupen, das mir wie ein Blitz in die Magengrube fuhr, und sah den rasch größer werdenden, silbrig polierten Kühlergrill eines Lastwagens auf mich zukommen. Dann tat es einen Schlag, ich flog in die Luft, und in mir zerriss etwas.
2
Ich war nicht mehr Gossec. Wir waren zwei. Dieser zerschundene, verkrümmte Leib da unten im Bett, in den unablässig arbeitende Apparate mit keuchendem Zischen ein Leben hineinpumpten, das ihm eigentlich nicht mehr zukam. Und ich hier oben, ein luftiger Geist, der wie angeleint über dem kümmerlichen Daseinsrest namens Wilhelm Gossec hing, weil sich niemand dazu verstehen wollte, die Geräte endlich abzuschalten, um mich himmelwärts streben zu lassen.
Doch dann schlug eine Glocke von irgendwoher vier, die nächtliche Stunde, zu der man sich peinigender Gedanken und körperlicher Attacken nicht mehr zu erwehren weiß, die Hüter des Lebens gaben mich endlich frei, und ich schlüpfte mühelos in ein milchig nebliges Milieu hinüber wie unter eine weiche Decke, wattig, aber ungreifbar wie eine Wolke. Wer auch immer ich jetzt war, ich verspürte keine Last und keinen Schmerz mehr, ich hatte alles abgestreift. Ich schwebte, war federleicht; ein sanft sich kräuselnder Luftzug hob mich empor und würde mich rasch aus dem Drama dieses Lebens entführen.
Von oben kam Musik, das musste der Himmel sein, dem ich mich näherte! Flirrende Engelschöre, pompöser Posaunenschall oder wogende Streicher? Nichts dergleichen, ich wurde mit einem Blues empfangen und verstand sofort, dass sich ein Leben wie meines keiner anderen Form als dieser fügte. Schmerz, Trauer, Enttäuschung, aber auch Streben, Hoffnung und Erfüllung – der Blues hat zum Auspinseln unseres Schicksals zwar nur eine Farbe zur Verfügung, die aber in allen Schattierungen von Nacht- bis Himmelblau. Wenn die Wolkenfetzen die Sicht freigaben, glaubte ich die Musiker wiederzuerkennen, alte schartige Kerle, denen ich irgendwo schon einmal begegnet war, auch wenn sie jetzt in ihren langen weißen Hemden aussahen, als kämen sie von der himmlischen Resterampe. Ein massiger Mensch saß breitbeinig am Schlagzeug und trommelte einen so lässigen, dabei wuchtigen Shuffle, dass es bis in die Unterwelt hinunterschepperte. Der glatzköpfige Slidegitarrist schaute schwermütig wie ein dunstverhangener Vollmond zu mir her und ließ seine Gitarre in metallischen Glissandi weinen und klagen, dass sich mein Herz zusammenzog. Der Rhythmusgitarrist, ein Rumpelstilzchen mit Tartarenkopf und in zu großen Stiefeln, hüpfte wie ein Hampelmann zwischen den beiden hin und her, der Bass wummerte und dröhnte, der Musiker selbst blieb hinter einer Wolke versteckt.
So ging es weiter himmelwärts, die Bilder wechselten, als passierte ich verschiedene Etagen, bis meine Reise plötzlich ins Stocken geriet, und ich wie ein Ballon unter der Decke hing. Ich kam nicht mehr vom Fleck, als stünde ich unentschieden zwischen Himmel und Hölle, festgehalten in einem Zwischenreich, weil der Geist die Erinnerung an den Körper und seine Existenz auf Erden nicht vollends abstreifen wollte. Etwas hielt mich. Ich sträubte mich, alles einfach loszulassen, denn nur jetzt, nur in diesem Moment des Übergangs, wo das Irdische noch nicht spurlos verblichen war, gab es die letzte Gelegenheit, eine Antwort auf die Frage zu erhalten, mit der ich mich zeitlebens herumgequält hatte.
Zweifellos trieb der Teufel, jene Spottgeburt aus Dreck und Feuer, in der Welt sein Spiel mit uns. Der Herr hatte ihn verstoßen und ihm das irdische Feld eröffnet. Aber wer hatte abgemacht, dass er sich so erfolgreich gegen die Guten behaupten durfte? Woher bezog dieser Kerl die unbändige Kraft, stets den Bösen, den Unverschämten, den Skrupellosen und Unbarmherzigen zum Sieg zu verhelfen? Warum schiss er nie auf den kleinen, sondern immer nur auf den größten Haufen? Warum blieb der Gutherzige der Depp?
Früher zu Zeiten des Alten Testaments wachte der Herr eifersüchtig, manchmal sogar kleinlich darüber, dass keiner vom Weg abwich, den er vorgezeichnet hatte. Auf Sodom und Gomorrha ließ er Schwefel und Feuer regnen, weil die beiden Städte nicht parierten. Das Böse wurde unnachsichtig ausgelöscht, wer zu viel wollte und raffte, bekam eins auf die Finger. Und den Guten gegenüber zeigte er sich alles andere als kleinlich. Dass sich Lots Töchter von ihrem Vater schwängern ließen, weil sonst kein Mann mehr übrig war, ging als Notinzest straflos durch. Und nun? Hatte er das Interesse an uns verloren und uns als unbelehrbar aufgegeben?
Dieser Gedankenwurm nagte in mir wie eh und je.
Wem, wenn nicht ihm, konnte ich dieses Problem vorlegen? Mir war sofort klar, dass ich ein gefährliches Spiel betrieb: Wer im Begriffe steht, vor den Herrn hinzutreten, sollte besser Antworten statt Fragen haben, schon gar nicht solche, die an der Wohlgefügtheit des Weltenbaus zweifeln und selbst einen Heiligen um seine himmlische Existenz brächten. Dazu war das Streben nach Seligkeit bei mir nicht voll ausgebildet, denn schon beim bloßen Gedanken an das irdische Jammertal verspürte ich eine heftige Sehnsucht nach da unten.
Nach da unten? Als Geist war ich so unvollkommen wie schon als Mensch. Seit wann denken ätherische Geschöpfe in plumpen Gleichnissen wie in denen von Himmel oben oder Hölle unten? Illuminierten Seelen, predigte Prälat Gstettner, werde das Ewige unverhüllt und bilderlos zuteil, und sie seien sich darin genug! Das mit dem bärtigen Gottvater und dem Heiligen Geist als Taube könnten wir, wenn es ernst werde, getrost vergessen.
Ich versuchte angestrengt, mich in diesem Sinne dem Himmlischen zu öffnen, verhedderte mich aber immer mehr im Gestrüpp erdgebundener Überlegungen. Schließlich gestand ich mir ein, dass ich noch nicht einmal im Tod aus meiner Haut schlüpfen konnte.
Herrgottsakrament, außerdem hatte ich doch recht, und wie! Gegen das Gschwerl, das sich bei uns in München herumtrieb, waren alttestamentarische Bösewichter nicht mehr als Waisenknaben! Bei solchen Argumenten würde sich nicht einmal er aus der Affäre ziehen können.
Ach du liebe Güte!
Dieser Seufzer stammte von Schwester Eremberta, die es schon damals im Kindergarten der Armen Schulschwestern kommen sah, dass sich bei mir ein schlimmes Ende andeutete. Mit einer Selbstdisziplin, die mir als kleinem Kerl den Schweiß auf die Stirn trieb, hatte ich zwei Fleißkärtchen erworben. Kaum war der Handel perfekt, kniff ich Erna in den Hintern und schmiss den dicken Karl in die Pfütze. Als mir Schwester Eremberta die Kärtchen wieder abnahm, seufzte sie, so einer wie ich werde mit seiner Ungebärdigkeit sogar den Himmel verwirken.
Tatsächlich, so war es! Ich wurde abgewiesen und hatte wieder einmal das sicher Geglaubte verscherzt! Bleischwer zog es mich nach unten, ich glitt in die Tiefe hinab.
3
Tiefer hinunter geht es nicht. In der Poccistraße in München jedenfalls nicht. Ich war im Schacht der U3 und U6 Richtung Implerstraße angekommen. Dort etwa zwanzig Meter hinter dem Bahnsteig in der schwarzen Röhre befand sich der Auslass, durch den man mich Arme Seele der Welt wieder zurückgab. Das zeugte von überlegenem Sinn und Verstand, denn mein Weg von dieser Haltestelle nach Hause beträgt gerade einmal fünf Minuten. Ich lugte über die Kante des Bahnsteigs. Auf dem drahtgeflochtenen Vierersitz hatte es sich ein Penner mit Decke bequem gemacht. Mit einem Schnalzlaut zog er die Bierflasche aus dem Mund und riss die Augen auf. Mehr an Erstaunen wollte er offenbar nicht preisgeben.
»Grüß Gott!«
So kannte ich mein München.
»Gern, wenn ich es je wieder nach oben schaffen sollte.«
Er legte die Decke beiseite, erhob sich ein wenig unsicher, stand dann aber doch wie eine Eins. Er streckte mir beide Hände entgegen, ich fasste sie und kletterte so aus dem U-Bahn-Schacht heraus. Ich klopfte mir den rußigen Dreck aus den Kleidern und musterte ihn.
»Was schaust du denn so?«
Herausfordernd erwiderte er meinen Blick und nahm einen Schluck aus seiner Flasche.
»Musst mir nichts erzählen, eine solche Predigt höre ich mir einmal wöchentlich drüben bei der Heilsarmee gegen ein warmes Essen an! Im Großen und Ganzen …«
Seine großzügige Rundumbewegung, die er mit der flaschenlosen Hand umschrieb, umfasste alle hier unten verfügbaren Endstationen von Fürstenried-West bis Garching.
»… ist der Mensch an seinem Unglück selbst schuld. Dieses Jammertal haben wir uns selbst zuzuschreiben. Aber im Kleinen geht trotzdem ein bissel was.«
Ich überlegte, ob das eine Antwort auf mein Problem sein sollte oder nur Gefasel. Er leckte sich die Lippen.
»Hättest vielleicht ein paar Euro für mich?«
Ich griff in meine Tasche. Dort steckte ein Zehner. Er schob ihn ein und tippte an seinen Hutrand.
»Ich bin übrigens der Michi, falls du mich mal brauchst …«
4
Als ich die Treppe zur Ruppertstraße hochstieg, verstand ich, warum sich Michi nach unten verkrochen hatte. Ein eisiger Wind pfiff und wirbelte Schneeflocken vor sich her. Ich klappte den Kragen meiner Jacke hoch und zog sie enger um den Leib. Aus Walter’s Schänke schwallten zuckrige Weihnachtsschnulzen, als säße Johnny van Dyck persönlich an der Hammond-Orgel. Drinnen steckten zwei ältere Frauen ihre Säufernasen in Glühweinpötte. Eine blickte auf und winkte heftig. Ich erkannte Frau Loibl. Mir war in meiner momentanen Verfassung Gesellschaft jeder Art unangenehm, aber gegen die von Frau Loibl hatte ich eine solche Aversion, dass mein Gewissen einen U-Turn machte und auf der Gegenspur an mir vorbeipreschte. Mit anderen Worten: Ich betrat die Schänke, weil mir das am meisten zuwider war.
Frau Loibl war eine prekäre Existenz, sie lebte, von anderen als Kellerassel bespöttelt, bei uns im Souterrain. Das bisschen Geld, das sie hatte, verdiente sie sich schwarz als Putzfrau. In ihrer Gegenwart fühlte ich mich stets mies und war von einem brutal schlechten Gewissen geplagt, weil sie mich so abstieß und ich sie auf Teufel komm raus nicht leiden konnte. Deshalb waren Begegnungen mit ihr eine harte Prüfung.
»Die Vroni hätte ein Hauszelt!«
Diese Gesprächseröffnung war überraschend originell, wer dachte mitten im Winter an Camping? Die Vroni genannte Kumpanin nickte mit bedeutungsvollem Besitzerstolz.
»Aha!«
Frau Loibl klopfte auffordernd auf den Stuhl neben sich. Halbherzig, mit nur einer Arschbacke setzte ich mich.
»Ja haben Sie es denn noch nicht gehört? Von unserem Haus?«
Ich schüttelte den Kopf. Frau Loibl und Vroni agierten jetzt als eingespieltes Duo. Die eine redete, die andere übersetzte alles in die übertrieben grimassierende Gebärdensprache von Betrunkenen.
»Da ist einiges im Busch. Einiges!«
»Was denn?«
Sie beugte sich ganz weit vor. Ihr Atem roch, als habe jemand den Deckel des Glühweintopfs gelüftet.
»Sanierung.«
Am Nebentisch wandte sich ein älterer Mann in einem graublauen Anorak, der früher einmal strahlend blau gewesen musste, zu uns um und nickte. Das war Herr Sinzinger, der irgendwie irgendwo bei Frau Loibl einquartiert war, auch wenn niemand verstand, wie das zugehen konnte. Sinzinger hielt in der Öffentlichkeit Distanz zu seiner Quartiergeberin und tat so, als sei er der steinerne Gast. Er redete nur in Notfällen, bei Bestellungen zum Beispiel, wenn sein Herrengedeck zur Neige ging, das bei ihm aus einem rüden Rotwein, dem Bärenheber, wie ihn Wirt Walter ausschenkte, und einem Klaren bestand. Unter dem Tisch lag Rasso, ein einäugiger Schäferhund, mit dem sich Sinzinger osmotisch durch Handauflegen verständigen konnte.
»Da, wo unsere Wohnung ist, kommt ein Aufzug hin«, sagte Sinzinger und rieb sich die Nase, als wolle er eine Prise Schnupftabak einarbeiten.
Ich kannte unser Haus und wusste nicht, woher man solche Parolen hätte beziehen können, merkte aber, dass ich dieser Sache heute Abend nicht mehr auf den Grund gehen wollte. All diese undeutlich gelallten Einlassungen taten mir regelrecht körperlich weh. Ich fühlte mich zerrissen, mir war, als sei draußen unter der Laterne mein Schatten stehen geblieben und warte darauf, dass wir endlich weitergingen.
»Langwied«, sagte Frau Loibl. »Der Campingplatz ist ganzjährig offen. Da hast du den See in der Nähe, Toiletten, Duschen, Waschmaschine – alles da!«
Vroni grimassierte immer noch.
»Und jeden Morgen frische Semmeln im Camping-Shop«, ergänzte Herr Sinzinger.
»Perfekt! Ich muss jetzt aber leider …«
Es ging einfach nicht mehr, ich stand auf.
»Ich komme gelegentlich unten bei Ihnen vorbei. Das besprechen wir ein andermal!«
Rasch verließ ich die Schänke und lief außer Sichtweite. Ich konnte das einfach nicht ertragen. Man kommt aus dem Jenseits und stolpert in die Gesellschaft dieser Säufernasen. Der Plan für heute Abend musste ein anderer sein!
5
Mit klopfendem Herzen bog ich in die Fleischerstraße ein. Was für derbe Scherze hatten sich die da oben ausgedacht? Gab es Gossecs Antiquitäten überhaupt noch? Doch dann sah ich ihn schon: Der frische Schnee vor meinem Laden spiegelte das warme, gelbe Licht aus dem Schaufenster. Auch meine beiden Buchsbäume samt Lichterketten hatte jemand auf dem Gehsteig aufgebaut.
Die Straße war leer. Vom Südbahnhof wehte das Rattern von Güterwaggons herauf. Dann war nur noch das Knirschen des Schnees zu hören, in dem ich mit meinen kräftigen Sohlen Waffelmuster hinterließ. Ruhe steht dem Winter gut an, der Schmutz und die Schrunden der Stadt verschwinden unter einer weißen Decke.