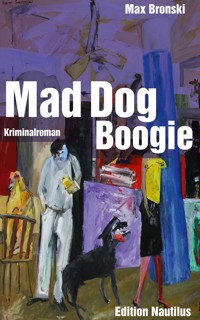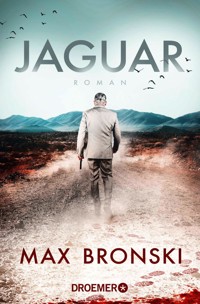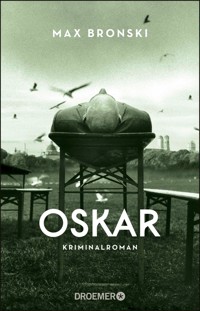Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Nautilus
- Kategorie: Krimi
- Serie: Wilhelm Gossec Bd. 4
- Sprache: Deutsch
»Hitler in München! Die Schlagzeile war echt. Fasching, womöglich ein Scherz, auf jeden Fall aber eine geschmacklose Provokation. Das Bild dazu ein grobkörniger Schnappschuss. Da stand ein Troll im Wehrmachtsmantel, Stiefeln, mit einer Offiziersmütze auf dem Kopf. Der Wiedergänger hatte dem Schlachthofviertel einen Besuch abgestattet.« Gossec, der grantige Trödler mit dem untrüglichen Gefühl für Gerechtigkeit, will nach einer durch etliche Biere beflügelten Diskussion seinem Freund Julius beweisen, dass der Münchner heute genauso anfällig ist für den »Führer« wie einst. Er greift in seinen Klamottenfundus, verkleidet sich und zieht los. Eine Schnapsidee, leider mit höchst problematischen Folgen. Er trifft auf eine Mahnwache von Neonazis und rettet sich nur mit Mühe. Am Tag danach muss er in der Zeitung lesen, dass seine Aktion einem bekannten Kabarettisten in die Schuhe geschoben wird und die Neonazis Vergeltung geschworen haben. Gossec fühlt sich miserabel. Er trifft den Kabarettisten, will die Sache aufklären. Der aber ist eher amüsiert und hat nichts dagegen, mit dieser Aktion identifiziert zu werden. Ein paar Tage später ruft er Gossec an, anscheinend wird er doch bedroht. Kurz darauf ist er tot. Und Gossec findet sich bewusstlos in dessen Wohnung wieder. Max Bronski erzählt in »Nackige Engel« von einem Mord, der keiner gewesen ist, von einer Geheimloge, die sich als harmloses Networking bayerischer Couleur entpuppt, und von alten Freunden, von denen einer bereit ist, über Leichen zu gehen. Auch in diesem Kriminalroman leuchtet München. Für Gossec allerdings wird es dunkel.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 210
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Max Bronski
Nackige Engel
Roman
Edition Nautilus
So urteilt die Kritik über „Nackige Engel“
In seinem neuesten Krimi um seine skurrile Hauptfigur konstruiert der Münchner Autor einen ungewöhnlichen Kriminalfall, in den er aktuelle wirtschaftliche und politische Geschehnisse raffiniert mit einbindet und den er mit privaten Lebensgeschichten locker umrahmt (…) schnörkellos, mit scharfer Zunge und viel Witz. Ein ironischer, derber Krimi… (Günter Freund, Bayern im Buch Nr. 2 von 2010)
Die Romane sind eine gelungene Mischung aus Krimi und Sozialsatire mit Elementen eines Roadmovies. (Buchkultur vom Sommer 2010)
Max Bronski schreibt flotte Krimis mit viel Lokalkolorit, und wer den schnoddrigen Gossec einmal erlebt hat, vergisst ihn nicht mehr. (Lorenz Braun, buchmedia magazin vom Frühjahr / Sommer 2010)
Eine nette, geschickte Konstruktion für einen Krimi ‐ freut sich unser Rezensent und hofft, dass diese Kolumne dazu beiträgt, dass Max Bronski so berühmt wird, dass sein Pseudonym endlich enttarnt wird. (Andreas Ammer, Deutschlandfunk Büchermarkt vom 9. April 2010)
„Nackige Engel“ in einem Wort: herrliche Zerstreuung, Unterhaltungsliteratur mit Tiefgang. Der Roman öffnet Blicke in die deutsche Gesellschaft, in die heutige Neo‐Nazi‐Szene, hinter die Kulissen des deutschen Geheimdienstes und in die Zeit der politischen Aktivitäten von Franz Josef Strauß und hinter die Kulissen des deutschen Geheimdienstes. Weltliteratur aber darf man nun nicht erwarten, ‐ das eine oder andere „Stützbier“ fördert schon die Lektüre. (Lutz Bunk, Deutschlandradio Kultur vom 4. März 2010)
Die Frage, ob es sich bei Max Bronskis Roman Nackige Engel um einen Kriminalroman oder eine Gesellschaftssatire handelt, stellt sich der Leser erst gar nicht. Mit witziger Ironie und einem Augenzwinkern schildert der Autor die Neonazi‐Szene und öffnet Einblicke in die Münchner Gesellschaft rund um das Schlachthof‐Viertel. Der flüssig und amüsant geschriebene Kriminalroman, um den Antihelden Wilhelm Gossec, unterhält den Leser bestens und entwickelt sich zu einem tiefsinnigen Gesellschaftsroman. Am Ende ist es dem Leser schon fast egal, wer eigentlich der Täter war. (Michael Petrikowski, Gedankenspinner vom 14. März 2010)
Wann, liebe BR’ler, schenkt ihr uns endlich die Gossec-Serie in Radio und TV? (Hermann Barth, in vom 11. März 2010)
… München, das samt Weißwurst, Biergarten, Föhn, urigem Dialekt und rechter Szene plastisch Gestalt annimmt. (Uschi Loigge, Kleine Zeitung vom 10. April 2010)
Die Geschichte überzeugt (…) vorrangig durch Wortwitz und wunderbar kreative Sprache… (kulturnews vom Mai 2010)
„Nackige Engel“ ist ein schräger Krimi, der tief in die bayerische – oder besser Münchner – Psyche eintaucht. (Münchner Merkur vom 27./28 März 2010)
Temporeich und mit bissigem Witz schlägt sich Gossec durch München, dem er in tiefer Hass‐Liebe verbunden ist. Aber womöglich ist es das letzte Mal, dass man mit dem unerschrockenen Trödler die schmuddeligen Ecken der „Weltstadt mit Herz“ erkundet. Denn am Ende wird es dunkel für Gossec, sehr dunkel. (NDR Kultur vom 24. März 2010)
Dafür würzen feine Ironie und auch etwas Melancholie eine atmosphärisch dichte, zugleich aber in lakonisch-knappem Stil erzählte Geschichte. Best Unterhaltung also auf hohem Niveau – das muss man erst mal können. (Ulrich Kroeger, Sonntagsjournal vom 6. Juni 2010)
Max Bronskis Krimi ist mit leichter Hand geschrieben (…) Vor allem aber überzeugt er durch seinen lockeren Plauderton, der immer wieder zu derb-komischen Arabesken führt, in denen Gossec seinem grimmigen-bayerischen Sarkasmus freien Lauf lässt. (Jochen Rack, SWR 2 Buchkritik vom 2. Juli 2010)
Das ist kein g’miatlicher Krimi im Münchner Bierhimmel, das ist eine beinharte Geschichte auf der Schattenseite der Weißwurstmetropole, eine ganz starke! (Tiroler Tageszeitung vom 2. August 2010)
Münchens stärkste Krimis liefert Max Bronski… (Weilheimer Tagblatt vom 25. März 2010)
Und weil er seinen Helden und Erzähler mit einer wunderbar lakonischen Sprache ausgestattet hat, die ebenso gut für selbstironische wie für leicht sentimentale Passagen funktioniert, ist auch Gossecs vierter Fall ein Lesevergnügen. Auch dass er Längen vermeidet, spricht unbedingt für den Autor. Gossecs Verwicklung in den Fall und dessen anschließende Aufklärung (…) werden auf ungefähr 200 Seiten abgehandelt. Bei solch lobenswerter Selbstbeschränkung muss alles stimmen, und das tut es hier auch. Am Ende dieses bemerkenswerten Beispiels deutscher Krimikunstfertigkeit gibt Gossec den Münchener im Himmel. Hoffen wir, dass er nur träumt. (Joachim Feldmann, kulturmagazin vom 24. April 2010)
Herr Bronski, wer immer Sie sein mögen, gerne mehr davon! (Christoph Mahnel, literaturmarkt.info vom 1. März 2010)
Ach, München leuchtet ja doch! (Michael Berwanger, in vom März 2010)
Heil myself! TOM DUGAN
A bunch of lonesome and very quarrelsome heroes were smoking out along the open road; the night was very dark and thick between them, each man beneath his ordinary load. LEONARD COHEN
That’s right, it’s come to this, yes it’s come to this, and wasn’t it a long way down, wasn’t it a strange way down? LEONARD COHEN
1
Hitler in München!
Unglaublich! Mit der Wiederkehr einer solchen Botschaft hatten nicht einmal die Braunen gerechnet. Vermutlich saßen die jetzt da und rubbelten an den Lettern herum in der Angst, dass sich die gute Nachricht bald von selbst wieder in Luft auflösen würde. Ein Spuk? Aber die Schlagzeile war echt und vor allem tagesaktuell. Durfte man eine solche Überschrift überhaupt unter die Leute bringen?
„Seite sechsundfünfzig, Münchner Teil.“
Grußlos hatte Julius meinen Laden betreten und mir die Zeitung auf den Tisch geworfen. Seine bloße Anwesenheit bereitete mir heute Morgen körperliche Pein. Julius’ Blick war brackig, und die verquollene Visage wies enge Verwandtschaft mit dem Profil eines Donauwallers auf. So wie er mich musterte, sah ich noch schlimmer aus.
Heute früh hatte ich mit einem unbeholfenen Schlag Wecker und Wasserglas vom Nachttisch gefegt und war, vom selbst verursachten Lärm unsanft geweckt, erschrocken hochgefahren. Minutenlang verharrte ich auf der Bettkante. Meine bleiche Haut hatte in der Dunkelheit etwas Fluoreszierendes an sich. Ich versuchte, die nötige Kraft zu schöpfen, um den Nacktmull, dem ich mich innerlich wie äußerlich anverwandelt fühlte, niederringen zu können. Die Selbstbegegnung im Spiegel würde eine Schwächung herbeiführen und musste daher vermieden werden. Ich wusste, dass ich mich vor meinem Anblick ekeln würde.
Julius tippte auf die Zeitung. Ich lehnte mich zurück und drehte mir eine Zigarette. Er verzog angewidert das Gesicht. War mir jetzt auch egal. Mein Kaffee war kalt geworden, irgendwas frisches Warmes brauchte ich jetzt.
Den Artikel überflog ich nur kurz. Fasching, womöglich ein Scherz, auf jeden Fall aber geschmacklose Provokation – war ja alles richtig! Das Bild dazu war ein grobkörniger Schnappschuss. Da stand ein Troll in Wehrmachtsmantel, Stiefeln, mit einer Offiziersmütze auf dem Kopf. Im Widerschein des Blitzlichts erkannte man Silberpaspelierung und Totenkopf. Das Gesicht blieb unkenntlich, ein konturlos-grauer Brei, aber natürlich mit dem Bärtchen, das ausreichend Führeridentität stiftete. Im Hintergrund die Backsteinmauer von St. Anton. Ecke Thalkirchner-/Kapuzinerstraße ungefähr. Er legte grüßend die behandschuhte Rechte an den Schild seiner Mütze. Der Wiedergänger hatte dem Schlachthofviertel einen Besuch abgestattet.
Nun schob Julius die Boulevardversion herüber. Neonazis: Ehrenwache vor Scheißhaus! Das klang schon entschieden besser. Vier Kerle standen vor einer Reihe blau-brauner Dixikabinen, zwei mit Fackel, zwei mit Transparent: Deutsche Ehre, deutscher Soldat. Julius rang sich ein wulstiges Grinsen ab.
„Irre, oder?“
Aber das Irrste, was mir heute nicht mehr in den gequälten Schädel wollte, war, dass ich diese ganze Geschichte losgetreten hatte.
2
Nur unter Schwierigkeiten war ich in der Lage, den Ablauf der Ereignisse auf die Reihe zu bekommen, das Geschehene einem halbwegs vernünftigen Menschen erklären zu wollen, wäre von vornherein zum Scheitern verurteilt.
Mein leerer, aus den Tiefen der inneren Alkoholwüste kommender Blick wanderte durchs Schaufenster nach draußen. Das Wetter lieferte stimmungsmäßig die passende Grundierung. Mit Sonne im Herzen hätte man den föhnigen Wärmeeinbruch als unerwarteten Frühlingsboten begrüßt, aus meiner Perspektive war das nichts weiter als ein brutales Tauwetter. Von den Dächern rasselten Schneelawinen herunter und schlugen klatschend auf dem Pflaster auf. Vorsichtige Fußgänger wichen daher auf die Straße aus und hofften den durch den Dreck pflügenden Autos rechtzeitig entgehen zu können. Das ganze Schlachthofviertel ein brauner Matsch – genau das war der Ausdruck, den ich die ganze Zeit gesucht hatte.
Gestern Vormittag war ich noch bequem und im Vollbesitz geistiger Kräfte hinter der Ladentheke gesessen, hatte in alten Jahrgängen der Fischereizeitschrift geblättert und Kaffee getrunken. Seit letzter Woche war ich Mitglied der Isarfischer. Angeworben hatte mich Rübl, mein Hausbesitzer, dessen entspannte Altersdebilität sich zu einem wahren Jungbrunnen für ihn entwickelte. Zum Glück für uns Mieter konnte er sich allen Versuchen widersetzen, in ein Altersheim verfrachtet zu werden. Dass er nun ganztägig in seiner Hofwerkstatt an der Zündapp seiner Jugend fräste und feilte, war gut zu ertragen. Dieser vergreiste Halbstarke hatte mir den Aufnahmeantrag mit dem Hinweis überbracht, man könne im Verein auch Backfische angeln. Der Witz war zwar abgestanden, aus Respekt vor der Immobilie lachte ich trotzdem. Zusammen mit dem frischen Vereinsausweis lag eine Einladung für den Stammtisch der Fliegenfischer im Briefkasten, und ich hielt es für angezeigt, meine Kenntnisse ein wenig aufzufrischen.
Von Zeit zu Zeit linste ich nach hinten, wo ein Kunde meine Blechware in den aufgestellten Kisten durchwühlte. Ein schmales Bürschlein, Kapuze über den Kopf gezogen, Fieldjackett im Militärstil. Er kam mir bekannt vor, ich brachte ihn aber nicht mehr bündig in meinen Erinnerungen unter. In den Zeiten, als ich noch meine Pflegetochter betreute, tauchte des Öfteren ein Freund von ihr im Laden auf, der seinen kleinen Bruder überallhin mitschleppte. Irgendetwas in dieser Richtung musste es mit ihm gewesen sein oder auch nicht. Ich war inzwischen einer Altersklasse zugehörig, in der man Einzelwesen aus der Hammelherde junger Kerle nur dann noch zweifelsfrei identifizieren konnte, wenn sie einen Opa nannten. Jedenfalls war der unbekannt Gewordene jetzt groß genug, um sich mit großer Begeisterung durch meine Blechware zu arbeiten.
Was gab es da nur zu finden? Mea Culpa! So genau sah ich gar nicht hin, was ich aus Nachlässen herauszerrte an Abzeichen, Orden oder Ansteckern. Wenn der Kunde damit ankam und kaufen wollte, konnte man immer noch überlegen, was es ihm wohl wert war und ob man so etwas überhaupt verkaufen durfte. Ich guckte ihn über meine Zeitschrift hinweg an, er drehte sich um.
„Hast du auch Wehrmachtsplakate, Kamerad?“, fragte er frech.
Wahrscheinlich wollte er mich gesinnungsmäßig antesten.
Jetzt bemerkte ich, dass er doch anders als die meisten seiner Altersklasse aussah. Er trug ein Kapuzenshirt mit Frakturschrift, außerdem fielen mir seine Springerstiefel unter den hochgekrempelten Hosenbeinen ins Auge. Alles da, aber eben doch ein schmales Bürschlein mit Streuselkuchengesicht, einer, den das Leiden der Pubertät in die vollkommen falsche Ecke geschickt hatte. Meinethalben, aber jetzt ging es erst mal darum, Flagge zu zeigen.
„Verpiss dich. Ab mit dir! So einen wie dich will ich nie wieder in meinem Laden sehen.“
Ich packte ihn an der Brustfraktur und schob ihn aus meinem Laden hinaus.
„Das wirst du noch bereuen“, zischte er.
Er war noch bleicher als vorher geworden.
3
Schlagartig bekam ich ein schlechtes Gewissen. Wie viele Heldengedenktage und sonstige Gedächtnisaufmärsche hatte ich schon verstreichen lassen, ohne einen Finger zu rühren. Wie Kletten hefteten sich die Jungbraunen an unser Viertel, um ihre Kameradschaftstreffen, Julfeiern und anderen nordischen Märchenabende abzuhalten. Bis in unseren Stadtrat hatten sie sich vorgekämpft. Dass ich mich jetzt gegen die unerwünschte Kundschaft zur Wehr setzen musste, war nur die Spitze des Eisbergs.
Es rumorte in mir. Also rief ich Julius an und redete druckvoll auf ihn ein. Der wiegelte ab, weil er anderes im Sinn hatte. Die Website seines Premiumkunden war nachzubessern. Der Mühlen-Fredi hatte gestern Pfundweckerl statt Roggenschrot ausgeliefert, weil der Warenkorb bockte. Also programmierte Julius mit Feuer unterm Arsch. Aber als alter Freund verstand er sofort, dass mein Bedürfnis nach Aussprache eine gewisse Dringlichkeit erreicht hatte. Er versprach, nach Geschäftsschluss bei mir vorbeizuschauen.
Gegen sieben Uhr kam er dann mit einem Kasten Weißbier herüber, den er kommentarlos in der Küche abstellte. Wir entkorkten eins nach dem anderen und begannen von unserem häuslichen Feldherrnhügel aus die Weltlage zu erörtern. Inzwischen hatte ich viel Zeit gehabt, meine Entrüstung und Befürchtungen mit einem soliden Unterbau zeitgeschichtlicher Analogien zu sockeln. So vorbereitet, nagelte ich meine Argumente unter Mithilfe des Küchentischs vor Julius hin, der das Pech hatte, der erste Adressat zu sein. Dass er anfänglich nur nickte, brachte mich auf die Palme. Nachdem ich sonst nichts an seiner Haltung auszusetzen hatte, prangerte ich seine Bierruhe an. Schließlich wurden wir doch ziemlich laut. Irgendwann klopfte Rübl ans Küchenfenster und fragte, ob alles in Ordnung sei. Das war es mit uns beiden sicherlich, ich hätte nur wissen können, dass man auch mit seinem besten Freund niemals unter massivem Alkoholeinfluss politisieren sollte. Weil man sich im Prinzip versteht, schraubt man sich bei untergeordneten Themen, die noch kontrovers sind, immer weiter in auftrumpfende Rechthabereien hinein.
„München ist dabei wieder einmal besonders gefährdet. Warum eigentlich immer München?“, fragte ich.
Julius zuckte die Achseln und reichte mir ein Weißbier.
Um das verstehen zu können, durfte man sich München nicht als bloßen Ort denken, sondern als geistige Verfassung, in der sich das Träumerische fortwährend in das Reale hineinwebt. Man konnte in München die Akropolis nachbauen, der italienischen Renaissance eine Straßenschneise nach Norden schlagen oder Kanäle durch die Stadt brechen, weil man auf einem Boot von Nymphenburg nach Schleißheim schippern wollte. Mögen täte man noch viel mehr! Dieser Überdruck lässt München unter einem ständig geschwollenen Hirn leiden, das noch dazu in die provinziell enge Kalotte des bayerischen Umlands eingepfercht ist. Nicht dass jeder Wahnsinn diesem Schwollschädel entspränge, aber wenn er erst mal in der Welt ist, findet er bei uns das nötige Reizklima, um zu keimen und schließlich zur Blüte zu kommen. In München hatte der steile Schein immer schon glänzende Aussichten gehabt, auch der von weit her importierte, denn original musste hier noch nie etwas sein, nicht einmal das Hofbräuhaus. Nur das Bier im Krug macht einen echten Rausch.
Sicher hatten Julius und ich hier noch einmal je ein weiteres Weißbier entkorkt.
„Prost!“
Bei uns konnte Lenin zusehen, wie der Weltkampftag der Arbeiterklasse kollektiv im Biergarten absoff; hierzulande hockte Hitler als Onkel Dolf unterm Esstisch und ahmte für die Kinder die Geräuschkulisse einer kompletten Artillerie vom Schrapnell bis zum Mörser nach.
„Echt?“, fragte Julius.
„Sicher“, sagte ich. „Habe ich gelesen. Und wenn du je eine seiner Reden gehört hast, dann weißt du, was ich meine.“
Julius nickte beeindruckt. Vielleicht war das der Zeitpunkt, an dem ich mir an diesem Abend einzubilden begann, intellektuell auch die ganz großen Linien lässig im Blick behalten zu können.
Also warum München? Weil jeder Wahnsinn Widerstand braucht, etwas, woran er sich reiben kann, um sich weiter zu erhitzen. Unser gut katholisches Milieu sorgt für ausreichend Wohlanständigkeit, für Leute eben, die sich gern über alles aufregen, was aus der Art schlägt. Und nun kommt noch eine zweite Zutat ins Spiel: Dem bayerischen Menschenschlag ist eine seltsame Art des Duldens eingepflanzt. Die Tugend der clementia, aber mit begrenztem Haltbarkeitsdatum, nur so lange, bis das Maß voll ist. Man schaut sich auch den größten Schmarren eine Zeit lang an. Daraus ergibt sich eine Gemütsverfassung, die man als Erregungs- und Ruhezustand gleichermaßen bezeichnen kann: grantiges Abwarten. Wenn der Vorrat an Geduld verbraucht ist, schlägt man zu, dann aber ansatzlos und hart. Das mit dem viel geliebten Ludwig I. und der Tänzerin ließ man sich eine Weile lang gefallen. Schließlich hat man ihn zum Teufel gejagt. Unsere Revolution und die anschließende Räterepublik krochen nicht etwa aus den Tiefen des Mathäserkellers hervor, sie kamen so plötzlich und heftig in die Welt, als hätte man eine Bierflasche aufschnalzen lassen. Die Revolution musste her, und wenn schon, dann sofort. Das Neue kommt als Sturzgeburt. Der Protestant hingegen pflegt den zähen und vernünftigen Protest, nagelt erst mal Thesen ans Portal oder marschiert monatelang mit einer Kerze in der Hand um die Kirche. In Bayern wird der Kessel hochgeheizt, bis es den Deckel absprengt. Dann kracht es. Und da kann es schon mal passieren, dass dabei der brüllende Irrsinn entweicht.
„Und so weit“, sagte ich, „sind wir jetzt fast schon wieder.“
Julius verschränkte die Arme und lehnte sich ostentativ nach hinten. Es kränkte mich, dass er die Stirn runzelte und vom Glauben an meine Rede abfiel. Wie ich nun wieder auf Hitler kam, wusste ich nicht mehr, aber ich wollte auftrumpfen als einer, der in die Abgründe der menschlichen Seele blicken konnte.
„Würde Hitler heute durch München marschieren, würde der überwiegende Teil der Passanten wieder den rechten Arm hochrecken!“
Jetzt hatte sich Julius endgültig entschieden, auf der Seite der Gutmenschen zu bleiben. Er schüttelte den Kopf.
„Glaube ich nicht. So viel Lehre hat man aus der Vergangenheit gezogen.“
„Und wer, meinst du, macht dann aus diesen jungen Burschen Nazis?“
„Ein paar Unverbesserliche oder Verirrte gibt es immer. Hier geht es doch ums große Ganze.“
Ich schrie ihn an, schalt ihn naiv, aber er blieb bei seiner Auffassung. So wogte das noch ein paar Weißbier hin und her, bis ich zum endgültigen Schlag ausholte, um diesen sturen Ochsen zur Räson zu bringen. Ich nahm den Schlüssel vom Haken und ging in den Keller hinunter, wo sich in einem Abteil ein provisorisches Lager von mir befand. Mein Giftschrank. Dort lagen auch die Teile aus dem Kostümfundus eines Theaters, die ich nicht zum freien Verkauf anbieten wollte: darunter ein Wehrmachtsmantel, Stiefel und eine SS-Offiziersmütze. Flugs hatte ich mich umgekleidet. Mit einem Kajalstift markierte ich noch das Bärtchen. Julius stand hinter mir und beobachtete mich fassungslos.
„Spinnst du?“
„In zwanzig Minuten bin ich wieder da, und dann wissen wir, wer recht hat!“
Als ich das Haus verließ, saß Julius sprachlos in sich zusammengesunken in der Küche.
4
Trotz des frühen Abends war das Viertel menschenleer. Dem nasskalten Wetter wollte sich kaum jemand aussetzen. Die paar Passanten, die mir über den Weg liefen, taten so, als bemerkten sie nichts. Da war einer zum Maskenball unterwegs. München im Fasching! Oder ein ungläubiger Schrecken hatte sie fest am Wickel, nach dem nicht sein durfte, was sie sahen. Als ich in die Thalkirchner Straße einbog, schlotterte ich bereits unter dem weiten Mantel. Die Kälte kroch unter meine Totenkopfmütze, und mit ihr begannen sich dort Zweifel einzunisten. Natürlich war das, was ich da abzog, eine vollkommen hirnrissige Aktion. Einmal die Arbeitsagentur umrunden und dann sofort wieder zurück nach Hause, dachte ich.
Dieser Plan wurde durchkreuzt. Von der Lindwurmstraße her näherte sich ein Fahrzeug mit Blaulicht. Offenbar hatte ein braver Bürger die Polizei verständigt. Ein probates Mittel: Wenn man sich in Recht und Unrecht nicht mehr selbst einmischen mochte, konnte man seine Zivilcourage telefonisch lamentierend im nächsten Revier abgeben und die Funkstreife bestellen. Ich lief über die Straße zum alten Südfriedhof hin, in dessen verschwiegene Dunkelheit ich mich zu flüchten hoffte. Als ich den Weg zwischen altem und neuerem Teil entlanghastete, sah ich beim Eingang Feuerschein. Dort hielten sich nicht selten Penner auf, wahrscheinlich hatten sie sich ein Feuer angezündet, um ihre Knochen zu wärmen. Als ich näherkam und feststellte, wen ich vor mir hatte, erstarrte ich. Die Heftigkeit meiner Reaktion schien sich ebenso sehr in den Gesichtern der anderen zu spiegeln: Ich stand vor einem Trupp Neonazis, die neben dem Friedhofseingang eine Mahnwache mit Fackeln abhielten.
5
Was machten die denn da? Die dahinterstehende Geschichte ließ sich rasch rekonstruieren; ich hatte sie in Etappen mitverfolgt, aber eben nicht die nötigen Schlüsse daraus gezogen. Ursprünglich und lange unbeachtet war neben dem Friedhofstor eine Platte mit den eingemeißelten Namen toter Soldaten angebracht gewesen, die Anfang des letzten Jahrhunderts im damaligen Südwestafrika umgekommen waren. Den Toten des Kolonialkriegs – so hatte man das ehrende Gedenken überschrieben. Etwa hundert Jahre später hatten Kriegsgegner aus dem Viertel die Tafel mit no war! übersprüht. Die Friedhofsverwaltung ließ die Steinplatte abnehmen, reinigen und sie so hoch oben an die Mauer hängen, dass man sie nur mit riesigen Leitern hätte erreichen können. Bald darauf war die Inschrift mit zielsicher geworfenen Farbbeuteln unleserlich gemacht. Wieder entschloss sich die Friedhofsverwaltung, die Tafel abzunehmen, diesmal für immer. Das wiederum hatte die Neonazis auf den Plan gerufen, denn hier war ein Denkmal für den deutschen Soldaten geschändet worden.
Dass wegen der Tafel eine Auseinandersetzung zwischen Pazifisten und Rechten hin- und herging, hatte ich wohl mitbekommen. In der Zeitung war darüber berichtet worden, und neulich lag ein Flugblatt im Dreck, das ich mir mit dem Stiefel etwas hergerichtet hatte. Darin war von einer Mahnwache die Rede, wo und wann, darum hatte ich mich nicht weiter gekümmert. Solange man ihnen nicht direkt gegenüberstand, nahm man dergleichen als Nachrichten aus einer anderen Welt hin. Dabei zogen die Neonazis ja schon länger durch unser Viertel, trafen sich in Gasthäusern mit gut deutschem Namen und ebensolchem Bier und verprügelten hinterher Griechen, Türken oder Schwarze. Kurzzeitig war das ein Thema. Dann, ohne dass man einen Finger rühren musste, wurden solche Gasthäuser umbenannt, firmierten nun als Bistro, und das breite Bündnis der Mutant Heroes aus Döner, Pizza und Souvlaki, das sich zu solchen Anlässen wie von selbst aufstellte, hatte einen großen multikulturellen Sieg errungen. Alles ohne mich, denn auch mir war die Tugend des grantigen Abwartens reichlich zuteilgeworden.
Sie waren nur noch zu viert, zwei Fackel- und zwei Transparentträger. Es ging auf neun Uhr, und eine achtstündige Mahnwache zehrte auch die Ressourcen der Rechten aus. Die Kameraden der vorherigen Schichten hatten sich wohl schon um ihren Stammtisch versammelt. Die Schrecksekunde schien mir bereits auf Minuten angewachsen, aber dann zeigte die andere Seite endlich eine Reaktion: Vier Arme klappten zum Hitlergruß hoch.
Große Erleichterung durchrieselte mich, und daran merkte ich, welch große Angst ich ausgestanden hatte. Natürlich mochte auch von denen niemand ernsthaft glauben, dass sie einen leibhaftigen Hitler vor sich hatten, wohl aber, dass mit meiner Vermummung höheren Orts eine besonders effektvolle Aktion eingefädelt worden war. Leider hatte man vergessen, den Schützen Arsch zu instruieren. Sie standen stramm. Mit dem Rest Hirn, das ich noch hatte, reimte ich mir die verwegene Hoffnung zusammen, dass ich in meiner Maskerade unberührbar bleiben würde. Als wandelndes Symbol! Ein Neonazi verprügelt doch keinen, der ihm als Hitler verkleidet gegenübertritt, ebenso wenig wie der Pfarrer einem Jesusdarsteller gegenüber handgreiflich werden würde. Da wirkte doch eine ganz natürliche Beißhemmung.
Jetzt war ich am Zug.
Ich legte die Hand grüßend an meinen Mützenschirm und drehte ab. Das war ein kritischer Moment; wie würden die vier reagieren? Erst mal passierte nichts. Ohne Instruktionen von oben auf sich allein gestellt, war der Trupp ausschließlich auf seine Schwarmintelligenz angewiesen und daher zunächst gehandicapt. Man dachte nach. Eine Richtung musste sich erst noch herauskristallisieren, damit sich der Haufen formieren konnte.
Als ich das Knirschen von Springerstiefeln auf Kies hinter mir hörte, wurde mir klar, dass sich die komplette Mahnwache aufgemacht hatte, mir zu folgen. Wie eine Schleppe zog ich zwei Fackel- und zwei Transparentträger hinter mir her: Deutsche Ehre, deutscher Soldat!
Es wäre eine hemmungslose Übertreibung zu sagen, dass ich noch sicher auf den Beinen war. Zum ersten Mal an diesem Abend fühlte ich mich richtig volltrunken und hatte das beschissene Gefühl, hin und her zu schwanken. Sogar ein eingefleischter Altnazi, der seit Jahr und Tag mit seiner Standarte den Rudolf-Heß-Gedenkmarsch abmetert, hätte mit meinen sechs, sieben Weißbier im Leib erhebliche Probleme gehabt, sauber an der Spitze zu marschieren. Dazu das unangenehme Gefühl, dass mir vier misstrauische Augenpaare Brandlöcher in den Uniformrücken schmurgelten. Außerdem plagten mich ein fürchterlicher Angst- und Bierdruck auf der Blase und vor allem der eine Gedanke: Wie komme ich aus dieser irrwitzigen Nummer wieder heraus?
Wir überquerten die Thalkirchner Straße. Erste Pfiffe von Passanten ertönten. Blitzlicht flammte auf, jemand schien zu fotografieren. Wie ein ferngesteuerter Zombie hielt ich auf die große Baustelle an der Walterstraße zu. Mit Julius hatte ich vor einiger Zeit das dort abgestellte Gerümpel gefilzt, um festzustellen, ob etwas Brauchbares darunter war. Ich wusste daher, dass es eine Baustellenzufahrt nach der anderen Seite hin gab.
„Warten!“
So cheffig, wie es mir zu Gebote stand, raunzte ich den Befehl zu meinem Trupp hin. Dann verschwand ich zwischen den Dixiklos hindurch in das Erdgeschoss des Rohbaus. Bald schon fing ich an zu laufen, riss mir den Mantel vom Leib und die Mütze vom Kopf, schmiss beides in einen Container und rannte schneller als der deutsche Landser vor dem überlegenen Feind Richtung Heimat.
Julius gegenüber war ich zu keiner zusammenhängenden Erklärung fähig. Dass die Sache aus dem Ruder gelaufen sein musste, sah er an dem Fehlen der Uniformstücke. Eine Weile lang hoffte er wohl, dass mich die Cognacs, die wir tranken, wieder zu einem artikulationsfähigen Menschen machen würden. Aber ich wollte alles in einem grundlosen Ozean des Vergessens ersäufen, was ich da durch meine dreiste Dummheit herausgefordert hatte, und so passierte eigentlich nur dies, dass wir uns heftig wie selten zuvor die Kante gaben.
6
Seitdem Julius die Zeitung auf den Tisch geworfen und mein dumpfes Sinnieren schweigend hingenommen hatte, wartete er darauf, dass ich irgendwelche Anzeichen von Reue zeigte. Theoretisch ja, praktisch nein, ich blieb hartnäckig im Zustand des Stupor Alcoholicus, wenn überhaupt für irgendetwas geeignet, dann sicher nicht für die moralischen Herausforderungen des Lebens, sondern nur noch für den Mickey-Rourke-Ähnlichkeitswettbewerb.
„Und weißt du, was das Schlimmste ist“, fragte Julius.
Mit meinem geschwollenen linken Lid deutete ich an, dass sich etwas Schlimmeres gar nicht denken ließ.
„Das hier“, sagte Julius und tippte auf einen Zeitungsabsatz.
Nachdem ich keine Anstalten machte, die Sache zur Kenntnis zu nehmen, las er mir vor.
„Und so weiter“, raffte er den Anfang zu bündiger Kurzform, „und jetzt kommt es: Hinter der Maske wird der Kabarettist Beppo Wolfertshofer vermutet, der schon mehrfach mit spektakulären Antinazi-Aktionen Furore gemacht hat. Wolfertshofer tritt mit seinem Programm noch bis Aschermittwoch im Schlachthof auf. Und jetzt hör genau hin: Die Nationalen Kameraden München haben auf ihrer Website Wolfertshofer eine seiner Provokation angemessene Antwort angedroht.“
Julius schob mir das Blatt unter die Augen.
„Du weißt, was das heißt! Ärger auf jeden Fall, womöglich sogar Gefahr für Leib und Leben.“
Wie ferngesteuert stand ich auf, nahm das Espressokännchen an mich und braute mir eine zweite Portion.
„Du hast recht, sagte ich dann nach einer Weile, den heißen Kaffee schlürfend, ich habe unheimlichen Scheiß gebaut.“
Julius atmete pfeifend aus und schaute mich erleichtert an.
„Und was machen wir jetzt?“
„Ich muss etwas tun, verbesserte ich ihn. Du bist aus dem Schneider.“
„Und das wäre?“
„Zu Wolfertshofer gehen und ihm sagen, dass die Geschichte auf meine Kappe geht.“
Dann stand ich auf, holte mir einen Karton und klapperte nacheinander Büffet und Kühlschrank ab. In der Kiste verstaute ich alle Alkoholika. Julius guckte mir interessiert zu.
„Aber du fängst jetzt nicht gleich wieder zu saufen an?“
„Im Gegenteil. Für mich beginnt schon heute die Fastenzeit.“
Ich schaffte alles, inklusive der restlichen Weißbiere, in den Keller. Den Schlüssel hängte ich an ein Kettchen und überreichte ihn Julius.
„Verwahr das“, ich stockte, „sagen wir: mindestens die nächsten Wochen und gib mir den Schlüssel auch dann nicht, wenn ich dich schreiend darum bitte.“
Julius nickte tapfer und machte Anstalten zu gehen.
„Noch etwas …!“
Er drehte sich um.
„Kannst du das Leergut mitnehmen?“
Achselzuckend raffte er die Flaschen und Kästen zusammen und verschwand.
Mittags sperrte ich pünktlich den Laden zu, hängte ein Schild ins Fenster, nach dem ich im Kundenauftrag unterwegs sei, und legte mich ins Bett. Gegen Nachmittag war ich so weit wieder hergestellt, dass ich den Besuch bei Wolfertshofer in Angriff nehmen konnte.
7
Wolfertshofer aufzutreiben, war nicht schwer. Zwei Stunden vor seiner Vorstellung saß er in der Gaststube am Stammtisch und stärkte sich. Gott sei Dank alleine. Wolfertshofer wirkte nicht beunruhigt, mit großem Behagen widmete er sich einem panierten Schnitzel mit Kartoffelsalat. Seine Halbe Bier war schon fast ausgetrunken. Das sah verdammt gut aus. Ich klopfte zweimal auf den Tisch.
„Darf ich?“
Er schnitt eine Grimasse, die eher Ablehnung bedeutete.
„Ich muss mit Ihnen reden.“
„Was gibt’s?“
„Ich war es“, sagte ich. „Diese Hitlergeschichte, meine ich.“