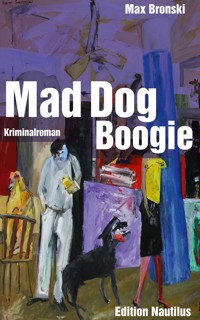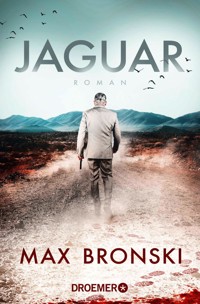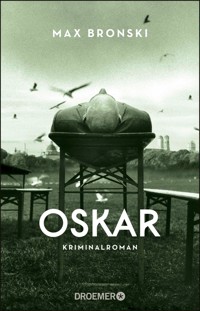Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Nautilus
- Kategorie: Krimi
- Serie: Wilhelm Gossec Bd. 2
- Sprache: Deutsch
»Mein Laden im Schlachthofviertel ist gerade mal fünf Minuten von der Theresienwiese entfernt. Normalerweise spielt das keine Rolle, denn die Theresienwiese ist ein ziemlich reizloses steiniges Gelände, topfeben, ohne Baum und Strauch. Aber einmal im Jahr findet dort mindestens vierzehn Tage lang das Oktoberfest statt, das der Münchner dieses steinigen Geländes wegen Wiesn nennt.« Wilhelm Gossec ist Antiquitätenhändler, besser gesagt Trödler, und das Oktoberfest ist auch für ihn ein gutes Geschäft, schon im September stellt er sein Geschäft für die ausländischen Gäste auf Bavarica um. Eines Abends, als Gossec es sich gerade in der Wohnung hinter dem Laden gemütlich machen will, hört er ein Klatschen auf dem Pflaster und sieht einen Mann da liegen, ausgeraubt, eine Bierleiche. Gossec findet in seinen Taschen nur noch eine Einladung von der Firma Global Real Estate für das Käferzelt und eine Visitenkarte. Nach der handelt es sich um den Abgeordneten Ernst Hirschböck aus Niederottling. Ein Landtagsabgeordneter, eine global agierende, börsennotierte Immobilienfirma, ein Münchner Scherbenviertel, in dem die Leute aus ihren billigen Wohnungen hinaussaniert werden sollen – mehr braucht Max Bronski nicht, um einen Krimi zu erzählen, in dem die Korruption das Selbstverständlichste auf der Welt ist, würde nicht manchmal einer aus lauter Gier über das Ziel hinausschießen und wäre da nicht Gossec mit seinem völlig überholten Gerechtigkeitssinn.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 177
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Max Bronski
München Blues
Roman
Edition Nautilus
So urteilt die Kritik über „München Blues“
… wichtiger sind Sprachwitz, Lokalkolorit, Atmosphäre: Der Roman führt auf unterhaltsame Weise eine Seite Münchens vor, die Reisenden sonst meist verborgen bleibt. (NZZ am Sonntag vom 1. Juli 2007)
Viel Lokalkolorit und Einblicke in die Denkungsart der Bayern. (Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung vom 9. März 2008)
Was hier so launig als Krimi daherkommt, ist letztlich eine beißende Gesellschaftssatire. Vor allem aber bringt Bronski die Stimmung der Stadt München brillant auf den Punkt. Die beklemmend leeren Straßen, die Enge, die ganze Last einer zutiefst provinziellen Stadtgeschichte und diese allgegenwärtige lähmende Antriebslosigkeit hat selten einer so präzise in einen Roman gepackt. (Andrian Kreye, Süddeutsche Zeitung vom 12. Mai 2008)
Wunderbar seine kleinen Charakterstudien. (…) Da stimmt jeder Zug am Lokalkolorit und selbst Saupreißn fühlen sich bestens unterhalten. (Westfälischer Anzeiger vom 21. Februar 2008)
Nein. Michael Fitz ist nicht Max Bronski. Macht nichts. Denn Michael Fitz hat einen Heidenspaß beim Lesen. Immer wieder muss er sich lachend selbst unterbrechen. Und mit ihm amüsieren sich die 150 Zuhörer. (Anja Witzke, Donaukurier vom 26. Februar 2008)
Ein Landtagsabgeordneter, eine global agierende, börsennotierte Immobilienfirma, ein Münchner Scherbenviertel, in dem die Leute aus ihren billigen Wohnungen hinaussaniert werden sollen – mehr braucht Max Bronski nicht, um einen Krimi zu erzählen, in dem die Korruption das Selbstverständlichste auf der Welt ist, würde nicht manchmal einer aus lauter Gier über das Ziel hinausschießen und wäre da nicht Gossec mit seinem völlig überholten Gerechtigkeitssinn. (Krimitime’s Blog vom 27. November 2009)
Das explosive Gemisch aus plakativer Brutalität und bissiger Ironie sind Bronskis Markenzeichen. (…) Drum schlägt Bronski sprachlich genauso beherzt zu wie sein Held mit der bloßen Faust. "München Blues" ist ein bayerischer Vollblut-Krimi, der reinhaut, mitten ins Zwerchfell und gerne auch mal unter die Gürtellinie. (Jörg von Bilavsky, Literaturkritik.de vom März 2007)
Bronski ist ein witziger Autor. Er hat Einfälle, die nicht mit sich selbst protzen, sondern tatsächlich ein Licht auf Sachverhalte und Lebensumstände werfen (…) Es geht ja gut aus, aber das war nicht vorhersehbar, und so nenne auch ich am Ende «München Blues» eine literarische Spitzenleistung. (Franz Schuh, kultiversum vom Juni 2007)
Die trockene fatalistische Haltung des Trödelhändlers hat was. (Bettina Göcmener, Die literarische Welt vom 28. April 2007)
Witzig, deftig, ironisch und eigenwillig: Max Bronskis neuer Münchenkrimi ist nicht nur für Schlachthofviertel-Bewohner ein Muss.
(Günter Keil, Radio Gong 96,3 Buchtipp vom 25. März 2007)
Gossec ist ein sehr erdiger Held und Max Bronski (…) gibt ihm den nötigen Witz und die richtige Pfiffigkeit mit, damit daraus ein rasanter und lebendiger Krimi wird. (Buchkultur vom April/Mai 2007)
…jedes Wort eine Faust, jeder Satz ein Treffer. (Main-Echo vom 10./11. März 2007)
Max Bronski könnte für Deutschland das werden, was Wolf Haas mit seinem „Brenner“ für Österreich wurde: Die selbstironische Lakonie seines Helden Wilhelm Gossec (…) geht runter wie eine frische Maß auf der Wies’n. (bücher vom März 2007)
Der Reiz von „München Blues“ liegt in dem trockenen Neonblick, den Autor Max Bronski in den besten Momenten auf die Weltstadt mit Herz wirft. (Christoph Gröner, Abendzeitung vom 17./18. März 2007)
Nach „Sister Sox“ ist das der zweite gelungene München-Krimi von Max Bronski, dem man zu diesem krachert-charmanten Beinahe-Prekarier und dem gekonnt gemalten Lokalkolorit nur gratulieren kann. (Armin Baumer, in Nr. 7 vom 22. März bis 4. April 2007)
Er setzt mit Erfolg auf Tempo und Sprachwitz… (Tobias Kaiser, titel-magazin vom 22. April 2007)
Mit Gossec gelingt dem studierten Theologen Bronski das Porträt eines schrägen Vogels, den man gerne auf weitere München-Abenteuer begleiten würde. (Berchtesgadener Anzeiger vom 20./21. Januar 2007)
Bronskis München Blues ist ein straff, mit viel Witz und Tempo erzählter Krimi; sein Gossec ist ein Großstadtritter, den man mögen kann: rotzig und keineswegs zimperlich, integer, aber pragmatisch, den Damen hold und hinter seinem Schlagring eine echt edle Seele von Mensch. (Gitta List, Schnüss Nr. 8 2007)
Nach „Sister Sox“ erneut ein rasanter, harter und flippig-fetziger Szenekrimi, der in seiner oft sehr derben Tonart dennoch unterhaltsam und spannend ist. (Joseph Schnurrer, Bayern im Buch vom November 2007)
… genau das Buch, das man braucht. (Saarbrücker Zeitung vom 12. September 2007)
Was will man mehr von einem Kriminalroman? (Barbara Steinbauer, Radio Aktiv Buchtipp vom 12. März 2007)
Bronski unterhält auch in seinem zweiten Roman mit brachialer Situationskomik, mit fundamentaler Respektlosigkeit, mit gnadenlosem Witz. (Ulrich Noller. WDR 5 Gänsehaut vom 9. März 2007)
…ist Bronski wieder ein überzeugender Krimi gelungen, in dem er nicht mit Gesellschaftskritik geizt und der nicht nur im Münchner Raum empfohlen werden kann. (Ulrike Weil, ekz-Informationsdienst)
Das macht Spaß und ist auch spannend. (Uli Geißler, literature.de vom 7. Mai 2007)
Schräges Vergnügen – nicht nur für Mieter. (buchjournal vom Frühjahr 2007)
Der Roman beginnt mit einem Kabinettstückchen Bronski’scher Ironie, indem er sich eine heilige Kuh des Münchner Selbstverständnisses gnadenlos vornimmt: das Oktoberfest. (Edgar Illert, RadaR Augenweide Extra vom 1. August 2007)
Stormy Monday
They call it stormy Monday, But Tuesday’s just as bad; They call it stormy Monday, But Tuesday’s just as bad; Wednesday’s worse, And Thursday’s also sad.
Yes, the eagle flies on Friday, And Saturday I go out to play; Eagle flies on Friday, And Saturday I go out to play; Sunday I go to church, Then I kneel down and pray.
Lord, have mercy, Lord, have mercy on me. Lord, have mercy, My heart’s in misery: Crazy ’bout my baby, Yes, send her back to me!
AARON WALKER
1
Mein Laden im Schlachthofviertel ist gerade mal fünf Minuten von der Theresienwiese entfernt. Normalerweise spielt das keine Rolle, denn die Theresienwiese ist ein ziemlich reizloses steiniges Gelände, topfeben, dazu ohne Baum und Strauch. Am anderen Ende erhebt sich ein Hang, an dessen Kante ein mächtiges altdeutsches Weib von ihrem Sockel auf die Wiese herunterschaut. Über einem weiten, hemdartigen Kleid, dessen gnädige Falten ihre Körperfülle verhüllen, trägt sie ein Bärenfell um den Leib gegürtet, in ihrer Rechten hält sie das blankgezogene Schwert und mit der Linken hebt sie einen Eichenkranz empor. Selbst Heraldikspezialisten würden bei ihr eher auf Odins Gattin Freya tippen, säße nicht ein bayerischer Löwe zu ihren Füßen, der sie uns als Darstellung der Bavaria nahezubringen versucht. Eingerahmt wird die Bronzestatue von einer Tempelanlage, die so griechisch ist wie das Kapitol in Washington römisch. Der Tempel stellt in diesem anarchischen Mix von Kulturen eine Ruhmeshalle dar, in der verdiente ortsansässige Persönlichkeiten wie der Bierbrauer Pschorr und der Wassertreter Kneipp mit Büsten geehrt werden. Erst mit dieser unterstützenden Information versteht man, warum gewitzte Heraldiker darauf hinweisen, dass der Kranz aus Eichenlaub üblicherweise aus Lorbeer gewunden wird. Wie gesagt: Normalerweise spielt die Nähe zur Theresienwiese keine Rolle, aber einmal im Jahr findet dort unten mindestens vierzehn Tage lang das Oktoberfest statt, das der Münchner dieses steinigen Geländes wegen Wiesn nennt.
Was auf dem Oktoberfest stattfindet, überschreitet die Grenzen der menschlichen Vernunft und Vorstellungskraft in einem solchen Maße, dass nur beherzte Bezifferungen helfen, ein Bild davon zu vermitteln: Von den sechs Millionen Besuchern ergattern allenfalls zwei Millionen einen Platz im Bierzelt. Ein Viertel davon ist ein glatter Ausfall, weil sie nur Kaffee, Wein, Saft oder Schnaps trinken, zu jung, zu alt oder zu invalid sind und damit die sechs Millionen Maß Bier dem Rest überlassen. Die schütten demnach pro Kopf vier Liter in sich hinein. Mancher merkt erst im Lauf des Abends, dass es sich dabei um ein getuntes Wiesnmärzen mit deutlich mehr Prozenten handelt. So abgefüllt, torkeln, taumeln oder stolpern Tausende von Besuchern Richtung Innenstadt. Wenn sie körperlich unbeschadet die stark befahrene Lindwurmstraße überquert haben, suchen sie schnurstracks Seitenstraßen auf, um, von der Macht bis dahin sekundärer Bedürfnisse getrieben, irgendwo in einer nahegelegenen Einfahrt oder einem Hausgang zu kotzen, zu pissen oder sich endlich gegenseitig an die Wäsche zu gehen. Im Prinzip stehen sie dann direkt vor meinem Laden.
Warum tue ich mir das eigentlich an? Weil ich in diesen zwei Wochen mehr verdiene als in den ganzen drei Sommermonaten davor. In der heißen Zeit ist meine komplette Ware nur Trödel. Die alten Polster müffeln, die Schränke und Kommoden dünsten den Geruch überständiger Mottenkugeln aus, vor allem die Bücher und Zeitschriften riechen nach Moder und Staub. Umsatzmäßig kann man den Sommer knicken. Im September stelle ich mein Sortiment auf Bavarica um. Herzen, Seppelhüte oder Fäkalhumor auf Naturholz, „Wenn’s Arscherl brummt, is Herzerl gsund!“, kommen niemals in mein Schaufenster, aber Gamsbärte, Charivari oder handgeschnitzte Hirschhornknöpfe wohl. Der ausländische Gast vor meinem Laden versteht sofort, dass er bei Antiquitäten Gossec originale Souvenirs erbeuten kann.
Eine gewisse Geschmeidigkeit muss man in meinem Gewerbe schon an den Tag legen, wenn man überleben will. Auch ältere Mädchen besuchen heutzutage kein Geschäft mehr für Mieder- oder Galanteriewaren. Der Dessous-Shop und die Bijouterie laufen aber rasend gut. Dementsprechend hat sich mein Berufsstand vom Trödel-, Gebraucht- oder Nostalgiewarenhandel zu einer Art Kunstagentur entwickelt. Wir vermitteln Interessenten gut gepflegte Antikschätze und tragen in unserer Brusttasche vierfarbig gedruckte Visitenkarten mit Reliefprägung, auf denen ein besonders schönes Stück in appetitlich nussigem Braun den Kunden anstrahlt. In München trägt der Kaufmann den Pelz zwar inwendig, aber mehr als sonst wo gilt, dass schon der bloße Anschein von Schäbigkeit den beruflichen Selbstmord bedeutet.
Nachschub für meinen Laden bekomme ich über Haushaltsauflösungen, die ich kostenlos anbiete. Die guten Stücke wandern in mein Sortiment, der Rest wird an Ort und Stelle zu Kleinholz gehauen und entsorgt. Saisonal schichtet man das Angebot um, man hat Erfahrung, und im Herbst sind eben aus guten Gründen Bavarica absolut angesagt.
So lief es auch dieses Jahr, im Prinzip saugut. Pünktlich zum Einzug der Wiesnwirte wurde noch einmal die Sommersonne angeknipst. Dieser Pakt mit dem Himmel funktionierte so reibungslos und hielt die ganze Zeit über, dass Kernbayern schon allein deshalb immer katholisch bleiben wird. Gegen acht Uhr schloss ich den Laden und zog wie immer in diesen zwei Wochen den Rollladen vors Schaufenster, weil ich nicht testen wollte, wozu ein enthemmter Besucher mit einem geklauten Maßkrug und dem unstillbaren Drang nach meiner Ware fähig sein kann. Ich zog mich in meine Wohnung zurück, zwei Zimmer, Küche, Bad, direkt hinter dem Laden.
Bei der letzten Haushaltsauflösung hatte ich alte Prinz Eisenherz-Bücher entdeckt, die wollte ich in Ruhe durchblättern. Mit ein paar Selbstgedrehten und Weißbier hätte das ein beschaulicher Abend werden können. Man hat in diesen Zeiten keinen großen Aktionsradius. Mit dem Auto dem Rummel zu entfliehen, hätte bedeutet, auf Alkohol weitgehend verzichten zu müssen. An jeder nennenswerten Oktoberfest-Ausfallstraße war Polizei postiert, um die Betrunkenen aus dem Verkehr zu ziehen. Nach den harten und betriebsamen Tagen, wie sie im Moment zu absolvieren waren, hatte ich überhaupt keine Lust darauf, mit der Bieruhr im Kopf herumzulaufen. Und die öffentlichen Verkehrsmittel kamen für mich zurzeit auch nicht infrage. Man stand eingekeilt in der schwiemeligen Schar dieser Bayrisch-Herz-kostümierten Leute, die nicht einmal mehr vor dem Lodentanga zurückschreckten. Wie eine Planierraupe ist Landhausmode über den Geschmack dieser Republik gefahren. Schon deshalb ließ ich meinen alten Janker mit grünem Kragen dauerhaft im Schrank, mit dem ich mich noch vor etlichen Jahren in Göttingen als Förster vom Silberwald beschimpfen lassen musste.
Gegen halb neun hörte ich von draußen ein Klatschen auf dem Pflaster, als sei einer mit dem Gesicht voraus aufs Trottoir gefallen. Wenn ich irgendeine arme Sau liegen sehe, bricht sich die Pfadfindererziehung in mir Bahn. Also schaute ich lieber gar nicht hinaus. Gegen neun Uhr war jedoch nicht mehr zu überhören, dass jemand durch den unteren Türschlitz in meinen Laden hineinröchelte. Es war eine ganz seltsame Mischung aus rasselndem Schnarchen und schmerzvollem Stöhnen. Vorsichtshalber ließ ich die Ladentür geschlossen und ging hintenherum durch den Hof.
Tatsächlich lag auf der Schwelle ein Mann auf dem Bauch, Gesicht nach unten, wie in Schwimmhaltung einen Arm nach vorne, den anderen nach hinten. Es sah so aus, als wollte er durch die geschlossene Tür in den Laden kraulen. Seine Alkoholaura war derartig massiv, dass er sich promillemäßig in menschliche Grenzbereiche vorgewagt haben musste. Da er hin und wieder stöhnte, lebte er noch. Ich drehte ihn auf den Rücken. Er sah fürchterlich aus, das Gesicht blutig zerschrammt, das Hemd hing ihm halb offen aus der aufgeknöpften Hose, weil es so heillos Betrunkene da unten zwar irgendwie auf-, aber nicht mehr zukriegen, und er stank nach Urin, weil sie auch beim Pinkeln nicht aufhören können, vorwärts zu stolpern. Bierleichen sind normalerweise nicht mein Problem, man ruft die Sanitäter und lässt sie abtransportieren. Aber der da hatte keine Brieftasche, keine Armbanduhr, kein Handy, keinen elektronischen Schlossöffner und auch sonst nichts mehr, womit er sich als Mitglied unserer hoch technisierten Gesellschaft hätte ausweisen können. Mit anderen Worten: Man hatte ihn ausgeraubt. Seine Hosentaschen waren leer, nur oben in der Brusttasche seines Hemds steckte eine mehrfach gefaltete Einladung der Global Real Estate in das Bräurosl-Festzelt. Dahinter klebten zwei zerknitterte Visitenkarten. Danach lag der Landtagsabgeordnete Ernst Hirschböck aus Niederottling an der Ilz vor mir auf dem Boden. Ich klopfte ihm die Wange.
„Hallo!“
Er riss die Augen auf und lallte, der Traublinger solle mit dem Wagen kommen.
Da war ich sicher, dass ich Hirschböck vor mir hatte, denn er sprach Niederbayerisch.
Es ist Auswärtigen schwer zu erklären, was einem Oberbayern niederbayerisch anmutet. Da ist etwas Gemeinsames bei gleichzeitiger Fremdheit, und die gibt den Ausschlag. Wer die in München geltende Regel abändern möchte, gehört automatisch nach Niederbayern: beim Schafkopfen einen Farbwenz spielen wollen. Einen Dialekt sprechen, bei dem jedes Wort so platt geklopft und wäldlerisch garniert wie ein Jägerschnitzel daherkommt.
Und Hirschböck war definitiv einer vom Land. Bäuerlich wirkten ja viele, wenn man sie aus dem Anzug stemmte. Ein rot geädertes Gesicht, tief angesetzter Scheitel und abstehende Ohren. Da machte man leicht den Fehler, diesen Menschenschlag zu unterschätzen. Aber sie waren schlau, zäh, hatten alles nötige Sitzfleisch für Verhandlungen, und verhandeln ließ sich immer etwas, sogar die ehernen Prinzipien, denn hierzulande zählt nie der Buchstabe des Gesetzes, sondern immer nur das große Ganze. Dieses große Ganze ist wie der Himmel über Bayern, im Prinzip ist er weißblau, aber manchmal halt nicht. Darin ist man ganz katholisch: Wenn man dem Menschen schon Gebote auferlegen muss, dann darf der auch mal kräftig ausscheren. Sonst macht das ganze Leben keinen Spaß.
Ich hob ihn auf und schleppte ihn in meine Wohnung. Dort hielt ich seinen Kopf unter die Brause, betupfte seine Wunden mit Jod und flößte ihm eine Tasse furchterregend starken Pulverkaffee ein. Dass dieses probate Mittel unserer Vorfahren, den Alkoholpegel in nüchterne Bereiche runterzudrücken, ein Märchen war, wusste ich längst, aber so ein gallenbitteres, heißes Gebräu lässt auch im dumpfsten Schädel wieder ein paar Lämpchen aufleuchten.
Tatsächlich!
Der Traublinger solle kommen, ansonsten wolle er den Edi sprechen.
So kamen wir dennoch nicht weiter. In meinem Altkleiderfundus fand ich einen grauen Hausmeisterkittel, den ich ihm überzog. Nun waren seine Alkohol-Urin-Ausdünstungen auf ein erträgliches Maß heruntergedimmt. Ein böswilliger Mensch hätte ihm jetzt eines meiner gerahmten Sowjetplakate in den Schoß gelegt und ein paar Fotos geschossen. Fantasien in dieser Richtung hätte man genug, aber Wehrlosen gegenüber bin ich ein gutartiger Mensch.
„Taxi!“, schrie ich ihn an. „Wohin?“
Hirschböck hob den Kopf.
„Harlaching.“
Das würde glattgehen. Also rief ich ein Taxi, steckte Hirschböck eine meiner Geschäftskarten oben in die Brusttasche, damit er sich, wie es in Bayern heißt, revanchieren konnte, setzte ihn in den Wagen und gab dem Fahrer, einem Türken mit viel Verständnis für betrunkene Einheimische, einen Zwanziger. Er solle ihn an den gewünschten Ort bringen. Als ich jedoch nach einiger Zeit durch das Fenster hinausschaute, sah ich, dass sich nichts getan hatte. Der Wagen stand unverändert vor dem Laden. Also ging ich nochmals hinaus und fragte, was los sei.
Hirschböck saß hinten im Fond und stierte vor sich hin. Der Türke war verzweifelt.
„Wohin? Die Straße!“
„Meichelbeckstraße“, nuschelte Hirschböck in dem ihm eigenen Dialekt.
Der Türke sah mich an.
„Was meint er? Meiselböck oder Meischelbach oder wie oder was?“
Keine Frage, für einen Taxifahrer und seinen betrunkenen Gast war das der GAU. Selbst wenn man die Meichelbeckstraße noch astrein aussprechen konnte wie Hirschböck, ergab sich durch die unterstellte alkoholische und dialektale Verzerrung ein derart brutaler Parallaxenfehler, dass man so gut wie keine Chance hatte, dorthin gebracht zu werden, es sei denn, der Fahrer hätte gewusst, dass es eine Meichelbeckstraße wirklich gibt.
„Meichelbeckstraße“, wiederholte ich, „Menterschwaige, kurz vor der Eisenbahnbrücke rechts.“
Endlich fuhren sie los.
2
Gerade mal zwei Stunden durfte ich den feierabendlichen Frieden genießen. Dann klingelte es an meiner Haustür. Schnauze voll, dachte ich, ich wollte meine Ruhe. Ich hatte es mir mit Zigaretten, Bier und Prinz Eisenherz wieder gemütlich gemacht. Das Weißbierglas setzte ich ganz unauffällig ab, um nicht herumzuscheppern. Eine verfehlte Maßnahme, vielleicht wäre Lärm besser gewesen. Bald darauf rasselte ein Schlüsselbund an meiner Tür, und schneller, als ich hochfahren konnte, standen zwei Herren in passablen grauen Anzügen im Flur. Der Erste trug ein grünes Polohemd, der Zweite ein rotes, trotzdem sah das stark nach Dienstkleidung aus.
„Guten Abend, Herr Gossec“, sagte der Vordermann.
Das klang ziemlich höflich, auch das Lächeln des Hintermanns wirkte ausgesprochen schüchtern. Geradezu sympathisch. Ich war vollkommen verdattert.
„Was gibt’s?“, fragte ich.
Der Grüne hob den Dietrich hoch, den er noch in der Hand hatte.
„Zunächst einmal müssen wir uns entschuldigen für unser überraschendes Eindringen …“
„… aber wir sahen Gefahr im Verzug“, ergänzte der Schüchterne.
„Und da reagiert man gern mal ein wenig über“, nahm der Grüne den Faden wieder auf.
Er zog meine Geschäftskarte aus seiner Reverstasche.
„Der Herr Staatssekretär hatte die bei sich.“
Mir entging nicht, wie der Schüchterne mit geübtem Blick meine Wohnung förmlich abscannte, auf der Suche nach Auffälligkeiten und Spuren, von denen ich nicht wusste, worin sie hätten bestehen können. Die Situation war hochgradig absurd, aber ich hatte das sichere Gefühl, dass es besser war, wenn ich mich fügte.
„Also bitte“, sagte ich, „sehen Sie sich ruhig in meinen Räumen um. Und dann erzählen Sie mir Ihre kleine Geschichte.“
Die beiden ließen sich nicht lange bitten. Alles ging fast geräuschlos vor sich, da waren Spezialisten am Werk. Nach einiger Zeit waren sie wieder bei mir.
„Alles bestens …“
„Keine Brieftasche, kein Handy gefunden?“, fragte ich süffisant.
Schmerzliches Bedauern fältelte das Gesicht des Schüchternen.
„Du meine Güte, darum kümmern wir uns nicht. Sehen wir denn aus wie Schutzmänner?“
„Hatte denn der Herr Staatssekretär ein Schriftstück bei sich, so eine Art Exposé“, brachte der Grüne den eigentlichen Gedanken zur Blüte.
„Eine Einladung zur Wiesn, zwei Visitenkarten, sonst null“, erwiderte ich.
„Ach herrje!“, jammerte der Schüchterne.
Gram schien ihn aufzuzehren. Jetzt wurde es mir doch zu bunt.
„Und in welche Abteilung gehört ihr zwei denn?“
„Sie müssen entschuldigen“, begann der Schüchterne, „aber …“
Wieder übernahm der Grüne.
„Waren Sie vielleicht auch auf dem humanistischen Gymnasium? Ich bin in Ettal zur Schule gegangen.“
„Nie“, erwiderte ich.
„Aber was Prätorianer sind, wissen Sie schon?“
„Sicher.“
„Na also“, freute sich der Schüchterne.
Das Frappierende an dieser Nullauskunft war, dass ich sie dennoch auszulegen versuchte. Man spürt einem Sinn hinterher, wo keiner ist. Das System da oben ist beschäftigt, und schon ist einem die Initiative entglitten. Wieder war es der Grüne, der das Gespräch zielgerichtet vorwärtsbrachte.
„Nach Lage der Dinge können wir uns nur für Ihr couragiertes Verhalten bedanken. Der Staatssekretär in hilflosem Zustand. Durch K.-o.-Tropfen von den Beinen geholt …“
Das also war die offizielle Version.
„… ausgeraubt …“
„… da haben Sie sicher Schlimmeres verhütet.“
Der Grüne gab mir die Hand, mit der Linken klopfte er mir auf die Schulter. Eine Geste, so golden wie ein Orden. Der Schüchterne nickte anerkennend und knuffte mich in die Seite. Ich hatte zwei neue Freunde gewonnen. Genau genommen drei, aber der dritte Mann wusste in seinem Alkoholdelirium noch nichts davon. Als sie weg waren, fiel mir zum ersten Mal ein, dass ich mich wenigstens nach dem Namen dieser perfekten Dienstsymbiose hätte erkundigen können. Aber wahrscheinlich hätte sich der Schüchterne Maier zwo und der Grüne Müller fünf genannt. Oder so ähnlich. Solche Leute kommen schon in Tarnanzügen auf die Welt.
3
Ein paar Tage später lernte ich Traublinger kennen. Er fuhr in einem BMW mit getönten Scheiben vor meinem Laden vor. Die letzten Wiesntage waren angebrochen. Obwohl schon Oktober, war es untertags immer noch heiß. Erst abends wurde es empfindlich kalt. Traublinger war ein vierschrötiger Kerl mit dem Kampfhaarschnitt eines amerikanischen Marine. Seine Augen waren hinter blau verspiegelten Sonnengläsern von den Ausmaßen einer Ganzkörper-Skibrille verborgen. War auch besser so, denn seine Gesichtszüge verrieten nichts Gutes. Sie waren kantig und grob, wie mit einem Stechbeitel aus einem Holzklotz herausgeschlagen. Traublinger stieß derart wuchtig meine Ladentür auf, dass er beinahe die Glocke aus der Verankerung gerissen hätte.
„Langsam, Freund“, sagte ich.
„Traublinger“, erwiderte er barsch. „Büro Hirschböck.“
Erwartungsvoll sah er mich an. Dann warf er ein in Papier gewickeltes Päckchen auf den Ladentisch. Kerle wie er machten mich aggressiv.
„Ja was denn nun?“, fragte ich. „Soll ich salutieren, oder gehen wir gleich zum Exerzieren in den Hinterhof?“
Traublinger streckte seinen Grobschädel über die Theke. Dabei hob er den rechten Arm an, um seine Achsel darzubieten.
„Ha, ha, ha. Sie dürfen mich kitzeln, vielleicht lache ich dann.“
Ein ungutes Lüftchen wehte mich an. Typen wie Traublinger stehen bis zur Halskrause unter Testosteron. Sie tragen zwar frisch gebügelte Hemden, duschen dreimal täglich und rasieren sich ebenso oft. Aber das bringt nichts, sie riechen trotzdem büffelig, weil so hochgetaktete Männer wie er auch im Ruhezustand die schweißige Energie von Moschusochsen absondern. Ich trat einen Schritt zurück.
„Also, worum geht es?“
Mit beiden Händen riss Traublinger das Papier vom Päckchen und holte ein in Plastik gehülltes graues Teil hervor.
„Erstens: der Kittel. Gereinigt und fachmännisch kunstgestopft.“
Er warf ihn vor mich hin.
„Zweitens: das Fahrgeld.“
Er hielt ein Kuvert hoch, öffnete es und ließ einen Hunderteuroschein hervorspitzen.
„Hoppla. Mit Bakschisch vom Effendi. Da sag ich aber ganz herzlich: Vergelt‘s Gott!“
„Bloß nicht frech werden.“
„Frech, ich? Für einen, der an dem betreffenden Abend die Sache vergeigt hat, reißen Sie hier ganz schön das Maul auf. Mehrfach hat Ihr Chef gejammert, Sie möchten ihn nun endlich abholen. Wo waren Sie eigentlich?“
Traublinger schlug mit der flachen Hand auf meine Theke, dass meine alte Registrierkasse einen Satz machte.
„An mir lag’s nicht! Ich habe mit dem Wagen an der verabredeten Stelle gewartet. Stundenlang. Wer nicht kam, war er.“
„Brav“, sagte ich. „Dann grüßen Sie den Chef mal schön von mir. War mir ein Vergnügen.“
Ich ging zur Tür und hielt sie auf. Ich wollte nicht meine Einrichtung unter den Händen dieses Rohlings zerschmettert sehen.
Traublinger ging an mir vorbei. An der Tür fasste er sich in die Brusttasche und zog ein handgeschriebenes Billett hervor.
„Das Wichtigste hätte ich beinahe vergessen.“
Er ließ es in meinen Hemdausschnitt fallen.
„Wiedersehen!“
Dann brachte er den BMW zum Brüllen. Was folgte, war ein Kavalierstart mit einer so sagenhaften Beschleunigung, dass der Fahrer den gewünschten Schlag ins Kreuz bekam.