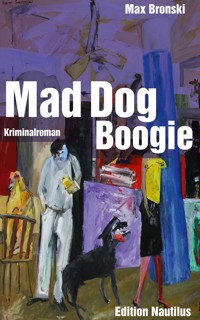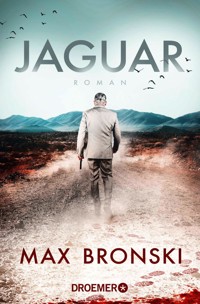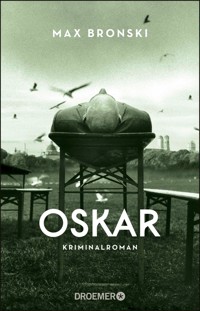Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Nautilus
- Kategorie: Krimi
- Serie: Wilhelm Gossec Bd. 1
- Sprache: Deutsch
Es ist der heißeste Sommer in München seit Menschengedenken. Da erhält Wilhelm Gossec, Betreiber eines kleinen Trödelladens, auf seinem Anrufbeantworter einen Hilferuf seiner Ziehtochter Pia. In ihrer Wohnung findet Gossec die Leiche eines jungen Mädchens, von Pia keine Spur. Ehe er sich's versieht, steht er zwischen allen Fronten und findet sich auf einer rasanten Hetzjagd durch die bayerische Metropole wieder. Die Krimiserie um den Trödelhändler Gossec hat sich weit über die Grenzen Münchens hinaus zum Kult entwickelt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 187
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Max Bronski
Sister Sox
Roman
Edition Nautilus
So urteilt die Kritik über „Sister Sox“
Endlich – Wir haben einen neuen Underground-Helden! (Vivesco vom März 2007)
Der 1964 geborene Bronski hat einen schön bösen Blick auf die Welt… (Thomas Klingenmaier, Stuttgarter Zeitung vom 7. April 2006)
Sein erster Krimi, in schön knapper, mit reichlich Ironie getränkter Sprache gehalten, ist eine rasante Hetzjagd durch die Landeshauptstadt – mit spannender Story und vielen Blicken hinter die Fassaden. (Magnus Reitinger, Weilheimer Tagblatt vom 24./25 Mai 2006)
… um mit „Sister Sox“ zu beweisen, dass man auch im ach so sauberen, derrickigen München einen dreckigen, schnellen, witzigen Noir ansiedeln kann. (Ulrich Noller, Stadt Revue schwarzlicht vom April 2006)
Es ist dieser grundentspannte Erzählsound, der einen so unwiderstehlichen Charme entwickelt, dass man gern weiter und weiter liest. (Katharina Granzin, die tageszeitung vom 22. Juli 2006)
Der pseudonyme Autor mit Hang zu Lakonik und Ironie kennt die Schattenseiten seiner Stadtseiten seiner Stadt offensichtlich in- und auswendig. (Badische Neueste Nachrichten vom 31. Juli 2006)
Die Komik seiner Redeweise ist eine materialistische; er spricht die Dinge so direkt aus, wie es die besseren Kreise nie tun würden, und die schlechteren, weil sie auch genug zu verbergen haben, gleichfalls nicht. (Michael Schweizer, Kommune Nr. 2 von 2006)
… ein bemerkenswert schräger Kriminalroman. (…) Stellenweise erinnert „Sister Sox“ an Friedrich Anis Stil, ist jedoch schriller und schneller. (Günter Keil, Süddeutsche Zeitung Nr. 67 vom März 2006)
Was dann aber auf den nächsten 190 Seiten geschieht, ist so weit entfernt von Mann’scher Prosa wie ein Eminem-Konzert von einer kammermusikalischen Darbietung der Mondscheinsonate. Und doch liegt bei aller brachialen und temporeichen Sprache doch auch so etwas wie ein kaum wahrnehmbares Band von feiner Ironie um „Sister Sox“, derjenigen des Lübeckers (…) nicht unähnlich. (Edgar Illert, RadaR Augenweide 15. Oktober 2006)
…eine entspannt-rotzige Sprache, Lakonie, dröger Humor und ein straffer Plot treiben seinen Erstling (…) in Richtung gelungener Großstadtkrimi, und das ist für die deutschen Verhältnisse dieser Spielart des Genres auf jeden Fall bemerkenswert. (Schnüss Nr. 8 von 2006)
Gossec begibt sich auf eine kalkuliert schnoddrige und mit viel Flair erzählte Achterbahnfahrt durch die Leben und Laster der bayerischen Hauptstadt. Knackig! (Thomas Fischer, Kieler Nachrichten vom 5. Juli 2006)
Bronski erzählt im charmanten Unterschichtenjargon vom schlagfertigen Trödler Gossec (…) Das liest sich flott, knackig und mit manch verschmitztem Seitenhieb gegen das gemütliche München-Bild… (Rheinischer Merkur vom 12. Oktober 2006)
Unabhängig davon ist Bronski ein sprachlich und inhaltlich überzeugender Krimi gelungen, der deshalb ermpfohlen werden kann. (Ulrike Weil, ekz-Informationsdienst)
»Er sah gegen die gelbliche Wolkenwand, die von der Theatinerstraße heraufgezogen war und in der es leise donnerte, ein breites Feuerschwert stehen, das sich im Schwefellicht über die frohe Stadt hinreckte …«
THOMAS MANN
1
Der erste Eindruck war zutreffend. Die Frau am Telefon war unangenehm. Sie hatte eine Stimme, so brüchig wie die von Tante Lisbeth. Sie redete zu viel, zu eilfertig, auf eine dienernde Weise versuchte sie mir ihre Wünsche mundgerecht zu machen. Ich habe in der Süddeutschen Zeitung ein Dauerinserat geschaltet: Haushaltsauflösungen kostenlos. Fachgerechte Entsorgung inklusive. So blieb ich im Geschäft. Ein bisschen fiel immer ab, etwas Brauchbares, manchmal sogar Rares, das sich in meinem Laden präsentieren ließ. Früher hieß er Gossecs Trödel. Inzwischen firmiere ich als Antiquitäten Gossec, denn in einer gediegenen Stadt wie München verkaufen sich gebrauchte Stücke nur noch, wenn es sich um Antikschätze handelt. Die Anruferin hatte auch keinen Haushalt zur Auflösung anzubieten, sondern nur einen Schuppen, noch dazu in der Nähe von Allershausen. Trotzdem betrieb ich aktiv Selbstüberzeugungsarbeit, malte mir eine Scheune voller antiquarischer Kostbarkeiten aus, die ich nur aufzuladen hätte, und sagte zu.
Als ich mit meinem Mercedes-Bus dort eintraf, empfing mich an der Hofeinfahrt ein halbwüchsiger Junge, ein stämmiger Kerl in knielangen Satin-Turnhosen mit Speckbauch, der mich nach Polizistenmanier mit der Ladefläche rückwärts zu einem Bretterverschlag hin einzuwinken versuchte. Dann holte er seine Mutter, die Frau mit der Tante Lisbeth-Stimme. Schon ein kurzer Blick von der Tür aus genügte. Ein schlauer Bauer hatte sein Holzlager mit Gerümpel vollgeknallt und überlegt, wie er einen Simpel wie mich aus der Stadt herbeilocken könnte, der ihm den Krempel vom Hals schaffen würde. Ich sagte, für Sperrmüll sei ich nicht zuständig, und machte auf dem Absatz kehrt. Auf einen Schlag wurde die Frau ausfällig. Es hat keinen Sinn, mit ordinären Frauen herumzudebattieren. Wäre Tante Lisbeth Onkel Georg gewesen, hätte ich ihm eine runtergehauen. Als ich im Führerhaus meines Busses saß, merkte ich, dass etwas gegen das Blech dengelte. Der Jungpolizist bewarf mich mit Steinen. Ich startete, schlug mit der flachen Hand den ersten Gang hinein und trat das Gaspedal durch. Der Wagen machte einen Sprung, und die beiden brachten sich in Sicherheit. Ich nahm nicht den direkten Weg zur Ausfahrt, sondern querte noch ihre Petunienrabatten neben dem Kiesweg. Man ist ja nicht das Arschloch vom Dienst.
Der schlechteste Fall war eingetreten, aber vollkommen wehrlos war ich nicht. Um den Frust abzufedern, hatte ich einen Besuch bei meinem Freund Hinnerk vereinbart, der in Unterastbach unweit von Allershausen das ehemalige Pfarrhaus bewohnt. Als sie ihm das Haus verkauften, war er noch Herr Rab. Seit sie seinen Vornamen kennen, ist er ein Außenseiter. Als würde ein Rasso Selchbeitl auf einer friesischen Insel Fuß zu fassen versuchen. Geht nicht. Auch deshalb neigt Hinnerk zu Schwermut. Vorsichtshalber lud ich noch zwei Kästen Weißbier im nächsten Getränkemarkt auf. Dann war alles gut: Freitag im August, und ein sonniges, heißes Wochenende stand bevor. Wahrscheinlich hatte ich mich nur deswegen selbst reingelegt, um mir zwei Ferientage auf dem Land gönnen zu können. Kurze Zeit später saß ich auf der Terrasse, trank Weißbier, guckte hinunter auf den Astbach, der durch Felder und Wiesen mäanderte, und ließ mich von den spätsommerlich aggressiven Schnaken zerstechen. Hinnerk stiefelte im Garten herum, der sich weit bis an den Bach hinunter zog, und sammelte Holz. Er schichtete einige Arm voll neben der Feuerstelle auf. Er machte das für mich. Schon der Hominide war tief befriedigt, wenn er abends in ein flackerndes Feuer gucken konnte. Bis die Nacht heraufzog und das Glimmen und Glosen der kokelnden Glut mit einem klaren Sternenhimmel zu harmonieren begann.
„Siehst du das“, sagte Hinnerk.
Hinnerk schob sich ständig mit dem kleinen Finger die Nickelbrille nach oben. Er schwitzte, und so glitt die Brille auf seiner feuchten Nase immer wieder nach unten. Aber das machte ihm nichts aus. Er war beschäftigt, sinnlos zwar, trotzdem muss man sich Hinnerk dabei als einen glücklichen Menschen vorstellen. Er wies auf einen Drahtzaun, der scheinbar zwecklos durch das Gelände verlief.
„Das da“, Hinnerk zeigte auf einen Baum jenseits des Zauns, „das da ist eigentlich mein Apfelbaum.“
„Sieht nicht danach aus.“
„Vor einer Woche“, Hinnerk flüsterte und zeigte auf das Nachbarhaus, „hat Plattner in einer Nacht-und-Nebel-Aktion den Zaun hingestellt. Er wusste, dass ich unterwegs war.“
„Und jetzt?“
„Suche ich die Einträge im Grundbuch zusammen. Was mir fehlt, ist ein Protokoll, in dem wir die Grundstücksgrenze genau festgelegt haben.“
„Und dann?“
„Wird eben prozessiert.“
„Mann o Maus Hinnerk! Das kann Jahre dauern.“
Hinnerk nickte und schaute traurig. Sein strubbeliges blondes Haar war klitschnass. Sein olivgrünes T-Shirt mit den dunklen Flecken war wie ein Schaubild der menschlichen Schweißdrüsendichte am Oberkörper.
„Ich koch dann mal“, sagte Hinnerk und verschwand im Haus.
Drinnen werkelte er vor sich hin. Er machte Kartoffelsalat mit Gurken. Dazu würde es Bratwürste geben. Über dem Feuer gegrillt. Drei Weißbier hatte ich schon intus, und auch sonst war es etwas kühler geworden. Ein sanfter Wind zog über die Hügel. Von meiner Liege aus hatte ich den Bach im Blick, aber seitdem mich Hinnerk darauf hingewiesen hatte, kam mir dieser Maschendrahtzaun immer absurder vor. Widersinnig. Eine Schrunde mitten in dieser schönen Landschaft. Ein Denkmal menschlicher Bosheit und Besitzgier.
Ich wuchtete mich hoch und ging zum Schuppen. Werkzeug und Gartengeräte waren dort aufbewahrt. Das Teil, das ich suchte, lag an die Werkbank gelehnt, der gut ein Meter lange Vorschlaghammer. Ich schulterte ihn und ging zum Bach hinunter. Kricket und Krocket sind beides englische Spiele und für Unkundige nicht leicht auseinander zu halten. Kricket ist, bei allem Respekt, so etwas wie Baseball, während Krocket gern im Garten gespielt wird. Man befördert mit einem Schlaghammer den Ball durch Tore. So ähnlich, leicht und anmutig, haute ich Pfosten für Pfosten des Zauns weg. Schließlich rollte ich das Drahtgeflecht zusammen und zog es vor den Schuppen des Nachbarn. Ich schellte. Herr Plattner öffnete. Plattner war im Feinripp und trug eine der lustig superbunt gefleckten Boxershorts, in denen dicke Männer so gerne Sport treiben.
„Ich soll grüßen vom Herrn Rab“, sagte ich. „Er braucht den Zaun nicht mehr und hat mich gebeten, ihn zurückzugeben.“
Plattner glotzte mich entgeistert an. Ich machte meine Glöcknernummer. Ein wenig bucklig, in den Knien wippend stand ich da, ließ die Armen tief nach unten hängen und den Vorschlaghammer hin und her pendeln. Plattner drückte die Tür zu. Ich hörte Kette und Riegel. Dann ging ich wieder hinüber zu meiner Liege. Hinnerk kam mit der Schüssel voll Kartoffelsalat aus dem Haus.
„Was für ein Blick. Herrlich und ganz unverstellt.“
Hinnerk begriff und küsste mich auf die feuchte Stirn.
2
Sonntagnachmittag bestieg ich meinen alten Mercedes-Bus, um wieder nach Hause zu fahren. Von der Autobahn aus sah ich, dass schwefelgelbe Wolken München umkreisten. Zum Zentrum vorzustoßen, war ihnen noch nicht gelungen. Das konnte dauern.
Als Münchner behilft man sich bei solchen Wetterlagen. Zwangsläufig. Derartige Druckverhältnisse sorgen dafür, dass man schon nüchtern einen so dummen Schädel hat, als sei man besoffen. Deshalb sucht man sich einen schattigen Platz in einem der Biergärten, die bald so überfüllt sind, dass an der Schänke die Maßkrüge ausgehen. Man bemüht sich mit anderen zusammen, die Lücke zwischen gefühlter und tatsächlicher Betrunkenheit zu schließen und den Rausch auf eine solide Grundlage zu stellen.
An der Ausfahrt Schenkendorfstraße war Schluss mit der angenehmen Luftzufuhr von draußen. Spätestens vor der schneckenartig gewundenen Auffahrt auf den Ring musste man die Geschwindigkeit drosseln, sonst landete man im Straßengraben wie die übermüdeten Langstreckentürken, die bei Freimann versäumt hatten, den Ziegelstein vom Gaspedal zu nehmen. In der Stadt waren die Straßen leer. Sogar der Ring. Ferienzeit, viele hatten sich in den Süden aufgemacht. Außerdem war es für draußen zu heiß. Die Sonne hatte den ganzen Tag auf den Steinhaufen draufgeknallt, der abends, wenn die Temperatur eigentlich erträglich wurde, wie ein Kachelofen Hitze abgab. Im Biedersteiner Tunnel umfächelte mich angenehme Kühle. Ein Versprechen auf mehr, und so nahm ich die nächste Ausfahrt zum Biergarten Hirschau. Neben einem BMW-Cabrio war sogar für meinem Bus noch Platz.
So wie hier am Rande des Englischen Gartens, wo man den Eisbach plätschern hören könnte, wenn nicht das dauernde Plopp-Plopp des nahen Tennisplatzes dazwischenkäme, hat man sich die Umgebung vorzustellen, die sich Aloisius, der singende Münchner im Himmel, gewählt hat. Da ist viel aus Holz: die Bäume, die Tische und Bänke, die Fässer und die Stäbe, an denen die Steckerlfische gebraten werden. Natürlich auch die Grillkohle. Ich genoss die friedliche Stimmung und fühlte mich durch das Bier angenehm abgekühlt. Ich beließ es bei einem und ging zum Wagen zurück.
An das Cabrio neben meinem Bus gelehnt, wartete ein ungeschlachter Kerl auf mich. Er richtete sich zu voller Größe auf, als ich mich näherte. Ich warf einen Blick auf das Nummernschild, und sofort war mir klar, dass Ungemach dräute. Fast alle Ebersberger, die nach München hineinbrettern, haben schnelle Autos. Wenn man Pech hat, so wie ich, sieht ein solcher Lackel wie der aus den Fugen geratene Sänger von Dschingis Khan aus. Groß, wuchtig, mit nach unten gezogenem Schnauzer, Lockenmatte den Hals hinunter, aber Ohren frei, deutlich zu fett, zu rotgesichtig und zu blond. Er grinste, als ich kam. Außerdem trug er eine Lederhose im Landhausstil. Sein weißes Hemd war aufgeknöpft, um die Brustwolle zu zeigen, und um den Hals hatte er ein rotes Tuch geknüpft, wie man es auch schwarzen Hunden gerne umbindet.
„Da, schau mal her.“
Er zeigte auf einen Kratzer an seinem Cabrio, der mich so alt wie der Wagen selbst anmutete.
„Und, was machen wir da?“
„Zahlen“, sagte er.
Er hatte seine Hände in die Hosentaschen eingehakt. Der Hirschhornknauf eines Messers schaute heraus. Wahrscheinlich zum Schneiden von Spareribs oder Grillwammerl.
„Wie viel?“
„Mit hundert Euro wäre ich einverstanden“, antwortete er.
Ich beugte mich noch einmal über den Kratzer. Keine Frage, der war uralt. Aber mit dem Trick hatte er sicher nicht das erste Mal abkassiert. Geld versoffen und verfressen. Also nachtanken am Parkplatz bei irgendeinem unbedarften Simpel wie dem, für den er mich hielt. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, trat er einmal mit der Sohle seines Haferlschuhs an meinen Kotflügel.
„Moment“, sagte ich.
Ich öffnete die Tür meines Wagens und klappte das Handschuhfach auf. Dort hielt ich für solche Zwecke eine kurze Ledergerte aufbewahrt, eine Sonderanfertigung für Graf Holbach selig, der damit seine Schäferhunde vertrimmt hatte. Ich zog ihm die Gerte über die ausgestreckte Hand. Er schrie, fluchte und hielt sich den rot aufquellenden Striemen. Ich angelte das Messer aus seiner Tasche und warf es in hohem Bogen ins Gebüsch. Dann packte ich ihn am Halstuch.
„Hau ab und versuch das nie wieder.“
Er rannte zum Biergarten zurück.
„Ludwig, Herrmann – Hilfe!“
Mit dreien konnte ich es nicht aufnehmen. Ich sprang in den Bus, startete und fuhr los. Als ich wieder auf den Ring fuhr, merkte ich, wie mir das Adrenalin das Blut in den Adern vorwärtspeitschte. Der Kupplungsfuß zitterte. Ich war froh, als ich endlich in die Fleischerstraße einbog und meinen Wagen im Hinterhof parken konnte. Hinter meinem Laden sind die zwei Zimmer, die ich bewohne.
3
Warum gibt es keine Löschtaste für solche Peinsäcke und schlechte Gedanken? Schlimm genug, dass sie überhaupt herumlaufen, muss man auch noch an sie denken. Ich hoffte, wenigstens den Abend so angenehm wie die Tage zuvor bei Hinnerk ausklingen lassen zu können, und holte mir aus dem Laden eine Teakholzliege. Ich stellte sie im Hof unter dem Baum auf und legte mich flach. Diese Edelliegen wie neu waren im Moment mein Verkaufsschlager. Das Stück zu fünfzig Euro. Ich hatte die ganze Partie von einem pleitegegangenen Saunaclub im Truderinger Gewerbegebiet übernommen. Auch Fransenschirme bot man mir an. Aber die sahen beschissen aus. Erinnerten an die Frisur von Elton John. Außerdem rochen sie nach dem Fichtennadelschweiß der Sauna.
Alles war ruhig. Bis auf Rübl, der in seiner Garage werkelte. Die grob hochgemauerte Schachtel hatte ein Wellblechdach und eine ehemals grüne Doppeltür, ebenfalls aus Blech. Das Stück war inzwischen eine echte Rarität. In so einer Garage hatte das Mädchen Rosemarie ihren Borgward abgestellt. Dort drinnen hörte man ein ständiges Klopfen, Schaben und Dengeln. Aber Rübl durfte das, ihm gehörte das ganze Anwesen. Früher war seine Autowerkstatt im Hof untergebracht gewesen. Tunen und Lackieren waren seine Spezialität. Das ständige Inhalieren von Lösungsmitteln hatte Rübl halbdebil und vergesslich gemacht. Traurig, aber menschlich ein Gewinn: Aus dem derben Kapo war durch den Schaden ein freundlicher, älterer Herr geworden, der, mit sich und der Welt zufrieden, gerne vor seinem Haus saß. Hin und wieder pfiff er Elvis-Songs. Er grüßte jeden Passanten.
Die Abendschwüle drückte mir auf das Hirn, plättete alles wie mit einem heißen Bügeleisen. Jede Körperfalte schweißfeucht, mein Kopf eine Matschbirne. Ich stemmte mich aus meiner Liege hoch und ging zum Kühlschrank. Ein alter Privileg mit Wackelbein. Schwankte hin und her, wenn man ihn öffnete. Ich holte eine Packung Eistee mit Pfirsichgeschmack heraus und drückte mir den kalten 2,5-Liter-Quader eine Weile lang an die feuchte Brust. Dann erst goss ich mir das Glas voll. Wie immer lag noch ein frisches Päckchen Tabak unter dem Gefrierfach. Draußen wurde die oberste Schicht zu schnell trocken und dürr. Schon meine Mutter hatte ihren Kaffee im Kühlschrank aufbewahrt. Ich drehte mir zwei Zigaretten, steckte die eine sofort an und klemmte die andere hinter das Ohr. Ich gab der Kühlschranktür einen Tritt, der alte Kerl schwankte und begann sofort brummend zu rödeln, um den Kälteverlust auszugleichen. Das bereitete ihm Mühe und dauerte. Wenn er allerdings die Temperatur hinunter gedrückt hatte, machte er zum Abschluss hechelnde Geräusche wie ein Bär, der es endlich geschafft hat, sich einen runterzuholen.
Als ich wieder zu meiner Liege zurückging, lief mir Rübl über den Weg.
„Hallo Herr Rübl, ich bin’s: Gossec. Wilhelm Gossec.“
Ich sagte immer meinen Namen zu ihm. Vielleicht hatte sein löchriges Hirn noch einen Rest Aufnahmefähigkeit. Sollte ich mir im Haus je eine größere Wohnung leisten können, hätte ich dadurch einen klaren Vorteil gegenüber anderen Bewerbern. Rübl nickte grinsend.
„Alles klar, oder?“
Er hielt eine fast ausgerauchte Zigarette zwischen Daumen- und Zeigefingernagel wie in eine Pinzette eingeklemmt, um noch einen letzten, heißen Zug nehmen zu können. Dann schnippte er den Rest auf den Teer. Obwohl er schon lange außer Dienst war, zog Rübl täglich eine weite, blaue Handwerkerhose an, die er mit einem eng geschnallten braunen Gürtel am Leib behielt. Er trug ein weißes Feinripp-Unterhemd, ein scharfer Kontrast zu seinen gebräunten Armen und Schultern. Selbst ohne Hemd hätte es ausgesehen, als trüge er eines: weiße Haut in scharf konturierter Unterhemdform. In seinem Gürtel steckte ein Zettel. Als ich genauer hinsah, bemerkte ich, dass mein Name darauf stand. Ich deutete auf die Nachricht.
„Gossec, das bin ich. Ist jemand für mich da gewesen?“
Rübl schüttelte den Kopf.
„Ein Gossec ist nicht da gewesen.“
Da war ich schon kurz davor, diesem Debilo den Zettel mit Gewalt abzunehmen. Aber Hausbesitzern gegenüber sollte man alle Geduld aufbringen, sie sitzen am längeren Hebel.
„Ist der für mich?“
Ich deutete noch mal auf den Zettel. Erst jetzt schien sich Rübl daran zu erinnern. Er zog ihn aus dem Gürtel und faltete ihn auf. Er runzelte die Stirn und las vor.
„Bitte melde dich doch endlich! Pia. – Keine Ahnung, nie gehört.“
„Von wem haben Sie den Zettel?“
„So ein junger Kerl mit Vespa. Kam hier reingefahren.“
Fortbewegungsmaschinen hinterließen bei Rübl immer einen bleibenden Eindruck. Mehr war nicht zu holen. Aber ich wusste nun Bescheid. Ich ging in meine Wohnung zurück. Da sah ich, was mir vorher schon hätte auffallen können, dass das rote Lämpchen meines Anrufbeantworters blinkte. Noch eine Nachricht von Pia. Allein die Tatsache, dass sie sich gemeldet hatte und dann noch zweimal, bedeutete, dass sie in einer üblen Klemme steckte. Pia Sockelmann war zweiundzwanzig Jahre alt und meine Ziehtochter, Nennnichte – was auch immer, jedenfalls war ich so eine Art Onkel für sie. Aber nur, wenn sie einen brauchte.
Beim ersten Mal verstand ich so gut wie nichts von dem, was mir Pia mitteilen wollte. Zu sehr genuschelt und gelallt, zu viele Silben verschluckt. Letzte Sätze, wie kurz vor dem Hinüberdämmern in eine Narkose. Sie hatte sich mit irgendetwas so zugeballert, dass sie kein vernünftiges Wort mehr zustande brachte. Das Wenige, was ich herausfiltern konnte, klang schlimm. Sie wolle raus aus dieser Scheiße. Sie brauche mich jetzt, ich müsse ihr helfen. Ich wählte die Nummer, die sie durchgegeben hatte. Nichts, kein Anschluss unter dieser Nummer.
Schlimmstenfalls war ihre Nachricht seit zwei Tagen auf meinem Anrufbeantworter. Einen Timer hatte der alte Apparat nicht. Verdammte Hacke! Musste ich nun schon wieder den Arsch für dieses ausgekochte Miststück hinhalten? Dabei war sie für mich verschollen. Zuletzt hatten wir uns vor drei Jahren gesehen. Kurz vor ihrem steilen Aufstieg in den Pophimmel. Damals brauchte sie Geld, und ich borgte ihr welches. Wusste ja ohnehin, dass borgen bei ihr schenken meinte. Seither war sie weg, und ich kannte noch nicht einmal ihre neue Adresse. Ich setzte mich wieder auf die Liege, schloss die Augen und stellte mich erst mal tot.
4
Wie ruhig hätte dieser Abend verlaufen können! Ich rauchte die Zigarette und trank den Eistee zu Ende. Dann stieg ich wieder in den Bus und fuhr los. Zu Iris.
Iris war in den achtziger Jahren aus Schwandorf nach München gekommen, weil sie zum Film wollte. Iris war blond, sah gut aus, hatte jedoch kleine Fehler und große Prinzipien. Sie sprach oberpfälzisch und wollte sich nicht die Bluse aufknöpfen. Deshalb durfte sie in einer Försterserie nur in einer Kleinstrolle als Magd mitmachen, in Kinofilmen spielte sie ein paar Mal die Kellnerin. Die Texte, die sie zu sprechen hatte, waren so lakonisch wie der bayerische Menschenschlag an und für sich: „So ein Sauwetter!“ und „Wohlsein!“ Enttäuscht gab sie alle Karrierepläne auf und lernte Friseuse. Irgendwann machte sie mit einer Kollegin Urlaub in Finale Ligure an der Riviera. Am Strand lernte sie Pierre kennen, einen schwarzen Straßenhändler aus Mali, der Wickelröcke, Sonnenbrillen und Handtaschen verkaufte. Wie seine Kollegen wanderte Pierre den Strand entlang und breitete seine Waren aus, wenn er ein Geschäft witterte. Iris hatte Mitleid. Schwitzend, bepackt wie Mulis schufteten die sich ab, während sie sich wie Madame Pompadour unterm Sonnenschirm pelzte. Iris hatte ein weiches Herz und kaufte einen Wickelrock. Pierre sah ihr an, dass da noch mehr zu holen war. Abends tingelte Pierre mit seiner Gitarre am Lungomare. Dort begegnete ihm Iris wieder. Später schwor sie Stein und Bein, dass es nur eine einzige Unvorsichtigkeit gegeben habe, die zu dem Volltreffer führte, aus dem Pia wurde. Sicher hat die Tochter ihr musikalisches Talent von Pierre geerbt. Und ein wenig von seiner Hautfarbe. Viel mehr ließ sich über ihren Vater auch nicht sagen, denn Iris wusste noch nicht einmal seinen Nachnamen. In Pias Abstammungsurkunde ist der Nachname mit Mondieu angegeben, denn das hatte er mehrfach gestöhnt, als es passierte.
Als ich Iris kennenlernte, hatte sie schon einige ihrer Prinzipien über Bord geworfen, um Pia und sich durchzubringen. Sie arbeitete als Bedienung im Blauen Engel, einer Oben-ohne-Bar. Ursprünglich war ich nur auf den mit Abstand schönsten Busen scharf, fand aber dann Gefallen an einem Familienleben, bei dem ich Papa sein durfte, der mit Mama im Bett liegt und ein hübsches, kaffeebraunes Kind mit Ringellöckchen spazieren fährt. Nach drei Jahren allerdings hatte Iris das Gefühl, dass sie etwas Besseres verdient hatte als einen Trödelhändler. Das erwies sich als Irrtum.
Ich bog in die Dülferstraße ein. Dort in einem heruntergekommenen Sozialblock lebte Iris. Schlimmer als Hasenbergl, wo winters gerne mal die Türen verheizt werden, kann es wohnungsmäßig nicht kommen. Ich klingelte mehrfach, aber niemand öffnete. Ein kleiner, vielleicht elfjähriger Junge mit Ohrring und Haarzöpfchen saß unter den Klingelknöpfen auf der Stufe und rauchte. Ständig schnippte er die Asche mit dem Daumen ab.
„Zu wem willst du denn?“
„Sockelmann.“
Der Junge wies nach gegenüber auf eine Kneipe.
„Hocken in der Tankstelle. Seit heute Mittag.“
Die Luft in der Tankstelle war so rauchgeschwängert, dass man hin und wieder nur tief durchatmen musste, um kräftig zu inhalieren. Sogar die Fensterscheiben schienen innen einen nikotinbraunen Film zu haben. In der Ecke saß Iris vor einem Pils. Wir begrüßten uns. Durch die Sauferei hat sie alles verloren, was sie einst so attraktiv machte. Eine früh gealterte Frau mit geblähtem Bauch und Kastenfigur. Ein Zombie, der versucht, die schöne Iris darzustellen. Ich kam gleich zur Sache.
„Wo steckt Pia?“
„Keine Ahnung. Zu Hause, auf Tournee, im Studio. Mir sagt sie doch nichts mehr.“
„Wo wohnt sie denn?“
Iris blickte sich um. Aus der Toilette kam ein Fettsack geschwankt. Er trug seine Sportkleidung körpernah. Eine Polyesterwurst. Im Gehen war er noch dabei, seinen Schwanz wieder an der richtigen Stelle zu verstauen.
„Pscht“, machte Iris. „Keine Adresse zu ihm. Er versucht sonst, sie laufend anzubaggern.“
Der Fettsack hatte sofort gemerkt, dass es um ihn ging.
„Was will denn der von uns“, fragte er Iris.
„Nur ein paar Auskünfte.“
„Sag ihm, dass das was kostet.“
„Sag ihm, er soll sich raushalten“, gab ich an Iris zurück.
Ich hatte Iris die ganze Zeit über angesehen. Jetzt spürte ich, wie sich der Dicke an meinem Kragen festgekrallt hatte, um mich hochzuziehen.
„Halt’s Maul, sonst häng ich dich an der Lampe oben auf.“
Bei solchen Typen durfte man nicht lange fackeln. Den ersten Schlag versenkte ich in seiner Wampe. Er rumpelte gegen die Holztäfelung, die aussah wie ein Saunaverschlag. Den zweiten setzte ich unters Kinn. Er sackte nach unten weg und kam, abgefedert durch seinen fetten Arsch, auf dem Boden an. Der Kopf fiel ihm zur Seite, und so blieb er ruhig und friedlich hocken. Ich packte Iris an der Hand und zog sie aus der Kneipe. Die anderen Zecher machten erschrocken Platz.
„Ich kann doch den Erwin nicht so sitzen lassen.“
Iris begann zu weinen.
„Pia hat angerufen, sie ist in Schwierigkeiten. Und ich weiß noch nicht mal, wo sie wohnt“, schrie ich sie an.
„Dr.-Friedl-Straße 15.“
Ich zog einen 20-Euro-Schein aus der Tasche und gab ihn Iris.
„Versauf ihn wenigstens alleine, ja.“
Iris sah an sich herunter und rubbelte mit dem Ärmel an ihrem ehemals rosafarbenen T-Shirt, als könne sie es auf die Schnelle noch sauberer kriegen.
„Tut mir leid, ich wusste ja nicht, dass du kommst.“
Ich ging zu meinem Bus hinüber. Auf dem Trittbrett stand der kleine Raucher. Er guckte nach innen, ob es etwas zu holen gab.
„Weg mit dir, Junge.“