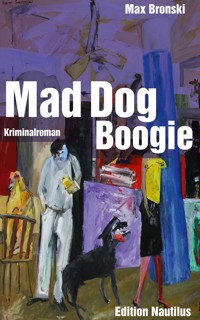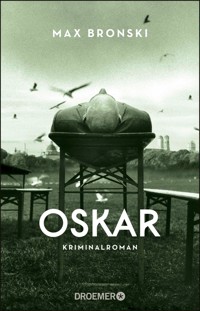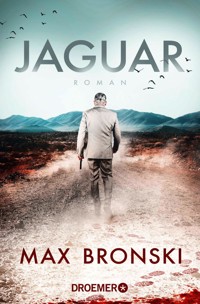
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Raffiniert, rasant, doppelbödig: ein packender Agenten-Thriller um einen internationalen Rache-Feldzug Durch die Willkür des Zufalls geraten zwei junge Männer Ende der 80er-Jahre ins Fadenkreuz der CIA: Ruben Diaz aus San Salvador beobachtet ein Massakers an den jesuitischen Dozenten der Zentralamerikanischen Universität; der Schweizer Santino Marti wird als Tourist in Puerto Rico in ein Mord-Komplott gegen den nicaraguanischen Präsidenten verwickelt. Beide lässt die CIA unauffällig verschwinden. Auf einem Gefängnisschiff im Golf von Mexiko, einer sogenannten »black site«, treffen Ruben Diaz und Santino Marti aufeinander, aus den Leidensgenossen werden Freunde. Bis zu ihrem verbrieften Tod. 2012 werden in Afrika, den USA und Lateinamerika merkwürdige Morde verübt. Die Opfer – ein Entwicklungshilfe-Berater, ein hippieartiger Privatier, ein Fondsmanager – scheint nichts zu verbinden. Doch alle wurden mit dem Zeichen des Jaguar-Gottes Kinich Ahau gebrandmarkt. Und einer von ihnen ist ein ehemaliger CIA-Agent, der in den 80ern an mehreren Geheim-Operationen in Lateinamerika beteiligt war … »Der Jaguar« von Max Bronski ist ein ebenso vielschichtiger wie rasanter Rache-Thriller für alle Fans von Jason Bourne und der Agenten-Thriller von Robert Wilson oder John le Carré.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 326
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Max Bronski
Jaguar
Thriller
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Durch die Willkür des Zufalls geraten zwei junge Männer Ende der Achtzigerjahre ins Fadenkreuz der CIA: Ruben Diaz aus San Salvador und der Schweizer Santino Marti werden auf ein Gefängnisschiff im Golf von Mexiko verschleppt, wo aus den Leidensgenossen Freunde werden. Einer wird sterben, doch dem andern gelingt die Flucht. 2012 werden in Afrika, den USA und Lateinamerika scheinbar willkürliche Morde verübt. Einziger Zusammenhang: das Zeichen des Jaguargottes der Maya, mit dem der Mörder die Leichen brandmarkt. Einer der Toten ist ein ehemaliger CIA-Agent, der in den Achtzigern an mehreren Geheimoperationen in Lateinamerika beteiligt war …
Inhaltsübersicht
Vergib mir mein verrücktes Leben I
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
Elephant Hunt
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
Im Garten der Götter I
Der Sarg des Pharaos
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
Random Walk
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
Jaguarwoman
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
Im Garten der Götter II
Waterfront
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
The Champ I
Hellraiser
The Champ II
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
Die Freunde Bentons I
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
Die Freunde Bentons II
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
Vergib mir mein verrücktes Leben II
1. Kapitel
2. Kapitel
El Salvador muere
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
Fürst der Finsternis
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
Dragonfly
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
Die Freunde Bentons III
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
Comandante Delgado
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
In der Unterwelt
Der Räuber, der seine Beute mit einem einzigen Sprung erlegt
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
Schatten
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
The Warrior
1. Kapitel
2. Kapitel
The Great Wide Open
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
Dämmerung
1. Kapitel
2. Kapitel
Bibliografische Hinweise
Er (scil. der Einzelne) wird in diesem wie auch in vielen anderen Fällen von einer unsichtbaren Hand geleitet, um einen Zweck zu fördern, der keineswegs in seiner Absicht lag. Es ist auch nicht immer das Schlechteste für die Gesellschaft, dass dieser nicht beabsichtigt gewesen ist. Indem er seine eigenen Interessen verfolgt, fördert er oft diejenigen der Gesellschaft auf wirksamere Weise, als wenn er tatsächlich beabsichtigt, sie zu fördern.
(Adam Smith)
Das unbekannte Etwas, das ich suchte, konnte nichts anderes als die Bioelektrizität sein. Das fiel mir eines Tages ein, als ich mir den Vorgang der sexuellen Reibung zwischen Glied und Scheidenschleimhaut im Geschlechtsakt physiologisch verständlich zu machen suchte.
(Wilhelm Reich)
Hey, die Schlitzaugen glauben nicht an Jesus, sondern an Shindurindubindu, fucking hell!
(Larry Hagman)
San Salvador, September 2009
Vergib mir mein verrücktes Leben I
1.
Als die Colonia 22 de Abril in Sicht kam, erhob sich der Bewaffnete im hinteren Bereich des Busses, schob den breiten ledernen Waffengurt zurecht und bezog neben der Fahrertür Position. Das Fahrzeug wurde langsamer und fuhr an die rechte Seite des Bulevar del Ejercito Nacional heran. Der Wachmann beugte sich vor und sah zum Fenster hinaus, um die wartenden Fahrgäste an der Haltestelle zu taxieren. Seine verspiegelte Brille reflektierte das harte Licht des frühen Nachmittags. Dann erst gab er dem Fahrer ein Zeichen, die Tür zu öffnen. Zu seinem Erstaunen schickte sich ein mittelalter, hagerer Mann, den er als Fremden ausgemacht hatte, auszusteigen. Er wirkte äußerlich wie ein Salvadorianer, aber die Art und Weise, wie er seinen Blick über die vorbeiziehende Umgebung hatte schweifen lassen, verriet, dass er hier nicht heimisch war.
Der Wachmann fasste ihn am Oberarm. »Bleiben Sie! Die Gegend ist gefährlich, hier geht niemand ungeschoren spazieren.«
Der Fremde strich sein schlohweißes Haar nach hinten und lächelte. Dann löste er sanft die Hand des Wachmanns von seinem Arm und hielt sie eine Weile lang umfasst.
»Danke. Ich komme zurecht.«
Auf dem Gehsteig drehte er sich nochmals um. »Wir sind alle in Gottes Hand!«
»Alle? Die Colonia zählt bestimmt nicht dazu.«
Der Fremde schüttelte den Kopf. »Gerade die Colonia …«
Er stockte. Gedankenverloren sah er zu Boden. Der Wachmann wartete, bis der Fremde die Wendung fand, nach der er suchte.
»Gott packt den Menschen wie ein Pitbull. Wo er sich hineinverbissen hat, lässt er nicht mehr los.«
2.
Von der breiten ungeteerten Straße gingen Häuserzeilen mit kleinen, schachtelartigen, dicht aneinandergereihten Bauten ab. Die engen Gassen dazwischen trugen keine Namen, nur Nummern. Überall lag Müll, Hunde strichen herum und durchwühlten die Haufen. Alte Frauen, die auf den Stufen vor den Haustüren saßen, boten in Kartons Waren feil, Obst, Kekse und Fladenbrot. Die jungen Leute, Frauen wie Männer, die dem Fremden begegneten, wirkten mit ihren tätowierten Gesichtern wie Angehörige eines fremden Stamms. Niemand grüßte, kein Wort wurde gesprochen, aber alle blickten ihm nach und verfolgten aufmerksam seinen weiteren Weg.
Sein Gang auf dem unbekannten Terrain war tastend, der Blick jedoch unbefangen, er musterte das Viertel und seine Bewohner. Ihm war keine Furcht anzumerken. Eine der Gassen öffnete sich weiter hinten zu einem Platz, der durch Bäume beschattet wurde. Dort blieb er stehen. Er zog einen Zettel aus der Tasche, überprüfte die Angabe darauf und überquerte dann die Anlage, auf der eine Gruppe kleiner Jungen barfuß Fußball spielte. Auf einer Bank lag ein Mann in Bermudashorts und rauchte. Mit dem unbewegten Blick eines Reptils sah er zu, wie sich der Fremde näherte. Als er herangekommen war, sprang er auf, zog sein Messer und winkte ihn heran. Dann wies er auf die Brusttasche des anderen. Der Weißhaarige musterte den Angreifer. Auf dessen nackten Oberkörper war eine Madonna tätowiert, eine Schmerzensmutter mit blutendem Herzen. Der Strahlenkranz ihres Heiligenscheins fächerte sich über die gesamte Brust auf. Da sein Opfer keine Anstalten machte, eine Geldtasche auszuhändigen, machte der Tätowierte einen Ausfallschritt und streckte die Klinge in der Art eines Fechters nach vorne. Unversehens zuckte die Hand des Fremden hervor, er packte den Angreifer am Handgelenk, pflückte ihm mit der anderen Hand die Waffe aus den Fingern und warf sie in hohem Bogen ins Gebüsch. Er ließ ihn nicht los, fasste auch das andere Gelenk und zog den sich sträubenden Widersacher ganz nahe zu sich heran, bis sie sich Auge in Auge, Stirn an Stirn gegenüberstanden. Dann küsste er ihn zunächst auf die linke, dann auf die rechte Wange und gab ihn schließlich frei. Ohne sich noch einmal umzudrehen, ging er seines Wegs.
Endlich erreichte er eine Art Baracke aus Holz und Wellblech. Ein älterer Mann sägte an einem Brett, das er auf zwei Holzböcke gelegt hatte. Sein nackter Oberkörper war feucht von Schweiß, um die Stirn hatte er sich ein Tuch gewunden. Trotz seines Alters wirkte er muskulös wie einer, der es gewohnt war, körperliche Arbeit zu verrichten.
Der Fremde blieb stehen und beobachtete ihn. Schließlich spürte der Arbeitende, dass ihm jemand zusah, er packte das Handtuch, das über einem der Böcke hing, und trocknete sich Gesicht und Oberkörper ab, erst dann wandte er sich dem Besucher zu. Auf der Brust des alten Mannes war ein Lilienkreuz zu sehen, das er sich in Höhe des Brustbeins hatte tätowieren lassen, darunter ein rundes, verschlungenes Symbol, die wie in Stein gehauene Maske des Sonnengottes Kinich Ahau.
Das Gesicht des Weißhaarigen zuckte, er hatte den anderen erkannt. Augen und Mund verengten sich zu Schlitzen, er war überwältigt, und es sah aus, als begänne er zu weinen. »Padre?«
Der Geistliche nickte und ließ das Handtuch sinken, auch er war sichtlich angerührt. »Bist du es wirklich oder träume ich?«
Der Fremde nickte, dann lagen sie sich in den Armen. Auf dem Gesicht des Besuchers, das von tiefen Längsfalten durchfurcht war, spiegelten sich Gleichmut und Friede.
3.
»Ich mache uns etwas zu essen.«
Der Geistliche buk Maisfladen mit Bohnenfüllung, sie setzten sich draußen an den Tisch und aßen. Der Gast wirkte gelöst. Sie sprachen über Musik. Auf vielfache Bitten hin holte der Pater nach dem Essen seine Gitarre. Etwas ungelenk spielte er die Spanische Romanze. Dem anderen liefen Tränen über die Wangen, und er bedeckte seine Augen.
»Geht es dir nicht gut?«
Er schüttelte den Kopf. »Ich bin krank.«
»Was fehlt dir?«
»Krank im Kopf.«
Der Pater wartete.
»Ich habe fast zwei Jahre gebraucht, um hierherzukommen. Nicht, weil ich es nicht gewollt hätte! Ich bin gespalten, ständig verliere ich mich an einen anderen in mir.«
Der Geistliche fasste nach den Händen seines Gasts.
»Ich tue, was ich nicht tun will, ich finde mich wieder, wo ich nicht sein will, und weiß zumeist noch nicht einmal, wer ich bin.«
»Wo kommst du her?«
Er zuckte die Achseln. »Womöglich aus Südafrika.«
»Womöglich?«
»Plötzlich wache ich auf. Ich kann dir ganz genau beschreiben, wie ich auf einem Parkplatz neben einer großen Autostraße im Pick-up sitze. Wie bin ich dahin gekommen?«
»Einbildung?«
»Es gibt diese Straße, es gibt diesen Parkplatz, wahrscheinlich auch den Pick-up. Und ich war noch nie zuvor in meinem Leben an diesem Ort. Diamond Hill Toll Plaza, N4, Parkplatz. Ganz präzise. Wie könnte das Einbildung sein?«
»Um das zu verstehen, musst du mir mehr von dir erzählen.«
»Nicht jetzt. Später.«
4.
Mit dem Abend kam die Unruhe zurück. Die Konturen zerflossen, alles löste sich auf, wurde grau, dann schwarz, wurde eins und machte ihn einsam. Sein Herz pochte hart, als könne es sich damit gegen die Angst zur Wehr setzen, die ihn umklammert hielt. Auf seiner Brust lastete ein Druck, der ihm das Atmen schwer machte. So wanderte er im Kreis umher. Sein Schritt war ausgreifend, durch die abendliche Wärme lag sein Hemd feucht am Oberkörper an. Er musste sich spüren, um sich nicht wieder zu verlieren.
Um ihn herum gedämpfte Lichttupfer, die durch die Bäume und das Buschwerk schienen, als habe man dort Lampions aufgehängt. Immer wieder suchte er die Nähe der Häuser, vereinzelt waren Bewohner herausgekommen, saßen auf Stühlen, die sie nach draußen gestellt hatten, oder auf den Stufen ihrer Häuser. Es roch nach Essen, nach Moder und Fäulnis, nach verbranntem Stoff, nach Abtritt, nach Auspuffgasen. Auch die Stimmen verwoben sich und mit ihnen die Schicksale der Menschen in der Colonia. Schwere Flüche eines Mannes, das Kichern eines Mädchens, das Keifen einer alten Frau, das Schreien eines Kleinkinds, das Tuscheln eines Liebespaars. Ein Feuerzeug flammte auf, ein junger Mann, auf dessen Stirn römische Ziffern tätowiert standen, entzündete einen Joint. Er steckte die Glutseite in den Mund und blies seinem Freund durch das andere Ende den Rauch in die Lungen.
Endlich schien sich der Fremde durch seinen beständigen Marsch um den Platz beruhigt zu haben. Er holte aus seinem Gepäck eine Bibel, entzündete am Tisch eine Petroleumlampe und las. Er rezitierte halblaut, sein Gebetsstrom wand sich wie ein Rosenkranz dahin.
5.
Drei Wochen lang blieb der Gast. Dann, eines Morgens, als der Geistliche Frühstück bereitet hatte und ihn zu Tisch holen wollte, sah er, dass die Kammer leer war. Alles war säuberlich aufgeräumt, in einem Kuvert auf dem Bett hatte er Geld zurückgelassen. Der Pater erschrak, als er die Scheine zählte.
Südafrika, Swasiland, August 2009
Elephant Hunt
1.
»Amerikaner?« Neugierig musterte der schwarze Officer sein Gegenüber. Dem Äußeren nach ein Bure wie aus dem Bilderbuch. Ein massiger Schädel wie der von Ohm Krüger, dazu das niederländisch gefärbte Englisch.
Von hinten ertönte ein Zischen. Ruckartig wandte der Officer den Kopf. Er erkannte Matt Limmerdal vom Servicepersonal der amerikanischen Botschaft. Wortlos klappte der Zollbeamte den Pass zu, reichte ihn zurück und winkte den Nächsten in der Schlange heran.
Der kräftige Mann passierte die Sperre.
»Willkommen, Mr. van Holst! Ich bin Matt Limmerdal von der Botschaft. Guten Flug gehabt?«
Van Holst nickte. Sie schüttelten sich die Hände.
»Kann sich jemand um mein Gepäck kümmern?«
Limmerdal winkte den breitschultrigen Schwarzen heran, der sich im Höflichkeitsabstand hinter ihm gehalten hatte. »Joey betreut Sie und bringt die Koffer zum Wagen.«
Das akkurat in die Hosen gesteckte weiße Polohemd und der breite Ledergürtel wirkten wie eine Uniform. Unter Joeys blauem Blouson durfte man eine Waffe vermuten.
»Welchen Wagen habe ich?«
Limmerdal reichte ihm eine Mappe mit den Papieren und den Autoschlüsseln. »Einen Landrover, wie Sie es wollten. Steht draußen in der Parkzone.«
Van Holst sah auf seine Uhr. »Nach Pretoria, wie lange dauert das?«
Limmerdal wiegte den Kopf. »Totius Street?«
Van Holst nickte.
»Bei der aktuellen Verkehrslage sollten Sie mit fünfundvierzig Minuten rechnen.«
»Vielen Dank für Ihre Bemühungen.«
Limmerdal wirkte irritiert. »Stopp! Unsere Sicherheitshinweise haben Sie doch erhalten?«
»Das wohl.«
»Dann wissen Sie, dass wir bei einer Mission wie der Ihren verpflichtet sind, Ihnen Begleitschutz zu stellen?«
Jovial tätschelte van Holst Limmerdals Oberarm. »Ich weiß Ihre Mühe zu schätzen. Aber ich arbeite grundsätzlich allein. Also packen Sie Ihren Joey wieder ein.«
2.
Die Fahrt auf den großzügig breiten Straßen verlief problemlos, und van Holst erreichte schon nach dreißig Minuten Pretoria. Die Niederlassung von USAID lag noch im Außenbezirk der Stadt. Van Holst reihte sich in die Warteschlange vor einer Ampelkreuzung ein und schaute auf das Display seines Navigationssystems. In einigen Minuten sollte er sein Ziel erreichen.
Er schloss die Augen, um sich für seinen Termin zu sammeln, fuhr dann aber erschrocken hoch, als er das splitternde Bersten einer Fensterscheibe hörte. In Rückspiegel sah er einen Schwarzen mit einem Hammer in der Hand, der auf dem Trittbrett eines Wagens stand. Jetzt beugte er sich ins Innere, wahrscheinlich hatte er Wertgegenstände entdeckt und wollte sie herausfischen. Der Motor heulte auf, der Fahrer beschleunigte so stark aus dem Stand, dass die Reifen zu quietschen und zu qualmen begannen. Er riss das Lenkrad herum und scherte mit seinem Fahrzeug aus der Schlange aus, nahm die Gegenfahrbahn, hielt in hohem Tempo auf die Ampel zu, die immer noch auf Rot stand, und überquerte in waghalsigen Ausweichmanövern die Kreuzung. Jenseits davon fuhr er krachend auf den begrünten Mittelstreifen der belebten Straße auf, trat ruckartig auf die Bremse, sodass es den Schwarzen, der sich die ganze Zeit über an der Wagentür festgeklammert hatte, vom Trittbrett auf den Rasen schleuderte.
Die Schlange setzte sich in Bewegung, hinter ihm wurde gehupt, und van Holst verstand, dass sich niemand veranlasst sah einzugreifen. Als er die Kontrahenten passierte, sah er noch, wie der Weiße seinen Gegner mit einem Schlag auf den Unterarm entwaffnete und sich auf ihn stürzte. Die Entschlossenheit, mit der sich der Autobesitzer zur Wehr setzte, erstaunte van Holst. Burenblut, dachte er noch, dann verlor er die beiden aus den Augen.
3.
Im Büro von USAID spürte van Holst, wie sehr ihm der Jetlag seines zwanzigstündigen Flugs in den Knochen saß. Hier war früher Nachmittag, in Boston ging es bereits auf den Abend zu. Er goss sich einen weiteren Kaffee ein. Dabei waren die Temperaturen im August sehr angenehm, während zu Hause der Sommer auf dem Höhepunkt stand, war es hier frühlingshaft frisch, zwanzig Grad zeigte das Thermometer, und ein laues Lüftchen wehte durch das offene Fenster. Die Themen, die er mit Tom Hite, dem für Swasiland zuständigen Abteilungsleiter, durchging, waren nach gerade mal einer Stunde erschöpft. In der Tat war da nicht viel zu besprechen, Hite wusste nichts, was van Holst nicht zuvor schon hatte recherchieren können. Swasiland musste man eigentlich der Obhut der Salesianer überlassen, das Land war ein Armenhaus. Hite schob seine Unterlagen in die Mappe zurück.
»Rob, mich würde wirklich interessieren, auf welcher Grundlage ihr bei Sirius Consulting eure ökonometrischen Modelle aufstellt. Ich meine, wie rechnet man die Zukunftsaussichten eines Landes durch?«
Van Holst grinste breit, winkte Hite heran und beugte sich über den Tisch, als wolle er sein Geheimnis preisgeben, doch als er sprach, war der kumpelhafte Ton von zuvor verschwunden. »Vergiss es, Tom, diese Karten lege ich vor dir erst auf den Tisch, wenn du Präsident der Weltbank geworden bist.«
Hite spürte, wie Ärger in ihm aufstieg. Er verstand nun, warum dieser massige Kerl mit dem Schädel eines Keilers das Kampfschwein genannt wurde. Sein Ruf gründete sich auf die beeindruckend lange Liste von Projekten, die er abgewickelt hatte, aber mehr noch waren es die Geschichten, die sie umrankten. Van Holst verzehrte eine Schüssel Schafsaugen, trank literweise Wodka, verschaffte dem Neffen des Emirs eine üppige blonde Freundin, die nichts von einer Nutte an sich haben durfte, nächtigte im Regenwald in einem Zelt und besichtigte mit dem Motorschlitten die neuen Ölförderanlagen. Dass seine schwimmenden Kraftwerke wegen der Tierkadaver und des Mülls, die im Wasser trieben, nie funktionierten, Nomaden keine IT-Infrastruktur benötigten oder der Produktion von gentechnisch veränderten, ölfressenden Bakterien immer noch die Zulassung verweigert wurde, tat nichts zur Sache. Rob hatte diese Projekte verkauft, darum ging es. Der Plan war gut, nur die Ausführung mangelhaft.
Tom Hite erhob sich seufzend. »Dann sag mir wenigstens, warum du dich in dieser Sache persönlich engagierst? Ist da was drin?«
»Wenig«, sagte van Holst. »Ich hasse es nur, im Sessel zu sitzen und still zu halten. Außerdem bin ich gerne mal wieder in Südafrika, schließlich habe ich meine Kindheit hier verbracht. Meine Eltern sind damals von den Niederlanden nach Middelburg übergesiedelt. Und meine Schwester lebt immer noch dort.«
»Ich dachte, du seist Amerikaner.«
Van Holst grinste. »Bin ich inzwischen ja auch. Ich dachte, man sieht mir das an?«
4.
Zeitverschwendung, dachte van Holst, als er wieder unten im Wagen saß. Er tippte Middelburg als Reiseziel in das Navigationssystem und fuhr los. Das System lotste ihn bei Hatfield auf die N4.
Es war gut, wenn Leute wie Hite an seinen Methoden herumrätselten. Das machte die Modelle interessant. Dabei war das Elegante daran ihre bestechende Einfachheit. Man wählte als Bezugspunkt eine prosperierende Region, irgendein durch und durch sauberes Äldiswil, das in der Schweiz liegen mochte, auf jeden Fall eine betuchte Gegend mit kontinuierlichem Wachstum. Dann katalogisierte man, was dort alles an Hardware herumstand: Häuser, Stromleitungen, Straßen, Wasser und Abwasser, Bahnhof und Flughafen in der Nähe. Natürlich auch weiche Faktoren, wie Bildung, soziales und politisches System. Schließlich setzte man sich hin und kalkulierte, was ein solches Äldiswil summa summarum gekostet haben musste. Nun kam der entscheidende Transfer, denn man stand in der Pampa, der Wüste oder dem Urwald und hatte umzurechnen, wie viel Geld nötig war, um dieses Äldiswil hier vor Ort nachzubauen. Solche Modelle durften sich nicht mit dem Auspinseln von Menschenbildern verkünsteln, die Unterstellung war sehr einfach: Der betriebsame Schweizer war kein Nationalcharakter, sondern die Gussform eines universellen Homo oeconomicus, der auch in den entlegensten Winkeln der Erde werken und Erträge schaffen würde, wenn man ihm geeignete Voraussetzungen dafür bot. War das riskant? Vielleicht, aber wer sich das nicht vorstellen konnte oder wollte, für den gab es eine klare Ansage: Dann geht eben zurück auf eure Bäume!
Van Holst zog den Aschenbecher auf. Ein rotes Schild mit No smoking please! war eingeklebt. Er zündete sich dennoch eine Zigarette an und fuhr die Scheibe herunter.
Mit einem Gutachten von Sirius Consulting bot sich unterentwickelten Ländern die Chance, an Geld zu kommen. Das war die Mehrzahl, denn wer hatte schon einen gefüllten Topf wie die OPEC-Länder oder andere, die über nennenswerte Rohstoffe verfügten? Wenn sich van Holst auf den Weg machte, gab es zumindest die Unterstützung der US-Regierung, dann wurde ein Entwicklungsfonds von USAID oder sonst ein Budget angezapft, das ein Ministerium zur Verfügung stellte. Van Holst unterzog den Laden einer Bestandsaufnahme, versuchte, Chancen ausfindig zu machen, und rechnete mit seinem Äldiswil-Ansatz das notwendige Investitionsvolumen hoch. Damit wurde er dann beim Internationalen Währungsfonds, bei der Weltbank und anderen befreundeten Ländern vorstellig, deren Regierungen ein Interesse an der Region hatten. In aller Regel floss dann Geld.
Dem jeweiligen Land damit einfach die Taschen zu füllen, wäre natürlich Wahnsinn, keine der beteiligten Organisationen konnte es dulden, dass ihre Mittel verheizt wurden. Also verlangte man eine Garantie, dass das ganze Unterfangen greifbare Resultate erbringen würde. Das Land brauchte IT, Straßen oder Stromleitungen, hatte aber kein ausreichendes Know-how, um so etwas auf die Beine zu stellen. Daher schrieb man in den Vertrag, amerikanische Firmen oder die anderer beteiligter Nationen hätten ihre Expertise einzubringen und die Projekte zu realisieren.
Ein kühler Windstoß fuhr durch das Wagenfenster und zauste van Holsts Haare. Er fühlte sich gut. Bloße Verwaltungsarbeit im Bostoner Büro machte ihn träge, man müllte ihn mit sinnlosen Vorgängen zu. Draußen im Feld gewann er seine Agilität zurück. Er fuhr rechts ran und warf einen kurzen Blick auf die Karte. Mamelodi wäre nur ein kurzes Ausscheren nach Norden, ein Zacken nach oben. Er könnte ein Township kennenlernen, das als musterhaft gepriesen wurde.
Er nahm die erste Abfahrt und fuhr auf den Solomon Mahlangu Drive auf, über den er Mamelodi direkt erreichen würde. Wie sollte man sich einen musterhaften Slum vorstellen? Ein Plumpsklo stank immer wie ein Plumpsklo.
Tatsächlich sah er wenig später auf der rechten Seite Hütten aus Wellblech und zusammengestückelten Holzplatten. Hühnerställe mit Gärtchen. Die hübschen Ziegelbauten zur Linken interessierten ihn nicht, er nahm die Schotterstraße. Anstandslos steckte sein Wagen die tiefen Schlaglöcher weg. Wasser spritzte auf. Nachdem er sich einen Überblick verschafft hatte, hielt er an, um ein paar Fotos zu machen. Hier gab es wenig zu verbessern, da half nur ein Bulldozer, um anschließend solide Häuser hinzustellen.
Jemand klopfte an der Beifahrerseite an die Scheibe. Van Holst ließ sie herunter.
»Hi, ich bin Cindy.«
Ein vielleicht zwölfjähriges Mädchen hatte das Trittbrett erklommen und schaute ins Wageninnere. Sie trug bunte Klämmerchen im Haar. Ihre Wimpern waren getuscht, der Mund war geschminkt. Das verwaschene rosa T-Shirt war weit ausgeschnitten. Auf dem dürren Oberkörper zeichneten sich erste Brustknospen ab.
Van Holst wusste, dass es ein Fehler gewesen war, das Fenster zu öffnen. Er legte keine dürren Kinder flach, auch nicht solche, die lasziv zu gucken gelernt hatten.
»Nichts da«, sagte er. »Weg mit dir!«
Er fuhr die Scheibe wieder hoch. Cindy schrie und schlüpfte rasch aus der Fensteröffnung, um nicht eingeklemmt zu werden. Wütend patschte sie gegen das Glas. Was van Holst jedoch mehr beunruhigte, war, dass sie nicht aufhörte zu schreien. Die Nachbarn kamen aus ihren Hütten gelaufen. Hektisch versuchte er, den großen Wagen zu wenden. Ein erster Stein krachte auf das Blech. Um das Auto herum ballte sich eine Menge zusammen. Endlich hatte er den Landrover auf Kurs gebracht. Van Holst trat das Gaspedal durch. Die Menschen vor ihm sprangen beiseite, einer wurde von seinem Kotflügel erfasst und gegen den Zaun geworfen. Dann brauste er, eine Staubwolke hinter sich herziehend, die Straße hinunter.
Als er endlich wieder den Solomon Mahlangu Drive erreicht hatte, hielt er geradewegs auf die N4 zu.
5.
Van Holst atmete durch. Wer in einem unterentwickelten Land neue Strukturen einziehen wollte, durfte sich nicht von Gutmenschentum leiten lassen. Der karitative Ansatz war ein Todesurteil, niemand konnte dauerhaft mit Geschenken am Leben erhalten werden. Für beide Seiten der Theke hatten klare Regeln zu gelten. Der eine stand am Ausschank, der andere bezahlte. Das war das System. Nur wenn es funktionierte, hatte niemand ein Problem damit, hin und wieder einen Drink zu spendieren. Aber das musste die Ausnahme bleiben.
Van Holst zerrte an seinem Krawattenknoten und öffnete den obersten Kragenknopf. An der Diamond Hill Toll Plaza fuhr er den Parkplatz an. Es wurde Zeit, dass er sich von seiner engen Geschäftskutte befreite. Er holte aus seinem Koffer Kapuzenshirt und Sneakers und zog sich um. Ein schon etwas schäbiger grauer Toyota Pick-up war ihm gefolgt und parkte nun in einiger Entfernung. Misstrauisch beäugte van Holst den Wagen. Er bildete sich ein, ihn schon in Pretoria auf dem Parkplatz von USAID wahrgenommen zu haben. Für mögliche Gefahren hatte er eine Antenne. Die Türen waren geschlossen, niemand war zu sehen.
Van Holst zündete sich eine Zigarette an und behielt das Fahrzeug im Auge. Nach einer Weile entschied er sich doch, den Stier bei den Hörnern zu packen und den Pick-up in Augenschein zu nehmen. Es wäre nicht das erste Mal, dass man ihm hinterherspionierte.
Der Fahrer saß zurückgelehnt, den Hut ins Gesicht geschoben auf dem Rücksitz. Die Arme hielt er an seinen Leib gepresst, als plagten ihn Schmerzen. Van Holst klopfte an die Autotür. Der andere schob den Hut nach hinten und offenbarte van Holst einen verstörten Blick, schmerzvoll, aus einer anderen Welt kommend.
»Alles in Ordnung mit Ihnen?«
Van Holst spürte die Anstrengung, die es den Fremden kostete, Haltung zu zeigen. Er straffte sich, atmete tief durch. Seine Gesichtszüge glätteten sich.
»Geht schon wieder. Hatte einen Anfall. Malaria. Packt einen noch Jahre später am Arsch.«
Er öffnete die Wagentür und stieg aus. »Was gibt’s?«
Er trug kakifarbene Kleidung, sein Gesicht war bleich, aber erkennbar sonnenverbrannt und ledrig. Offenbar verbrachte er viel Zeit in der freien Natur, möglicherweise war er ein Wildhüter.
»Wollte nur feststellen, ob wir uns kennen.«
»Warum nicht? Schon mal auf Safari gewesen?«
Van Holst schüttelte den Kopf. Jetzt bemerkte er, dass die rückwärtige Scheibe des Toyota eingeschlagen war. Deshalb war ihm der Wagen bekannt vorgekommen.
»Waren Sie das heute, den man im Wagen angegriffen hat?«
Der andere nickte. »Kommt hier vor.«
»Was machen Sie? Sind Sie Ranger?«
»So was Ähnliches.« Er hüstelte. »Zurzeit bin ich auf Elefantenjagd.«
»Ach was! Elefanten werden doch schon lange nicht mehr gejagt.«
»Hier gibt es definitiv zu viele. Der Bestand verdoppelt sich alle fünfzehn Jahre. Und kaum jemand macht sich einen Begriff davon, was schon ein einzelgängerischer Bulle für Schaden anrichtet. Man muss ihn aus dem Verkehr ziehen.«
Van Holst wurde hellhörig. Er war selbst passionierter Jäger, am liebsten in Texas, wo aus dem Helikopter gejagt werden durfte, um der Wildschweinplage Herr zu werden. Gerne hätte er ein Riesentier wie einen Elefanten vor die Flinte bekommen.
»Irgendeine Chance, dass man da als Privatmann …?«
Der Ranger schüttelte den Kopf. »Null! Vergessen Sie es! Ein Elefant muss fachmännisch zur Strecke gebracht werden. Und absolut kontrolliert. Man folgt ihm, bis man ihn ganz alleine vor sich hat. Allerdings hilft es manchmal, ihn zu ködern.«
Van Holst bemerkte nun die bauchige Tasche auf dem Rücksitz, die auf den ersten Blick wie eine groß geratene, aber edle Tennistasche wirkte.
»Ihr Gewehr? War es das, worauf der Dieb aus war?«
Der andere nickte.
»Darf ich es mal sehen?«
»Gern.« Er zog den Reißverschluss der Waffentasche auf. Ein schön gearbeiteter Gewehrschaft und ein Doppellauf mit großem Durchmesser wurden sichtbar.
»Donnerwetter!«
Der Ranger streichelte den Schaft. »Nussbaumholz.«
»Kaliber?«
»Wir arbeiten nur mit .577.«
»T-Rex! Mann, das Ding produziert ja einen Rückstoß wie eine Haubitze.«
»Sie scheinen ja Fachmann zu sein. Eine solche Flinte lässt man sich nicht einfach aus dem Wagen klauen.«
Van Holst zündete sich eine Zigarette an und sah den Ranger prüfend an. »Sieht wie eine Westley Richards aus. Wie kommen Sie an so ein Gerät? Kostet gut und gern dreißigtausend Dollar.«
Der Ranger zwinkerte. »Erbstück von Onkel James. War damals für einen Bruchteil des heutigen Preises zu haben.«
Er zog den Reißverschluss wieder zu. »Was dagegen, wenn ich jetzt mein Nickerchen halte?«
»Natürlich nicht. Tut mir leid, dass ich Sie gestört habe.«
»Kein Problem. Übrigens haben Sie vorne am Kotflügel einen Blutfleck. Würde ich an Ihrer Stelle wegmachen.«
»Danke.«
Sie schüttelten einander die Hand.
»Alles Gute für Sie. Wohin geht es?«
»Swasiland.«
Der Ranger tippte an die Krempe seines Huts.
»Waidmanns Heil!«
Van Holst ging zu seinem Wagen zurück. Tatsächlich war am Kotflügel ein angetrockneter roter Fleck. Sah aber eher harmlos aus. Er spuckte auf ein zusammengeknülltes Papiertaschentuch und wischte ihn ab. Dann schnippte er die Kippe weg, nahm zwei Koffeintabletten und setzte sich wieder ans Steuer.
Erst auf der Straße fiel ihm auf, dass er ohne Not sein Reiseziel verraten hatte.
6.
Hinter Donkerhoek verschwanden die Hügel, und die Landschaft breitete sich so flach gebügelt aus, als befände man sich in Nebraska oder sonst wo im Mittleren Westen.
Van Holst geriet erneut ins Grübeln.
Wie zum Teufel verkaufte man Investoren eine solche Klitsche wie Swasiland? Das kleine Land von der Größe New Jerseys war am Arsch. Die Kassen waren leer, niemand wollte ihm weiteren Kredit einräumen. Politisch allerdings war Swasiland loyal, es war Mitglied in allen wichtigen internationalen Organisationen, auch in der Welthandelsorganisation, denn ein Land, das keinen freien Marktzugang garantieren wollte, bekam keinen Cent.
Wer glaubte, von diesem Prinzip abrücken zu können, dem wurde der Kopf gewaschen. Vor einigen Wochen hatte er eine Videokonferenz mit Goodman Simelane abgehalten. Simelane war einer jener jungen Funktionäre, die das US-Förderprogramm durchlaufen hatten und so in den Genuss einer Ausbildung an einer amerikanischen Universität gekommen waren. Simelane brachte ins Gespräch, was er an China verstanden zu haben glaubte, nämlich ob es nicht sinnvoll sei, den heimischen Markt zunächst einmal abzuschotten, bis sich eine eigenständige Wirtschaftskraft im Land entwickelt habe. Van Holst wurde grob. Blödsinn, das Rad noch einmal erfinden zu wollen! Wozu sei es notwendig, eine eigene Zitrusbrause, einen Impala- oder Zebraburger zu entwickeln, wenn man Coca-Cola im Land sitzen habe und Beef Patties in jeder gewünschten Menge beziehen könne, und zwar zu Preisen, die nicht unterboten werden könnten, weil sie marktgestählt seien? Wenn Simelane Ansatzpunkte für geeignete Reformen suche, dann sei es sinnvoller, über das politische System nachzudenken. Man erwarte früher oder später robuste Schritte in Richtung Demokratie.
In Swasiland herrschte eine absolute Monarchie. Das war unschön, aber tolerabel. Der König gab viel Geld aus, zu viel, darüber hinaus war er harmlos. Van Holst hatte eine Einladung von ihm erhalten, sich den Reed Dance anzusehen, der einmal im Jahr im königlichen Kraal stattfand. Zehntausende von kinderlosen, unverheirateten jungen Frauen aus dem ganzen Land machten sich auf, um an dem achttägigen Fest teilzunehmen. Schilfbüschel tragend zogen sie zum Festplatz, wo gesungen und getanzt wurde. Traditionelle Folklore gab es viel in Afrika, aber diese hätte sich das Moulin Rouge nicht besser ausdenken können: Die jungen Frauen waren so gut wie nackt, und der Sinn des Fests war, dass sich der König eine aus den Reihen der jungfräulichen Töchter des Landes zur Frau erwählte.
Van Holst knurrte. Tatsache war, dass Spanner aus aller Welt das Land besuchten, um Ärsche und Titten zu begutachten und terabyteweise Fotos von jungen schwarzen Frauen zu produzieren, die sich gerne auch abseits des Fests für ein wenig Geld in gestellten Posen ablichten ließen. Um das zuzulassen und sogar noch zu fördern, brauchte man die kreuzbrave Mentalität eines Onkel Tom! Oder fände man es etwa im kulturellen Umkehrschluss in Ordnung, eine fotobewehrte Truppe Scheichs über die FKK-Strände der Nordseeinsel Ameland zu kutschieren?
Natürlich konnte das Land Tourismus gut gebrauchen, aber um den Reed Dance zu einem echten Wirtschaftsfaktor zu machen, hätte man die achttägige Veranstaltung zu einer ganzjährigen ausbauen müssen. Tatsache war zudem, dass das Fest nur ein drastischer Indikator dafür war, wie krank das Land darniederlag. Der verstorbene König hatte es auf gut siebzig Ehefrauen gebracht, und so ähnlich stellte sich der männliche Swasi seinen sexuellen Radius vor. Was Wunder, dass das Land die weltweit höchste Aidsrate aufwies. Die Festtage würden wesentlich dazu beitragen, die Ansteckungszahlen hoch zu halten.
Middelburg kam in Sicht, und van Holst fuhr von der N4 ab.
7.
Frauke van Holst hatte im Garten den Tisch gedeckt. Sie bewohnte das Elternhaus. Ihr Bruder spazierte auf dem Grundstück hin und her, betrachtete die Beete, begutachtete die weiß blühenden Kakteen, öffnete die Tür zum Schuppen und klopfte die Holzbalken der Laube ab. Er war lange nicht mehr hier gewesen, Heimweh hatte er nie verspürt, aber jetzt trieb ihn eine Unruhe, nachzusehen, was von früher übrig geblieben war. Sein Vater hatte in den Fünfzigerjahren ein gutes Auskommen als Stahlarbeiter gehabt und für sich und seine Familie ein schönes Anwesen gebaut, ein Ziegelhaus, so wie sie es von den Niederlanden her kannten.
Mit den Erinnerungen, die in Rob van Holst hochstiegen, machten sich ungute Gefühle breit, Beklemmung und Angst vor allem. Ein Gelände voller Fluchten, Verstecken und Höhlen. Manche Gerüche, wie den des modrigen Holzes und der früheren Kleiderkammer, erkannte er sofort wieder. Er spürte die derbe Hand seines Vaters. An irgendetwas war er immer schuld, es galt bloß herauszufinden, woran. Von einer glücklichen Kindheit konnte keine Rede sein. Vor allem seiner Schwester zuliebe war er zurückgekommen.
»Alles noch da?«
Er nickte.
»Setz dich!«
Frauke hatte Biltong zubereitet, gewürztes und getrocknetes Rindfleisch, das sie mit selbst gebackenem Brot und Salat servierte.
»Nur Kaltes! Ich wusste ja nicht, wann du kommen würdest.«
»Ist doch gut. Habe ich seit Jahrzehnten nicht mehr gehabt.«
Tess hatte sich ein hübsches Kleid angezogen und schaute erwartungsvoll auf den Onkel aus Amerika.
»Studierst du schon?«
Statt einer Antwort wandte Tess den Blick zur Seite, zu ihrer Mutter. Frauke lachte.
»Möchte sie. Allerdings in den USA. Wir dachten, du könntest ihr dabei ein wenig behilflich sein?«
Van Holst nickte. So war Familie – wenn es einer zu etwas gebracht hatte, wollten die anderen ein Stück davon abhaben.
Später saß er mit Frauke auf der Terrasse und blickte zu den abgeflachten Buckeln der Berge hinüber, die sich im Dunkeln abzeichneten.
»Kannst du dich nicht ein bisschen um Tess kümmern?«, fragte Frauke. »Sie hat das nie verwunden, dass ihr Vater einfach abgehauen ist. Sie bräuchte eine Chance, wie du, als du in Schottland studieren durftest.«
Van Holst schaute zum ersten Stock hinauf. In Tess’ Zimmer brannte Licht. Wahrscheinlich hatten sie abgesprochen, dass Frauke ihren Bruder beknien würde. Die Widerworte lagen ihm auf der Zunge. Wäre er damals nicht abgehauen, hätte man ihn aus dem Elternhaus geworfen. Und das Stipendium für St Andrews war ihm nicht durch Protektion zugeschanzt worden, er hatte es durch Leistung erworben.
»Na gut, ich komme auf der Rückfahrt noch einmal vorbei, und wir sprechen alles durch.«
»Lieb von dir!« Frauke küsste ihn auf die Wange.
8.
Van Holst schlief sofort ein. Aber bereits nach einer Stunde wachte er wieder auf. In Boston wäre das ein Nickerchen am Nachmittag gewesen. Er richtete sich auf und machte das Licht an. In einem Bücherregal auf dem Speicher hatte er drei verschlissene Bände seiner früheren Lieblingslektüre gefunden: Bomba – der Dschungelboy. Gerührt betrachtete er die Bücher und las den Klappentext: Auf seinen Streifzügen durch den geheimnisvollen Urwald bedrohen Bomba lauernde Leoparden und sprungbereite Jaguare, tückische Giftschlangen und riesige Anakondas, Alligatoren und Piranhas. Feindliche Eingeborene und grausame Kopfjäger, die auf menschliche Beute Jagd machen, sind hinter ihm her. Bomba behauptet sich durch die scharfe Wachsamkeit aller Sinne und durch blitzschnelles Handeln im entscheidenden Augenblick. Sein väterlicher Freund ist ein alter Naturforscher, der ihn als Findling im Dschungel aufgezogen hat. Aber in Bombas Herz ist frühzeitig eine Sehnsucht erwacht, die immer stärker in ihm wächst: Er will das Geheimnis seiner Herkunft ergründen, er will wissen, wer seine Eltern sind und ob sie noch leben.
Das waren die echten Gefühle seiner Kindheit und Jugend! Er verbrachte den Rest der Nacht lesend und in Fantasien schwelgend.
Nach einem gemeinsamen Mittagessen am nächsten Tag fuhr van Holst weiter. Er erneuerte sein Versprechen, auf der Rückfahrt noch einmal zu kommen, aber Tess ließ ihn trotzdem nur mit großem Bedauern ziehen.
Gegen Abend langte er in Mbabane an, die Einreise verlief ohne Schwierigkeiten. Er spürte, dass er übermüdet war, der Nacken fühlte sich steif an, die Augen brannten, und die Zigaretten schmeckten wie angekokeltes Stroh. Nur noch wenige Kilometer mussten bewältigt werden, um seine Unterkunft, das Royal Sun Hotel, im Ezulwini Tal zu erreichen. Dort angelangt, übergab van Holst Wagenschlüssel und die Verantwortung für das Gepäck dem Portier und ließ sich sofort sein Zimmer zeigen. Man hatte ihm eines mit Balkon reserviert. Das Hotel lag an einen Berghang geschmiegt, von wo aus sich der Blick über das Tal zu der hoch aufragenden Bergkette der Mdzimba Mountains öffnete. Er zog die Vorhänge zu, für solche touristischen Besonderheiten war in den nächsten Tagen Zeit genug. Auf dem Tisch lag ein Kuvert mit einer Nachricht des Honourable Minister of Finance Maxwell Nkambule, der van Holst herzlich willkommen hieß. Van Holst faltete die Karte und steckte sie zurück in den Umschlag. Under Secretary Musa Makhubu würde ihn morgen Vormittag zum Reed Dance abholen. Der Höhepunkt der Feierlichkeiten stand an.
Van Holst besah sich im Spiegel. Seine Augen waren rot unterlaufen, seine Hand zitterte. Diese verfluchten Koffeintabletten! Er rekapitulierte, es mussten wohl acht Stück gewesen sein, die er eingeworfen hatte. Auf dem Tisch war eine Flasche Wasser bereitgestellt, van Holst setzte sie an und trank sie leer. Auspissen war immer noch das beste Mittel. Anschließend ging er unter die Dusche, ließ das Wasser auf seinen Rücken prasseln, so kalt, wie er es gerade noch aushalten konnte. Als er sich abfrottierte, war ihm wohler.
Er zog ein frisches Hemd an und ging nach unten. Rund um den Pool waren die Tische für das Abendessen aufgestellt worden. Dort bereiteten Köche ein Mongolian Barbecue vor. Van Holst nahm an der Bar einen Whiskey Soda, spürte, wie ihn der Alkohol langsam zur Landung ansetzen ließ, und legte noch ein weiteres Glas nach. Anschließend stellte er sich am Büfett einen Teller mit rohem Fleisch zusammen, das von den Köchen auf heißen Platten gebraten wurde. Was immer es sein mochte, Kudu, Zebra, Strauß oder Krokodil, es schmeckte ordentlich, dachte van Holst. Allerdings spürte er, wie die Hitze in seinen Körper zurückkehrte. Der Schweiß stand ihm auf der Stirn. Er schob den Teller von sich.
Den Tee, der nach dem Essen servierte wurde, wollte er nun auf keinen Fall zu sich nehmen. Er bestellte ein Bier und setzte sich auf einen der Liegestühle, die auf dem Rasen zwischen Bougainvilleas und Jakarandas bereitgestellt waren. Mit geschlossenen Augen ließ er das Bier in sich hineinrieseln. Seine körperliche Verfassung pendelte zwischen Extremen, einer Müdigkeit, die ihm fast die Füße wegzog, dazu aber einem Puls, der wie von einer Maschine angetrieben pumpte und pochte.
Als er die Augen wieder öffnete, flimmerte das Bild, das er vor sich hatte, wie ein altes Fernsehgerät.