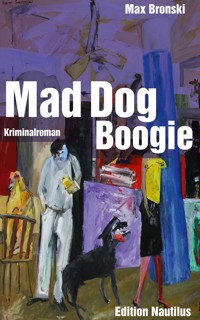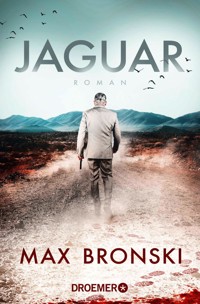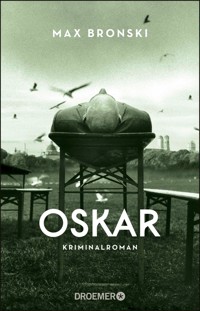Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Nautilus
- Kategorie: Krimi
- Serie: Wilhelm Gossec Bd. 3
- Sprache: Deutsch
München leuchtet in vorweihnachtlicher Pracht. Da gerät selbst der grantige bayerische Mensch in eine friedliche Adventsstimmung. Auch Wilhelm Gossec ist festlich gestimmt, hat er doch für seinen Trödelladen ein paar gute Stücke ausfindig gemacht. Auf dem Heimweg begegnet er einem weinenden Riesenmannsbild in Nikolauskluft. Man kennt sich. Es handelt sich um Vierthaler, den König der Penner, der von einem Altenstift zur Nikolausfeier gebucht wurde. Leider hat er auf dem Weg ein paar Gläschen getrunken, und jetzt weiß er nicht mehr weiter. Gossec hat der Himmel geschickt, er muss diesen Job übernehmen. Nach kurzem Überlegen willigt er ein, und in diesem Moment ist der Advent für ihn gelaufen. Der Ersatznikolaus wird in Bankraub, Kokainhandel und Spendenunterschlagung verwickelt, gerät ahnungslos in eine lebensbedrohliche Situation und ermittelt auf eigene Faust. In sein Visier gerät schnell Berni Berghammer, Sternekoch, geschäftlicher Tausendsassa und skrupelloses Schlitzohr, Liebling der Münchner Schickeria. Sein dritter Fall konfrontiert Gossec mit den Reichen und Schönen Münchens …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 178
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Max Bronski
Schampanninger
Roman
Edition Nautilus
So urteilt die Kritik über „Schampanninger“
Humorvoll, mit Sprachwitz und dem Gespür für die besondere Situation schreibt Bronski seinen Krimi. (…) Max Bronski ist ein unterhaltsamer und spannender Krimi gelungen, der zügig und gut lesbar ist. (Martin Bremer, NDR 1 Bücherwelt vom 1. Februar 2009)
Max Bronski kennt sich aus im „Milieu“ dieses Millionendorfs, in dem alle, auch Mörder, Betrüger und selbst Polizisten irgendwie etwas Gemütliches haben, weit entfernt von der Brutalität und sadistischen Raffinesse bei anderen Krimi-Autoren in anderen Großstädten. Zudem befleißigt sich Max Bronski einer Sprache, die ununterbrochen kabarettreife Sentenzen gebiert, was den Leser eher schmunzeln als sich gruseln lässt. (Sigrid Menzinger, Bayern 2 Diwan vom 6. September 2008)
Autor Max Bronski hat erneut einen München-Krimi geschrieben, der sich erfreulich von der Masse der Neuveröffentlichungen abhebt. (…) Mit viel Ironie und Sarkasmus füttert Bronski sein Werk, dessen Akteure (…) im Grunde ihres Herzens liebenswürdige Zeitgenossen sind… (Martina Jordan, Main-Echo vom 6. September 2008)
“Schampanninger”, Max Bronskis dritter München-Krimi, ist nicht nur für die Landeshauptstädterein ausgesprochen amüsanter Lesestoff: Mit gnadenlosem Blick, böser Zunge und einem Augenzwinkern seziert Bronski die Münchner Promi-Welt zwischen Obdachlosenspeisung und Champagner-Empfang… (Münchner Merkur vom 6. September 2008)
Der Krimi ist unterhaltsame witzige Lesekost. (Marianne de Mestral, P.S. vom 11. Dezember 2008)
Wohlgemerkt: ein Krimi, kein Schlüsselroman. (Focus vom 18. August 2008)
Aber weil Max Bronski seine etwas krachlederne Story ironisch unterfüttert, hat er seinen Lesern einen zumindest ganz prickelnden Münchner „Schampanninger“ eingeschenkt. (Alexander Altmann, tz vom 18. September 2008)
Max Bronskis (…) München-Krimi mit dem schönen Namen „Schampanninger“ ist eine bitterböse und gleichzeitig urkomische Abrechnung mit dem Mythos München im Stil des amerikanischen Kultautors Kinky Friedman. (Oberhessische Presse vom 20. September 2008)
Und es zeigt sich, dass ein guter Krimi gar keine spektakulären Morde braucht und keine Psychopathen mit blutigen Händen. Sondern einfach nur einen Autor, der sich auskennt, wo er seine Geschichten spielen lässt, der pointiert erzählen kann und einen Blick für Menschen hat. (…) Feine Krimikunst! (Ralf Stiftel, Westfälischer Anzeiger vom 23. Dezember 2008)
Es geht um den herrlich schrägen Sound des Ich-Erzählers, um die träfe Milieu-Schilderung, um das ironische Spiel mit der Tradition hartgekochter Burschen. (NZZ am Sonntag vom 27. Juli 2008)
Eine ebenso komische wie spannend-unterhaltsame Geschichte (…) Mit derbem Humor und satirischem Grant nimmt Max Bronski (…) die Verlogenheit und Geldgier der weißblauen Schickeria und verteidigt in der Figur seines alteingesessenen Helden Gossec die bodenständige Münchener Lebensart… (Jochen Rack, SWR 2 Buchkritik vom 27. Oktober 2008)
Ein Krimi, der durch Witz und Ironie besticht… (Saarbrücker Zeitung vom 29. Oktober 2008)
Der Autor ist vielmehr Spezialist für Atmosphäre, eine unverstellte, originelle Sprache und – das kann er am allerbesten – die Beschreibung deftiger, lebensvoller Typen. Der schönste von ihnen ist Gossec. (Joachim Kronsbein, Spiegel Special vom 30. September 2008)
In einem Seminar würde ich diskutieren, ob Bronski nicht die Kriminalhandlung bloß dazu benützt, um seine Sprache und um „München“ zu inszenieren. (…) Bronski arbeitet (…) mit erstklassigen Einfällen… (Franz Schuh, Literaturen vom Oktober 2008)
Die Romane von Bronski leben von Anspielungen (…) und der flotten Geschichte. (Buchkultur vom Oktober/November 2008)
Max Bronski zeichnet auch mit seinem dritten Krimi ein herrlich ironisches Bild Münchens. (kulturnews vom September 2008)
… ein gesellschaftskritischer Krimi mit einem trotz seiner Exzentrik sympathischen Antihelden. Nicht nur im Münchner Raum empfohlen. (Ulrike Weil, ekz-Bücherdienst)
Bronski schreibt auch den dritten Gossec-Band witzig, schlitzohrig und in Liebe zu seinem Helden hin – dem weißblauen Philip Marlowe. (bücher vom Oktober 2008)
Wichtiger ist die Sprache. (…) Wichtiger ist zudem Gossecs Blick auf eine Stadt im Wandel, auf Menschen, Orte, Situationen. (Florian Welle, Süddeutsche Zeitung vom 20. Dezember 2021)
Die dritte Folge einer Reihe, die Bayerns Hauptstadt besser auf den Punkt bringt als so mancher Gesellschaftsroman. (Andrian Kreye, Süddeutsche Zeitung vom 7. August 2009)
Wanna fuck you all night long (Robert Plant)
I wanna make love to you, little girl, twenty five hours a day (Robert Plant)
Exuberance is beauty (William Blake)
1
Zuerst machte es heftig Klack, ein derber Handschlag von Kontakt zu Kontakt, den sonst nur alte Eieruhren beherrschten, die ihre Minuten zu Ende gezählt hatten. Dann ging ein Rauschen durch mein Schlafzimmer.
„Guten Morgen, München!“
Dieser Gruß kam scheppernd von links unten. Mein Radiowecker. Leicht beduselt, aber von preußischem Geist beseelt, hatte ich ihn gestern Abend unter das Bett gekickt. Vorsichtshalber, man kannte sich ja.
„Das ist der Weihnachts-Countdown.“
Erbarmen! Hatten wir in der guten alten Zeit dafür nicht den Adventskalender? Und jetzt wurde auch noch eine Uschi ins Studio durchgeschaltet. Sie rief den geliebten Heimatsender von ihrem Appartement in Kitzbühel aus an. Ich kroch unters Kissen. Was hatte ich denn da für einen Irrsinn von Frequenz eingestellt? Man glaubte sich durch Erfahrung gewitzt, mied alle Sender, die skrupellos Jingle Bells oder George Michael abnudelten, und lief dann völlig unvorbereitet in Uschis alpenländische Verbalschwinger, mit denen sie ihrer Freude auf den heutigen Nikolausabend am Kachelofen Ausdruck verlieh. Im Halbschlaf war man vollkommen machtlos und den Bildern dieses schlechten Traums ausgeliefert. Und danach waren solche Uschis ledrig durchgebräunte Blondinen, die wie Schwestern von Hansi Hinterseer aussahen. Ende Oktober stellten diese grünen Witwen ihre Besuche am Gardasee ein. Nach einer kurzen Trauerphase, die um Allerheiligen herum ihr Ende fand, konzentrierten sie sich dann ganz auf Kitzbühel. Das Gute lag so nah, gerade mal ein Stündchen oder weniger entfernt, je nachdem, was vorne unter der Haube steckte. So lange war man früher mit der Tram nach Pasing oder Grünwald kutschiert. Aus Vernunftgründen leistete man sich irgendwann doch das eigene Appartement in den Bergen, denn abends alkoholisiert wieder zurückzufahren wäre verantwortungslos.
Eines Tages waren die Kinder erwachsen, und man kannte inzwischen das Speckknödel servierende Personal mit Spitznamen. Also blieb man gerne auch die Woche über dort, zumal die Frau unangefochten ihren Pelz durch die Gassen tragen durfte. Allein das machte das Städtchen einzigartig auf der Welt.
„Kitzbühel?“, fragte der Moderator. „Ist das dieser Vorort von München?“
Zu diesem Brüller ließ er die Publikumskonserve johlen. Aber wo war da der Witz? Wenn damit nicht alle Steuervorteile von Uschis Ehemann zunichtewürden, hätte man die Eingemeindung in der Tat längst versucht.
Jetzt wurde Uschi auch noch zeckig. Bald sei Schluss mit der Gemütlichkeit. Die Russen würden in Scharen einfallen.
Man kannte diese Leier! Der Tourismus- oder Heimatverband warnte, schließlich waren prügelharte soziale Gegensätze aufgebrochen. Sogar der gut gesäumte Münchner Kaufmann hatte nicht den Hauch einer Chance und fühlte sich regelrecht gemobbt, wenn der Russe den Rubel brutal rollen ließ und für Anoraks in Goldlamé und die elefantenfußgroßen Fellboots gerne auch das Doppelte oder Dreifache hinlegte.
Und jetzt weiter mit der Tiroler Stubenmusi. Nein, endlich hatte ich das Untier am Schwanz erwischt und zog es zu mir her. Ein Schlag auf den Knopf, und Friede kehrte in meinem Schlafzimmer ein. Teuer erkauft, denn nun war ich glockenwach. Aber das war ja wohl auch der tiefere Sinn dieser ganzen Quälerei.
„Guten Morgen, Gossec.“
Gleich nach dem Kaffee war Babsi am Telefon. Ausgerechnet! Sie war eine dieser Beziehungen, die man sich einfing, wenn man angetrunken und von dumpfem Trieb genasführt, partout eine Frau zu Hause abliefern wollte. Natürlich hatte Babsi damals genauso Schlagseite wie ich, aber einer Frau sagte man im Nachhinein nicht, dass sie nur betrunken war. Man nahm den Suff und seine Folgen gefälligst auf die eigene Kappe und bewahrte Haltung, auch wenn man schon am nächsten Morgen ahnte, dass man diesmal die Arschkarte gezogen hatte. Kerle mit seelischer Hornhaut hatten so eine Affäre schon am Mittag danach vergessen, ich trug lebenslang ein schlechtes Gewissen mit mir herum. Das fiel zwar nicht weiter auf, wurde aber ziemlich akut, als sie anrief.
„Hallo Babsi.“
Ich wusste ja, dass sie in der Zwischenzeit Mutter geworden war und sich vom Vater ihres Kindes getrennt hatte. Jedenfalls heulte sie mir die Hucke voll, dass ihr unmündiges Kind immer noch auf einer Schaumstoffmatratze schlafen müsse. Dafür konnte ich nun auch nichts.
„Du bist doch Möbelhändler. Könntest du ihr nicht mal ein anständiges Bett besorgen?“
Möbelhändler! Ich fühlte mich zwar mehr für Antikschätze und nicht für Gebrauchtmöbel zuständig, aber in diesem Fall konnte man eine Ausnahme machen. Mein Punktestand im goldenen Himmelsbuch würde rasant nach oben schnellen und von den Schuldgefühlen, die mich bedrängten, konnte ich einiges abbauen.
„Ich kümmere mich darum und gebe dir Bescheid, wenn ich was Passendes habe.“
Nach diesem rasanten Angang driftete ich in einen beschaulichen Tag. Genau genommen passierte gar nichts. Kein einziger Kunde verirrte sich in meinen Laden, einzelhandelsmäßig war dieser fünfte Dezember ein so kompletter Ausfall, als hätten sie unser ganzes Schlachthofviertel abgeriegelt. Aber die Weisheit des Ostens und ihre Broschüren waren inzwischen auch schon bei einem Trödelhändler wie mir angekommen, und das nicht nur in dem Separatkasten, in dem ich für meine Kunden Buddhistika bereithielt. Diese Weisheit lehrt uns, dass den westlichen Menschen nichts so sehr aufreibt wie die quälenden Gedanken an gestern und morgen. So saß ich also mit großem Gleichmut auf einer bislang unverkäuflichen Chaiselongue und rauchte meine Selbstgedrehten.
Draußen war aber auch einiges geboten. Es schneite den ganzen Tag über. Flocken, dick wie Bettfedern, schwebten so langsam herab, dass man ihre Schneekristalle im Vorbeifliegen durchzählen konnte. Ich hatte es mir hinter meinem Schaufenster wie vor einem Himmelsaquarium bequem gemacht. Langweilig wurde einem da nie. Man guckte hoch, suchte sich ein besonders wohlgeformtes Exemplar aus und verfolgte seinen Weg nach unten, bis es sich in die weiße Bedeckung einfügte. Danach ließ ich mich von einem Wirbel ablenken, von Flocken, die wieder hochgeblasen wurden und scheinbar nie unten ankommen wollten. Zwischendurch widmete ich mich ihrem Formationsflug und machte Mustergucken, wie es die Norweger tun, wenn sie ihre Pullover stricken.
So verging der Tag. Gegen vier Uhr kam mit der Dämmerung eine Knackkälte, die den Zauber zumindest bis morgen konservieren würde. Heute wurden wir Daheimgebliebenen für vieles entschädigt. München präsentierte sich in weißer Pracht, gegen die diese Uschis und ihr Kitzbühel nicht ankamen.
Ich fuhr auf. Die Hirnregion, die für die Regelung des Alltags zuständig ist, gab Alarm. Ein Hausmeisterehepaar mit dem strikten Auftrag, noch dieses Jahr Ordnung zu schaffen, hatte sich auf meine Daueranzeige in der Süddeutschen Zeitung hin gemeldet, nach der ich Haushaltsauflösungen durchführe. Ich hatte ihnen zugesichert, das Speicherkabuff in der Klenzestraße in Augenschein zu nehmen, um eine Regelung zur Entsorgung des Altmobiliars zu treffen. Ich sperrte meinen Laden ab und ging zu Fuß hinüber.
Eine gute Viertelstunde später stand ich mit dem Ehepaar Rheinthaler in der Abstellkammer. Er hatte sich einige Nikolaus-Glühweine spendiert und nuschelte so Unverständliches wie der Wind, der durch das Dachfenster pfiff. Sie, die beim Aufstieg zum Speicher von einem ständigen Messingpolier- und Geländerwischzwang heimgesucht wurde, versuchte seinen Halbsuff durch kapohaftes Auftreten zu übertünchen. Wer beim Geschäftemachen derart behindert war, lag immer daneben. Ich gab mich unterwürfig, und so glaubte sie, mich gehörig übers Ohr gehauen zu haben, als sie mich für fünfzig Euro zum Abtransport des ganzen Plunders vergatterte. Ich hätte auch dann noch einen guten Schnitt gemacht, wenn ich die fünfzig Euro meinerseits hätte drauflegen müssen. Ein paar Stücke wie das geschnitzte Zigarrenschränkchen oder der sterbende Wildschütz in Öl warteten nur darauf, in meinem Laden feilgeboten zu werden. Und eine pfenniggute Liege für Babsis Kleine war auch dabei.
Mit einer vorteilhaften Abmachung im Rücken und einem guten Geschäft vor Augen tat sich unsereiner mit dem auf den Augenblick ausgerichteten Leben deutlich leichter. Östliche Weisheit nur nachzubeten war einfach, sie in westliche Anschauungen zu gießen hingegen ziemlich kompliziert. Mein Freund Julius, der sich in meinem Buddhistika-Kasten gerne leihweise bediente, hatte mir gelegentlich erklärt, dass ich mir das mit der Schichtung der Lebenszeiten übereinander wie eine Schnitzelsemmel vorstellen müsse. Vergangenheit und Zukunft seien nur Puffer-, allenfalls Sättigungsmasse für das Eigentliche, den Genuss des Augenblicks, das Schnitzel eben.
Als ich die Geyerstraße erreichte, ging der Mond auf, rund, fett und so platzgreifend voll, dass ich mich am liebsten in die Büsche geschlagen hätte, um ihn wie ein Köter anzuheulen. Bei jedem Schritt knirschte die feste Schneedecke. Man hatte auf dem Gehsteig fürs Erste nur eine schmale Gasse geräumt.
Dann sah ich ihn, ein unvergesslicher Anblick, der mir bis heute eingeprägt geblieben ist. Er saß am Ende der Straße auf einem Türmchen aufeinandergeschichteter Pflastersteine: ein weinender Nikolaus. Wie ein geprügelter Schlosshund winselte und wimmerte er in sich hinein. Dazwischen schnappte er röchelnd so heftig nach Luft, dass es ihm den Kopf in den Nacken riss.
Seinem Kollegen hatte ich noch vor dem Tengelmann die weiß behandschuhte Hand geschüttelt und dafür einen Gewürztaler erhalten. Aber der hier war ein anderes Kaliber, ein Mordskerl, nur eben todtraurig. Als ich näherkam, hob er den Kopf.
Jetzt erkannte ich ihn. Unter der Bischofsmaske steckte Lorenz Vierthaler, Häuptling der Penner, Stubenältester im Obdachlosenheim. Ich hatte mir im Gehen mit klammen Pfoten eine Zigarette gedreht, die ich mir anzünden wollte. Als ich vor Vierthaler stand, unterließ ich es. Ich hätte damit Gefahr für Leib und Leben heraufbeschworen. Die Schnapsaura, die seinen weihnachtlichen Vollbart umwölkte, war so intensiv, dass ich wegen der drohenden Verpuffung darauf verzichtete. Die Flammen hätten von seinen weißen Polyesterhaaren rasch Besitz ergriffen und sie wie einen strohrumgetränkten Zuckerhut über der Feuerzangenbowle abgefieselt.
„Gossec, du musst mir helfen“, greinte Vierthaler. „Jemand muss rüber ins Altenstift zur Nikolausfeier.“
Er stöpselte seine Geschichte zusammen. Kompliziert war sie nicht. Mittags war er als blitzsauberer Bischof Nikolaus vom Carl-Löbe-Heim für Obdachlose losgezogen. Die karitativ gesinnten Schwestern des Josepha-Altenstifts wollten Randständigen eine Chance bieten und hatten ihren Bischof dort bestellt. So weit, so gut, aber Vierthaler war schließlich den vielfältigen Versuchungen der Geyerstraße erlegen.
Die Geyerstraße hat der Teufel gesehen. Sie bildet einen Auslass aus dem Edelviertel Glockenbach hinüber zum Schlachthof, wobei man sinnigerweise die Kapuzinerstraße zu überqueren hat. Dort wäre man am Ziel, wenn man dem Kreuzfeuer von Verlockungen widerstehen könnte, mit dem selbst ein versuchungsgestählter Minderbruder wie der heilige Antonius seine liebe Not gehabt hätte. Am Eingang der Geyerstraße lockt das Bachstüberl, in dem man prollig gepflegt ein, zwei Weißbier trinken kann. Zivilisiert verabschiedet man sich, steht dann aber gleich ums Eck vor einem Tag und Nacht offenen Kiosk, wo man sich, weil einem schon wieder knochenkalt ist, einen kurzen Klaren oder einen Underberg im Fläschchen aushändigen lässt. Alle guten Vorsätze kreisen darum, diesmal nicht hineinzugehen, aber wenn man dann vor dem weißblautümeligen Schluckspecht steht, gibt sich einem die Klinke wie von selbst in die Hand. Auch dann käme man noch halbwegs unbeschadet über die Straße, wenn nicht noch der Geier-Horst auf einen warten würde. Hier fügt man sich in sein Schicksal und gibt sich die Kante. Man hockt hinter einem gelbschlierigen Schaufenster, trinkt Pils oder Weißbier, Eierlikör oder deutschen Weinbrand, je nachdem, ob man ein weiblicher oder männlicher Kunde ist. So ähnlich war es wohl Vierthaler ergangen. Verschärfend kam hinzu, dass er nur Geld holen musste, wenn er welches brauchte. Er ging zweihundert Meter weiter zum Rewe, wo er den Leuten die Hand schüttelte und sie um eine Spende für Obdachlose bat. Damit soff er weiter.
Vierthaler hatte sich aufgerichtet und klammerte sich schwankend an mein Revers.
„Gossec, du musst das machen.“
Ich war dem Kerl, der mir mit seiner ungesunden Fahne vor dem Gesicht hing, überhaupt nichts schuldig.
„Die lassen mich nie wieder ins Löbe-Heim rein.“
Aber das Herumzinseln, ob sich Geben und Nehmen irgendwie die Waage halten, macht dich vollends zum Deppen. Die guten wie die schlechten Taten musst du kraftvoll aus dir heraushauen, sonst bist du dein Leben lang ein Schleicher, der mit seiner geizigen Buchführung Hirn und Herz vergiftet und sich per saldo nie traut, besser oder schlechter als andere zu sein. Wer einen solchen Gedanken geradeaus zu Ende denken kann, hat zweifellos die Statur zum Bischof Nikolaus.
„Zieh die Kutte aus und mach deinen Bart ab.“
Vierthaler glotzte mich blöd an, endlich begriff er. Er schälte sich aus seinem Ornat, dann hängte ich das Kostüm an das Verkehrsschild zum Lüften und Ausdünsten.
„Wo sind der Hirtenstab und die Mitra?“
Vierthaler deutete auf den Geier-Horst und zerrte mich hinter sich her. Drinnen gab es ein großes Hallo unter den Saufbrüdern, als wir die Kneipe betraten. Die waren einer wie der andere austrainierte Kerle, die gut und gern sechs Stunden täglich ihren Arsch in Kneipen platt saßen. Sie hatten alle dieselbe Physiognomie, diese ausgeleierte Säuferfresse mit der gelbbraunen Gesichtshaut, einem Farbton, in dem auch Theke, Stühle, Wände, Vorhänge und Fenster gebeizt waren. Unter dem Gelächter und Gejohle dieser Alkchinesen bestellte ich mir einen Pfefferminztee. Vierthaler bedeutete seinem Freund Horst hinter der Theke mit gönnerhafter Geste, dass alles auf seine Rechnung gehe.
Wir besprühten meinen Bischofsumhang mit einem Fichtennadelspray, weil Nikoläuse in der Regel aus dem Wald und nicht aus der Kneipe kommen, und schließlich war ich so weit. Die Alkchinesenfraktion bescheinigte mir, eine Eins-a-Figur zu machen, und so zog ich los.
2
Schon beim Überqueren der Kapuzinerstraße fasste ich volles Vertrauen zu meiner Maske. Vielleicht wäre es einem Bischof angemessener gewesen, einen Ampelübergang zu benutzen, ich hatte jedoch in alter Gewohnheit die Direttissima genommen. Respektvoll verlangsamten die Autos ihre Geschwindigkeit und winkten mich durch. Um mich noch ein wenig zu sammeln, Zeit genug war zudem, spazierte ich um den Block zur Isar hin.
Die Grünanlagen waren menschenleer, weit und breit war niemand zu sehen, und so entschloss ich mich, meine von Lampenfieber und Kälte angegriffene Blase zu entleeren. Ich stellte mich hinter einen Baum. Aus der dunstigen Dunkelheit der Isarauen schälte sich nach und nach ein Langläufer heraus. Der Sportler kam vom Flaucher in zügigen Skatingschritten und hatte einen Rucksack bei sich. Auch auf der kleinen, wenig befahrenen Sackstraße, die zu den Anlagen führt und mit reichlich Schnee bedeckt war, blieb er auf seinen Skiern.
Am Stadtbach hatte er sein Auto abgestellt. Behände sprang er aus der Bindung, schnallte Ski und Stöcke zusammen, schob sie in den Kofferraum und warf den Rucksack hinterher. Interessiert hatte ich zugesehen, während ich mich wieder einpackte. Nach dem sportlichen begann nun der seltsame Teil dieser Darbietung: Hastig zerrte er Pudelmütze und Skibrille vom Kopf, stopfte beides in die Seitentasche seines Anoraks, zog ihn aus, knüllte ihn zusammen und warf das Bündel in eine Bachabzweigung, die in die Isar hineinstrudelt.
Ich trat hinter den Baum, um nicht bemerkt zu werden.
Aus seinem Wagen holte er eine Jacke, die auf die Entfernung wie ein Seemannszweireiher wirkte, und setzte eine an den Seiten hochgerollte Strickmütze nach Art der Matrosen auf. Dann stieg er ein und fuhr los. Erst im Fahren blendete er das Licht auf, und die Scheinwerfer leuchteten mich für einen kurzen Moment hinter meinem Baum stehend an. Als wäre er erschrocken, trat er auf das Gaspedal. Im Vorbeipreschen erhaschte ich einen kurzen Blick durch das Seitenfenster seines Opels und meinte einen älteren Mann mit buschigen Augenbrauen und einem Schnauzer ausmachen zu können. Die Einfahrt in die Wittelsbacherstraße nahm er mit Anlauf, wahrscheinlich, um nicht anhalten zu müssen. Zwar war dort gestreut, aber der Verkehr hatte schon tiefe Spurrillen gegraben und die Schneedecke aufgebrochen. Er durchpflügte die Schneewellen, riss auf der anderen Straßenseite das Steuer herum, beschleunigte wieder, sodass der Wagen in einem Powerslide herumgezogen wurde. Dann fuhr er stadtauswärts davon.
Was zum Teufel hatte das zu bedeuten?
Kurze Zeit später sah ich klarer. Aus einer einzelnen fernen Polizeisirene waren rasch viele geworden. Schon als ich den Roecklplatz überqueren wollte, geriet ich in eine Gruppe von Beamten, die mich zur Personalfeststellung festhielten.
„Ihren Ausweis bitte!“
„Werden jetzt auch schon Bischöfe festgenommen?“
Die Jungen waren vollkommen humorlos. Ich musste Bart und Mitra abnehmen, um die Ähnlichkeit mit meinem Passfoto herstellen zu können. Dann gaben sie auch noch meine Daten über Funk durch.
„Was ist denn passiert?“
„Dazu dürfen wir nichts sagen. Schauen Sie halt nächster Tage in die Zeitung“, sagte der Beamte.
Es ist schon ganz anderen Helden widerfahren, dass sie nicht ans Ziel kommen konnten, weil sie einfach nicht die richtigen Fragen gestellt haben. Man hätte es bei mir ja mal versuchen können! Aber von nichts kommt nichts, ich bin nun mal keiner von denen, die zu sabbern beginnen, wenn sie den Herren von der Funkstreife eine Information stecken könnten.
Zumal als Nikolaus beherrscht man sich und wahrt die Contenance. Man ist mehr für die guten Taten zuständig und nicht als Krampus unterwegs.
Ich hob grüßend meinen Stab und zog Richtung Josepha-Altenstift los.
3
Schwester Adeodata kam aus der Küche herbeigeeilt, wischte sich im Gehen an der weißen Schürze ab und begrüßte mich. Die Haut ihrer Hände war hart und rissig. Die zehrende Arbeit war ihr auch sonst anzumerken. Leicht gebückt führte sie mich in ihr Büro. Verblüfft sah ich mich um. Der Raum wirkte, als hätte man das Kontor in Puckis Mädchenzimmer verlegt. An der Wand klebten Tierbilder und Postkarten. Wo die Akten in den Regalen Lücken gelassen hatten, waren Figürchen drapiert, vorwiegend Clowns und Putten. Ich setzte mich. Noch bevor ich auf der Sitzfläche angekommen war, zog sie mit rascher Bewegung einen braunen Stoffbären an sich.
„Da haben wir ja noch mal Glück gehabt, nicht wahr, Tim-Bär?“
Sie setzte sich den schon etwas räudigen braunen Gesellen auf den Schoß. Ich musterte sie. Ihr Gesicht war durch die Haube wie in einen Rahmen gespannt. Welcher Pegelstand geistiger Gesundheit bei ihr anzusetzen war, erschloss sich einem Außenstehenden nicht auf Anhieb. Dann klingelte jedoch das Telefon, und Adeodata gab eine eindrucksvolle Probe ihrer Lebenstüchtigkeit. Ihr Ton wurde geschäftsmäßig, die Rechte klickerte währenddessen über die Computertastatur. Wer das so locker rüberbrachte, hatte allenfalls einen leichten Sprung in der Schüssel. Sie war zwar schon etwas runzlig, aber ihre Augen strahlten fast jugendlich klar. Damit war auch ihr Wesen bezeichnet. Beim Arbeiten konnte sie tüchtig hinlangen, ansonsten pflegte sie eine juvenile Mädchenhaftigkeit.
„Wie viele werden es denn heute Abend sein?“
„Sicher neunundneunzighundert.“
„Wie viel?“
Schwester Adeodata stimmte etwas an, was vor gut dreißig Jahren einmal ein glöckchenhelles Lachen gewesen war. Schalkhaft bog sie ihren Oberkörper zurück. Einem testosterongesättigten Kerl wie mir ging diese Jungmädchentour ziemlich auf den Senkel.
„Ich sag das immer so, wenn es ganz, ganz viele sind.“
Du meine Güte, musste sie denn alles in ihrer kindlichen Teddybären-Sprache ausdrücken? Was für ein Glück, dass Vierthaler ausgefallen war. Spätestens jetzt hätte er auf dem Absatz kehrtgemacht und wäre wieder im Stübchen eingecheckt. Sie reichte mir ein eng beschriebenes Blatt.
„Fürs goldene Buch“, sagte sie.
Die Sündenliste also. Frau Bierlein sagte schlimme Namen zu Frau Puchner. Frau Gratzl wollte nie ihre Schokolade teilen. Frau Michelsteiner wurde beim Origamifalten so grantig, dass sie den Storch ihrer Nachbarin zerknüllte. Undsoweiter undsoweiter. Hin und wieder Delikte, mit denen auch unsereiner etwas anfangen konnte, wie, dass Frau Steinle ihrer Mitbewohnerin ständig den Cognac wegtrank.
„Und Männer gibt es keine hier?“, fragte ich.
Schwester Adeodata lachte scheppernd wie ein Klingelbeutel.
„Mit den Männern haben wir es hier nicht so.“
Dann legte sie mir ihre verwitterte Hand auf den Unterarm.
„Aber ein paar gibt es schon. Und natürlich den Herrn Pfarrer.“
„Aha. Gehört der auch dazu?“
Sie sah mich strafend an. Gerne hätte ich noch weiter gestichelt, aber man soll in Gegenwart gelebter Keuschheitsgelübde nicht herumledern. Ich sparte mir deshalb den Einwand, dass es ihr gar nicht erlaubt war, sich den Herrn Pfarrer als Mann vorzustellen, denn das wäre nichts weniger als Unkeuschheit in Gedanken gewesen. Sünde eben.
„Kommen Sie, sagte sie. Es ist Zeit.“
Bühne frei, dachte ich. Hinterher würde ich Frau Steinle um einen Cognac anhauen.