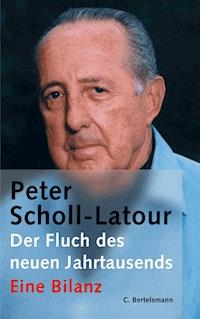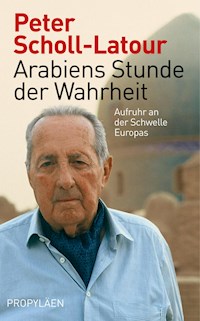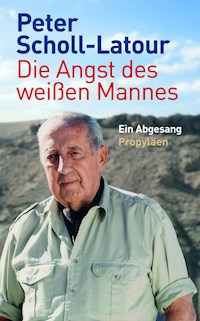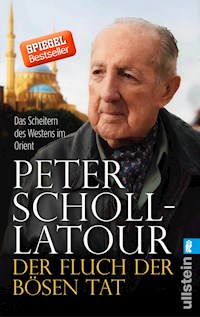9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Peter Scholl-Latour kennt Indochina wie kaum ein anderer, er ist mit allen Ländern zwischen dem Golf von Bengalen und dem Golf von Tonking vertraut: Vietnam, Kambodscha, Laos, Thailand, Burma und Singapur. Außerdem kennt er den mächtigen Nachbarn China. Seit er 1945 an Bord eines französischen Truppentransporters zum ersten Mal dorthin reiste und Augenzeuge der indochinesischen Tragödie wurde, hat er seine Erlebnisse und Erfahrungen zu einer Folge eindrucksvoller Bilder verdichtet. Eine Reportage höchsten Ranges, erfüllt von scharf umrissenen, ungeheuer lebendigen Figuren, bewegt von der Turbulenz der Ereignisse. "Ein Abenteuerbuch, das zugleich ein Lehrbuch für angewandte Politik ist." Frankfurter Allgemeine Zeitung "Das ist das beste deutsche Indochina-Buch." Süddeutsche Zeitung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Das Buch
Was hat sich in den Ländern Indochinas seit Ende des Zweiten Weltkrieges wirklich ereignet? Peter Scholl-Latour kennt die Region wie kaum ein anderer, er ist mit allen Ländern zwischen dem Golf von Bengalen und dem Golf von Tonking vertraut: Vietnam, Kambodscha, Laos, Thailand, Myanmar und Singapur. Außerdem kennt er den mächtigen Nachbarn China. Seit er 1945 an Bord eines französischen Truppentransporters erstmals dorthin reiste, hat er die Stationen einer nicht endenden Tragödie miterlebt. Die Beobachtungen und Erfahrungen jener Jahre haben sich in diesem Buch zu eindrucksvollen Bildern verdichtet. Der Autor bietet eine Reportage höchsten Ranges, in der Menschen und Ereignisse, aber auch die Exotik dieser Länder lebendig werden und in der sich Zusammenhänge und Einsichten wie von selbst ergeben.
Der Autor
Peter Scholl-Latour, geboren 1924 in Bochum. Promotion an der Sorbonne in Paris in den Sciences Politiques, Diplom an der Libanesischen Universität in Beirut in Arabistik und Islamkunde. Seitdem in vielfältigen Funktionen als Journalist und Publizist tätig, unter anderem als ARD-Korrespondent in Afrika und Indochina, als ARD- und ZDF-Studioleiter in Paris, als Programmdirektor des WDR-Fernsehens, als Chefredakteur und Herausgeber des Stern und als Vorstandsmitglied von Gruner + Jahr. Seine TV-Sendungen erreichen höchste Einschaltquoten, seine Bücher haben ihn zu Deutschlands erfolgreichstem Sachbuchautor gemacht.
Peter Scholl-Latour verstarb am 16. August 2014.
Von Peter Scholl-Latour sind in unserem Hause außerdem erschienen:
Die Welt aus den Fugen
Arabiens Stunde der Wahrheit
Die Angst des weißen Mannes
Der Weg in den neuen Kalten Krieg
Zwischen den Fronten
Rußland im Zangengriff
Koloß auf tönernen Füßen
Weltmacht im Treibsand
Kampf dem Terror – Kampf dem Islam?
Peter Scholl-Latour
Der Tod im Reisfeld
Dreißig Jahre Krieg in Indochina
Mit einem aktuellen Vorwortdes Autors
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Lizenzausgabe im Ullstein Taschenbuch1. Auflage September 2013© Deutsche Verlags-Anstalt GmbH, Stuttgart 1979Vorwort zu dieser Ausgabe: © Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2013
ISBN978-3-8437-0555-4
Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, MünchenTitelabbildung: FinePic®, München (Landschaft) und ullstein bild – ddp (Autorenfoto)
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden
eBook: Pinkuin Satz und Datentechnik, Berlin
Vorbemerkung
Dieses Buch ist aus der Erinnerung geschrieben und gibt ein persönliches Erlebnis wieder. In dreißig Jahren Indochina habe ich die Erfahrung gemacht, daß die subjektive Berichterstattung oft die ehrlichste Methode ist, der Wirklichkeit oder – wenn man vor dem großen Wort nicht scheut – der Wahrheit näherzukommen.
P. S.-L.
Inhalt
Vorbemerkung
Vorwort zur Neuausgabe von 2013
DER ERSTE INDOCHINA-KRIEG: Die Franzosen
Ihr fahrt in die falsche Richtung: An Bord der »Andus«, Ende 1945
Buddha auf dem Tiger: Cochinchina, Anfang 1946
Onkel Hos Pakt mit dem französischen General: Haiphong, im Frühjahr 1946
Das neue Gesicht des Krieges: Saigon, Anfang 1951
Der Edelmann und die Hiobsbotschaften: Hanoi, Anfang 1951
Der streitbare Bischof: Phat Diem, 1951
An der Grenze Chinas: Lai Tschau, 1951
Nach der Niederlage von Dien Bien Phu: Hanoi, im Sommer 1954
Bei den letzten Außenposten: Son Tay, im Sommer 1954
Stellung im Reisfeld: Auf der Nationalstraße Zehn, im Sommer 1954
Das letzte Gefecht: Hung Yen, im Juli 1954
Gefangenenaustausch: Hai Thon, im Sommer 1954
Flug über die Demarkationslinie: Zwischen Hanoi und Saigon, im Sommer 1954
Auftakt einer neuen Tragödie: Saigon, im Sommer 1954
DER ZWEITE INDOCHINA-KRIEG: Die Amerikaner
Le sourire khmer: Kambodscha, im Frühjahr 1965
Der amerikanische Stil: Vietnam, im Frühjahr 1965
Bei den Marines: Vietnam, 17. Breitengrad, im Herbst 1966
Victor Charlie will sich nicht zeigen: Kim-Son-Tal, im Herbst 1966
Die Gipfelkonferenz zählt die Tage des Vietcong: Manila, im Herbst 1966
Auf der Suche nach der verlorenen Zeit: Laos, im Herbst 1966
»Zu ihrer Rettung vernichtet«: Vietnam, im Herbst 1967
Bereit für die Revolution: Kambodscha, im Frühjahr 1970
Auflösung und Flucht: Hue, Ostern 1972
Die Vietnamisierung der Särge: Saigon, im Frühjahr 1972
Opium und Geheimdienst: Goldenes Dreieck, im Sommer 1973
Pol Pot ante portas: Kambodscha, im August 1973
Gefangener des Vietcong: Südvietnam, im August 1973
Fieberträume auf Bali: Bali, im März 1975
Die letzten Tage von Saigon: Saigon, im April 1975
Indochina, mon amour: Im Flugzeug, Ende April 1975
DER DRITTE INDOCHINA-KRIEG: Die Chinesen
Umerziehung und neue Fronten: Ho-Chi-Minh-Stadt, im August 1976
Sparta am Roten Fluß: Hanoi, im August 1976
Der Feind aus dem Norden: Im nördlichen Grenzgebiet Vietnams, August 1976
Skorpione in einer Flasche: Hanoi, im August 1976
Erdbeben in China: Peking, Ende August 1976
Der Stellvertreter-Krieg in Kambodscha: Kambodschanisch-thailändische Grenze, im Februar 1979
»China packt die vietnamesische Schlange am Schwanz«: Bangkok, im Februar 1979
Nachschub für die »Roten Khmer«: Kyon Yai, Ende Februar 1979
Cocktails und Bonzen im roten Laos: Vientiane, im März 1979
Der verlassene Königsweg: Pakse, im März 1979
Krisenstimmung am Mekong: Vientiane, im März 1979
Bilanz eines begrenzten Krieges: Hongkong, im März 1979
Der Drache und der Polarbär: Peking, im März 1979
Zu Gast bei Sihanouk: Peking, im März 1979
Wandzeitungen und Haute Couture: Peking, im März 1979
Der Indochina-Krieg dreht sich im Kreise: Kunming, im März 1979
Gefährten seit dreißig Jahren: Pan Qi, im März 1979
Marx und Mohammed: Kunming, im März 1979
Epilog in Europa: Paris – Bonn, im August 1979
Nachwort zur Taschenbuchausgabe 1992
Chronik des Indochina-Krieges
Vorwort zur Neuausgabe von 2013
Im Laufe meines langen Lebens habe ich mir einen Sport daraus gemacht, sämtliche Länder dieser Erde zu bereisen. Das ist mir auch gelungen, mit Ausnahme von ein paar Atollen im Pazifik und ein paar winzigen Eilanden der Karibik. Ich war stets auf der Suche nach der Authentizität fremder Kulturen und den Spuren ihrer oft brutalen Exotik. Die letzte Lücke wurde geschlossen, als ich vor wenigen Jahren die ehemals portugiesische Inselhälfte von Timor, die Republik Timor Leste, erforschte.
Immer wieder wurde mir die Frage gestellt, wo ich mich denn am wohlsten gefühlt, welche Region mich am tiefsten beeindruckt und in ihren Bann gezogen hätte. Die Antwort war stets die gleiche, und sie kam immer spontan: »Indochina, mon amour«, der Titel eines Kapitels des vorliegenden Buches, der häufig plagiiert wurde. In Frankreich gilt der Spruch: »On revient toujours à ses premières amours« – Man kehrt stets zu seiner ersten Liebe zurück, und das dürfte bei mir für jene einst französischen Besitzungen am Mekong und am Roten Fluß gelten, deren Faszination ich als junger Mann erlegen war. Ähnlich ist es wohl auch dem englischen Autor Graham Greene ergangen, als er den Stoff für seinen »Stillen Amerikaner« sammelte.
Paradoxerweise waren selbst die Soldaten des französischen Expeditionscorps diesem Charme verfallen, als sie – in tragischer Verkennung des Zeitenwandels – in den Dschungeln und Reisfeldern von Vietnam, Kambodscha und Laos einem verspäteten imperialen Traum nachjagten und dabei unter schweren Verlusten scheiterten. »Le Mal jaune« hat Jean Lartéguy, ehemaliger Para-Offizier in Indochina, seinen persönlichen Rückblick überschrieben. Damit war nicht irgendeine tropische Krankheit gemeint, sondern die schmerzliche Nostalgie, mit der die Veteranen dieses sinnlosen, aber romantischen Abenteuers in Fernost gedachten, als sie – wenige Jahre nach der Niederlage von Dien Bien Phu – in den trostlosen Schluchten des Atlas in die blutigen Exzesse des Algerienkrieges verwickelt wurden.
Historische Bedeutung und die angespannte Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit sollten die ehemaligen französischen Kolonien in Ostasien erst gewinnen, als das spärliche Truppenaufgebot, über das die IV. Republik verfügt hatte, durch die kolossale Streitmacht der USA abgelöst wurde, die eine angeblich von Hanoi ausgehende Ausbreitung des Kommunismus im Keim ersticken sollte. Die Präsidenten Eisenhower und Kennedy waren dem Irrtum erlegen, die revolutionäre marxistische Botschaft Ho Chi Minhs könne bis nach Indien ausstrahlen und – einem Domino-Effekt gehorchend – die brodelnden Menschenmassen des gesamten südasiatischen Kontinentalblocks gegen den Westen mobilisieren.
Mit dem Einsatz von einer halben Million GIs und einer Bombardierungsintensität, die den ungeheuren Vernichtungsaufwand des Zweiten Weltkrieges übertraf, würden die USA den Aufruhr der fanatisierten gelben Zwerge Südostasiens binnen weniger Monate zerschmettern, so lautete damals die Überzeugung des Pentagons und der weltweiten Medienlandschaft. Wer hätte damals – zumal in Deutschland, das die zermalmende Wucht amerikanischer Kriegführung an den Stränden der Normandie erlebt hatte – verstehen können, daß das Eingreifen der USA in den begrenzten Raum zwischen dem siebzehnten Breitengrad und der Südspitze von Camau in einem »Quagmire«, einem Sumpf versacken würde? Wer hätte ahnen können, daß am Ende eines wenig glorreichen Engagements von fast zehn Jahren die schmähliche Flucht der Amerikaner aus ihren letzten Quartieren von Saigon stehen würde? Als ich – auf Grund meiner intensiven Erfahrungen im französischen Indochina – schon während der ersten Phase nach der Landung der US-Marines in Danang in meiner Berichterstattung ernsthafte Zweifel am Erfolg dieses gigantischen Unternehmens äußerte, stieß ich auf Kritik und Spott. Damals übte ich zum ersten Mal die Rolle des einsamen »Rufers in der Wüste« aus, des unkonventionellen Abweichlers von der vorherrschenden Meinung, der ich mein ganzes Leben lang treu geblieben bin und in der ich selten widerlegt wurde.
Die Magie Indochinas hat in meinem beruflichen und auch privaten Leben entscheidend nachgewirkt. Wenn sich nicht neuerdings Ströme von Touristen über dieses entzauberte Wunderland ergössen, könnte ich mir sogar vorstellen, in einem verwunschenen Gehöft am Ufer des Mekong meine Tage zu beschließen. Aber das würde voraussetzen, daß sich die grandiose Unberührtheit und freundliche Schicksalsergebenheit der Eingeborenen erhalten hätten, die nun nur noch in meiner Phantasie weiterleben. So bleibt mir wenigstens als flüchtiger Glücksmoment mein letzter Aufenthalt im wiedererstandenen Stadtzentrum von Hanoi erhalten. Dort hatte ich mich als einsamer Europäer auf den Steinbänken am »Kleinen See« einer Runde hochbetagter Asiaten beigesellt. Es kam zwar kein Gespräch auf, aber wir genossen die brüderliche Gemeinsamkeit des Greisenalters, während wir wortlos auf das stille Wasser des »petit lac« blickten. Auf dessen Grund soll der Sage zufolge eine riesige Schildkröte über das Zauberschwert jenes fernen vietnamesischen Nationalhelden wachen, der die weit überlegenen Horden des Mongolen-Kaisers Kublai Khan in der Schlacht von Bac Dang vernichtete und so seine Nation vor der totalen Unterwerfung und Assimilation durch das chinesische Reich der Mitte bewahrte.
Im vorliegenden Buch geht es nicht um meine persönlichen Befindlichkeiten, sondern um die Frage, inwieweit das Schicksal Indochinas das Weltgeschehen beeinflußt hat. Wenn man von dem Kompromiß absieht, zu dem sich Washington 1953 nach dem massiven Durchbruch der Volksbefreiungsarmee Mao Tse-tungs in Korea gezwungen sah, haben die USA die erste spektakuläre Niederlage ihrer Geschichte in Vietnam erlitten. Psychologisch hat sich die »Superpower« von dieser Demütigung bis heute nicht erholt, vielmehr ist dieser Koloß, dessen Potential und technologischer Vorsprung zur Stunde noch unerreicht sind, seitdem von einem militärischen Fehlschlag zum anderen gestolpert.
Der Krieg gegen den Irak Saddam Husseins misslang total und beschwor ein verhängnisvolles Chaos herauf, auch wenn der Diktator von Bagdad gefangen und hingerichtet wurde. In Afghanistan beobachten wir zur Stunde, wie nach mehr als zehnjähriger Terroristen-Bekämpfung die als teuflische Verbrecher geschmähten »Taleban« im Begriff stehen, die Macht in Kabul wieder an sich zu reißen. Die absurden Entgleisungen des sogenannten Arabischen Frühlings haben die Unfähigkeit dieser Weltmacht bloßgelegt, den Geboten der psychologischen Kriegführung gerecht zu werden und auf die Tücken des »asymmetric war« in angemessener Form zu reagieren. Im pazifischen Raum, dem Barack Obama seine prioritäre Aufmerksamkeit widmen will, sieht sich Amerika außerstande, den paranoiden Drohgebärden der nordkoreanischen Kim-Dynastie mit gebührender Strenge zu begegnen.
Kaum war der Kalte Krieg zwischen Ost und West, zwischen Washington und Moskau, mit der Selbstauflösung der Sowjetunion und dem Zerplatzen der kommunistischen Utopien zugunsten der Atlantischen Allianz entschieden, da verstrickten sich die USA in einen diffusen, globalen Feldzug gegen die unterschiedlichen Formen des islamischen Extremismus. Vor allem aber gab sich die Volksrepublik China als ungeheuerlicher Machtfaktor zu erkennen und schickt sich an – laut Analysen erfahrener Experten – die USA binnen zwanzig Jahren auf den zweiten Rang zu verweisen. Entgegen allen Befürchtungen hat jedoch das Einrücken der nordvietnamesischen »Bo Doi« in Saigon seinerzeit keinen geopolitischen Erdrutsch ausgelöst. Wenn man den zahllosen Filmen aus Hollywood Glauben schenkt, hätten die GIs in der »Hölle« von Vietnam sogar ganze Serien von Heldentaten vollbracht. Vielleicht ist der imaginäre Fiebertraum von »Apocalypse now« den düsteren Schimären dieses asiatischen »Horrors« noch am nächsten gekommen.
Was nun das wiedervereinigte Vietnam betrifft, so bemüht sich das ideologisch verkrustete Regime von Hanoi um eine zögerliche marktwirtschaftliche Öffnung und die mühselige Ausrichtung auf das Vorbild der ostasiatischen »Tigerstaaten«. Es kam immerhin im Innern zur allmählichen Aussöhnung zwischen Nord und Süd sowie zu einer spürbaren Anhebung des Lebensstandards der bislang darbenden Bevölkerung. Einen Nachahmungseffekt hat jedoch das heroische Experiment Ho Chi Minhs bei keinem einzigen seiner südostasiatischen Nachbarn ausgelöst. Zwar üben die Funktionäre aus Hanoi in der verschlafenen Hauptstadt von Laos, Vientiane, noch eine schikanöse Kontrolle aus, aber das Königreich Thailand jenseits des Mekong entfaltet hier eine weit überlegene Anziehungskraft, und von Norden her gewinnt das diskrete Vordringen der Volksrepublik China ständig an Boden.
Kambodscha hat jede Bevormundung durch seine vietnamesischen Erbfeinde längst abgeschüttelt. Der kriegserprobten Armee Hanois, die die Allmacht Amerikas in die Schranken wies, ist es nicht gelungen, in einem konventionellen Feldzug, der so gar nicht ihrer bewährten Praxis als Partisanen und Untergrundkämpfer entsprach, den Widerstand der »Roten Khmer« zu brechen und das einst so attraktive Königreich des Prinzen Sihanouk zu unterjochen. Es war für mich ein düsteres Erlebnis, als ich im Jahr 1980 im Dschungel der Provinz Siem Reap Zugang zu einer Kampfeinheit der Roten Khmer fand, zu den »Kriegern der Apokalypse«, wie ich sie in meiner Fernsehdokumentation nannte. Es berührte seltsam, daß ich mit jenen führenden Männern – Kieu Samphan und Yeng Sari – zusammentraf, ja mit ihnen tafelte, die für den abscheulichen Massenmord am eigenen Volk verantwortlich waren, und dabei von jenen Kindersoldaten bedient wurde, die kurz zuvor noch die Feinde ihres Steinzeitkommunismus durch das Überstülpen von Plastiktüten zu ersticken pflegten.
In unserer schnellebigen Zeit verblaßt allmählich das Vietnam-Syndrom und wird durch eine seltsame Anhäufung von posttraumatischen Verwirrungen bei den heimgekehrten Soldaten der Irak- und Afghanistanfeldzüge verdrängt. Immerhin bleibt als Fazit bestehen, daß zwischen Saigon und Danang der Traum einer weltweiten »Pax americana« zerbrach und das Gerede vom »Ende der Geschichte« jeden Sinn verlor.
Als im Sommer 2013 Barack Obama im Emirat Qatar diskrete Gespräche mit den unlängst noch als ruchlose Terroristen geschmähten Taleban aufnahm, um mit ihnen einen halbwegs reibungslosen Abzug der alliierten ISAF-Kontingente aus Afghanistan auszuhandeln, drängte sich die Erinnerung an den endlosen Schacher um einen Waffenstillstand in Vietnam auf, zu dem sich zu Beginn der siebziger Jahre Präsident Nixon und sein Außenminister Henry Kissinger bereitgefunden hatten. Was am Ende besiegelt wurde, war die Preisgabe des südvietnamesischen Staatsgebildes und der mit Amerika verbündeten Armee des Generals Nguyen Van Thieu, der sich verraten fühlte. Eine vergleichbare Entwicklung dürfte sich bei den geheimen Kontakten anbahnen, die zwischen den Bevollmächtigten des Weißen Hauses und den Emissären des Mullah Omar aus Kandahar aufgenommen wurden. Der vom Westen als gefügiger Staatschef eingesetzte Hamid Karzai muß befürchten, daß sein Regime ebenso schonungslos der Willkür seiner Gegner ausgeliefert wird, wie das einst in Südvietnam geschah.
Die kommunistische Führung der Lao-Dong-Partei von Hanoi sieht Gefahren eines ganz anderen Ausmaßes auf sich zukommen. Seit langem wird auf den in Peking gedruckten Landkarten die immense Fläche des Südchinesischen Meeres inklusive der dortigen Archipele Spratly und Paracel als integrierter Territorialbesitz des Reiches der Mitte dargestellt. Wenn dem so wäre, würde Peking über die dort georteten reichen Vorkommen an Erdöl und Gas verfügen und seine Hoheitsgewässer bis in die unmittelbare Nachbarschaft der philippinischen, malaysischen und vietnamesischen Küsten ausdehnen. Die Lebensader des gewaltigen maritimen Verkehrs zwischen dem Indischen und dem Pazifischen Ozean geriete unter chinesische Kontrolle, eine Perspektive, die für die kraftstrotzenden Anrainer dieser Region, zumal für Amerika, Indien und Japan, absolut unerträglich wäre.
Schon bereiten sich die Geschwader der US Navy auf eine solche Konfrontation vor, während China seine raketenbestückte U-Boot-Flotte fieberhaft ausbaut. Am energischsten widersetzte sich bereits die Volksrepublik Vietnam dieser angestrebten Expansion seines nördlichen Nachbarn und schreckte sogar vor bewaffneten Zwischenfällen nicht zurück. Die Krisenstimmung rund um die South China Sea hat bewirkt, daß zwischen Washington und Hanoi eine Interessengemeinschaft, ja eine strategische Partnerschaft entstanden ist, die vor fünfzig Jahren unvorstellbar gewesen wäre. Im Raum des Westpazifiks bereitet sich ein gigantisches Kräftemessen vor, bei dem die ehemaligen Kolonialmächte Europas – auf Grund selbstverschuldeter Schwäche und der Verstrickung in die Querelen des Orients – rat- und tatenlos ins Abseits gedrängt sind.
DER ERSTE INDOCHINA-KRIEGDie Franzosen
Ihr fahrt in die falsche Richtung
An Bord der »Andus«, Ende 1945
Der Truppentransporter »Andus«, 26000BRT, war von der Royal Navy ausgeliehen. Es lief so manches auf Pump bei den französischen Streitkräften in jenen Tagen. Die Nation hatte sich von der Niederlage des Jahres 1940 weder moralisch noch materiell erholt. Die britischen Seeleute der »Andus« blickten mit einiger Verwunderung auf die Angehörigen dieser Kolonialarmee, die sie nach Fernost geleiten und die dort offenbar das französische Versagen im Mutterland wettmachen sollten. Der Krieg gegen Japan, in den de Gaulle sich noch in aller Eile hatte drängen wollen, war zu Ende gegangen, ohne daß eine einzige französische Einheit daran teilgenommen hätte. In Sichtweite der »Andus« folgte ein anderes Truppenschiff ähnlicher Tonnage. Neben dem Union Jack führte es die niederländische Fahne. Holländische Kolonial-Truppen waren nach Batavia unterwegs. Im Roten Meer begegnete die »Andus« ganzen Konvois, die in entgegengesetzter Richtung nach Europa steuerten und an deren Masten Siegeswimpel flatterten. An Deck standen britische Veteranen des Burma-Feldzugs, die auf ihre heimischen Inseln, in den Frieden und den Alltag zurückkehrten. Durch den Feldstecher konnte man ihre von der Tropensonne geröteten Gesichter erkennen, auf denen sich die hemmungslose Freude spiegelte, den Gefahren des Dschungels und eines unerbittlichen Gegners entronnen zu sein. Die Engländer winkten den französischen Soldaten der »Andus« sowie den Holländern ausgelassen zu. Durch ein Megaphon war eine englische Stimme mit spöttischem Unterton zu hören: »You are going the wrong way … Ihr fahrt in die falsche Richtung!« – »Was wollen diese Briten schon wieder?« fragte ein beleibter französischer Schreibstuben-Major mit tiefer Mißbilligung in der Stimme.
Es war eine absurde Situation. In London, wo seit kurzem die Labour Party regierte, hatte man sich kurzerhand entschlossen, den Empire-Träumen – Kipling hin, Kipling her – den Rücken zu kehren und den indischen Subkontinent in die Unabhängigkeit zu entlassen. In Burma hatte die britische Armee nach anfänglichen Rückschlägen eine letzte große Schau abgezogen. Mit der geschwellten Brust des Siegers konnte sie nun von der Szene abgehen, und Admiral Mountbatten würde dem Abschied von Delhi Statur und Allüre verleihen. Doch die Unterlegenen der ersten Runde, die Zufallssieger der letzten Stunde, Franzosen und Holländer, die klammerten sich an die Fata Morgana ihrer einstigen überseeischen Herrlichkeit, an Indochina und an Indonesien.
Die jungen französischen Offiziere litten unter der Enttäuschung, zu spät zu kommen und nunmehr einem zweitrangigen Unternehmen entgegenzusehen. Manche hatten unter de Gaulle bei den »Freien Franzosen« gedient – von der Vichy-Regierung als Landesverräter deklariert – oder hatten sich in Nordafrika unter amerikanischem Oberbefehl der Armee angeschlossen; die meisten jedoch hatten die Demütigung der deutschen Besatzung auskosten müssen. Diese Schmach der Niederlage und der Unterwerfung suchten sie nun im Wasser des Mekong-Stroms und des Roten Flusses abzuwaschen. Insgeheim bangten sie davor, in ein befriedetes, in Treue zu Frankreich verharrendes Indochina zurückzukehren. Es dürstete sie nach exotischem Abenteuer, nach den émotions fortes – dem starken Erlebnis. Vermutlich hatten die wenigsten dieser Leutnants Jean-Paul Sartre gelesen, aber sie waren auf ihre Art Existentialisten in Uniform. Sie suchten die Wege der Freiheit, les Chemins de la Liberté in einem tropisch-kriegerischen Saint-Germain-des-Prés ihrer Phantasie. »Endlich ein Stück Erde finden ohne Asphalt …« schrieb einer von ihnen in sein Tagebuch.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!