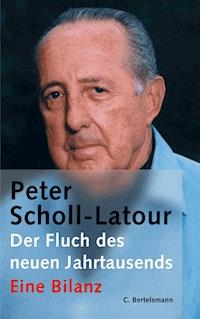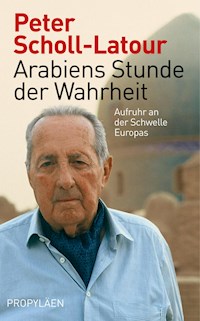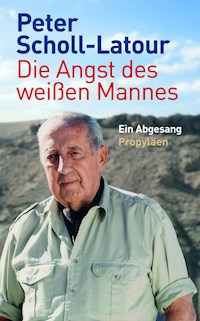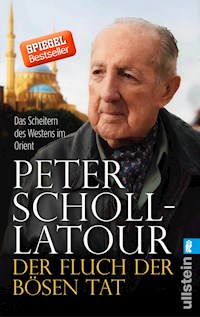9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Nach dem Ende des Kalten Krieges trat der Westen als Sieger der Geschichte auf. Frühzeitig hatte Peter Scholl-Latour vor der Isolation Russlands, der Explosivität des Nahen Ostens und der Herausforderung durch China gewarnt. Auch die aktuellen Konflikte im Kaukasus, in Pakistan oder im Iran hatte er lange vorausgesehen. Sie alle sind die Vorzeichen eines neuen Kalten Krieges, den der Westen nur verlieren kann. Entdecken Sie auch das Hörbuch zu diesem Titel!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Das Buch
Nach dem Ende des Kalten Krieges und dem Zusammenbruch der Sowjetunion trat der Westen als Sieger der Geschichte auf. Nato-Osterweiterung, Balkankriege, Afghanistan-Einmarsch oder Irak-Feldzug – sie alle wurden ohne Rücksicht auf Russland oder andere nicht-westliche Mächte in Szene gesetzt. Peter Scholl-Latour hat diese Muskelspiele von Anfang an mit Skepsis beobachtet. Frühzeitig hat Deutschlands erfahrenster Kommentator des Weltgeschehens vor der Isolation Russlands, der Explosivität des Nahen Ostens, der Herausforderung durch China und der Überdehnung der westlichen Kräfte gewarnt. Auch die aktuellen Konflikte im Kaukasus, in Pakistan, im Iran oder im Osten hat er seit langem vorausgesehen. Eindringlich beschreibt er den Weg in einen neuen, diesmal multipolaren Kalten Krieg zwischen Washington und seinen europäischen Partnern auf der einen Seite, Moskau, Peking und der islamischen Welt auf der anderen. Diese Auseinandersetzung kann der Westen nur verlieren.
Wie immer zeichnen sich Peter Scholl-Latours Analysen durch profunde Kenntnis der geschilderten Länder und Kulturen sowie durch geradezu prophetische Urteilskraft aus. Zusammenhänge, die die Medien übersehen oder unterschlagen – hier werden sie deutlich.
Der Autor
Peter Scholl-Latour, geboren 1924 in Bochum. Promotion an der Sorbonne in Paris in den Sciences Politiques, Diplom an der Libanesischen Universität in Beirut in Arabistik und Islamkunde. Seitdem in vielfältigen Funktionen als Journalist und Publizist tätig, unter anderem als ARD-Korrespondent in Afrika und Indochina, als ARD- und ZDF-Studioleiter in Paris, als Programmdirektor des WDR-Fernsehens, als Chefredakteur und Herausgeber des STERN und als Vorstandsmitglied von Gruner + Jahr. Seine TV-Sendungen erreichen höchste Einschaltquoten, seine Bücher haben ihn zu Deutschlands erfolgreichstem Sachbuchautor gemacht. Peter Scholl-Latour verstarb am 16. August 2014.
Von Peter Scholl-Latour sind in unserem Hausebereits erschienen:
Die Welt aus den Fugen
Arabiens Stunde der Wahrheit
Die Angst des weißen Mannes
Zwischen den Fronten
Russland im Zangengriff
Koloss auf tönernen Füßen
Weltmacht im Treibsand
Peter Scholl-Latour
Der Weg in denneuen Kalten Krieg
Eine Chronik
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-taschenbuch.de
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen,
wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung,
Speicherung oder Übertragung
können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Ungekürzte Ausgabe im Ullstein Taschenbuch
1. Auflage Oktober 2009
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2008/Propyläen Verlag
Umschlaggestaltung: HildenDesign, München
(unter Verwendung einer Vorlage von Morian & Bayer-Eynck, Coesfeld)
Titelabbildung: Nina Mallmann, Porträt; corbis, Hintergrund
Lektorat: Cornelia Laqua
Satz: LVD GmbH, Berlin
E-Book-Konvertierung: CPI – Ebner & Spiegel, Ulm
Printed in Germany
ISBN 978-3-8437-0178-5
INHALT
PROLOG
»Die Welt ist verrückt geworden« · Interview, 20. Januar 2008
DAS JAHR DER SCHLANGE – 2001
Das Krebsgeschwür · 22. Oktober 2001
Afghanistan wirft weite Schatten · 19. November 2001
Kein Ersatz für Arafat · 17. Dezember 2001
DAS JAHR DES PFERDES – 2002
Vom Hindukusch nach Kaschmir · 14. Januar 2002
Hat die NATO ausgedient? · 11. Februar 2002
Reise durch das Reich des Bösen · 10. März 2002
Die USA als Verlierer · 8. April 2002
Was vom Kampf gegen den Terror übrig blieb · 6. Mai 2002
Wie Pazifisten zu Falken werden · 3. Juni 2002
Russlands Sorgen in Asien · 9. Juni 2002
Der uferlose Kampf gegen das Böse · 1. Juli 2002
Keine Überlebenschance für Saddam Hussein · 29. Juli 2002
Nibelungentreue und Bündnispflichten · 26. August 2002
Ein Leichnam herrscht über Afghanistan · 23. September 2002
Die Bomben von Bali · 21. Oktober 2002
»Tot oder lebendig« · 17. November 2002
Unheimlicher Partner Türkei · 16. Dezember 2002
DAS JAHR DES SCHAFS – 2003
Der bedrohliche »Pygmäe« Nordkorea · 13. Januar 2003
Europa in selbstverschuldeter Ohnmacht · 10. Februar 2003
Die 2. Front im Norden · 9. März 2003
Saudi-Arabien im Fadenkreuz? · 10. März 2003
Der Krieg beginnt · 23. März 2003
Im Irak droht eine Superintifada · 5. Mai 2003
Amerikas Kesseltreiben gegen Iran · 2. Juni 2003
»Heia Safari« im Kongo · 15. Juni 2003
Angriffspläne gegen Iran · 29. Juni 2003
Enttäuschung in Kabul · 13. Juli 2003
Hinrichtung in Mossul · 28. Juli 2003
Afghanistan – so brenzlig ist es wirklich · 18. August 2003
Entführung in der Sahara · 25. August 2003
Die Mutter aller Lügen · 29. August 2003
Schiitische Märtyrer · 31. August 2003
Terror und Chaos · 28. Oktober 2003
»Nachrichtendienst ist Herrendienst« · 7. Dezember 2003
Das Fell des Bären · 15. Dezember 2003
DAS JAHR DES AFFEN – 2004
Vom Bösewicht zum Liebling des Westens · 12. Januar 2004
Keine Blauhelme für Bagdad · 9. Februar 2004
»Das amerikanische Gewissen« · 8. März 2004
Der Preis der Torheit · 5. April 2004
»Wir sind doch keine Idioten!« · 23. April 2004
Die Lähmung der Vereinten Nationen · 3. Mai 2004
Die Pforten der Hölle · 25. Mai 2004
Defätisten im »alten Europa« · 28. Juni 2004
Die Mauer im Heiligen Land · 26. Juli 2004
Propagandakampagne gegen Sudan · 23. August 2004
Besser mit Kerry, einfacher mit Bush? · 18. Oktober 2004
Was kommt nach Yassir Arafat? · 8. November 2004
Der »liebe Führer« von Nordkorea · 6. Dezember 2004
DAS JAHR DES HAHNS – 2005
»Wenn ich deiner vergesse, Jerusalem« · 10. Januar 2005
Ein Amerikaner in Europa · 28. Februar 2005
Die neuen Emire von Zentralasien · 4. April 2005
Zähneknirschen auf dem Kontinent · 2. Mai 2005
Das »Mädchen« und die hohe Politik · 30. Mai 2005
Brüssels Drang nach Osten · 27. Juni 2005
Die neuen Assassinen · 25. Juli 2005
Mehr Resignation als Begeisterung · 22. August 2005
Die Büchse der Pandora · 19. September 2005
Europäische Affenschlacht · 17. Oktober 2005
Gleichgewicht des Schreckens · 4. November 2005
Die brennenden Vorstädte von Paris · 14. November 2005
Verhörmethode »Waterboarding« · 12. Dezember 2005
DAS JAHR DES HUNDES – 2006
Geblendet in Gaza · 9. Januar 2006
Das Vordringen der Gotteskrieger · 6. Februar 2006
Ein deutsch-amerikanischer Krimi · 6. März 2006
Die »Gas-Prinzessin« von Kiew · 3. April 2006
Die friedliche Völkerschlacht · 26. Juni 2006
Hizbullah siegt im Libanon · 21. August 2006
Zwischen Hass und Trauer – Eine Bilanz nach fünf Jahren Krieg · 1. September 2006
Die erzürnten Generale von Ankara · 18. September 2006
Das Wettrüsten geht weiter · 16. Oktober 2006
Irakisierung am Hindukusch · 5. November 2006
Das Ende der Hypermacht · 13. November 2006
Putin im Zangengriff · 13. November 2006
Agentenmord in London · 11. Dezember 2006
DAS JAHR DES SCHWEINS – 2007
Die Äthiopier erobern Somalia · 8. Januar 2007
Das Eis schmilzt – die Konflikte kochen · 12. Februar 2007
US-Raketen gegen Teheran? · 12. März 2007
Gefangene in bester Form · 10. April 2007
»Condy« gegen den Kreml · 7. Mai 2007
Deutsche Kriegsopfer · 25. Mai 2007
Windmühlen an der Ostsee · 4. Juni 2007
»Der Islam bietet die Lösung« · 2. Juli 2007
Erdoğan – Hoffnung und Dilemma zugleich · 30. Juli 2007
Wie fit ist Frankreich? · 27. August 2007
Moskauer Rätselraten · 24. September 2007
Atommacht am Abgrund · 19. November 2007
»Großmacht ja, Weltmacht nein« · Interview, 30. November 2007
Das Klima und der liebe Gott · 17. Dezember 2007
DAS JAHR DER RATTE – 2008
Stammesfehden in Kenia · 7. Januar 2008
Ein »schwarzer Kennedy«? · 11. Februar 2008
Die blutenden Wunden des Balkans · 3. März 2008
Die Kanzlerin sagt »nein« · 7. April 2008
Eine gesteuerte Revolte in Tibet · 5. Mai 2008
Deutschlands heißer Wahlsommer · 2. Juni 2008
Das Pulverfass am Kap · 13. Juni 2008
Das Nein der Iren · 1. Juli 2008
Ist Obama gut für Europa? · 1. Juli 2008
Der Mensch ist das schlimmste Raubtier · Interview, 3. Juli 2008
Provokation am Kaukasus · 25. August 2008
Wall Street in Trümmern · 22. September 2008
»Pitbull mit Lippenstift« · 27. Oktober 2008
EPILOG
Der Schwarze Mann im Weißen Haus · 5. November 2008
Bildnachweis
PROLOG
Zum »greisen König der Unken« hat mich einmal ein wohlgesinnter Kollege gekrönt. Ein solches Renommee sollte man pflegen, zumal wenn der Warner – wie die viel zitierte Cassandra beim Fall von Troja – mit seinen Voraussagen Recht behielt. Die übliche Kritik wird auch dieses Mal nicht ausbleiben, wenn ich ohne jede Emotion feststelle, dass wir in den »Kalten Krieg« zurückgefallen sind. Die Beschwichtigung von Politikern und von Publizisten, die sich daran gewöhnt haben, harte Realitäten zu leugnen oder schönzureden, bis das Unheil über sie hereinbricht, kann daran nichts ändern. Im Schwarzen Meer lagen sich auf dem Höhepunkt der Ossetien-Krise russische und amerikanische Flottenverbände gegenüber. Im September 2008 nahm eine von Moskau ausgesandte Armada, geschart um den Kreuzer »Peter der Große«, Kurs auf die Karibik und die Küste Venezuelas. Wenn das Pentagon in Ost-Polen ein Raketen-System aufbaut, das vom Kreml als Provokation, ja als Bedrohung aufgefasst wird, soll sich niemand wundern, wenn demnächst auf dem Boden von Belarus und jenes Oblast Kaliningrad, das einst Königsberg hieß, auch russische Lenkwaffen mit Nuklearsprengköpfen eingebunkert werden.
Gemessen an den Spannungen, die unsere gegenwärtige Situation einer enthemmten strategischen Globalisierung kennzeichnen, mag uns der »Kalte Krieg von gestern« – nachdem einmal der apokalyptische Höhepunkt der Kuba-Krise überwunden war – als eine relativ verlässliche Kohabitation von zwei konträren Machtsystemen erscheinen. Diese lieferten sich zwar in irgendwelchen entlegenen Gegenden Stellvertreterkriege – »war by proxies« –, aber gleichzeitig bewährte sich eine Übung der gegenseitigen Konsultation und Mitteilung, die gelegentlich an Komplizenschaft grenzte. Im Schatten des Potenzials atomarer Vernichtung, über das die beiden Supermächte verfügten und das ein strategisches Patt erzwang, genossen die übrigen Staaten niederen Ranges ein beachtliches Maß an Sicherheit und Stabilität. Die Westeuropäer zumal konnten sich in Ruhe der Häufung ihres Wohlstandes widmen und sich auf mehr oder minder schnöde Weise jeder schicksalhaften Verantwortung entziehen.
Dieser Zustand hat sich von Grund auf geändert, seit die Sowjetunion in sich zusammenbrach und zehn Jahre später die Todesengel einer finsteren, weit verzweigten Verschwörung die Wahrzeichen des westlichen Kapitalismus in Manhattan selbstmörderisch zum Einsturz brachten. Der Kalte Krieg von heute verfügt nicht mehr über die angespannte Verlässlichkeit des bipolaren Antagonismus zwischen Washington und Moskau. Auch die kurze Übergangsphase einer ausschließlich amerikanischen Hegemonie und die damit verbundene Hoffnung auf eine »pax americana«, die sich nach dem siegreichen Abschluss des ersten Irak-Krieges »Desert Storm« unter George Bush senior einstellte, haben nur eine Dekade gedauert. Der Begriff »new cold war«, vor dessen Formulierung die meisten zurückscheuen, bezieht seine Berechtigung nicht allein aus dem Wiederaufleben der gewohnten Gegnerschaft zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und einem wieder erstehenden russischen Imperium. Dieser jetzige Kalte Krieg ist multipolar, besser gesagt, multilateral geworden, entzieht sich jedem Kalkül und jeder heimlichen Abstimmung.
Die neue Weltmacht China, die im Begriff steht, den Status quo im ostasiatisch-pazifischen Raum aus den Angeln zu heben, wäre ja noch einzuordnen in irgendeine Form von vorsorglicher Kooperation, die den Absturz in den Abgrund verhindert. Der scheidende amerikanische Präsident hat jedoch Feinde einer ganz anderen Kategorie auf den Plan gerufen und sieht sich mit einer Konspiration der »Kräfte des Bösen« konfrontiert, für die er den Ausdruck »Islamo-Faschismus« prägte. Unter dem vagen Sammelbegriff »Al Qaida« agieren seitdem bunt gescheckte Haufen von fanatischen Attentätern, die über den ganzen »Dar-ul-Islam« – von Marokko bis Indonesien – verstreut sind und in einer Masse von 1,3 Milliarden Koran-Gläubigen untertauchen können. Gegen diese kunterbunte Assoziation »teuflischer« Übeltäter, in die die Propaganda Washingtons so unterschiedliche und tödlich verfeindete Fraktionen wie die extremistisch-sunnitischen Wahhabiten Arabiens und die schiitischen Revolutionswächter der Islamischen Republik Iran einreiht, hat George W. Bush den weltumspannenden Kampf gegen den Terrorismus ausgerufen. Die zutreffende Feststellung Zbigniew Brzezinskis, des ehemaligen Sicherheitsberaters des US-Präsidenten Carter, dass man mit dem Wort »Terrorismus« keinen Gegner definieren kann, sondern eine Form der Kriegsführung, wie sie von Partisanen, Freischärlern oder Guerrilleros seit langem praktiziert wurde, hat wenig gefruchtet. Dass der Terror auch von durchaus ehrbaren Widerstandskämpfern angewandt wurde, passte nicht in die manichäischen Vorstellungen der neokonservativen Ideologen am Potomac.
Die Europäer, die Deutschen zumal, sollten zur Kenntnis nehmen, dass sie nicht nur in eine unheimliche und ständig expandierende Abart des »Kalten Krieges« zurückgeworfen wurden. Laut Völkerrecht und Artikel V des Atlantischen Bündnisvertrages, dessen Beistandsverpflichtung nach dem Horror-Effekt von »Nine Eleven« durch die westlichen Alliierten einstimmig in Kraft gesetzt wurde, sehen sie sich in einen regelrechten »heißen Krieg« verwickelt und sind weit davon entfernt, sich aus dessen unerbittlichen Zwängen zu lösen. Die westliche Staatengemeinschaft operiert »out of area« gegen ein bluttriefendes Gespenst, gegen eine Hydra mit tausend Köpfen, und wenn die Gefahr einer klassischen Niederlage auch ausgeschlossen bleibt, so erscheint jede Perspektive eines siegreichen Ausklangs dieser Kampagne illusorisch.
Im vorliegenden Buch handelt es sich um ein Kaleidoskop von Kommentaren, Fernsehdokumentationstexten, Reportagen und Interviews. Sie sind in chronologischer Reihenfolge und ohne jede nachträgliche Berichtigung abgedruckt. Die Abfolge dieser Beiträge umfasst den Zeitraum zwischen den Jahren 2001 und 2008. Am Anfang steht der zunächst brillant geführte Eroberungsfeldzug »Enduring Freedom« in Afghanistan, der im Lauf der Zeit zum heillosen Abnutzungskrieg, »war of attrition«, verkam. Die Serie endet mit der Wahl des neuen amerikanischen Präsidenten. Letztere findet vor dem Hintergrund einer zunehmenden Ratlosigkeit der US Army zwischen Mesopotamien und Hindukusch statt, während das Debakel von Wall Street den deutschen Finanzminister Peer Steinbrück zu der Feststellung veranlasste, die USA hätten ihren »Status als Supermacht des Welt-Finanzsystems eingebüßt«.
In der Zwischenzeit offenbart sich die Unzulänglichkeit der viel gerühmten Wertvorstellungen des Westens. Der hemmungslos spekulative Turbo-Kapitalismus liegt in Trümmern. Eine technisch extrem perfektionierte Militärmaschine wird durch die geschmeidige und einfallsreiche Partisanentaktik des sogenannten »asymmetrischen Kriegs« in Schach gehalten. Die Staatengemeinschaft des Westens muss sogar ihre Unfähigkeit eingestehen, ihrer Vorstellung vom demokratischen Pluralismus weltweit Geltung zu verschaffen. Wie viel verlockender klingt doch in weiten Regionen trotz der damit verbundenen Bevormundung die Doktrin vom »politischen Konsens«.
Der Sinn des sporadischen Rückblicks, den ich heute vorlege, lässt sich an der jüngsten Entwicklung im Kaukasus exemplifizieren. Die plötzliche Offensive der georgischen Armee gegen die abtrünnige autonome Republik Süd-Ossetien hat eine russische »Strafaktion« ausgelöst, mit deren Ausmaß niemand gerechnet hatte. Im Kreml und in breiten Schichten der russischen Bevölkerung wurde das Vabanquespiel des Georgiers Saakaschwili, sein Überfall auf die ossetischen Sympathisanten Russlands südlich des Kaukasus, als unerträgliche Provokation empfunden. Der Fall Ossetien symbolisiert einen bedrohlichen Wendepunkt und wird von Dmitri Medwedew, dem Präsidenten der Russischen Föderation, mit der Tragödie des 11. September 2001 gleichgesetzt, die Amerika zutiefst erschütterte und zur geballten militärischen Aktion veranlasste.
So unerwartet, wie manche das heute darstellen, wurde die jüngste kaukasische Krise übrigens nicht vom Zaun gebrochen. Im Herbst 1996, also zwölf Jahre vor den Kämpfen um Zchinwali, hatte ich unter dem Titel »Das Schlachtfeld der Zukunft – Zwischen Kaukasus und Pamir« einen Erlebnisbericht veröffentlicht, der damals als Schwarzmalerei bemängelt wurde. Deshalb erlaube ich mir, ein paar Impressionen zu zitieren, die sich mir im Frühjahr 1996 an Ort und Stelle aufgedrängt hatten und die heute wieder einen sehr aktuellen Klang gewinnen.
Süd-Ossetien im Rückspiegel
ZCHINWALI, IM FRÜHJAHR1996
Um nach Zchinwali, dem Regierungssitz Süd-Ossetiens zu gelangen, bedurfte es einer Sondergenehmigung, die am besten bei der OSZE-Mission in Tiflis einzuholen war. Der örtliche Stab der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa setzte sich aus Offizieren und Diplomaten verschiedenster Nationalität zusammen. Für meine Inspektionsfahrt hatte sich der deutsche Oberstleutnant Heino von Heimburg als freundlicher und kompetenter Begleiter zur Verfügung gestellt. In Zchinwali wurden die Behörden von meiner Ankunft verständigt. Von Tiflis bis Gori fährt man 60 Kilometer in westlicher Richtung. Dann knickt die Straße nach Norden ein, und nach einer Strecke von 15 Kilometern ist die Grenze Süd-Ossetiens erreicht. Alles spielt sich in einem »Taschentuch« ab. Bis zu den steilen Fels- und Gletschermassen des Kaukasus, der hier von dem weißen Kegel des mehr als 5000 Meter hohen Kasbek gekrönt wird, sind es allenfalls weitere 50 Kilometer Luftlinie.
In dieser Gegend wurde mit der vorherrschenden Zwergstaaterei nicht gespaßt. Eine Kontrollstation der früheren sowjetischen Verkehrspolizei war zum befestigten Bunker ausgebaut. Ein Panzerfahrzeug vom Typ BPR-70 war neben der Schranke und einer Barriere aus Sandsäcken aufgefahren. Hier hielten sich nur russische Soldaten auf. Über dem kleinen Fort wehte die russische Fahne. Spannung war nicht vorhanden. Oberstleutnant von Heimburg trug Uniform, und wir wurden freundlich durchgewinkt. Vom Regierungssitz Zchinwali trennten uns jetzt nur noch ein paar hundert Meter. Das unansehnliche Städtchen, gut 30 000 Einwohner, ist in eine grüne Mulde gebettet. Warum es den »Swiadisten« – so nannte man die Anhänger des ersten Präsidenten der unabhängigen Republik Georgien, Swiad Gamsachurdia, der von den Sowjets jahrelang eingekerkert wurde und als glühender Nationalist die Autonomie Süd-Ossetiens wie auch Adschariens nicht anerkennen wollte – nicht gelungen war, diese wehrlos exponierte Ortschaft im ersten Anlauf zu erobern, bleibt eines der Geheimnisse der damaligen kaukasischen Kriegsführung. Immerhin waren Ende 1991 rund 3000 bewaffnete Georgier bis ins Zentrum vorgerückt. Die sporadischen Kämpfe zogen sich eineinhalb Jahre hin. Dann kam es im Juni 1992 unter russischem Druck zum Waffenstillstand, der im Frühjahr 1996 recht und schlecht andauerte.
Die Kuriosität dieser Vereinbarung, die es immerhin ein paar georgischen Dorfgemeinden mit rund 15 000 Menschen erlaubte, der »ethnischen Säuberung« zu entgehen, bestand darin, dass eine dreifache Militärpräsenz ausgehandelt wurde. Ein ossetisches, ein russisches und ein georgisches Bataillon – jedes etwa 500 bis 600 Mann stark – wachten über einen verschwommenen Status quo. Die OSZE-Mission hatte sich bislang als Schiedsrichter und Überprüfungsapparat erstaunlich gut behauptet, registrierte Fehlverhalten der gegnerischen Kräfte, versuchte Kontakte herzustellen, ja inspizierte sogar die Gefängnisse. Wie lange die Russen die indiskreten Ausländer noch auf einem Gebiet dulden würden, das sie – mit voller Zustimmung der Osseten – als ihre exklusive Domäne betrachteten, blieb dahingestellt.
Der Präsident der Republik Süd-Ossetien, so lautet sein vollmundiger Titel, trug den Namen Ludwig Alexejewitsch Tschibirow. Zur Unterzeichnung eines neuen Memorandums war er gerade nach Moskau gereist. So wurde ich von Sergej Kochojew – laut Visitenkarte »Chairman of the Supreme Soviet Committee for Communication and Nationalities« in die komplizierten Lokalverhältnisse eingewiesen. Mit gutem Grund weigerten sich die Osseten, von den Georgiern assimiliert zu werden. Die Georgier bilden eine kaukasische Urrasse, die – ähnlich wie die Basken in den Pyrenäen – keiner anderen Völker- oder Sprachfamilie zugerechnet werden kann. Die Osseten hingegen sind iranischen, wie Kochojew beteuerte, indogermanischen Ursprungs. Ihre fernen Vorfahren seien die Alanen gewesen, deren Raub- und Eroberungszüge zur Zeit der Völkerwanderung sich im Gefolge der Goten und Wandalen bis nach Spanien und Nordafrika erstreckten. Die Osseten können wirklich nichts dafür, dass sie durch die Willkür der sowjetischen Nationalitätenpolitik in eine Nord- und eine Südkaukasische Autonome Region gespalten wurden, deren Trennungslinie der Kamm des Hochgebirges ist. Im nördlichen Teil hat der Verwaltungssitz Ordschonikidse wieder seinen alten zaristischen Namen Wladikawkas – Herrscher des Kaukasus – angenommen und ist Bestandteil der Russischen Föderation. Der Süden hingegen wurde gegen den Willen der Betroffenen der damaligen Sowjetrepublik Georgien zugeschlagen.
Kochojew, der wie viele seiner Landsleute mit dunkelblonden Haaren und grauen Augen durchaus europäisch wirkte, hatte mehrere Jahre als sowjetischer Offizier gedient. Aus seiner Sympathie für Russland machte er keinen Hehl, und in dieser Beziehung war er repräsentativ für die große Mehrheit seiner Stammesbrüder. Die überwiegend christlichen Osseten hatten schon im achtzehnten Jahrhundert beim Nahen der ersten Kosaken-Vorhuten rückhaltlos Partei für den Zaren ergriffen. In den endlosen Kaukasus-Kriegen hatten sie stets mit den aus Sankt Petersburg entsandten Militärgouverneuren paktiert, die Wladikawkas zum Bollwerk imperialer Expansion ausbauten. Der russische Dichter Michail Lermontow, der in der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts als junger Offizier in diese raue, aber exaltierende Gebirgswelt abkommandiert wurde, hatte keine hohe Meinung von den allzu gefügigen Osseten. Er begeisterte sich hingegen für die kriegerische Unbeugsamkeit der Kabardiner und Tscherkessen. Zumindest seien diese muslimischen Krieger nicht dauernd besoffen wie ihre christlichossetischen Nachbarn, hat er damals geschrieben.
Etwa hundert Jahre später hat Swiad Gamsachurdia dieses iranische Zwergvolk mit extremer Verachtung gestraft. Es handele sich bei den Osseten um »Abfall der Geschichte«. An ihrer Treue zu Russland hielten die Osseten unverbrüchlich fest. »Wir sind jederzeit bereit, auf die Souveränität unserer Republik zu verzichten, wenn wir uns der Russischen Föderation anschließen und unsere Einheit mit Nord-Ossetien vollziehen können«, betonte Sergej Kochojew. Die Behörden von Zchinwali hatten ohnehin den Rubel als Währung beibehalten und den georgischen Lari abgelehnt. Sie lebten sogar mit einer Stunde Zeitverschiebung gegenüber Tiflis weiterhin nach dem Glockenschlag der Uhren des Kreml. Auch eine eigene Landesfahne hatten sie entworfen: Drei horizontale Streifen, weiß, rot und gelb. Ihre orthodoxe Kirche blieb natürlich dem russischen und nicht dem georgischen Patriarchen unterstellt.
Der »Beauftragte für Kommunikation und Nationalitäten« ließ keine verfrühten Hoffnungen auf Versöhnung aufkommen. Er zeigte mir die Zerstörungen, die durch georgischen Beschuss am Rande Zchinwalis entstanden waren. Die Zahl der Getöteten bezifferte er auf tausend. Sämtliche ossetischen Siedlungen im eigentlichen Georgien seien zwangsevakuiert worden. Massaker und Folterungen hätten stattgefunden. Immer noch würden Gräber mit ossetischen Leichen entdeckt. Hundert Dörfer seien systematisch von den Swiadisten vernichtet worden. All das klang sehr balkanisch.
Der deutsche Oberstleutnant drängte mich, mit der Inspektionstour zu beginnen. Er setzte sich an das Steuer des weißgestrichenen Landrovers mit dem weißen Wimpel der OSZE. Vor dem Aufbruch stellte er mir zwei zusätzliche Begleiter vor, einen Oberst der georgischen Streitkräfte und einen Oberstleutnant der ossetischen Armee. Beide Männer trugen die übliche gescheckte Tarnuniform sowjetischen Zuschnitts. Nur das Ärmelwappen und die Rangabzeichen unterschieden sich. Überraschend war das hohe Alter dieser militärischen Chargen. Der Georgier, der nach eigener Aussage als Professor für Strategie an irgendeiner Akademie in Tiflis unterrichtete, war schmächtig gewachsen und hatte die sechzig überschritten. Er wirkte zerbrechlich und wäre kaum noch als »kriegsverwendungsfähig« zu bezeichnen gewesen. Der süd-ossetische Oberstleutnant hingegen, ein breitgewachsener Koloss, war kaum jünger. Mühsam quälte er sich auf den Rücksitz unseres Wagens. Seine enorme Korpulenz hätte ihn im Ernstfall für jeden Kampfeinsatz disqualifiziert. Obwohl ich in dem seltsamen Trio mit Abstand der Senior war, erheiterte mich dieses Aufgebot soldatischer Vergreisung. Beide Offiziere erwiesen sich übrigens als höfliche und verträgliche Gefährten.
Es war ein strahlender Frühlingstag. Wir rumpelten über aufgewühlte Lehmpisten nach Norden. Jenseits des Dorfes Wanati drangen wir in endlose Obstplantagen ein. Hier entfaltete sich eine herrliche Farbensymphonie aus Rosa und Weiß. Der Himmel leuchtete tiefblau. Der nahe Horizont war durch die Kette des Kaukasus verstellt. Die Hütten der Einwohner waren erbärmlich, aber sie verschwanden in der üppigen Vegetation. Der georgische Oberst behauptete, das breite Massiv im Nordwesten sei der Elbrus, aber das konnte auf Grund der Entfernung nicht stimmen.
In Wanati entdeckte ich vor einer halb ausgebrannten Schule eine Büste Stalins mit zerschossener Nase. Dann passierten wir Dörfer, wo die rassisch gemischte Bevölkerung sich erbitterte Gefechte geliefert hatte. Ganze Häuserzeilen waren durch Direktbeschuss oder Brandstiftung systematisch vernichtet. Plötzlich fiel mir ein, warum mir dieser Ausflug so vertraut, diese Stimmung so bekannt vorkam. Zwei Jahre zuvor hatte ich in West-Slawonien den damals noch zur Serbischen Republik Krajina gehörenden Gebietsfetzen rund um Pakrac besucht. Dort war ich auf die gleichen Bilder gestoßen. Seit Ende der großen Ost-West-Konfrontation pflanzte sich die Vielzahl der Regionalkonflikte wie eine hoch infektiöse Epidemie weltweit fort. Die nackte Zerstörungslust, die kindisch-grausame Barbarei ähnelten sich überall.
Ganz ernst konnte man den ossetischen Partisanenkrieg »en miniature« dennoch nicht nehmen. Die Osseten sind auch vom militärischen Standpunkt aus die armen Verwandten in dieser martialischen Farce. Ihre isolierte Stellung im Vorgebirge war in einer Holzbaracke untergebracht. Mehr als acht Milizionäre, die nicht einmal Uniform trugen, konnte der örtliche Bandenführer uns nicht vorstellen. Die anderen waren mit Feldarbeiten beschäftigt, denn davon mussten sie leben. Ihr kümmerlicher Rubel-Sold war ihnen seit vier Monaten nicht ausbezahlt worden. Sie beteuerten dem schwergewichtigen Oberstleutnant ihrer »Armee«, dass sie zur Verteidigung bereit waren, aber dass es in diesem Sektor – abgesehen von gelegentlichem Viehdiebstahl – nichts zu vermelden gab. Die rustikalen Männer mit den vom harten Leben zerfurchten Gesichtern präsentierten uns ihre Waffen: ein paar alte Kalaschnikows und eine einzige Panzerfaust.
Bei dem georgischen Détachement, kaum drei Kilometer entfernt, fehlte es ebenfalls an jeglicher Disziplin. Ein Dutzend junger Soldaten, die immerhin Tarnuniform trugen, salutierten nicht einmal, als ihr weißhaariger Oberst aus Tiflis sich die erbärmliche Stube mit den Holzpritschen zeigen ließ. Sie öffneten auf Wunsch des deutschen OSZE-Beobachters bereitwillig ihre Waffenkammer. Auch sie warteten auf den längst fälligen Sold. Jeweils drei Monate lang müssten sie in diesem Außenposten verharren, so berichtete der Sergeant, der für die unrasierte Rotte verantwortlich war. Aber dann kam ein etwa vierzigjähriger Mann herbeigeeilt, offenbar in seiner Mittagsruhe gestört, und stellte sich als Hauptmann und verantwortlicher Befehlshaber vor. Über der gescheckten Hose trug er ein knallrotes T-Shirt. Im kurzen Gespräch schlug uns eine penetrante Alkoholwolke entgegen.
Letzter Abstecher – die Russen. Das unvermeidliche Panzerfahrzeug vom Typ B 234 stand neben den beiden Posten in Bereitschaft. Die Soldaten trugen Stahlhelme und kugelsichere Westen. Hier hatten wir es wenigstens mit einer halbwegs ansehnlichen Truppe zu tun. Der Eindruck verstärkte sich, als ein blonder Leutnant aus Sankt Petersburg, der uns mit stählernem Händedruck begrüßte, Meldung erstattete. Das Quartier war extrem primitiv, aber es herrschte Ordnung und Sauberkeit. Die Soldaten – es mochten zwei Dutzend sein – stammten aus den verschiedensten Teilen Russlands, von Murmansk bis zum Ural. Ich entdeckte keinen einzigen Asiaten. »Das Schlimmste ist die Langeweile«, sagte der zackige, blauäugige Leutnant. »Ansonsten kommen wir über die Runden.« Die meisten seiner Untergebenen nutzten die erzwungene Untätigkeit, um sich in der warmen Sonne zu bräunen.
Vor der Rückfahrt verabschiedeten wir uns in Zchinwali mit großer Herzlichkeit von dem georgischen und dem ossetischen Obristen. Ganz so harmlos, wie diese Erkundung vermuten ließ, war die Lage in Süd-Ossetien übrigens nicht. Hier hatten sich die russischen Streitkräfte eine sichere Domäne südlich der großen Gebirgsbarriere geschaffen. Seit die Republik Georgien durch den Bürgerkrieg in Abkhasien vom Norden abgeschnürt und die Grusinische Heerstraße, die in bedrohlicher Nähe des Unruheherdes Tschetschenien verläuft, auf Grund von Witterungseinwirkung und Lawinensturz kaum noch befahrbar war, blieb lediglich ein drei Kilometer langer Tunnel als sicherer Verbindungsweg zwischen Nord- und Süd-Ossetien, zwischen Zchinwali und Wladikawkas. Dieser unterirdische Weg wurde ausschließlich von russischem Militär benutzt, und seine Geheimnisse waren wohl gehütet. Die OSZE hatte hier keinen Zugang. Im Sommer 1991 war ich noch ohne sonderliche Schwierigkeiten auf der Grusinischen Heerstraße bis zum viel besungenen Kreuzpass gelangt. Vor solchen Exkursionen wurde nunmehr abgeraten.
An der alten Königsburg Mzcheta vorbei näherten wir uns wieder der Hauptstadt. Eine halb verwischte Inschrift fiel mir am Eingang von Tiflis auf: »Die Sowjetunion – Hort des Friedens«. Die Bauarbeiten an der Pipeline, die in amerikanischem Auftrag das georgische Transitland nutzen soll, um – unter Umgehung russischen und iranischen Territoriums – das Erdöl und das Erdgas Aserbeidschans und Zentralasiens vom Kaspischen Meer über Tiflis und Ost-Anatolien zum türkischen Mittelmeerhafen Ceyhan zu transportieren, waren bereits im Gange. In diesem Zusammenhang gewann die russische Militärpräsenz in Süd-Ossetien eine zusätzliche, bedrohliche Bedeutung. Nur ein paar Kilometer trennen das Städtchen Zchinwali vom Verlauf jener heiß umstrittenen Erdölleitung Baku-Tiflis-Ceyhan, BTC in der Abkürzung, die den Russen ein Dorn im Auge ist. Wenn es darauf ankäme, ließen sich aus engster Nachbarschaft beliebig Sabotageakte und Sprengungen inszenieren. Wie an fast allen Spannungsflächen zwischen Ost und West spielte auch in Georgien der gierige Zugriff auf das »Schwarze Gold« eine entscheidende Rolle in dem sich abzeichnenden Konflikt.
*
So viel zur Vorgeschichte des Zusammenpralls in Süd-Ossetien. Über den Hintergrund der im Sommer 2008 entbrannten Kämpfe lässt sich Folgendes berichten: Etwa 140 amerikanische Military-Advisors sind beauftragt, die gut gerüstete Armee Saakaschwilis zu beraten und auszubilden. Sehr erfolgreich waren sie wohl nicht, denn die Georgier haben – ganz anders als die todesmutigen Widerstandskämpfer Tschetscheniens – beim Nahen der russischen Panzerkolonnen fast ohne Gegenwehr das Weite gesucht. Die Instrukteure aus USA wussten zwangsläufig um die Vorbereitung des Überraschungsschlages ihrer Schützlinge gegen die süd-ossetische Enklave. Der in Tiflis ansässige CIA-Resident hat zweifellos darüber nach Langley berichtet. Offenbar ging der georgische Präsident davon aus, dass die Welt zum Zeitpunkt seiner Offensive durch die Olympiade von Peking voll abgelenkt wäre. Er wollte auch die kurze Phase nutzen, in der sein Gönner George W. Bush noch im Amt war.
Der amerikanische »Commander in Chief« wiederum hätte durch ein energisches Telefonat mit seinem georgischen Vasallen das törichte Abenteuer unterbinden können. Aber Bush spekulierte vermutlich darauf, dass das post-sowjetische Russland, das sich so oft hatte übertölpeln lassen, auch in diesem Fall stillhalten würde. Hinzu kam vielleicht das Kalkül, dass ein Prestige-Erfolg am Kaukasus und die damit verbundene Ausweitung der amerikanischen Einflusssphäre dem republikanischen Kandidaten John McCain, dem die Öffentlichkeit größere Kompetenz in strategischen Dingen zutraute als seinem Rivalen Barack Obama, zusätzliches Wählerpotenzial einbringen würde. Das Moskauer Duo Medwedew-Putin hat diese Planungen mit einem Schwerthieb durchkreuzt.
Schon richten sich die sorgenvollen Blicke der NATO auf die Flottenbasis Sewastopol auf der Halbinsel Krim. Der Kreml hat die zerstrittenen Politiker von Kiew wissen lassen, dass Russland nicht gewillt ist, diese beherrschende strategische Position am Schwarzen Meer dem Besitzanspruch der Ukraine auszuliefern. Neuerdings werden solche Warnungen aus Moskau wieder ernst genommen. Wer wagt da noch zu behaupten, von einem Rückfall in den »Kalten Krieg« könne keine Rede sein.
*
NB. In den folgenden Kapiteln habe ich die chronologische Aufreihung – wohl wissend, dass das europäische und das ostasiatische Neujahrsfest zeitlich nicht ganz übereinstimmen – mit den chinesischen Tierzeichen versehen, vom Jahr der Schlange bis zum Jahr der Ratte. Auf die astrologische Bedeutung dieser Symbolik will ich nicht eingehen, sondern lediglich einem Kulturkreis huldigen, dem im Zuge der unvermeidlichen und bis zum Überdruss zitierten Globalisierung eine eminente Bedeutung zukommt.
Die Welt ist verrckt geworden
INTERVIEW, 20. JANUAR2008
FOCUS: Herr Scholl-Latour, lassen Sie uns ber das Alter sprechen
SCHOLL-LATOUR: Nur zu. Da habe ich keine Scheu. Wenn jemand sagt, ich sei 83, rufe ich ihn zur Ordnung und sage: Ich werde 84!
FOCUS: Bei unserem letzten Gesprch bekannten Sie sich zum Alterszorn. Hat dieser sich inzwischen verstrkt?
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!