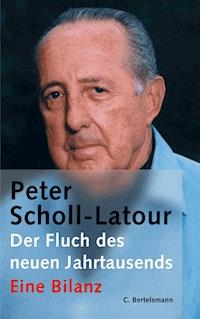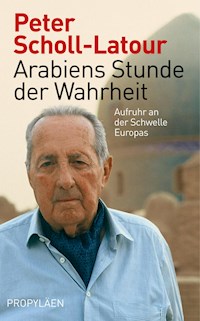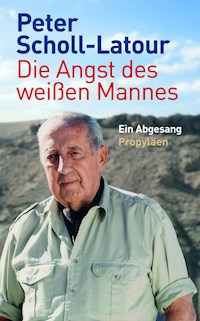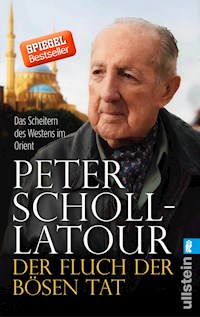12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bertelsmann, C.
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Das Vermächtnis des legendären Journalisten
Peter Scholl-Latour war über Jahrzehnte eine Institution im Journalismus. Mit Tod im Reisfeld schrieb er eines der bis heute weltweit erfolgreichsten Sachbücher; seine Analysen zu Konflikten und aktuellen Entwicklungen waren bis in sein hohes Alter gefragt. Seine Autobiografie hat er lange hinausgeschoben. In seinen Erinnerungen blickt er zurück auf seine Herkunft, auf frühe Erfahrungen mit Unterdrückung – als Sohn einer jüdischen Mutter –, auf die langen Wochen in einem Gestapo-Gefängnis und auf seine ersten journalistischen Abenteuer. Er berichtet von seinen unzähligen Reisen in Kriegs- und Krisengebiete, die ihn nicht selten in lebensgefährliche Situationen brachten. Politiker, Generäle, Rebellenführer – Scholl-Latour kannte viele, die an den Brennpunkten des 20. Jahrhunderts eine entscheidende Rolle spielten, und stets versuchte er, mit allen zu reden, um eine ausgewogene, realistische Sicht zu vermitteln. Im Rückblick reflektiert er viele Erlebnisse und Begegnungen vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen. Mitten in der Arbeit an diesem Buch wurde er aus dem Leben gerissen. Seine Erinnerungen bleiben unvollendet. Aber sie lassen noch einmal seinen unverwechselbaren Ton, seine packende Art zu erzählen und seine direkte, nie auf political correctness bedachte Urteilskraft lebendig werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 616
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Peter Scholl-Latour
MEIN LEBEN
C. Bertelsmann
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.
Redaktion: Cornelia Laqua
1. Auflage
© 2015 by C. Bertelsmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: buxdesign München
Bildredaktion: Dietlinde Orendi
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-18421-6
www.cbertelsmann.de
Inhalt
Avant-Propos
Kindheit in Bochum
Internat in Fribourg
Abitur in Kassel
Kriegsjahre in Berlin
De Profundis
Gestapo-Haft
Lothringer Idylle
Der Horror des Prager »Pankraz«
Wiener Intelligenz-Zelle
Die Rote Armee in Graz
Zu neuen Ufern
Vertauschte Rollen in Saigon
Frankreichs Indochinakrieg
Aufbruch
»Das abenteuerliche Herz«
Ein »Pascha« im Reisfeld
Landung in Tonking
Verhör in Bautzen
Blau-weiß-rot an der Saar
Halbmast in Fernost
»La sale guerre«
Das Pressecamp von Hanoi
Mao an der Schwelle von Shangri-La
Nach der Niederlage von Dien Bien Phu
Ein asiatischer Napoleon
Die letzten Außenposten
Die ersten Amerikaner in Saigon
Von Sartre bis Ibn-Khaldun
Existentialismus in Paris
Eine erste Arabellion
Orientalische Initiation
Die Sprache des Propheten
Krieg in Algerien
Aufruhr am Atlas
Gefahr in Batna
Wirrwarr in Algier
Disteln in der Mitidja
Afrika
»Im Herzen der Finsternis«
Auf den Spuren Stanleys
Im Schatten Lumumbas
Che Guevara und die Steinzeit
In den Klauen der »Simba«
Verzweiflung an Afrika
Geschichte eines Mordes
Blauhelme und Söldner
Requiem für einen Rebellenführer
»Facing Mount Kenya«
Das Ende der Mau-Mau
»Angola é nossa«
Buschkrieg auf lusitanisch
Gefangener der PIDE
Die Blume im Gewehrlauf
Das Ende der Algérie Française
Der Zorn der Centurionen
Wiedersehen mit Trinquier
Friedliches Tunis
Treibjagd auf Fellaghas
Die »blaue Nacht«
Friede über den Gräbern
»Adieu à la gloire«
Im Museum der Zeitgeschichte
Die Pflastersteine des Quartier Latin
Der Rußlandfeldzug des Generals
»Gipfel des Ruhms«
Unter dem Kreuz von Lothringen
»Die Eichen, die man fällt«
Epilog
Paris, Herbst 2015
Personen- und Ortsregister
Bildnachweis
Bildteil
Avant-Propos
Tourrettes-sur-Loup, Januar 2012
Welcher Dämon mag mich wohl an jenem sonnigen Nachmittag im Münchner Verlagshaus geritten haben, als ich meine Unterschrift unter den Vertrag setzte, der mich zur Niederschrift einer Autobiographie verpflichtete? Das war im Jahr 2000, wenn ich mich recht erinnere. Die finanziellen Bedingungen, die Garantiesumme, die mir zugestanden wurde, ging nicht über den bei mir üblichen Vorschuß hinaus. Ein rivalisierender Verlag, der sich offensichtlich von dieser Lebensbeichte einen sensationellen Auflageerfolg versprach, wollte mir das Doppelte bieten. Aber dann hätte ich mich unverzüglich an das Verfassen dieses Opus machen müssen, während Random House, wie sich der Buchvertrieb des Bertelsmann-Konzerns im Zuge der üblichen Verbalamerikanisierung umbenannt hatte, gar nicht versuchte, mir einen präzisen Erscheinungstermin vorzuschreiben.
Ich war damals sechsundsiebzig Jahre alt, und es mag lächerlich klingen, daß ich in diesem hohen Alter verlangte, das Projekt auf die lange Bank zu schieben, an seine endgültige Gestaltung erst heranzugehen, »wenn ich im Rollstuhl« säße, wie ich mich recht überheblich äußerte. Die Publikation einer Autobiographie, das verspüre ich auch heute noch, droht einen Schlußstrich zu ziehen unter jede schriftstellerische Kreativität. Im Unterbewußtsein könnte auch die Freude an neuen, originellen Erlebnissen erlöschen, an jenen »émotions fortes«, die meinem Leben einen Sinn gegeben haben.
Während ich diese Einleitung – gemäß dem Prinzip »nulla dies sine linea – kein Tag ohne geschriebene Zeile« – zu Papier bringe, ist der dichte, feuchte Nebel aufgerissen, der das Dorf Tourrettes-sur-Loup seit zwei Wochen in ligurische Trübsal hüllt. Am späten Nachmittag kommt jenseits der Zypressen und Agaven des Gartens eine strahlende Bläue auf, der dieser Landstrich den Namen Côte d’Azur verdankt. Über dem Esterel-Massiv, das im Mittelalter erobernden Sarazenen als Bollwerk diente, verfärbt sich der Horizont zu einem Purpurstreifen. In diesem Winter trennen mich nur noch ein paar Wochen von meinem achtundachtzigsten Geburtstag. So vermessen es klingt – bis zum Abschluß dieser Memoiren, deren Präambel ich zögernd beginne, hoffe ich, meinen weltweiten Peregrinationen, die seit sieben Dekaden andauern, noch die eine oder andere Episode hinzuzufügen.
Zu Füßen der Terrasse, die Eva ausbauen ließ, damit der Blick sich in ganzer Breite auf das Mittelmeer öffnet, umsäumt eine unberührte Waldlandschaft die steile Felsschlucht des Flüßchens Loup. An der Küste, in vierhundert Meter Tiefe und gebührender Entfernung, täuscht der Hafen Antibes ein makellos weißes Stadtbild vor. Der ursprüngliche Name Antipolis erinnert daran, daß griechische Händler diesen Strand besiedelten, lange bevor er der Provincia Narbonensis des Römischen Reiches einverleibt wurde. Jenseits der Fluten des geschichtsträchtigsten aller Binnenmeere, das mit aufkommender Dämmerung zur grauen Bleiplatte erstarrt, bilde ich mir ein, die Nähe der afrikanischen, der maghrebinischen Gegenpiste zu spüren. Wenn in heißen Sommern der Schirokko aus Süden bläst, übersprüht er die Mauern des Dorfes Tourrettes, dessen verschachtelte Silhouette einer maurischen Kasbah ähnelt, mit einer dünnen Schicht roten Treibsandes, der aus der Sahara herüberweht.
Ich werde mich bemühen, den Abschluß dieses Buches so lange hinauszuzögern, bis meine Kräfte vollends erlahmen und »Freund Hein«, wie man früher einmal sagte, seinen Schatten auf mich wirft. Vorbildlich hat sich in dieser Hinsicht Joachim Fest verhalten, dem ich mich stets verbunden fühlte. Sein Bericht über eine ungewöhnliche Jugend im Dritten Reich, »Ich nicht«, war unmittelbar vor seinem Tod erschienen. Was die ehrenden Reden betrifft, die einem mit Erreichen des biblischen Alters, bei Preisverleihungen oder runden Geburtstagen gewidmet werden, so haben sie stets den ungewollten Klang eines Nachrufs. Die Verleihung der wohl angesehensten Fernsehtrophäe bezeichnete ich denn auch als »letzte Ölung«, als quasisakramentale Zeremonie, die dem Veranstaltungsort, dem »hilligen Kölle«, gut anstand.
Als die Berliner Verlagsleitung von Ullstein meinen achtzigsten Geburtstag besonders aufwendig zelebrierte und Helmut Kohl mir die Ehre erwies, eine Laudatio zu halten, deren Wärme, intuitive Menschenkenntnis und rhetorische Kraft sich weit über die Platituden parlamentarischer Ergüsse erhob, habe ich am Ende meiner eigenen Danksagung die Anwesenden darum gebeten, auf das Anstimmen des üblichen »Happy birthday to you« zu verzichten. Seit Marilyn Monroe diesen Glückwunsch-Song im Ton eines erotischen Lustgekeuches an John F. Kennedy richtete, damit auch niemand daran zweifle, daß sie mit dem Präsidenten der USA geschlafen hatte, ist mir diese Weise ohnehin verleidet. Da mein Wiegenfest – ein recht altertümlicher Ausdruck – im März häufig mit dem Aschermittwoch zusammenfällt, zitierte ich jenen liturgischen Spruch, der jeder Lebenslage angemessen erscheint: »Memento homo quia pulvis es et in pulverem reverteris – Bedenke, Mensch, daß du Staub bist und zum Staube zurückkehren wirst.«
Mit der Niederschrift meiner »Memoiren« habe ich in den Erlebnisberichten meiner zahlreichen Bücher ja längst begonnen. Der französische Autor Chateaubriand hat seinen monumentalen Rückblick auf die Epoche Napoleons und Ludwigs XVIII. unter das Motto »Mémoires d’outre-tombe – Memoiren aus dem Jenseits« gestellt. Wenn Charles de Gaulle seine Serie von Erinnerungsbänden, die – dem Vorbild Julius Cäsars folgend – in der dritten Person abgefaßt sind, als »Mémoires d’espoir – Memoiren der Hoffnung« präsentierte, so entsprach das seiner Neigung, den französischen Niedergang, dem er sich mit seiner Résistance verzweifelt entgegengestemmt hatte, dessen er sich jedoch schmerzlich bewußt war, mit einem Schein imaginärer »gloire« zu überstrahlen, ehe er »ce cher et vieux pays – dieses liebe alte Land« den Ungewißheiten eines weltweiten Umbruchs überließ. »La vieillesse est un naufrage – das Alter ist ein Schiffbruch«, hatte er in einem früheren Lebensabschnitt festgestellt. Damit hatte er wohl kaum seine eigene Person gemeint, sondern die tragische Gestalt des von der ganzen Nation glühend verehrten Verteidigers von Verdun, den Marschall Pétain, dessen Kapitulation vor den siegreichen Armeen des Dritten Reiches er nur als Symptom von Senilität erklären konnte.
Mein Leben sei stets »in expectatione mortis – in Erwartung des Todes« verlaufen, hatte mein verstorbener Freund Johannes Gross in einer Tischrede gesagt. Das mag durchaus zutreffen für jemanden, der schon in jungen Jahren an der Exekutionsmauer stand. Aber diese Maxime gilt für jeden Menschen, beginnt das Sterben doch mit der Geburt, bleibt der Tod die einzige Gewißheit, über die wir verfügen. Der Gedanke daran hat sogar etwas Tröstliches, denn wer möchte schon ewig verweilen in einem Dasein, das der heilige Bernhard von Clairvaux als »Tal der Tränen« beschrieb?
Ich betrachte es dennoch als eine große Gunst, daß ich meine berufliche Tätigkeit als Buchautor und Chronist der Konflikte unseres Säkulums weit über den Zeitpunkt fortsetzen durfte, der für die meisten Kollegen den Beginn einer Existenz als Rentner oder Pensionär signalisiert. Das verleitet manchen Gesprächspartner auf den unvermeidlichen »Get-together«-Veranstaltungen, die ich nach Kräften zu meiden suche, die etwas hämisch klingende Frage an mich zu richten: »Warum tun Sie sich denn in Ihrem greisen Alter diese Strapazen noch an?«, wenn ich neue Reisepläne in Zentralasien erwähne oder darauf drang, mit siebenundachtzig Jahren südlich von Kundus an einer Patrouille der Bundeswehr in Richtung auf die afghanische Provinz Baghlan teilzunehmen. Aber warum sollte ich meinem Lebensstil, dem Rausch neuer Erkundungen entsagen, bevor die körperliche Gebrechlichkeit eines nahen Todes ohnehin diesen Verzicht erzwingen wird?
Der Historiker Michael Stürmer hat meinen intimen Wesenszug gelegentlich als »heroischen Pessimismus« beschrieben. Es wäre schön, wenn ich über diese römische Tugend in vollem Maße verfügte. Als ich mit Erreichen des fünfundsechzigsten Lebensjahres aus dem Vorstand des Verlagshauses Gruner + Jahr ausschied, oblag es Johannes Gross, die »oraison funèbre« zu halten in einer Hamburger Atmosphäre voll Herzlichkeit und guter Laune, die man dieser angeblich spröden Hansestadt gar nicht zutraut. Unter allen Anwesenden verfügte wohl nur er über ausreichend gallische Bildung, um den Begriff »oraison funèbre« vorrangig auf die erhabene Prosa des Predigers Bossuet am Hof Ludwigs XIV. zu beziehen.
Mein unentwegtes Vagantentum verglich Johannes allzu schmeichelhaft mit den Irrfahrten des antiken Helden Odysseus. Auf mehr als einer Insel, fügte er schelmisch hinzu, sei dieser nicht nur auf furchterregende Ungeheuer gestoßen, sondern habe sich auch am Charme weiblicher Verführerinnen, zumal der zauberhaften Kalypso, erfreut. Da fühlte ich mich veranlaßt, darauf zu verweisen, daß im Epos Homers der legendäre Ulysses nicht nur als wagemutiger Entdecker und Freund robuster Sinne geschildert wird, sondern als »polytropos«, als Mann vieler Listen, und daß auch bei mir zweifellos der vorhandene Hang zum Abenteuer mit einem stark ausgeprägten Selbsterhaltungstrieb gepaart war.
»Hos mala polla planchthe … der viele Leiden erdulden mußte«, heißt es schon in den ersten Versen der Homerschen Überlieferung. So wie die düstere Vision des verwüsteten Troja und der erschlagenen Gefährten den hellenischen Heimkehrer auf seiner endlosen Suche nach Ithaka begleitete, so bleibt auch bei mir der Gedanke an den Wahnsinn des Hitler-Reiches und dessen Untergang als warnendes Omen präsent, verweist auf die Prekarität, der »brave new world« unserer Tage, die sich der »pursuit of happiness – der Jagd nach Glück« – verschrieben hat.
Beim Erreichen meines letzten Lebensabschnitts stelle ich rückblickend eine glückliche Veranlagung fest, dank der ich den Horror, dem ich allzu oft begegnete, instinktiv verdrängen oder als unvermeidlichen Bestandteil der »conditio humana« akzeptieren konnte. Sogar in den Träumen, die Ernst Jünger mit solcher Präzision festzuhalten pflegte, haben mich die Gespenster der Vergangenheit weitgehend verschont. So hat die simulierte Erschießungsszene an der Mauer des SD-Gefängnisses von Prag, die sich ein paar sadistische Schergen Himmlers im Februar 1945 ausgedacht hatten, keine posttraumatische Verstörung bei mir hinterlassen, sondern sie erwies sich als psychisches Stahlbad, das mir erlaubte, allen weiteren Prüfungen, die mich erwarteten, mit einer gewissen »aequanimitas« zu begegnen.
Kein Mensch schätze sich glücklich vor seinem Tod, heißt es schon bei Sophokles. Eine romantische Weise, aus dem Leben zu scheiden, wurde mir versagt, als mich vor drei Jahren ein einmotoriges Flugzeug in jene urwäldlichen bizarren Felsformationen entrückte, die aus dem dampfenden Dschungel zwischen Orinoco und Amazonas wie gigantische Spukgestalten herausragen. Der Pilot, ein reiner Indianer, steuerte plötzlich mit seiner zerbrechlichen Cessna-Maschine auf eine gigantische Felswand zu, als wollte er dort zerschellen. Unmittelbar vor dem Zusammenprall kippte er jedoch mit einer akrobatischen Volte seitlich ab. Das jähe Ende, das ich bereits vor Augen hatte, verflüchtigte sich, und ich sah mich wieder den Ungewißheiten greisen Dahinsiechens ausgeliefert, das infolge der absehbaren Verlängerung des menschlichen Durchschnittsalters auf rund einhundert Jahre mit entwürdigenden Gebrechen einherzugehen droht.
Die Vielzahl der Autobiographien, die jährlich erscheinen, läßt sich kaum noch überblicken. Wer vermag da noch Dichtung von Wahrheit zu unterscheiden? Ich gestehe gern, daß ich mit einem Gefühl des Unbehagens an diese zwangsläufig egozentrische Aufgabe herangehe, und verweise den Leser bereits darauf, daß ich gar nicht daran denke, meine innersten Seelenzustände auszubreiten oder – einer exhibitionistischen Mode folgend – meine erotischen Aventuren zu schildern. Statt selbstgefällige Zuversicht vorzutäuschen oder in peinliche Larmoyanz zu verfallen, greife ich auf eine Anthologie der persönlichen Erlebnisse und Anekdoten zurück, die ich in diversen Veröffentlichungen notierte. Ich werde dabei jenen Ereignissen den Vorrang einräumen, in denen sich die Einzigartigkeit unseres Säkulums widerspiegelt.
Die Ausübung des Journalistenmetiers, die sich für mich rein zufällig ergab, habe ich niemals als hehre Berufung empfunden. Statt dessen vertieften sich im Verlauf der Jahrzehnte meine Zweifel an einer Profession, die sich mehr und mehr auf Effekthascherei und die Befriedigung des Massengeschmacks ausrichtet. Immerhin habe ich bei meinen politischen Analysen eine gewisse Genugtuung empfunden, daß mich ein sicheres Gespür, ein solides Studium, eine nüchterne Bestandsaufnahme vor Ort immer wieder in die Lage versetzten, so manche Schimäre der »political correctness« als Irrtum oder Lüge zu entlarven. Dazu bedurfte es keiner prophetischen Gaben. Zu den Niederungen des sogenannten »investigative journalism«, der Aufdeckung von Skandalen – im Französischen gibt es dafür den Ausdruck »fouille-merde« –, habe ich mich stets auf Distanz halten können.
Bei meiner vielfältigen Tätigkeit als Korrespondent oder Reporter habe ich niemals den Anspruch erhoben, eine »Wahrheit« zu verkünden. Das Wort »veritas« ist ein theologischer Begriff. Hingegen habe ich mich bemüht, der Wirklichkeit nahezukommen. Mit der schonungslosen Darstellung menschlicher Unzulänglichkeit bin ich nie der Illusion erlegen, die Welt verbessern zu können. Im Angesicht unerträglicher politischer Heuchelei im Namen von Menschenrechten und Demokratie blieb ich mir stets der Sentenz des genialen Komödienschreibers Molière bewußt: »L’ami du genre humain n’est l’ami de personne – Der Freund des Menschengeschlechtes ist niemandes Freund.«
Volker Schlöndorff hat einmal bemerkt, er sehe in mir eine Kombination von Stanley und Hemingway. Wenn dem nur so wäre! Ich will nicht verschweigen, daß ich mich in jungen Jahren mit dem Wunsch trug, einen zeitgenössischen Roman zu schreiben. Daß es dazu nicht gekommen ist, liegt vielleicht an dem Umstand, daß die schöpferische Imagination, die für ein solches Vorhaben unentbehrlich ist, durch die krude, unmittelbare Konfrontation mit der ernüchternden Realität, der ich pausenlos ausgesetzt war, erstickt wurde.
Eine Reihe von mir hochgeschätzter Autoren hat diese Widersprüchlichkeit überwunden und den Schwung von der eigenen Erfahrungsfolge zum literarischen Anspruch vollzogen. Ich denke dabei an Joseph Conrad, Graham Greene, Somerset Maugham, John le Carré und nicht zuletzt an André Malraux, der seine »Antimémoires« – der Titel ist ein Eingeständnis seiner einzigartigen Mythomanie – in den Dienst eines epochalen Zeitgemäldes stellte. Von Malraux stammt auch der Satz: »La vérité d’un homme c’est d’abord ce qu’il cache – Die Wahrheit des Mannes ist das, was er verbirgt«, eine Feststellung, die nicht nur den Verfassern von Autobiographien zu denken geben sollte.
*
Wir wollen uns nicht im Grübeln verlieren. Über Tourrettes-sur-Loup ist die Nacht hereingebrochen, die »nox humida« des mediterranen Winters. An der Küste flackert der Leuchtturm von Antibes in regelmäßig rotierenden Abständen auf. Zwischen hastig treibenden Wolkenfetzen leuchten die makellosen Konturen des Halbmondes auf, des »Hilal«, wie die Araber sagen, Symbol eines expandierenden Islam. Tatsächlich greift zu Beginn dieses Jahres 2012 auf dem Südufer des Mittelmeers jener weit verzettelte Aufbruch um sich, den man so voreilig als Arabischen Frühling gefeiert hat.
Vor zwei Wochen war ich in Richtung Tunis aufgebrochen. Dank einem glücklichen Zufall beförderte mich ein nächtlicher Flug der Libyan Airways in die durch Straßenkämpfe verwüstete Stadt Misrata. Muammar el-Qadhafi behauptete sich zu jenem Zeitpunkt noch mit einem letzten Aufgebot seiner Anhänger im nahen Hafen von Sirte. Die Rückfahrt zur tunesischen Insel Djerba, die über die vom Krieg verschonte Hauptstadt Tripolis führte, bot ein eindringliches Bild von den chaotischen Zuständen, in denen die libysche Jamahiriya zu versacken droht. In kurzen Abständen wurden wir durch Straßensperren aufgehalten und kontrolliert. Die mit Kalaschnikows fuchtelnden Wüstenkrieger, die unsere Ausweise ohnehin nicht entziffern konnten, erwiesen sich als relativ harmlose Wegelagerer. Sie winkten uns lässig durch. Unser einheimischer Fahrer wußte nicht im Geringsten, welchem Stamm oder Clan, welcher »Katiba« die selbst ernannten Ordnungshüter und Freiheitskämpfer angehörten. Aber es war deutlich zu spüren, daß zwischen diesen Haufen alte Feindschaften wiederauflebten und durch die Stimmung eines religiösen Jihad zusätzlich angeheizt wurden.
Vor meinem Rückflug aus Tunis hatte ich das mir vertraute Trümmerfeld aufgesucht, das auf die legendäre, erloschene Macht Karthagos verweist. Die Legionen des Scipio Africanus hatten nach der Eroberung dieser phönizischen Metropole keinen Stein auf dem anderen gelassen. In der Post, die ich bei meiner Rückkehr nach Tourrettes vorfinde, entdecke ich einen Brief des Münchner Verlagshauses, der mich freundlich drängt, die vereinbarte Biographie an meinem neunzigsten Geburtstag zu veröffentlichen. Das Interesse eines breiten Leserpublikums sei mir gewiß. Da kommen ganz unvermittelt alte Reminiszenzen hoch.
Es ist ja bezeichnend für das hohe Alter, daß das Langzeitgedächtnis sich mit besonderer Intensität erhält. Ich sehe mich plötzlich zurückversetzt in meine Gymnasialzeit des Collège Saint-Michel im schweizerischen Fribourg. Wir pflegten damals ganze lateinische Passagen der »Aeneis« auswendig zu lernen, jenes epischen Gesangs des Dichters Vergil, der dem trojanischen Helden Aeneas gewidmet ist. Nach der Erstürmung Trojas durch die grausamen Danaer hatte er sich nach Westen eingeschifft, um im fernen Karthago von der dortigen Königin Dido mit den Ehren empfangen zu werden, die einem ruhmreichen Krieger zustanden. Der ganze Hof dieser mächtigen Frau hatte sich versammelt in der Erwartung, eine präzise Kunde des trojanischen Untergangs zu vernehmen.
Um uns die Hexameter des römischen Barden Vergil einzuprägen, der im Auftrag des Kaisers Augustus die ruhmreiche Gestalt des Aeneas zum Gründungsvater der imperialen römischen Urbs hochstilisieren sollte, memorierten wir die Verse der »Aeneis«, indem wir – dem Brauch der Peripatetiker folgend – längs der Brüstung auf und ab schritten, die die mittelalterlichen Festungsanlagen der westschweizerischen Kantonshauptstadt überragte.
Bis auf den heutigen Tag bleibt mir haften, wie der herrische Aeneas sich gesträubt hatte, vor den neugierigen und vulgären Phöniziern den unsäglichen Schmerz zu erneuern, der ihn beim Gedanken an die vernichtete Festung Troja und den Tod seiner Gefährten überkam. »Infandum, regina, iubes renovare dolorem«, begann er schließlich seinen Bericht. Es liegt mir fern, auch nur die geringste Beziehung herzustellen zwischen meinem bescheidenen Lebenslauf und der olympischen Größe antiker Heroen. Aber auf die Ermunterung meines Verlegers, doch endlich mit meiner Autobiographie zu beginnen, antworte ich – in der Hoffnung auf ausreichende Lateinkenntnisse des bearbeitenden Lektors – mit dem resignierten Satz des großen Aeneas: »Sed si tantus amor casus cognoscere nostros – Wenn wirklich eine solche Begierde besteht, mein Schicksal zu erfahren, dann fange ich eben an« – »incipiam.«
Kindheit in Bochum
»Ich habe eine Überraschung für Sie«, sagte eine weibliche Stimme, die sich in Berlin-Charlottenburg am Telefon meldete. »Mein Vater ist in Bochum mit Ihnen zur Volksschule gegangen und hat Ihnen ein kleines Geschenk hinterlassen.« Am folgenden Tag habe ich mir den schmalen Bildband über den Bochumer Stadtteil Ehrenfeld, wo ich meine frühe Kindheit verbrachte, bei einer freundlichen Nachbarin abgeholt. Es handelte sich im Wesentlichen um Reproduktionen von Ansichtskarten, die in den zwanziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts mit umständlichen Apparaten aufgenommen und teilweise in rötlich-brauner Tönung nachkoloriert worden waren.
Ein seltsames Gefühl überkam mich dabei, ein Gemisch aus leichter Wehmut und der düsteren Wahrnehmung, wie kurz, aber möglicherweise auch viel zu lang ein menschliches Dasein ist. Auf dem grün umrandeten Einband ist der Bülow-Platz abgebildet, an dem ich täglich auf dem Schulweg vorbeikam. Er ist nach dem Zweiten Weltkrieg in Romanusplatz umbenannt worden, in ehrendem Gedächtnis an einen wackeren Jesuiten, Pater Romanus, der in einem Konzentrationslager des Dritten Reiches zu Tode geschunden wurde. Ein eigenartiger Zufall hatte es gefügt, daß auf meiner Geburtsanzeige dem »Bochumer Anzeiger« im März 1924 ein Druckfehler unterlaufen war. Statt meiner beiden Vornamen Peter Roman stand da »Pater Roman« zu lesen. Die alten Römer hätten darin wohl ein Orakel erblickt.
Durch welchen Zufall sich meine Familie nach dem Ersten Weltkrieg im Ruhrgebiet niederließ, hat mich nie sonderlich interessiert. Vermutlich bot sich dort meinem Vater eine günstige Chance für die Ausübung seines Berufes. Meine Eltern waren beide in Elsaß-Lothringen geboren und aufgewachsen. Die Familie meines Vaters stammte ursprünglich aus dem Saarland. Er hatte in München Medizin studiert und war als Sanitätsoffizier im Ersten Weltkrieg dekoriert worden. Danach hatte er sich auf Dermatologie, damals hieß es noch »Haut- und Geschlechtskrankheiten«, spezialisiert.
Meine Mutter, die in einem Pensionat des Schweizer Kantons Neuchâtel ihr Französisch vervollkommnete, war die Tochter eines Straßburger Studienrates für antike Sprachen, der angeblich fähig war, die langen Gesänge der »Ilias« und der »Odyssee« im griechischen Urtext frei vorzutragen. Mein Vater war in Lothringen, in dem Industrieort Hayingen, groß geworden, hatte dort mit seinen Spielkameraden nur französisch parliert, bevor er im Gymnasium von Diedenhofen, heute Thionville, sein Abitur bestand. Ich erwähne diese Herkunft lediglich, um die tiefe Verbundenheit zu erklären, die beide Eltern für das umstrittene Grenzland ihr ganzes Leben lang empfanden, so wie die spontane Nähe zu Frankreich, die sie sich stets bewahrten.
In Bochum kam der zugezogene Dermatologe beruflich gut zurecht, und meine Eltern hatten sich in den zwanziger Jahren auch gesellschaftlich solide etabliert. Sie dachten jedoch mit Nostalgie zurück an den grünen Lauf der Mosel, den auch die düsteren Schatten der Hochöfen nicht verschandeln konnten, und vor allem an die hohe Silhouette des Straßburger Münsters. Wie oft hat die Erinnerung an das Elsaß und die dort verbrachte glückliche Jugend meine Mutter, eine schöne Frau mit kastanienbraunem Haar und großen grauen Augen, später zu dem Spruch verleitet: »Die Erinnerung, das ist das einzige Paradies, aus dem wir nicht vertrieben werden können.« So traf es sich gut, daß meine Geburt in einem Bochumer Krankenhaus von einer Hebamme, die aus Colmar stammte, auf gut elsässisch angekündigt wurde: »Madame Scholl, es isch a Bua.« Das geschah an einem Sonntag, aber ob mir die Glückshaut des Märchens zuteil wurde, weiß ich bis heute nicht.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!